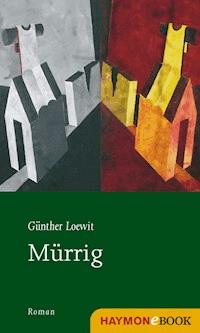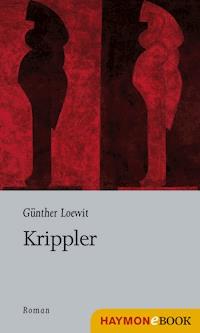Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Es geht um Geld, um das System und um die Ärzte, aber wer denkt noch an die Patienten? Sie bleiben auf der Strecke. Der erfahrene Arzt Dr. Günther Loewit will nicht länger zusehen. In diesem Buch rechnet er ab: Mit der Gesundheitsindustrie, die auf dem Rücken der Patienten ihre Milliarden vermehrt und Heilung zu einem Produkt macht. Mit der Politik, der nichts anderes einfällt als ausufernder bürokratischer Wahnsinn. Und mit den Ärzten selbst, die sich unter diesem Druck aus der Verantwortung ziehen. Gemeinsam mit der Journalistin Silvia Jelincic erzählt Loewit von aufrüttelnden Beispielen und dem Versagen des Systems.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 112
Veröffentlichungsjahr: 2026
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DER VERGESSENE PATIENT
Dr. Günther Loewit, Silvia Jelincic:
Der vergessene Patient
Alle Rechte vorbehalten
© 2026 edition a, Wien
www.edition-a.at
Cover: Bastian Welzer
Satz: David Fuchs
Gesetzt in der Premiera
Gedruckt in Europa
1 2 3 4 5 — 29 28 27 26
isbn: 978-3-99001-881-1
eisbn: 978-3-99001-882-8
Günther LoewitSilvia Jelincic
DERVERGESSENEPATIENT
Ein Arzt rechnet ab
Inhalt
Eine gefährliche Krankheit
Der neue Hospitalismus
Der Verlust des direkten Kontakts: Was Ärzte von Pflegern lernen können
Die falsche Effizienz
Die Kunst des richtigen Gesprächs und wie wir sie verlernt haben
Zuhören kann Leben retten
Was dem System nützt, nützt nicht immer dem Patienten
Was uns der Hippokratische Eid heute sagt
Arzt: (K)ein Beruf wie jeder andere?
Der Arzt wird gebraucht
Die Wahrheit hinter der Zwei-Klassen-Medizin
Am Patienten lernen
Dienst am Menschen
Ungesunde Hierarchien
Unnötige Operationen, Doppeluntersuchungen und Vorsorge: Warum Ärzte statt Kranke heute Gesunde behandeln
Warum die besten Ärzte in den Spitälern und nicht den Privatkliniken arbeiten
Wie ein Ort der Heilung aussehen sollte
Die wahren Gründe für die Erosion des Gesundheitssystems
Warum es keinen Ärztemangel gibt
Es geht auch anders
Die Faszination der Heilung
Warum der Medizin eine Revolution bevorsteht und sie eine Chance auf eine neue Art des Heilens ist
Was einen guten Arzt ausmacht
Die drei goldenen Prämissen des guten Arztes
Der Mensch als Zentrum der Heilung
Text
Es trug sich vor vielen Jahren in meiner Arztpraxis zu. Eine Frau nahm vor mir Platz und erzählte mir von ihrem Leiden. »Herr Doktor«, sagte sie, »ich habe ganz furchtbare Kopfschmerzen.« Ich führte die übliche Anamnese durch, machte einige Tests, konnte aber keine Anzeichen für eine ernsthafte Erkrankung finden. Womöglich waren die Schmerzen muskulär bedingt. Ich verschrieb ihr leichte Schmerzmittel und schickte sie nach Hause.
Kaum eine Woche später saß sie wieder in meiner Ordination. Nicht mehr mit Kopfschmerzen, sondern mit Zuckungen im linken Bein. Ich tastete das Bein ab, prüfte die Reflexe, die Durchblutung, alles schien in Ordnung. Auch als sie eine Woche darauf mit den gleichen Beschwerden im rechten Bein zu mir kam, konnte ich nichts Beunruhigendes finden. Ich veranlasste ein Blutbild, weil die Frau sich große Sorgen machte, aber auch darin fanden sich keine Auffälligkeiten.
Doch jeder Befund, der die Gesundheit der Frau bestätigte, schien sie noch mehr zu beunruhigen. Wöchentlich besuchte sie mich und klagte ständig über andere Schmerzen: Übelkeit, Atemprobleme, Hautausschlag, die Nase lief, im Ohr klingelte es. Nie konnte ich auch nur das kleinste Anzeichen einer Krankheit finden. Die Verzweiflung der Frau wuchs, ebenso meine Irritation. Und auch meine Ungeduld.
Irgendwann begann ich, ihre Besuche zu fürchten. Aber eines Tages kam mir die Idee, etwas anderes zu versuchen. Ich wollte sie heute einfach ausreden lassen, so lange, bis sie leer, bis nichts mehr in ihr drin war. Denn das war die einzige Konstante in ihren Besuchen gewesen: Obwohl sich ihre Probleme immer änderten, sprach sie stets mit schriller Stimme wie ein Wasserfall.
»Wie geht es Ihnen denn heute?«, fragte ich behutsam, als sie mir gegenüber Platz nahm. Wie in den Besuchen davor erzählte sie mir von neuen Problemen, die sie sich gar nicht erklären konnte. Doch diesmal schlug ich keine Untersuchung vor, hörte sie nicht ab, betastete nicht die schmerzenden Stellen, leuchtete nicht in Augen oder Rachen. Ich blieb einfach hinter meinem Schreibtisch sitzen und hörte zu. Bald schon erzählte sie nicht mehr bloß von ihren Schmerzen, sondern von ihrem Leben zuhause, von ihren Problemen in der Arbeit und den alltäglichen Bürden des Lebens. In der Zwischenzeit füllte ich einige Formulare auf dem Computer aus, aber ich hörte ihr weiterhin zu, nickte immer wieder bestätigend und stellte ein paar kurze Zwischenfragen, wenn sie in ihrer Erzählung stockte.
Schließlich kehrte Stille ein. Offenbar fiel ihr nichts mehr ein, worüber sie noch reden hätte können. Ich blickte auf den Bildschirm. Sieben Minuten und fünfzig Sekunden hatte die Frau gesprochen. Es war mir wesentlich länger vorgekommen.
»Was war jetzt genau Ihr Problem, weswegen Sie heute zu mir gekommen sind?«, fragte ich, um die Stille zu durchbrechen.
Die Frau blickte mich so verwirrt an, als hätte ich sie nach den lateinischen Namen ihrer Gehirnareale gefragt. »Das weiß ich gar nicht mehr so genau«, meinte sie, stand auf und lächelte mich an. Ich war gespannt. Der nächste Satz überwältigte mich vollkommen: »Herr Doktor, heute haben Sie mir zum ersten Mal geholfen.«
Mit diesen Worten verließ sie meine Praxis. Die wöchentlichen Besuche hörten auf. Sie kam zwar weiterhin zu mir, aber nicht mehr so häufig, und manchmal tatsächlich mit echten medizinischen Problemen. Aber jedes Mal nahm ich mir zehn oder fünfzehn Minuten Zeit, und hörte mir an, was sie zu erzählen hatte. Nicht nur bei ihr machte ich das so, sondern ich bemühte mich, dies zu einer Konstante in meiner Behandlung zu machen. Diese Patientin führte mir mit aller Klarheit vor Augen, was die Medizin heute zunehmend vergisst. Wo keine Krankheit ist, müssen wir keine suchen. Der Mensch ist mehr als die Summe seiner Organe, mehr als die Summe seiner Befunde. Und die meisten Probleme lassen sich mit weniger, nicht mit mehr Intervention beheben.
Diese drei Lektionen und noch viele mehr hat unser Gesundheitssystem und das derzeit herrschende Medizinverständnis ins Gegenteil verkehrt. Das kostet uns jedes Jahr Milliarden an unnötig ausgegebenem Steuergeld. Und, was noch schwerer wiegt, es kostet Menschenleben.
Eine gefährliche Krankheit
Eine der gefährlichsten Krankheiten unserer Zeit ist kein Virus, den ein Tier überträgt, oder eine Mutation von Zellen, die mit unserem Lebenswandel zu tun hat. Sie findet sich in keinem Lehrbuch und spielt in keiner Gesundenuntersuchung eine Rolle. Ihre Brutstätten sind manchmal ausgerechnet die Orte, die wir mit Heilung verbinden: Krankenhäuser, Arztpraxen, Gesundheitszentren. Diese Krankheit ist die größte Bedrohung der gesellschaftlichen und individuellen Gesundheit.
Ihr Name lautet Hospitalismus. Für die, die nicht wissen, was der Begriff bedeutet, werde ich ihn gleich erklären. Die es zu wissen glauben, werden überrascht sein.
Unter Hospitalismus versteht die medizinische Fachsprache psychische und physische Schäden, die durch einen stationären Aufenthalt im Krankenhaus entstehen. Historisch waren unhygienische Zustände schuld an zahlreichen Krankheiten. Vor fast zweihundert Jahren und vor den Entdeckungen der großen Hygieniker wie Ignaz Semmelweis war das Krankenhaus tatsächlich ein lebensbedrohlicher Ort. Semmelweis arbeitete ab 1846 in der Gebärklinik des Allgemeinen Wiener Krankenhauses. Dort gab es zwei Stationen. In der Station 1, wo Ärzte arbeiteten, war die Sterblichkeit der Mütter durch Kindbettfieber extrem hoch. Sie lag zwischen zehn und dreißig Prozent. In der Station 2, wo vor allem Hebammen entbanden, lag die Sterblichkeit hingegen nur bei zwei bis drei Prozent. Semmelweis fragte sich, wie dieser Unterschied zustande kam. Es musste eine logische Erklärung dafür geben. Und hätte er diese erst gefunden, könnte er vielleicht die Sterblichkeit auf Station 1 senken.
Tatsächlich fand Semmelweis die Ursache heraus, nachdem er die Arbeitsweise der Ärzte einige Zeit lang aufmerksam beobachtet hatte. Viele von ihnen gingen nach der Obduktion von Leichen direkt zu den Geburten – ohne sich dazwischen die Hände zu waschen. Hebammen hingegen hatten keinen Kontakt mit Leichen. Als Semmelweis diese Beobachtung, die auf seinem gesunden Hausverstand beruhte, seinen Kollegen mitteilte, erntete er nur Spott und Hohn. Damals glaubte niemand daran, dass sich Keime über Berührung verbreiten. Außerdem fühlten sich die Ärzte angegriffen. Sie sollten den Tod der Mütter verursachen? Während die Hebammen erfolgreicher arbeiteten? Das durfte nicht wahr sein.
Zumindest konnte Semmelweis ab 1847 in seiner Station durchsetzen, dass sich Ärzte die Hände mit einer Chlorlösung waschen mussten, ehe sie eine Entbindung durchführten. Die Sterblichkeit ging darauf stark zurück. Heute gilt Semmelweis als »Retter der Mütter« und als einer der wichtigsten Mediziner der Moderne. Seine große Erkenntnis basierte auf dem Einsatz von logischem Denken. Und schon damals musste er sich gegen ein verkrustetes System durchsetzen.
Nachdem Krankenhäuser neue Standards für Sauberkeit eingeführt hatten, veränderte sich der Hospitalismus. Heute versteht die Medizin darunter noch immer Probleme, die sich aus einem Krankenhausaufenthalt ergeben, allerdings haben sie andere Gründe.
Der neue Hospitalismus
Heute wird der Begriff Hospitalismus in der Medizin und Psychologie erweitert für die Schäden an Körper und Geist verwendet, die durch länger dauernde Kontakte mit Institutionen wie Krankenanstalten oder Heimen entstehen können. Psychisch, weil Patienten zum Beispiel zu lange von ihrer Familie getrennt leben müssen und sich alleingelassen fühlen. Sie können Depressionen oder Angstzustände entwickeln.
Physisch, weil sie sich zum Beispiel mit einem hartnäckigen Krankenhauskeim infizieren, der erschreckend oft selbst gegenüber den neuesten antibiotischen Substanzen resistent ist. Die Entwicklung dieser Keime hat vor allem mit dem widersinnig häufigen Einsatz von Antibiotika bei banalen Infekten und dem Kontakt zwischen Kranken zu tun, die sich in einem Krankenhaus nun einmal nicht vermeiden lassen. Diese Krankenhauskeime sind tatsächlich ein ernstes medizinisches Problem, denn sie sind aggressiv und nur schwer behandelbar. 25.000 bis 35.000 jährliche Tote an nosokomialen Keimen in Europa sprechen eine klare Sprache. Ich habe im Laufe eines langen Arztlebens einige Fälle erlebt, in denen der Krankenhausbesuch mehr Schaden als Nutzen gebracht hat. Ein junger Mann kam nach einem Mopedunfall mit einer Fraktur des Unterschenkels ins Spital. An sich war die Verletzung gut behandelbar, bei der OP setzten ihm die Ärzte Schrauben und Platten ein. Als diese einige Monate später wieder entfernt wurden, infizierte sich die Wunde jedoch mit antibiotikaresistenten Keimen. Den Unfall überlebte er problemlos, aber an der Metallentfernung wäre er fast gestorben.
Ein Freund von mir machte eine ähnliche Erfahrung, als er eine neue Hüfte bekam. Nach der Operation entzündete sich die Hüfte und wurde septisch. Sie musste ausgebaut werden. Wochenlang musste er liegen und bekam täglich Infusionen mit Antibiotika, die aber nur bedingt halfen. Erst nach sechs Monaten konnte ihm wieder eine neue Hüfte eingesetzt werden. Die Rehabilitation war mühsam. »Ich hätte mich nicht sofort operieren lassen sollen.«
Viele Menschen verlassen Krankenhäuser in einem schlechteren Zustand, als sie es betreten haben. Das ist ein Problem des Systems. Wir produzieren Kranke.
Mit diesen Fällen möchte ich nicht sagen, dass Krankenhäuser mehr Schaden als Nutzen bringen. Nein, sie sind überlebensnotwendig für Menschen und auch wichtig für ein Gesundheitssystem. Allerdings müssen wir uns gut überlegen, wann wir ins Krankenhaus gehen. Wir sollten dies nur in absoluten Notfällen tun. Wie dieses Buch zeigen wird, ist aber das genaue Gegenteil der Fall: Die Krankenhäuser werden überlaufen bei Problemen, die ein gut ausgebildeter Allgemeinmediziner leicht beheben könnte.
In diesem Buch geht es aber vor allem um eine andere Form des Hospitalismus. Eine Form, die noch unbekannt ist. Es geht um einen systemischen Hospitalismus. Überspitzt formuliert: Menschen gehen gesund ins Krankenhaus oder in die Ordination und kommen krank wieder heraus. Keime spielen dabei nur eine untergeordnete Rolle. Der Hospitalismus, den ich meine, wird von Fehlern verursacht, die vermeidbar wären. Von einem System, das überlastet und beinahe pervertiert ist. Diese Überlastung hat nicht nur mit politischen Entscheidungen zu tun, sondern auch mit einer kulturellen Entwicklung, mit einem veränderten Verständnis von Gesundheit und einer seltsamen Auffassung vom Arztberuf. Dieser Hospitalismus degradiert den Patienten zur Fallstudie, zum Sozialversicherungszahler, dessen Behandlung sich finanziell auszahlen muss. In ihm verkommen Ärzte zu bürokratischen Medizinern, die den Dienst am Menschen verlernen und zu Dienern eines profitorientierten Systems werden. 11,2 Prozent des Bruttoinlandsproduktes, so viel geben wir jährlich für das Gesundheitssystem aus, sind schließlich keine Kleinigkeit.
Im Laufe des Buches wird immer wieder die Geschichte einer Betroffenen, der Journalistin Silvia Jelincic, vorkommen, die all das erleben musste, wovon ich hier erzähle. Ihr Vater war und ist ein Opfer des neuen Hospitalismus.
Dieser Hospitalismus bedroht unser Sozialsystem, schlimmer noch, er bedroht unsere körperliche und mentale Gesundheit. Er verhindert in so manchem Fall sogar Heilung, weil Heilung nicht mehr im Mittelpunkt des Heilungsprozesses steht. Sondern Bürokratie, Geld, politische sowie wirtschaftliche Player und persönliche Interessen.
Der Fehler im System(Teil 1)
Bericht der Patientenangehörigen Silvia Jelincic
Ich war verzweifelt. Irgendwie nahm die Sache kein Ende. Zumindest kein gutes. Dreimal wurde mein Vater an der Wirbelsäule operiert. Dabei hätte eine einzige gut durchgeführte Operation reichen müssen. Nach einem kurzen Aufenthalt zu Hause musste er also schon wieder ins Krankenhaus. Dieses Mal, weil er viel Blut durch die Blase verlor. Beim Gedanken an die bevorstehende OP wurde ich nervös. Werden sie es wieder vermasseln?
Ein alter Freund hatte mir schon Monate davor die Nummer eines Arztes gegeben, von dem er meinte, er sei anders als die anderen Ärzte und auch anders als das System. Es war die Nummer Wolfgang Graningers, eines berühmten Infektiologen und Internisten.
Graninger, 77 Jahre alt, rettete meinem Vater seither schon mehrere Male das Leben. Allerdings können nicht einmal Ärzte wie Wolfgang Graninger und Günther Loewit die gravierenden Fehler ihrer Kollegen korrigieren. Es ist wie mit einer Vase. Einmal zerschlagen, hilft der beste Klebstoff nicht.
In jener Juninacht stand ich zerknirscht in Graningers Garten und erzählte von der neuerlichen OP meines Vaters. Mein Vater war seit der zweiten misslungenen Operation an der Wirbelsäule ans Bett gefesselt und stark geschwächt. Ich war verängstigt. Würde er den Eingriff gut überstehen? Graninger meinte, die Verödung einer Ader in der Blase sei Routine, ich könne beruhigt sein.
Doch einen Rat gab er mir: »Sagen Sie dem Anästhesisten, Ihr Vater soll keine Vollnarkose bekommen. Sonst schlittert er vielleicht wieder ins Delirium. Außerdem ist er zu schwach dafür.«
Ich bedankte mich und ging. Am Tag darauf war ich schon gegen sieben Uhr morgens im Krankenhaus, um mit dem Anästhesisten zu sprechen. Ich bat ihn, eine lokale Betäubung vorzunehmen.