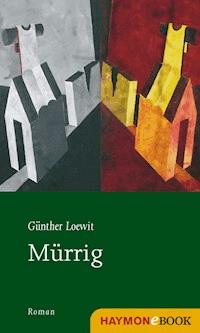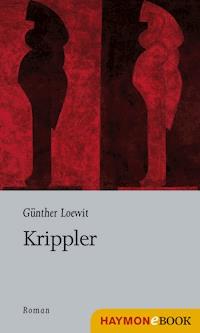Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Moderne Hochleistungsmedizin und die Verlängerung des Sterbens: Der medizinische Fortschritt lässt heute nahezu jede Krankheit heilbar erscheinen. Mit modernen Behandlungsmethoden erkämpfen wir uns immer mehr Lebenszeit. Doch welchen Preis zahlen wir dafür? Bedeutet ein längeres Leben automatisch ein besseres? Haben wir verlernt, den Tod als Teil des Lebens zu akzeptieren? Dr. Günther Loewit greift ein brisantes Thema auf: Sein Buch Sterben ist ein Plädoyer für Ehrlichkeit, Respekt und menschenwürdige medizinische Begleitung der letzten Lebensphase anstelle von Geschäftemacherei mit der Angst vor dem Tod. * kritisch, provokant und informativ * neuer Zugang zum Thema Sterben und Umgang mit dem Tod * Blick hinter die Kulissen des Gesundheitssystems * vom Medizin-Querdenker Dr. Günther Loewit * Sterbehilfe und Lebensverlängerung als eine Frage der Ethik
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 366
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dr. med. Günther Loewit
Sterben
Zwischen Würde und Geschäft
Inhalt
Titel
Zitat
Vorwort
Sterben und Tod I: Das Leben
Sterben und Tod II: Die Gesellschaft
Sterben und Tod III: Die Medizin
Nachwort
Dr. med. Günther Loewit
Zum Autor
Impressum
Weitere E-Books aus dem Haymon Verlag
Weitere E-Books aus dem Haymon Verlag
Death must be so beautiful. To lie in the soft
brown earth, with the grasses waving above one’s
head, and listen to silence. To have no yesterday,
and no tomorrow. To forget time, to forgive life,
to be at peace.
Oscar Wilde
Vorwort
Nicht den Tod sollte man fürchten, sondern dass man nie beginnen wird zu leben.
Marcus Aurelius
Herr P. liegt im Sterben. Er ist 90 Jahre alt. Seit 2 Tagen gelingt es der Krankenpflegerin nicht mehr, das künstliche Gebiss in Ober- und Unterkiefer zu platzieren. Zu starr und unbeweglich ist die Muskulatur des senilen Gesichts. Die blassgelbe Hautfarbe, Schweißperlen auf der Stirn, das zugespitzte Kinn und die eingefallenen Augen ohne Glanz geben ihm das typische Aussehen eines Sterbenden. Kinder und Enkelkinder stehen um sein Bett.
Seit 24 Stunden ist er nicht mehr erweckbar. Nicht mehr ansprechbar. Nicht mehr erreichbar. Niemand weiß, wo er ist, niemand weiß, ob er Schmerzen leidet. Ob und wie er noch fühlt. Sein Gesichtsausdruck ist ernst, gefasst. Aber nicht schmerzverzerrt. Die Lunge rasselt bei jedem Atemzug. Die Brust hebt und senkt sich unwirklich und maschinenhaft.
Immer wieder setzt der Atem für längere Zeit aus. In diesen Sekunden kehrt absolute Entspannung, ja Frieden in sein Antlitz. Vorübergehend. Dann beginnt der Brustkorb wieder, sich wie wild auf und ab zu bewegen. Das Gesicht wirkt während dieses Ringens um Luft angespannt, Herr P. kneift die Lippen zusammen. Kurz öffnet er die Augenlider ein wenig, ohne den Blick auf irgendeinen Punkt zu richten. Die Pupillen bleiben starr und trüb. Auch jetzt reagiert er weder auf Worte, noch auf die vorsichtigen Berührungen seiner Nächsten. Aber das heftige Atmen scheint eine Last, eine enorme Anstrengung zu bedeuten.
Nach zehn bis fünfzehn solcher Atemzüge fällt er wieder zurück, in eine totenähnliche Stille. Das Gesicht erholt sich von den Strapazen des scheinbar verzweifelten Kampfes um Luft. Ruhe. Erneute Entspannung. Ein letztes Kräftesammeln für ein vorletztes, für ein letztes Atemringen.
Etliche Stunden führt er diese Auseinandersetzung mit dem Tod. Er tut es konsequent, ohne Pausen, ohne zu rasten, ohne zu klagen. Es wirkt wie eine letzte große Arbeit, die noch getan werden muss. Man hat das Gefühl, dass Herr P. dabei nicht gestört werden möchte.
Dann, irgendwann, bleibt die Ruhe. Verschwindet die letzte Anspannung aus dem Gesicht. Hebt sich die Brust nicht mehr. Bleiben die Augen geschlossen, der Mund leicht geöffnet.
Herr P. bewegt sich nicht mehr. Nie mehr.
Herr P. ist gestorben.
Immer noch der gleiche Mensch im selben Bett wie vor wenigen Sekunden, aber nicht mehr am Leben.
Und doch noch nicht tot.
Denn auch der Tod braucht seine Zeit, um gänzlich Besitz vom leblosen Körper Herrn P.s zu ergreifen.
Meine ersten Erinnerungen überhaupt handeln von zu Hause, von Mutter und Vater, den Geschwistern, in der Reihenfolge ihres Auftretens im gemeinsamen Leben, und von Erlebnissen mit heute längst verstorbenen Menschen. Es sind Erinnerungen, die vom Entdecken des Lebens und der Welt handeln. Der Tod kommt in ihnen aber nicht vor.
Irgendwann, mitten in meinem 12. Lebensjahr, ist die Mutter eines Mitschülers im Alter von 42 Jahren an einem Herzinfarkt verstorben. Im ganzen Wohnblock – die Familie wohnte in der Nähe – herrschten blankes Entsetzen und Aufregung. Tagelang wurde von nichts anderem gesprochen. Wie konnte eine so junge Frau plötzlich sterben und nicht mehr da sein? Vom armen Witwer und von den unversorgten Kindern war die Rede. Dabei wurden die zwei Buben von allen anderen Müttern, so schien es, mit mehr Gefühl, Naschereien und Kuchen verwöhnt, als mir damals logisch erscheinen wollte.
Der ganze Rummel, die ganze Erregung um den Tod der angeblich so jungen Mutter war mir unverständlich. Wie konnten die Menschen ringsum eine 42-jährige Frau als jung bezeichnen? In den Augen eines 12-Jährigen war man mit 42 alt und konnte ruhig sterben, ohne dass deshalb die Welt zusammenbrechen müsste. So, wie die Welt im Wohnblock für einige Zeit zusammengebrochen ist. Lediglich die Tatsache, dass ein gleichaltriger Mitschüler seine Mutter verloren hatte, berührte mich insofern, als eine Welt ohne die eigene Mutter einfach unvorstellbar gewesen wäre.
Meine erste persönliche Begegnung mit dem Tod fand Jahre später im ersten anatomischen Sezierkurs zu Beginn des Medizinstudiums statt. Wir wurden einander weder vorgestellt noch auf die Begegnung vorbereitet. Unvermittelt trat er in mein Leben. Er reichte mir eine kalte, steife Hand.
Eine Hand mit Unter-, Oberarm und Schulter. Aber ohne Körper. Auf einem blank gescheuerten Blechtisch in einem nach Formaldehyd riechenden Raum. Die berührten, blassen Gesichter der drei Mitstudenten sind mir bis heute in Erinnerung geblieben.
Die weißen Mäntel, die wir nicht ohne Stolz trugen, mahnten in dem Augenblick ein, dass die Berufswahl getroffen war. Wessen Hand sollte da mit Pinzette und Skalpell zerteilt und in all ihren Funktionen verstanden werden? War es eine Frauen- oder eine Männerhand? Was hatte dieser Arm alles umfangen, wen hatten die Finger berührt? Zu welchem Körper gehörte sie? Woran und warum war der Körper dieses Menschen gestorben? Wie würde sich die kalte Haut anfühlen? Viele Minuten lang irritierte und lähmte uns der leblose Arm. Unsicher und schweigsam verlief der erste Kontakt mit der Hand eines toten Menschen. Erschrocken und ergriffen zugleich.
So wurde mir mit 19 Jahren zum ersten Mal bewusst, was der lebenslang gehegte Wunsch, Arzt zu werden, noch alles mit sich bringen würde. Der tote Körperteil bewegte und berührte jeden von uns Studenten auf seine Art. Und erst heute erkenne ich im Rückblick, wie wichtig es ist, werdende Mediziner so früh wie möglich mit dem Tod zu konfrontieren.
Nach Jahrzehnten, mitten im Berufsleben als Land- und Notarzt, begegnete mir noch einmal ein abgetrennter Arm. Der Tod hat zu diesem Zeitpunkt schon viele seiner Formen und Gesichter gezeigt.
Ich wurde während eines Sommergewitters zu einem Verkehrsunfall gerufen. Als ich mit Blaulicht am Unfallort eintraf, hatte die Polizei die Straße bereits abgesperrt. Die Ruhe war gespenstisch. Man hörte nur den Wind im reifen Korn auf den Feldern ringsum. Der in der Schulter des Opfers abgetrennte Arm lag 150 Meter weit von der Unfallstelle entfernt mitten auf der Fahrbahn. Vom Rückspiegel eines Autos mitgerissen. Ganz alleine am regennassen Asphalt, erinnerte er mich an die Extremität am Blechtisch. Der junge Motorradfahrer muss auf der Stelle tot gewesen sein. Die Brutalität des Unglücks und die grausame Schnelligkeit dieses Todes berührten mich noch einmal ähnlich tief wie der erste tote Arm, 20 Jahre zuvor.
Gegen Ende des Medizinstudiums, ich famulierte zu dem Zeitpunkt auf der Herzchirurgie, stellte mir der Tod zum ersten Mal eine Art Gretchenfrage. Jeden Abend begleitete ich – nicht ohne Stolz – den Abteilungsleiter bei der Visite. Und wie bei jedem Stationsrundgang kamen wir auch an jenem Tag wieder zum Zimmer einer langzeit-beatmeten Patientin. Während ihrer Herz-OP hatte sie einen Schlaganfall erlitten. Sie war nie mehr aus der Narkose aufgewacht, sondern für immer ins Koma gefallen. Nach ein paar Tagen wurde sie als hoffnungsloser Fall samt ihrer Beatmungsmaschine von der Intensivstation auf die Bettenstation verlegt. Die Angehörigen hofften immer noch auf ein Wunder. Aber die Situation verschlimmerte sich nur von Tag zu Tag. Und da standen wir vor ihr, mein Lehrer und ich. Ich sehe ihr aufgedunsenes Gesicht noch vor mir und habe ihren Namen bis heute nicht vergessen. Die Abendsonne schien ins Zimmer. In einem Glaszylinder sah man den Kolben auf und ab laufen, der ihr die Luft in die Lunge presste. Dieses Bild eines reduzierten menschlichen Lebens berührte und beschäftigte mich. Entsetzt und entrüstet stellte ich an jenem Abend meinem Begleiter die Frage, was das noch für ein Leben sein sollte. Eine Zeit lang schwieg und überlegte der Dozent. Dann sah er mir ruhig in die Augen und sagte: „Wenn du willst, darfst du die Maschine abstellen.“ Dabei zeigte er mit einer knappen Geste auf den Ein/Aus-Schalter. Für den Bruchteil einer Sekunde war ich mir sicher, den Schalter betätigen zu wollen. Aber dann setzte ein Nachdenkprozess ein, der bis heute noch nicht abgeschlossen ist.
Als jungen Arzt berührte mich der Tod älterer Patienten lediglich in Form der betroffenen Angehörigen. Der eigene Tod war aus meinem Blickfeld verschwunden, die Zeit bis dahin schien noch unendlich lang zu sein. Als Arzt arbeitete ich dem Tod zu, begleitete Patienten und dachte nicht ans eigene Sterben. Inzwischen sterben aber schon immer häufiger Patienten, denen deutlich weniger Lebensjahre als mir vergönnt waren. Der Tod kommt also näher und näher. Zieht seine immer engeren Kreise, nicht nur um Patienten, Familie und Freunde, sondern auch um das eigene Leben. Dieses Wissen macht die verbleibende Zeit zunehmend wertvoll.
32 Jahre Arztsein haben dem Tod ein schärferes und genaueres Gesicht gezeichnet. Er wurde ein nicht abweisbarer und nicht abzuschüttelnder Weggefährte. Wir teilen uns die Patienten, sozusagen. Zuerst überlässt er sie uns Ärzten, dann müssen wir sie ihm überlassen. Gegen ihn zu kämpfen, wie es immer als oberste Pflicht eines Arztes angesehen wird, erscheint mir heute in einem etwas anderen Licht. Denn der Kampf gegen den Tod ist immer nur vorübergehend zu gewinnen. Und das Blaulicht als Symbol für die ärztliche Dringlichkeit ist schon längst vom Dach meines Autos verschwunden.
Den Tod als notwendiges Ende des Lebens zuzulassen ist für mich Bestandteil unendlich vieler Patientengespräche geworden. Erst das Integrieren des Todes in die gemeinsamen medizinischen Bemühungen nimmt manchem Patienten den Druck, um jeden Preis gesund und jung bleiben zu müssen.
Immer wieder höre ich, wie erfüllend und befriedigend der Beruf des Landarztes doch sein muss. Die Antwort darauf lautet seit einiger Zeit monoton, aber wohlüberlegt und abgewogen: „Ja, der Beruf ist erfüllend … und das eigene Lebenswerk kann jederzeit am Ortsfriedhof bewundert werden.“ Allerdings gibt es auf keinem einzigen Grabstein eine Inschrift, die „ohne meinen Arzt könnte ich hier nicht ruhen“ lauten würde.
Als älter werdender Hausarzt überblicke ich in vielen Häusern drei, vier und sogar fünf Generationen von Menschen. Gegen diesen Aspekt der Lebensbetrachtung, und das wird mir erst in den letzten Jahren richtig bewusst, hat der Tod allerdings keine Chance. Das egozentrische Weltbild, das sich nur mit dem eigenen Leben und auch nur mit dem eigenen Tod beschäftigt, weicht zunehmend einem breiteren Blickwinkel, in dem es auch um die Menschheit an sich geht.
Der Apple-Gründer Steve Jobs hat den bevorstehenden eigenen Tod sehr beeindruckend mit den Worten „Der Tod ist vielleicht die beste Erfindung des Lebens. Er ist der Unternehmensberater des Lebens. Er mistet das Alte aus, um Platz für das Neue zu schaffen“ kommentiert. Der Satz hat mich in seiner Reife berührt.
Die Vorstellung, dass ich nach einem Leben voller medizinischer Aktivität und intensiver Beschäftigung mit Menschen in allen Lebenslagen selbst dem Tod ausgeliefert sein werde, ist manchmal bedrückend, manchmal aber auch tröstlich. Bewusst geworden ist mir im Lauf der Jahre aber, dass der Mensch nicht die Art des eigenen Todes, sondern nur die Art des eigenen Lebens selbst bestimmen oder zumindest mitbestimmen kann.
Sehr treffend hat der Evangelist Matthäus das Dilemma unserer Zeit vorweggenommen: „Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren.“ Das angstvolle Klammern an einem Leben um jeden medizinischen Preis lässt viele von uns schon lange vor dem Tod sterben. Denn ein Leben, das nur noch um seiner selbst willen erhalten wird, verliert Inhalt und Lebendigkeit.
Sich vor dem Tod zu fürchten ist vermutlich genauso wenig sinnvoll, wie den nächsten Winter verhindern zu wollen. Fürchten sollte man sich nur vor vergeudeten Lebenstagen. Letztlich sollte also im Verlauf des Lebens in jedem Menschen der Gedanke reifen, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis der Tod auch dem eigenen Leben ein Ende setzen wird. Die Medizin spielt dabei lediglich eine untergeordnete Rolle. Denn sterben muss jeder Mensch alleine, und für sich selbst. Und prinzipiell nur ein Mal.
Ein Ärzte-Sprichwort, das gerne im Zusammenhang mit dem Stellen von Diagnosen verwendet wird, lautet: „Erstens gibt es nichts, was es nicht gibt, und zweitens ist das Häufigere das Häufigere.“ Das bedeutet, dass man als Arzt zwar an alle Eventualitäten denken sollte, sich aber auch darauf verlassen kann, dass – statistisch gesehen – die meisten Krankheiten harmlos sind und so, wie sie gekommen sind, auch wieder von selbst gehen werden.
Ähnlich verhält es sich mit Einzelfall und Statistik.
Wenn von 100 Patienten, die erfolgreich reanimiert werden, bei denen die Reanimation aber länger als zehn Minuten gedauert hat, nur einer ein einigermaßen normales Leben weiterführen kann und die restlichen 99 als Wachkomapatienten enden, so wird diese statistische Aussage dem einen geretteten Menschen belanglos erscheinen. Weil die Statistik im Einzelfall nicht gilt.
Aber trotzdem lügt die Statistik nicht.
So soll in diesem Buch trotz der häufigen Beschreibung von Einzelfällen immer das größere Ganze im Blick behalten werden. Es muss tragfähigen Arzt-Patient-Beziehungen überlassen werden, individuelle Entscheidungen zu treffen. Jeder Mensch, jeder Patient ist eine Besonderheit. Jede schwere Krankheit eine individuelle Tragödie. Jeder Tod so einzigartig wie das ihm vorausgegangene Leben.
Mein ganzer ärztlicher Respekt gilt in jeder Situation stets dem einzelnen Patienten. Trotzdem wähle ich in diesem Buch immer wieder auch den übergeordneten Blick auf die medizinisch-gesellschaftlichen Eigenheiten unserer Zeit im Umgang mit dem Sterben und dem Tod. Manche der getätigten Aussagen mögen hart klingen, vielleicht auch im Moment unannehmbar sein, wenn sie ein betroffener Leser auf den individuellen Einzelfall bezieht. Aber nur, wenn man den Blick vom Einzelfall weg auf die großen Zusammenhänge lenkt, lässt sich verstehen, warum unsere Gesellschaft den natürlichen Umgang mit dem Tod verlernt und sich in ein Netz aus ökonomischen Abhängigkeiten, medizinischer Illusionen und unrealistischen Erwartungen gegenüber dem Leben und Sterben verstrickt hat.
Sterben und Tod I: Das Leben
Menschen sterben nicht, weil sie nicht mehr essen und trinken, sondern Menschen essen und trinken nicht mehr, weil sie sterben.
Das Versprechen vom ewigen Leben
Die modernen Medien suggerieren ewige Jugend, Gewinn und laufend steigenden Lebensstandard als einzig erstrebenswerte Güter. Das Covergirl ist immer jung, faltenfrei und makellos gekleidet. Unsere permanenten virtuellen Begleiter sind entweder ohnehin unsterblich oder altern zumindest nicht. Die Auflösung unserer Bildschirme übertrifft die Möglichkeiten des menschlichen Auges. Selbst vergrößert bleibt auf ihnen das virtuelle Leben fehlerfrei. Nur das eigene Gesicht im Spiegel altert. Unaufhörlich, unaufhaltsam.
Der westliche Lebensstandard unserer Tage wäre früheren Generationen wie die vorzeitige Erfüllung aller biblischen Versprechen auf das Paradies erschienen. Aus einer solchen Sicht verwundert es nicht, dass wir nicht mehr sterben wollen. Wer möchte schon freiwillig alle materiellen Güter und glitzernden Versprechungen dieser Welt für einen ungewissen Begriff vom Jenseits hinter sich lassen?
Studien belegen allerdings, dass uns das Paradies der westlichen Wohlstandsgesellschaft auch unglücklich und depressiv macht. Aus dem biblisch-symbolischen Fegefeuer ist oftmals das Burn-out zu Lebzeiten geworden. Der Glaube an ein erstrebenswertes Jenseits ist mit zunehmender materieller Sättigung deutlich geschwunden. Im Sterben liegt kein Trost mehr. Und eine überhebliche Medizin macht glauben, dass Sterben im Grunde gar nicht mehr notwendig wäre. Oder zumindest, dass bis zur Stunde des Todes alle Organe reparabel oder austauschbar wären.
„Die Augenmedizin hat sehr große Fortschritte gemacht: Rechtzeitige Diagnose und Vorsorge können die Sehkraft bis ins hohe Alter erhalten, betonen Mediziner.“ So zitierte der „Kurier“ im März 2013 die Sichtweise der Augenärzte. Was der zitierte Augenmediziner allerdings nicht sagt, ist, dass ein hoher Prozentsatz der alten und hochbetagten Menschen auch trotz der Fortschritte in der Ophtalmologie (Augenheilkunde) nur schlecht oder nichts sieht. Eben weil alte Menschen immer noch älter werden und die mit jeder erreichten Altersstufe zunehmenden Verschleiß- und Abbauprozesse nicht ewig korrigiert werden können.
Die Orthopäden wiederum betonen, dass sie in der Lage seien, bis ins ebenso hohe Alter Hüft-, Knie-, Sprung- und allerlei andere Gelenke durch künstliche Implantate ersetzen zu können. Dank der minimalinvasiven Chirurgie, die derartige Eingriffe wie z.B. bei einer Arthroskopie mit kleinsten Verletzungen an der Hautoberfläche und oft nur mit lokaler Betäubung durchführen kann, würden die perioperativen Risiken – also die Risiken auf Komplikationen während und unmittelbar nach der Operation – auch für hochbetagte Patienten ständig weiter sinken.
Auch Gefäß- und Herzspezialisten machen auf ihren jährlichen Mega-Event-Kongressen ähnliche Aussagen. Die Auflistung solcher und ähnlicher medizinischer Versprechungen könnte beliebig fortgesetzt werden. Kurz zusammengefasst: Niemand muss leiden, niemand muss sterben. Oder besser: Niemand müsste sterben. Wäre da nicht noch der Tod. Der Tod als medizinisch-gesellschaftliches Versagen. Als unausweichliche Hürde knapp vor dem ersehntesten aller Ziele, der Unsterblichkeit.
Schon längst ist der moderne Medizinbetrieb mit all seinen lebensbegleitenden Ritualen zu einer festen gesellschaftlichen Größe geworden. Von der Zeugung an über die Schwangerschaft und die Geburt, während des ganzen Lebens bis zum letzten Atemzug gibt es keinen Schritt mehr, der nicht von der Medizin begleitet oder gar autorisiert werden müsste. Das ärztliche Attest ist ein lebensbegleitender Bestandteil von Beruf und Freizeit geworden. Kein Kinderfußball, kein Judo-Kurs, keine Ausbildung zur Krankenschwester, Kindergärtnerin oder Lehrerin, keine Anstellung im Lebensmittelhandel, bei Bund oder Land kommt ohne „körperlich und geistig gesund und frei von ansteckenden Krankheiten“ aus.
Ein 18-jähriger junger Mann wird bei seiner Einberufung zur Musterung einer gründlichen medizinischen Untersuchung unterzogen: Lungenröntgen, eine augenärztliche, eine internistische und eine orthopädische Untersuchung, Harnanalyse und Blutabnahme. Der leicht erhöhte Blutdruck wird auf die Nervosität des Probanden zurückgeführt. Dass der junge Brillenträger fehlsichtig ist, ist offensichtlich und bedarf keiner eigenen Untersuchung. In der Harnprobe wird eine leicht erhöhte Eiweißmenge festgestellt. Der junge Mann wird erstens für tauglich zum Dienst mit der Waffe befunden und zweitens gebeten, die beanstandeten Befunde bei seinem Hausarzt einer weiteren Abklärung unterziehen zu lassen.
Dort ist der Blutdruck dann im Normbereich, der Harn in Ordnung. „Vermutlich“, sagt der Hausarzt, „haben Sie beim Heer keinen reinen Mittelstrahlurin abgegeben, das wird die Ursache für den falschen Befund gewesen sein.“
Acht Monate später tritt der inzwischen 19-Jährige seinen Zivildienst beim Roten Kreuz an. Der erste Tag der Grundschulung ist einer weiteren eingehenden medizinischen Untersuchung gewidmet. Wieder wird dem jungen Mann Blut abgenommen. Diesmal sind zwei Leberwerte leicht erhöht. Wieder wird der Proband in schriftlicher Form ersucht, die krankhaften Befunde beim Hausarzt weiter abklären zu lassen.
Dem Hausarzt erklärt der Zivildiener während der neuerlichen Blutabnahme in einem Nebensatz: „Wissen Sie, Herr Doktor, das war interessant, beim Roten Kreuz, da haben fast alle einen Zettel für den Hausarzt wegen der Leberwerte bekommen.“ Da dämmert dem Arzt, dass offensichtlich ein Analysegerät nicht korrekt kalibriert oder gar defekt war. Und wirklich, die zwei beanstandeten Leberwerte sind jetzt unauffällig.
Nach einem Monat Ausbildung zum Hilfssanitäter wird der Zivildiener der Rettungsstelle in seinem Heimatort zugeteilt. Er staunt nicht schlecht, als er erfährt, dass der erste Arbeitstag wieder mit einer medizinischen Untersuchung beginnen wird.
Etwas überspitzt könnte man formulieren: Die Medizin hat sich in so gut wie alle Bereiche des Lebens eingenistet wie eine Religion und bemüht in ihren Verhaltensweisen auch einen Großteil der kirchentypischen Strukturen. An die Stelle der einzelnen Götter in Weiß ist der Götze Medizin als übergeordnete Gottheit getreten.
Und wie überall, wo es um Götter geht, geht es um Macht. Daher darf es auch nicht verwundern, dass die Medizin den behandelnden Händen der Ärzte entwunden und in die Fänge der Politik übergegangen ist. Wo sich der Kreis auch schließt. Denn an die Stelle von freier Arztwahl – seitens der Patienten – und freier Wahl diagnostischer und therapeutischer Schritte – seitens der Ärzte – ist ein von der Politik festgelegtes enges Korsett in Form einer juridisch überprüfbaren, evidenz-basierten Einheitsmedizin getreten. Wehe den Ärzten, und wehe den Patienten, die sich nicht an diese Vorgaben halten wollen. Den einen könnte der berufliche Tod, den anderen der leibliche Tod drohen.
Kurz: Wer sich nicht ein Leben lang medizinisch kontrollieren und behandeln lassen will, dem blüht der Tod. Alle anderen Menschen sterben entweder medizinisch versehentlich, oder, aus juristischer Sicht noch besser, weil jemand aus dem Bereich der Gesundheitsindustrie schuld ist.
Die Medizin verspricht jede Krankheit schon lange vor ihrem Ausbruch entdecken und heilen zu können.
Scheinwissenschaftliche Aussagen, dass eine Lebenserwartung von 125 Jahren theoretisch möglich sei, klingen in Anbetracht des Alltags in modernen Pflegeanstalten wie Spott und Hohn. Und doch verfallen die Menschen unserer Tage solchen Versprechungen im gleichen Maß, in dem sie früher an ein ewiges Leben im Himmel geglaubt haben. Wozu sollte also noch jemand freiwillig sterben wollen?
Aber unsere Kultur hat nicht nur das Sterben verlernt, sondern auch den Tod aus ihrer Wirklichkeit verbannt. Sterben passt nicht zur Erfolgsgesellschaft. Sterben passt nicht in die allgegenwärtige virtuelle Parallelwelt. Sterben ist Versagen, Sterben ist Schwäche, Sterben ist eine Schande. Sterben ist das Eingeständnis der Endlichkeit in einer unendlich globalisierten Welt. Wir sterben nur noch unter Protest. Von der Schulmedizin im letzten Augenblick – wenn eine Heilung nicht mehr möglich erscheint – fallengelassen wie die sprichwörtliche heiße Kartoffel. Wir sterben versehentlich. Wir sterben abgesondert und abgeschoben im Hospiz. Wir sterben palliativ. Wir sterben während einer letzten OP. Wir sterben auf der Intensivstation. Wir sterben einsam. Wir sterben im Pflegeheim. Wir sterben im Geheimen. Wir sterben unsichtbar für die Welt außerhalb des Geriatrie-, Medizin- und Pflegesystems.
Wann und warum ist uns die Vertrautheit des Sterbens abhandengekommen? Ist die Freude am Leben in den letzten Jahrzehnten derart gewachsen, dass wir nicht mehr sterben wollen?
Gegen diesen Gedanken sprechen die Statistiken, die unseren westlichen Gesellschaften mehr kranke, depressive und ausgebrannte Mitglieder bescheinigen, als es je zuvor gegeben hat. Warum verbannt unsere Gesellschaft also den Tod aus ihrer Wirklichkeit? Warum wird der Tod nicht als Erlösung von Depression und Langeweile gesehen? Warum hat die Betrachtung „Jetzt und in der Stunde unseres Todes“ dermaßen an Bedeutung für unsere Lebensführung verloren?
Und warum ist unsere Gesellschaft nicht mehr imstande, den Tod als notwendigen Schlusspunkt des Lebens anzunehmen? Gibt es eine Parallelität zwischen den immer komplexer werdenden medizinischen Vorgängen um Zeugung, Schwangerschaft und Geburt des Menschen und der abhandengekommenen „Selbst-Verständlichkeit“ des Sterbens?
Wann und wo immer von sterbenden Menschen gesprochen wird, werden diese als „Patienten“ bezeichnet, was aus dem Lateinischen übersetzt „Leidender“ bedeutet. Aber nicht jeder sterbende Mensch ist zugleich ein leidender Mensch. Wir müssen wieder lernen, dass Menschen dann und wann auch gesund sterben können. Und dass selbst die beste medizinische Behandlung über das ganze Leben hinweg den Tod nicht verhindern kann.
Aber die Medizin spielt schon lange eine zwielichtige Rolle: Die Maxime moderner Heilkunst scheint zu lauten, so viele Untersuchungen wie nötig zu veranlassen, um aus einem unauffälligen Menschen einen Patienten zu kreieren (ganz nach der Devise: Es gibt keine gesunden Menschen, sondern nur schlecht untersuchte) und daraufhin so viel Therapie wie nötig durchzuführen, um aus dem künstlich erkrankten Individuum wieder einen gesunden „Patienten“ zu machen.
Nur wer sich konsequent von medizinischen Reihenuntersuchungen fernhält, hat eine Chance, gesund zu bleiben. Während in Österreich und Deutschland zum Beispiel bei Frauen ab dem gebärfähigen Alter jährlich Gebärmutterhalsabstriche als Krebsvorsorge durchgeführt werden, wird diese Untersuchung in Finnland zum einen erst ab dem 30. Lebensjahr und zum anderen nur alle fünf Jahre angeboten. Trotzdem gibt es in Finnland weit weniger Fälle von Gebärmutterhalskrebs. Die wissenschaftliche Erklärung für dieses Phänomen ist verblüffend und ernüchternd.
Nicht jeder pathologische PAP (krankhafter Abstrich) deutet auch tatsächlich auf ein invasives Karzinom (in die Tiefe wachsender Krebs) hin. Trotzdem werden bei österreichischen und deutschen Frauen bei Auftreten von krebsverdächtigen Zellen im Abstrich sofort sogenannte Konisationen – das sind kegelförmige Ausschneidungen aus dem Gebärmutterhals – durchgeführt und die so behandelten Patientinnen als Krebsfälle gewertet. Betroffen sind jährlich ca. 5.000 bis 6.000 Österreicherinnen und zehnmal so viele deutsche Frauen. Langzeitbeobachtungen zeigen jedoch, dass sich, vor allem bei jungen Patientinnen, die krankhaften Veränderungen in den allermeisten Fällen wieder spontan zurückbilden und die operierten Frauen nicht ernsthaft an Krebs erkrankt wären. Für die Fälle, in denen sich tatsächlich ein Karzinom entwickelt, genügt im Allgemeinen aber auch ein fünfjähriges Untersuchungsintervall, um noch rechtzeitig eine erfolgreiche Behandlung durchführen zu können.
So werden als Folge eines Vorsorgeuntersuchungsprogramms Krebsfälle produziert, die eigentlich gar keine wären. Von den Kosten, der psychischen Belastung für die Patientinnen, von den Komplikationen, die die durchgeführten Konisationen im Rahmen von Schwangerschaft und Geburt mit sich bringen, und dem dadurch verursachten volkswirtschaftlichen Schaden soll gar nicht geredet werden.
Aber selbstverständlich erhöht im Einzelfall eine nicht durchgeführte Reihenuntersuchung dann und wann auch das Risiko, eine ernste Erkrankung nicht frühzeitig entdecken zu können. Das Dilemma ist, dass die Statistik an sich nicht lügt, dass sie aber im Einzelfall bedeutungslos ist.
Eine hoffnungslose Situation?
Ja, könnte man sagen, für verunsicherte Menschen auf jeden Fall. Für die institutionalisierte Medizin aber keineswegs. Im Gegenteil: In der Wirtschaft stellt diese Konstellation eine klassische Win-Win-Situation dar. Denn offensichtlich hat die moderne Medizin in jedem lebenden Individuum einen Patienten erkannt. Kinder kommen als Patienten zur Welt, werden sogar schon als Patienten im Reagenzglas gezeugt. Durch permanente, lebensbegleitende Untersuchungen und Therapien wird aus dem freudig erwarteten Baby ein dauernder Patient. Das beginnt bei den orthopädischen Einlagen, der obligaten Zahnspange, setzt sich in wahren Impforgien fort, dem medizinischen Kampf gegen jede Unreinheit der Haut, der medizinisch-psychologischen Betreuung nicht normgerechter Kinder und den andauernden Reihenuntersuchungen.
Schwangere Frauen oder Säuglinge sind aber an sich keine Patienten. Ein Plattfuß mit drei Jahren ist keine Krankheit, nicht jeder schräg stehende Zahn ist korrekturbedürftig, und eine Impfung gegen Feuchtblattern (Varizellen) ist genauso wenig notwendig wie die Behandlung einzelner Aknepusteln mit nebenwirkungsreichen Medikamenten.
Und genauso wenig ist ein an Altersschwäche sterbender Mensch ein Patient.
Erst durch das Allmachtstreben der modernen Medizin werden auch die natürlichen physiologischen Vorgänge zu Beginn und am Ende des Lebens zu medizinisch-wissenschaftlichen Prozessen. Die Ethik unserer Gesellschaft ist von wissenschaftlichem Denken und kapitalistisch-säkularen Betrachtungen geprägt. Religiöse Aspekte haben zurzeit wenig Einfluss auf den gelebten Zeitgeist. Damit übernimmt die Medizin jene übergreifende, lebenslange Begleitung des einzelnen Menschen, die früher die Religion innehatte.
Ein Irrweg? Zumindest ein Paradigmenwechsel im Vergleich zu den vergangenen Jahrhunderten.
Im Verlauf des letzten Jahrhunderts hat sich der Zeitpunkt des individuellen Sterbens dank des medizinischen Fortschritts konsequent immer weiter ins hohe Lebensalter verschoben.
1865 erlebte die Hälfte aller in Berlin geborenen Kinder das fünfte Lebensjahr nicht. Und noch 1910 verstarben 20 % der Neugeborenen innerhalb der ersten Lebensjahre. Heute sind Säuglings-, Kinder- und Jugendsterblichkeit in den OECD-Ländern äußerst gering. Allerdings haben die Todesfälle die Zahl der Geburten schon längst überholt. Es gibt weit mehr über 65-Jährige, als es Kinder unter fünf Lebensjahren gibt. Ein Ungleichgewicht, das der Gesellschaft noch zu schaffen machen wird.
Viele Krankheiten werden durch den ständigen Ausbau der Vorsorgemedizin in früheren und damit besser heilbaren Stadien entdeckt. Die statistisch häufigsten Krebsarten konnten durch regelmäßige Screeninguntersuchungen der betroffenen Altersgruppen deutlich zurückgedrängt werden. Kardiologische Problempatienten werden schon in jungen Lebensjahren mit unter die Haut verpflanzten Defibrillatoren versorgt. Das Sterben „mitten im Leben“ ist seltener geworden.
Andererseits findet das Sterben nach der Ablösung der Großfamilie durch kleinere soziale Einheiten isoliert vom gesellschaftlichen Alltag statt. Damit wird der Tod in der heutigen Gesellschaft unwirklicher und schemenhafter wahrgenommen als früher. Genau genommen wird er als natürliches Phänomen gar nicht mehr wahrgenommen. Die Zahl der erwachsenen Menschen, die – außerhalb der virtuellen Medien – noch nie einen sterbenden oder einen toten Menschen von Angesicht zu Angesicht gesehen haben, wird von Jahrzehnt zu Jahrzehnt größer. In Zeiten mit hoher Säuglings- und Kindersterblichkeit, einer erhöhten Sterblichkeit nach Unfällen oder gar in Kriegszeiten war der Tod weit präsenter und damit integrativer Bestandteil des alltäglichen Lebens.
Aufschlussreich darüber, wie wir den Tod heute wahrnehmen, ist ein Blick auf eine Floskel, die man immer wieder auf Todesanzeigen oder Partezetteln liest: „plötzlich und unerwartet von uns gegangen“ steht da anlässlich des Todes eines 94-Jährigen geschrieben. Wie kann so eine Formulierung zustandekommen? Denn niemand stirbt mit 94 oder mehr Jahren unerwartet. Im Gegenteil muss in einem Alter weit über der statistischen Lebenserwartung immer mit dem Tod gerechnet werden. So kann der Tod vielleicht noch plötzlich eintreten, unerwartet auf keinen Fall. Es wird schließlich nach neun Monaten der Schwangerschaft auch kein Baby unerwartet und plötzlich zur Welt gebracht. Der sogenannte „unerwartete Tod“ hochbetagter Menschen spricht eher für mangelndes Reflexionsvermögen der weniger betagten Hinterbliebenen. Und in Gegenwart von Gedankenlosigkeit muss Würde immer kapitulieren.
Aber auch ein Paradigmenwechsel in der Medizin trägt zu dieser veränderten Wahrnehmung des Todes bei. Längst gibt sich die Medizin nicht mehr mit der kurativen Rolle zufrieden. Krankheiten sollen entweder rechtzeitig entdeckt oder gar schon lange vor ihrer Entstehung verhindert werden. Die moderne Reparatur- und Transplantationsmedizin lässt fast jede Krankheit, jedes Organversagen als heilbar erscheinen. Der Tod des Individuums wird zunehmend als Versagen dieser Medizin gesehen. Für kein anderes Lebensalter wird in der Medizin so viel Geld ausgegeben wie für das letzte Lebensjahrzehnt. Der Tod soll in immer noch höhere Altersgruppen verschoben, der Gedanke an den Tod als biologische Notwendigkeit vollkommen verdrängt werden.
Damit hat auch die Überlebenswahrscheinlichkeit im hohen Alter deutlich zugenommen. Das bedeutet nicht nur, dass es mehr alte Menschen gibt als je zuvor, sondern auch, dass sich immer mehr Menschen das Erleben eines hohen Alters erwarten dürfen. Vor 100 Jahren starben noch zwei Drittel der Deutschen vor ihrem 60. Lebensjahr. Heute macht diese Gruppe weniger als 10 % aus.
Aus diesem Blickwinkel ist es nicht weiter verwunderlich, wenn die Einsicht, sterben zu müssen, und die Bereitschaft, sterben zu wollen, laufend geringer wird. Ganz einfach, weil Sterben im öffentlichen Leben immer seltener vorkommt und statistisch gesehen fast nicht mehr notwendig erscheint.
Eine ältere Hausärztin, seit Jahrzehnten auf Schritt und Tritt mit dem Tod konfrontiert, hat es sich zur Angewohnheit gemacht, ihre Patienten bei passender Gelegenheit immer wieder auf den Tod und dessen Notwendigkeit hinzuweisen.
Immer dann, wenn ein Patient im Zusammenhang mit einer an sich eher harmlosen Diagnose die scherzhafte Frage stellt: „Frau Doktor, muss ich jetzt sterben?“, antwortet sie mit ernster Miene: „Ja, Sie müssen sterben“, und macht an dieser Stelle stets eine längere Pause, um den Gesichtsausdruck der verunsicherten und oft auch verängstigten Fragesteller zu erforschen. Und fährt, wenn sie glaubt, den Patienten lange genug auf die Folter gespannt zu haben, fort: „Aber jetzt müssen Sie noch nicht sterben, und wegen dieser Krankheit werden Sie auch nicht sterben müssen.“ Immer wieder ist sie verwundert, wie tief ihre – nicht weniger scherzhaft als die Frage gemeinte – Antwort Patienten berührt und verunsichert.
Wem gehört der Tod?
Will man die Frage beantworten, warum es so schwer geworden ist, zu sterben, kommt man an der Rolle der Naturwissenschaften nicht vorbei.
Solange die Erde eine Scheibe und das Zentrum des Universums war, schienen die Dinge rund ums Sterben einfacher gelagert gewesen zu sein. Die Kirche gab nicht nur die Grundstruktur des gesellschaftlichen Lebens vor, sie hütete auch das Wissen der Zeit, sie bestimmte, welche Literatur geschrieben und gelesen wurde, sie gab den Gang von Wissenschaft und Forschung vor. Der Himmel, und das war alles jenseits des Endes der Scheibe, konnte als Projektionsfläche für alle offengebliebenen Wünsche und Sehnsüchte nach einem entbehrungsreichen irdischen Leben herangezogen werden. Alternativen zu diesem Glauben gab es nicht. Wir waren Gottes Geschöpfe, er allein bestimmte Zeitpunkt und Art des Todes. Und der Tod gab uns die Möglichkeit, zum Schöpfer heimzukehren und ein weit besseres Leben als auf Erden zu führen. Es war einfacher, gläubig zu sein, weil der vergleichsweise niedrige Stand der Wissenschaft die Verheißungen der Kirche durchaus im Bereich des Möglichen erscheinen ließ.
Es ist nicht weiter verwunderlich, dass die Erkenntnisse von Johannes Kepler oder Galileo Galilei von der offiziellen Kirche als Kriegserklärung aufgefasst wurden. Wo sollte sich Gott aufhalten, wenn die Erde lediglich ein Planet unter Millionen, inmitten eines unendlichen Universums war? Wie sollte man den Gläubigen die immer größer werdende Diskrepanz zwischen kirchlichem und weltlichem Erkennen erklären? Wie sollte man das „per omnia saecula saeculorum“, das „von Ewigkeit zu Ewigkeit“ in Anbetracht von Einsteins Relativitätstheorie weiter verantworten?
Der Raumfahrt verdanken wir das Bild des verletzlichen blauen Planeten mitten in einem unendlichen Weltall. Schon längst kreist die Erde um die Sonne und die Sonne selbst auf ihrer vorgeschriebenen Route innerhalb der Galaxie. Für den kirchlichen Himmel ist es eng geworden. Der Schöpfer ist unsichtbar geworden und hat sich hinter den Grenzen des grenzenlosen Universums versteckt.
Und je mehr ein übergeordneter Gott verschwindet, umso göttlicher wird der Mensch selbst. Er übernimmt des Schöpfers Kompetenzen und lernt im Lauf seiner Entwicklung unter anderem Feuer, Atomkraft und sogar die Fortpflanzung des Menschen zu beherrschen. Was früher einmal ein sterbliches Ebenbild Gottes auf Erden war, ist heute, zumindest in den Augen der modernen Wissenschaft, die lebende Summe von unzähligen Organfunktionen. Und die können ausgetauscht oder maschinell ersetzt werden. Damit hat auch das Sterben in seiner früheren Notwendigkeit und Unabdingbarkeit an Stellenwert verloren.
In Umkehrung der Frage „Wozu vor dem Tod leben, wenn es ein Leben nach dem Tod gibt?“ muss man in Anbetracht der scheinbaren Möglichkeiten der modernen Medizin die Gegenfrage stellen: „Wozu sterben, wenn das Leben nicht mehr mit dem Tod enden muss?“
Jahrhundertelang spielte die Religion die wesentliche Rolle im Zusammenhang mit dem Sterben. Krankenölung, die Spende des Sterbesakraments und die spirituelle und rituelle Begleitung des Sterbeprozesses waren Teil der kirchlichen Kompetenz. Geburts- und Sterberegister wurden einzig und alleine von den Pfarren geführt und verwaltet. Wer sich fügte, durfte sich ein verkürztes Fegefeuer und die Aufnahme in den Himmel erhoffen.
Ähnlich agiert heute die Schulmedizin, die im gesellschaftlichen Wandel weitgehend die Rolle eines Glaubens angenommen hat. Nur wer sich den Segnungen moderner Medizin anvertraut, darf sich ein optimales Leben erwarten. Die Lebenserwartung wird einzig und alleine in Jahren gemessen. Dabei bietet die Medizin aber lediglich körperliche Gesundheit an.
Wer sich ungläubig zeigt, dem wird nicht mehr mit dem Fegefeuer oder der Hölle, sondern mit dem vorzeitigen Tod gedroht. Wer nicht bereit ist, ein Leben lang auf seinen Cholesterinspiegel zu achten, wird einem Herzinfarkt oder Schlaganfall zum Opfer fallen.
„Frau Doktor, könnten Sie bitte kommen, ich möchte mit Ihnen über den Zustand meiner Mutter sprechen.“ Eine etwas unsichere und verzweifelte Frau Mitte fünfzig wendet sich mit diesen Worten an eine am Gang vorbeieilende Ärztin. Immerhin bleibt diese stehen, gibt aber durch ihre Körperhaltung zu verstehen, dass sie nicht viel Zeit für die Fragestellerin erübrigen möchte oder kann.
„Was kann ich für Sie tun? Was ist mit Ihrer Mutter? Ich kenne Ihre Mutter ja nicht besonders gut.“
Zaghaft erwidert die leicht korpulente Frau: „Aber Sie sind doch die Stationsärztin, und Sie wissen ja, meine Mama ist wegen Leberkrebs bei Ihnen in Behandlung.“
Die so angesprochene junge Ärztin wendet sich jetzt schroff an die Bittstellerin: „Ach ja, aber Ihre Mutter ist eigentlich wegen Darmkrebs bei uns. Nur hat der jetzt leider auch die Leber befallen. Aber das ist deswegen noch lange kein Leberkrebs. Und wir behandeln das jetzt ohnehin mit einer neuen Chemotherapie. Glauben Sie mir, wir versuchen wirklich alles. Mehr können wir für Ihre Mutter im Moment auch nicht tun.“ Der Tonfall der Stationsärztin gibt dabei klar zu verstehen, dass jetzt alle Fragen beantwortet sein müssten.
Verunsichert wagt die Tochter der Patientin noch einen Versuch, ihr Anliegen zur Sprache zu bringen: „Frau Doktor, wenn ich mir die Mama so anschaue, sie wird doch von Tag zu Tag weniger, und essen tut sie auch nicht mehr, und ich hab mir gedacht, ob ich die Mama nicht mit nach Hause nehmen soll, wissen Sie, die Mama hat immer gesagt, dass sie einmal zu Hause sterben möchte.“
Noch einmal verändert sich der angestrengte Gesichtsausdruck der Frau Doktor. Streng blickt sie in das Gesicht der Angehörigen: „Aber eines sage ich jetzt ganz klar und deutlich. Wenn Sie Ihre Mutter jetzt mit nach Hause nehmen, wird sie nicht mehr gesund werden können. Das muss Ihnen klar sein. Hilfe für Ihre Mutter gibt es nur bei uns. Aber wenn Sie meinen, ich will Ihrer Entscheidung nicht im Wege stehen.“ Dann schweigt die Ärztin eine Weile, offensichtlich wägt sie den folgenden Satz und seine Folgen noch kurz ab, um ihn dann doch zu sagen: „Sagen Sie einmal, wollen Sie wirklich schuld am Tod Ihrer Mutter sein?“
Die so gemaßregelte Tochter der schwer krebskranken Patientin beginnt zu weinen und schluchzt: „Ja, Frau Doktor, wir danken Ihnen für alles, was Sie für die Mama getan haben, aber ich hab das auch mit meinem Mann so besprochen, wir werden die Mama heute noch mit nach Hause nehmen.“
Die Ärztin ruft in Richtung Schwesternstützpunkt, dass man sich um die Entlassung der Patientin kümmern und einen Heimtransport organisieren solle. Dann dreht sie sich wortlos um und marschiert mit schnellen Schritten den Gang weiter.
Es ist Nachmittag, 16:30.
Am nächsten Tag um 11:15 verstirbt die 76-jährige Chemotherapiepatientin zu Hause in ihrem Bett.
Anfang und Ende
Ins Leben zu treten und aus dem Leben zu scheiden sind zwei – prinzipiell natürliche – Vorgänge, die zwar in entgegengesetzter Richtung ablaufen, aber dennoch viele gemeinsame Eigenheiten aufweisen. Beide sind unserem Willen entzogen, und genauso wenig, wie uns im späteren Leben eine Erinnerung an den Geburtsvorgang begleitet, haben wir eine lebenslange Ahnung oder Vorahnung vom Sterben. Beides scheint sich im Lauf der Evolution als zweckmäßig erwiesen zu haben. Wie sollten auch die traumatische Erfahrung der eigenen Geburt bzw. eine dauernde, belastende Angst vor dem Lebensende bei der Erfüllung der reproduktiven Aufgabe hilfreich sein?
Der zunehmenden Ent-Wicklung des neuen Erdenbürgers steht das Zusammen-Wickeln des sterbenden Menschen gegenüber. Dem ersten Schrei nach dem Verlassen des Geburtskanals könnte in dieser Analogie der letzte Seufzer, der letzte Atemzug entgegengehalten werden, dem ersten Augenblick der letzte Blick der Augen. Beim Durchtrennen der Nabelschnur verliert der neue Mensch endgültig und unwiderruflich die Verbindung zu seiner Mutter, die ihn aus dem vermeintlichen Nichts ins Leben hinaus-, ausgetragen hat. Mit dem eingetretenen Tod ist der Mensch ebenso unwiderruflich die endgültige Verbindung mit dem Tod eingegangen. Metaphorisch gesehen ist er wieder im Nichts angelangt, aus dem er gekommen ist. Es gibt in beiden Fällen kein Zurück.
Schon wenn wir die Dauer der beiden entgegengesetzten Prozesse betrachten, fällt auf, dass zwar Geburt und Sterben beide einen Anfang und ein Ende haben, dass die dazwischen liegende Zeitspanne aber von Fall zu Fall verschieden lange dauern kann. Unkomplizierte Geburten kann man mit unkomplizierten Sterbefällen vergleichen, und beide stellen die jeweils überwiegende Mehrheit dar. Aber es gibt auch Geburtsvorgänge, die durchaus ein Äquivalent zum sogenannten Todeskampf darstellen. Manche Babys werden erst nach stundenlangem Geburtsringen, mit medikamentöser und mechanischer Hilfe (Wehentropf und Saugglocke), andere dagegen schon nach der ersten Presswehe zur Welt gebracht. Dementsprechend benötigt manch alter Mensch Monate und sogar Jahre zum Sterben, ein anderer schläft einfach friedlich ein und wacht nicht mehr auf. Und selbst dem Kaiserschnitt, der in den westlichen Industrieländern statistisch inzwischen mit einem Drittel aller Geburten zu Buche schlägt, kann man in einer solchen Betrachtung den Tod auf der Intensivstation gegenüberstellen.
Das bei Sterbenden typische Abwechseln von Ruhephasen und heftigem Atmen, um dem sterbenden Gehirn noch einmal ausreichend Sauerstoff zur Verfügung zu stellen, erinnert immer wieder an die Austreibungswehen einer gebärenden Frau. Auf die enormen Anstrengungen einer Wehe kehrt wieder Ruhe ein. Vorübergehende Entspannung für Mutter und Kind. Ein Kräftesammeln für die nächsten Zentimeter. Einmal in die Welt, einmal aus der Welt.
Geburt und Tod sind die zwei Gesichter der Medaille Leben. Das hat die Natur so eingerichtet.
Während die ersten Stunden des Lebens mit dem Herstellen erster Beziehungen, der endgültigen In-Funktion-Nahme aller Organe außerhalb des Mutterleibes, der ersten Nahrungsaufnahme und dem geistigen Verarbeiten erster – lebenslang gültiger – Impressionen ausgefüllt sind, laufen diese Prozesse in den letzten Stunden des Sterbenden in verkehrter Reihenfolge ab. Die Reduktion der Körperfunktionen wird von einer zunehmenden psycho-sensorischen Abflachung begleitet. Die Reflexe werden schwächer, zielgerichtete Reaktionen seltener. Essen und Trinken sind keine vorrangigen Bedürfnisse mehr, denn sie dienen ja der Aufrechterhaltung der Lebensfunktionen. Wenn der Prozess des Sterbens aber einmal eingesetzt hat, ist die weitere Zufuhr von Energie nicht nur unnötig, sondern auch kontraproduktiv.
Aber auch die ersten Wochen des Menschen, wenn man den Blickwinkel weiter fassen möchte, sind den letzten nicht unähnlich. Der ständigen Erweiterung des menschlichen Sensoriums steht der unaufhaltsame sinnliche Rückzug des sterbenden Menschen gegenüber. Die geäußerten Worte werden seltener, Sätze immer knapper, das wenige Gesprochene ist oft verwaschen und schwer verständlich, so wie die ersten verbalen Kundgebungen des sich entwickelnden Kindes. Für sich genommen, und aus dem gesamtmenschlichen Zusammenhang herausdestilliert, klingen das erste Lallen und das letzte Aneinanderreihen von Silben verblüffend ähnlich. Das Zuhören wird immer schwieriger. Einen Sterbenden anzusprechen ist der versuchten Kontaktaufnahme mit einem Neugeborenen nicht unähnlich. Mit häufig wiederholten, einsilbigen Worten, konzentriert und eindringlich gesprochen, den eigenen Kopf oft nahe an das Baby oder den Sterbenden herangerückt, gelingt oftmals eine erste oder eben eine letzte Kontaktaufnahme. Ein erstes kognitives Begegnen, ein letztes menschliches Verabschieden.
Auch bei der Art der Nahrungsaufnahme gibt es deutliche Parallelen. Sowohl die erste als auch die letzte Nahrung ist meist flüssig. In der jeweiligen Reihenfolge folgt breiige Nahrung vor festen Nahrungsmitteln. Wenn man Babys breiige Kost schmackhaft machen möchte, führt man am besten einen angehäuften Löffel an die Lippen und unter die Nase, um das Kind neugierig zu machen, Appetit zu erregen und den Schluckreflex auszulösen. Nicht anders geschieht die Fütterung dementer Patienten, die aufgrund ihrer Krankheit auf Essen, Trinken und Schlucken einfach vergessen würden. Wenn es aber gelingt, die Lippen mit Speisebrei zu benetzen, beginnen sonst apathische Patienten plötzlich die Lippen mit der Zunge abzuschlecken und das Eingespeichelte später auch zu schlucken.
Die erste Gehschule ist der letzten nicht unähnlich. Der erste fahrbare Sitz, sei es in Form eines Autos, eines Traktors oder eines Tieres mit Rädern, ist in dieser Analogie durchaus mit dem Rollstuhl am Ende des Lebens vergleichbar. Die letzten Schritte eines Menschen sind ebenso unsicher wie die ersten.
Und noch eine Parallele hat die Natur eingerichtet: Ein gestilltes, angenommenes, in seinen hygienischen Bedürfnissen zufriedengestelltes Baby ist im Grunde seiner Natur zufrieden. Es beschwert sich nicht über seine scheinbaren Defizite im sensomotorischen oder kommunikativen Bereich. Schließlich hat es diese Defizite ja auch nur im Vergleich zu einem Erwachsenen.
Auch in ihren wesentlichen Bedürfnissen ernst genommene Sterbende scheinen ab einem gewissen Punkt ganz gut mit dem Weg von der körperlichen Selbstständigkeit in den Tod zurechtzukommen. Immer wieder sind Ärzte erstaunt, dass selbst schwerstkranke, kaum oder gerade noch ansprechbare Patienten auf die Frage „Geht es für Sie so?“ oder „Kommen Sie zurecht?“ mit einem gezielten Kopfschütteln oder sogar mit einem schwachen „Ja“ antworten.
Auch das Ende der Pubertät und der Beginn der Wechseljahre, die in abgeschwächter Form auch beim Mann stattfinden, dürfen in dieser Betrachtung nicht fehlen. Mit dem Einsetzen der Geschlechtsreife erlebt die körperliche Reifung einen Höhepunkt. Denn aus biologischer Sicht macht nichts das Leben lebendiger als die Fähigkeit, es weiterzugeben. Mit dem Beginn der Wechseljahre geht diese Funktion – zumindest bei den Frauen – wieder verloren. Aber auch Männer durchleben eine hormonelle Umstellung und körperlichen Abbau. Ab diesem Zeitpunkt beginnt der Abstieg vom Gipfel des Berges, wieder hinunter ins Tal. Das nächste große Ziel, das die Natur vorgegeben hat, ist der eigene Tod.
Ein wesentlicher Unterschied besteht jedoch darin, wie diese Prozesse zu Lebensbeginn bzw. zu Lebensende durch die Außenstehenden wahrgenommen werden: Während jeder „Fort-Schritt“ des Babys freudig aufgenommen und durch Aufmunterungen unterstützt wird, überwiegen beim Sterben Trauer und resigniertes Zur-Kenntnis-Nehmen oder Nicht-wahrhaben-Wollen der „Rück-Schritte“.
Der Palliativmediziner Gian Domenico Borasio sagt: „Es gibt erstaunlich viele Parallelen zwischen Geburts- und Sterbevorgang. Es sind beides physiologische Vorgänge, für welche die Natur Vorkehrungen getroffen hat, damit sie möglichst gut ablaufen. Beide laufen in den meisten Fällen am besten ab, wenn sie durch ärztliche Eingriffe möglichst wenig gestört werden.“
Wer den Tod öfter gesehen, das Sterben von alten Menschen öfter begleitet hat, bemerkt, dass die Gesichter von Sterbenden untereinander ebenso Ähnlichkeiten aufweisen, wie es auch die Gesichter von Neugeborenen tun. (Übrigens: Manche erste Ultraschallbilder vom Gesicht des ungeborenen Menschen im Mutterleib erinnern ein wenig an das senile Aussehen, das dasselbe Gesicht Jahrzehnte später im Sterbebett haben wird.) Das spitze Kinn, die eingefallenen Wangen, kaltschweißige Haut, in den allermeisten Fällen Zahnlosigkeit, trübe, nicht mehr reagierende Augen und weitere Merkmale wie ein ganz spezieller Atemgeruch und die typischen Geräusche des schweren Luftschöpfens kennzeichnen den Anblick eines an Altersschwäche oder Auszehrung sterbenden Menschen. Und trotz dieser Ähnlichkeiten erkennt jede Familie, jeder Angehörige, der den Sterbenden auf diesem Weg begleitet, zu jedem Zeitpunkt dieses Prozesses im veränderten Gesicht unzweifelhaft seinen Angehörigen. Wie auch jede Mutter ihr Neugeborenes unter unzähligen anderen immer wiedererkennen wird.