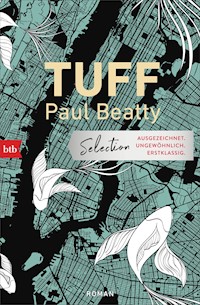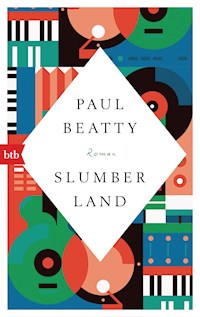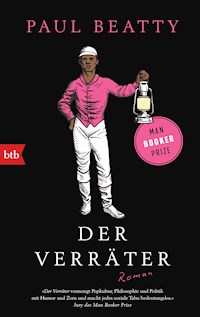
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand Literaturverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine bissige, kühne Satire über eine Gesellschaft, die ihre ethnische Spaltung noch lange nicht hinter sich gelassen hat.
Dickens, ein Vorort von Los Angeles, ist der Schandfleck der amerikanischen Westküste: verarmt, verroht, verloren. Zugleich ist es der ganze Stolz seiner schwarzen Einwohner, eine Bastion gegen die weiße Vorherrschaft. Hier zieht der Erzähler von "Der Verräter" friedlich Wassermelonen und Marihuana. Doch als sein bürgerrechtsbewegter Vater durch Polizeigewalt stirbt und die Gentrifizierung den gesamten Vorort auszuradieren droht, wird er unversehens zum Anführer einer neuen Bewegung: Mit seinem Kompagnon Hominy, alternder Leinwandheld aus "Die kleinen Strolche", führt er Sklaverei und Rassentrennung wieder ein ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 432
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Zum Buch
Dickens, ein Vorort von Los Angeles, ist der Schandfleck der amerikanischen Westküste: verarmt, verroht, verloren. Zugleich ist es der ganze Stolz seiner schwarzen Einwohner, eine Bastion gegen die weiße Vorherrschaft. Hier zieht der Erzähler von »Der Verräter« friedlich Wassermelonen und Marihuana. Doch als sein bürgerrechtsbewegter Vater durch Polizeigewalt stirbt und die Gentrifizierung den gesamten Vorort auszuradieren droht, wird er unversehens zum Anführer einer neuen Bewegung: Mit seinem Kompagnon Hominy, alternder Leinwandheld aus »Die kleinen Strolche«, führt er Sklaverei und Rassentrennung wieder ein …
Zum Autor
PAUL BEATTY, 1962 geboren, zählt zu den bedeutendsten amerikanischen Autoren der Gegenwart. Begonnen hat er als Lyriker, schnell avancierte er zum Star der New Yorker Slam- Poetry-Szene. Seine Romane haben in den USA Kultstatus. Für »Der Verräter« wurde Beatty mit dem National Book Critics Circle Award sowie – als erster Amerikaner – mit dem Man Booker Prize ausgezeichnet. Paul Beatty lebt in New York.
PAUL BEATTY
DER VERRÄTER
Roman
Aus dem Amerikanischen von Henning Ahrens
btb
Die Originalausgabe erschien 2015 unter dem Titel »The Sellout« bei Picador, New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Genehmigte Ausgabe Mai 2021 im btb Verlagin der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH
Copyright © 2015 by Paul Beatty All rights reserved
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2018 Luchterhand Literaturverlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
Covergestaltung: semper smile, München nach einem Entwurf von buxdesign | München unter Verwendung einer Gestaltung von © Rodrigo Corral Studio und einer Illustration von ©Matt Buck
ISBN 978-3-641-22249-9V004www.btb-verlag.de
www.facebook.com/btbverlag
Für Althea Amrik Wasow
Prolog
Aus dem Mund eines Schwarzen klingt das sicher unglaublich, aber ich habe nie geklaut. Habe nie Steuern hinterzogen oder beim Kartenspiel betrogen. Habe mich nie ins Kino gemogelt oder merkantile Gepflogenheiten und die Erwartungen von Mindestlohnempfängern ignoriert, indem ich einer Drugstore-Kassiererin das überschüssige Wechselgeld vorenthalten hätte. Ich bin nie in eine Wohnung eingebrochen. Habe nie einen Schnapsladen ausgeraubt. Habe mich in vollbesetzten Bussen oder U-Bahnen nie auf einen Platz für Senioren gepflanzt, meinen gigantischen Penis rausgeholt und mir lüstern, aber auch leicht zerknirscht einen runtergeholt. Dennoch sitze ich hier, in den Katakomben des Obersten Gerichtshofes der Vereinigten Staaten von Amerika, auf einem gut gepolsterten Stuhl, der, ähnlich wie das Land insgesamt, nicht ganz so gemütlich ist, wie er aussieht, die Hände in Handschellen auf dem Rücken, mein Recht zu schweigen längst abgehakt und vergessen, während mein Auto ebenso illegal wie ironisch in der Constitution Avenue steht.
Einbestellt durch ein amtliches Schreiben mit dem Stempel WICHTIG! in fetten knallroten Lettern auf dem Umschlag, tue ich seit meiner Ankunft in dieser Stadt nichts anderes, als mich zu krümmen und zu winden.
»Hochverehrter Herr«, begann das Schreiben.
»Glückwunsch, denn Sie könnten schon jetzt ein Gewinner sein! Ihre Sache wurde aus Bergen von Berufungsfällen zur Verhandlung vor dem Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten ausgewählt. Eine große Ehre! Wir raten Ihnen dringend, mindestens zwei Stunden vor der Anhörung da zu sein, angesetzt für 10:00 Uhr am 19. März im Jahre des Herrn …« Zum Schluss wurde erläutert, wie man von Flughafen, Bahnhof, Interstate 95 zum Obersten Gerichtshof gelangt, dazu gab es Coupons zum Ausschneiden für Sehenswürdigkeiten, Restaurants, Pensionen etc. pp. Eine Unterschrift gab es nicht. Es hieß nur:
Mit freundlichem Gruß,
das Volk der Vereinigten Staaten von Amerika
Washington, D. C. soll sich mit seinen breiten Boulevards, chaotischen Kreisverkehren, Marmorstatuen, Kuppeln und dorischen Säulen anfühlen wie das alte Rom (ob die Straßen des alten Rom auch voller obdachloser Schwarzer, Reisebusse, Sprengstoffspürhunde und Kirschblüten waren, sei dahingestellt). Gestern verließ ich das Hotel, ein sandalenbewehrter Äthiopier aus dem tiefsten und finstersten Dschungel von Los Angeles, und schloss mich dem Hadsch der patriotischen Hinterwäldler in Bluejeans an, die gemessenen Schrittes an den historischen Wahrzeichen vorbeipilgerten. Ich betrachtete voller Ehrfurcht das Lincoln-Denkmal. Was würde der Ehrliche Abe sagen, wenn er wieder zum Leben erwachen und sein hageres, sieben Meter messendes Körpergerüst vom Thron hieven könnte? Was würde er tun? Würde er einen Breakdance hinlegen? Pennys gegen die Bordsteinkante werfen? Nach einem Blick in die Zeitung feststellen, dass die von ihm gerettete Union heute eine funktionsuntüchtige Plutokratie ist, dass die von ihm befreiten Menschen Sklaven von Rhythmus, Rap und faulen Krediten sind, dass er mit seinen Talenten jetzt nicht mehr ins Weiße Haus, sondern auf den Basketballplatz gehören würde? Dort könnte er sich bei einem Konter den Ball schnappen, zu einem vollbärtigen Dreier aufsteigen, in dieser Pose verharren und Schwachsinn labern, während der Ball durchs Netz rauscht. Der Große Sklavenbefreier ist nicht aufzuhalten, nein, man kann ihn nur ausbremsen.
Wie nicht anders zu erwarten, kann man im Pentagon wenig mehr tun als Kriege anzetteln. Touristen dürfen nicht mal Fotos mit dem Gebäude im Hintergrund schießen, und deshalb war ich sofort bereit, meinem Vaterland zu dienen, als ich von einer Familie in Marineuniform, Veteranen in vierter Generation, gebeten wurde, mit Abstand zu folgen und sie klammheimlich zu fotografieren, während sie strammstanden, salutierten und rätselhafterweise die Finger zum Peace-Zeichen spreizten. In der National Mall fand eine Ein-Mann-Demo statt. Ein im Gras liegender weißer Junge manipulierte die Tiefenwirkung so, dass das ferne Washington Monument aussah, als würde ein riesiger, spitzer, hellhäutiger Steifer aus seiner offenen Hose ragen. Er scherzte mit Passanten, lächelte in ihre Handys und streichelte dabei seine trickreiche Dauererektion.
Im Zoo hörte ich, wie eine Frau den Zweihundert-Kilo-Gorilla, der im Primatengehege auf einem Eichenbalken saß und seine Brut beäugte, als »präsidial« bewunderte. Als ihr gegen die Informationstafel tippender Freund meinte, der Silberrücken heiße zufälligerweise Baraka, lachte die Frau schallend, bis sie mich erblickte, noch ein Zweihundert-Kilo-Gorilla, der sich gerade ein Wassereis oder eine Chiquita-Banane in den Mund stopfte. Daraufhin war sie tief zerknirscht und weinte bittere Tränen, beklagte ihre ungehörige Offenheit und meine Geburt. »Einige meiner besten Freunde sind Affen«, rutschte ihr heraus. Das wiederum brachte mich zum Lachen. Ich ahnte, wo sie zu Hause war. Diese Stadt ist ein einziger Freud’scher Versprecher, ein Betonphallus, ein Symbol für Amerikas Ruhm und Schande. Sklaverei? »Manifest Destiny«? Laverne & Shirley? Die Tatenlosigkeit, während sich Nazi-Deutschland anschickte, die Juden Europas komplett zu vernichten? Hey, einige meiner besten Freunde sind das Museum of African Art, das Holocaust Museum, das Museum of the American Indian, das National Museum of Women in the Arts. Außerdem sollten Sie wissen, dass die Tochter meiner Schwester einen Orang-Utan geheiratet hat.
Man muss sich nur Georgetown und Chinatown anschauen. Gemächlich am Weißen Haus, am Phoenix House, am Blair House und am hiesigen Crack-Haus vorbeischlendern, um zu wissen, was Sache ist. Man ist entweder Bürger oder Sklave, ob im alten Rom oder im heutigen Amerika. Löwe oder Jude. Schuldig oder unschuldig. Hat es sich entweder gemütlich eingerichtet oder nicht. Und hier, im Obersten Gericht der Vereinigten Staaten, in Handschellen auf dem rutschigen Lederpolster des Stuhls sitzend, kann ich nur verhindern, dass mein Arsch unrühmlich auf den Fußboden knallt, indem ich den Kopf weit in den Nacken lege, eine Haltung, die eventuell Gleichgültigkeit gegenüber der Haft signalisiert, auf jeden Fall aber eine Missachtung des Gerichts.
Die Justizwachtmeister marschieren wie ein wagenloses Ackergaul-Vierergespann in den Saal, zusammengeschirrt durch ihre Liebe zu Gott und Vaterland, sie haben militärisch kurze Haare und Schlüsselbünde, die wie Schlittenglöckchen klimpern. Das Zugpferd, eine stolze Kaltblutstute von Frau, vor der Brust eine regenbogenbunte Schärpe aus Vorladungen, tippt von hinten gegen meinen Stuhl. Sie will, dass ich gerade sitze, doch als die legendäre Verkörperung zivilen Ungehorsams, die ich bin, lehne ich mich noch weiter zurück, um dann wie eine linkische Demonstration passiven Widerstands auf den Fußboden zu knallen. Der Schlüssel für die Handschellen baumelt über meinem Gesicht, als sie mich mit einem dicken, haarlosen Arm in die Vertikale hievt, den Stuhl so dicht an den Tisch schiebt, dass ich mich mitsamt Anzug und Krawatte in der glänzenden, zitronenfrischen Mahagoniplatte gespiegelt sehe. Ich habe noch nie einen Anzug getragen, und der Händler, der mir diesen verkaufte, meinte: »Gefällt Ihnen garantiert, wie Sie darin aussehen.« Mein Spiegelbild sieht jedoch aus wie das aller anderen schwarzen Männer mit Geschäftsanzug und Cornrows oder Dreadlocks oder Glatze oder Afrolook, deren Namen und Gesicht keiner kennt – wie eine Verbrechervisage.
»Wenn Sie elegant sind, fühlen Sie sich wohl«, versprach der Händler obendrein. Garantierte auch dies. Sobald ich wieder zu Hause bin, verlange ich die $ 129 zurück, denn ich finde mich nicht elegant. Fühle mich auch nicht wohl. Ich fühle mich wie mein Anzug – billig, kratzig, mit aufgeribbelten Nähten.
Polizeibeamte erwarten meist, dass man sich bedankt. Ganz egal, ob sie dir den Weg zum Postamt erklären, dir hinten im Streifenwagen den Arsch versohlen oder, wie in meinem Fall, deine Handschellen lösen, dir Hasch und Drogenutensilien zurückgeben und dich mit dem traditionellen Federkiel des Obersten Gerichts ausstatten. Diese Beamtin schaut jedoch mitleidig drein, und das schon seit dem Vormittag, als sie mich mit ihrer Truppe auf der protzigen vierundvierzigsten Stufe des Obersten Gerichts in Empfang nahm. Die Beamten standen Schulter an Schulter unter dem pompösen Tympanon mit der Inschrift GLEICHESRECHTFÜRALLE, blinzelten in die Morgensonne, Kirschblüten wie Schuppen auf den Windjacken, und blockierten den Eingang zum Gebäude. Wir wussten alle, dies war eine Scharade, eine alberne Demonstration staatlicher Macht in letzter Sekunde. Nur der Cockerspaniel war nicht eingeweiht. Die Gurtleine hinter sich herziehend, flitzte er auf mich zu, schnüffelte erregt an meinen Schuhen und Hosenbeinen, wühlte mit feuchter, schnodderverkrusteter Schnauze in meinem Schritt und setzte sich dann neben mich, peitschte den Boden stolz mit dem Schwanz. Das Vergehen, das man mir vorwirft, ist so ungeheuerlich, dass eine Anklage wegen des Mitführens von Marihuana in einem staatlichen Gebäude so ähnlich wäre, als würde man Hitler des Herumlungerns in fremden Ländern bezichtigen oder eine multinationale Ölfirma wie British Petroleum nach fünfzig Jahren Umweltverschmutzung samt Ölpest, explodierten Raffinerien, Emissionen und einer schamlos verlogenen Werbekampagne wegen eines nicht benutzten Mülleimers verklagen. Also klopfe ich die Pfeife mit zwei lauten Schlägen auf dem Mahagonitisch aus. Fege und puste das Schleimharz auf den Fußboden, stopfe die Pfeife mit selbst angebautem Kraut, und die Beamtin zückt so zuvorkommend ihr BIC, um mir Feuer zu geben, als wäre dies meine letzte Zigarette vor der Hinrichtung und sie die Kommandantin des Erschießungskommandos. Ich lehne die Augenbinde ab und nehme den glorreichsten Zug in der ganzen Geschichte des Kiffens. Alle, die sich auf den Fünften Zusatzartikel berufen haben, alle, die in rassistische Stereotype einsortiert wurden, nicht abtreiben durften oder die amerikanische Flagge verbrannt haben, sollten jetzt schleunigst auf eine Wiederaufnahme ihrer Verfahren drängen, denn ich bin high im höchsten Gericht des Landes. Die Beamten starren mich verblüfft an. Ich bin Scopes’ Affe, das Fleisch gewordene fehlende Bindeglied in der Evolution der afroamerikanischen Jurisprudenz. Ich höre den Cockerspaniel im Flur winseln und an der Tür kratzen, als ich eine atompilzgroße Rauchwolke in die Gesichter der Berühmtheiten blase, die die Deckenfriese säumen. Hammurapi, Moses, Salomon – alle aus geädertem Marmor, jeder eine Beschwörung von Fairplay und Demokratie –, Mohammed, Napoleon, Karl der Große und ein pausbäckiger alter Grieche mit Toga werfen mir von oben steinerne, strafende Blicke zu. Ob sie mit ähnlicher Verachtung auf die Scottsboro Boys und Al Gore Jr. hinabgeschaut haben?
Nur Konfuzius wirkt gleichgültig. Die prächtige chinesische Seidenrobe mit ausgestellten Ärmeln, die Kung-Fu-Schuhe, die Barttracht eines Shaolin-Mönches. Ich recke die Pfeife über den Kopf, biete sie ihm an; die längste Reise beginnt mit einem einzigen Zug …
»Der Quatsch mit der ›längsten Reise‹ stammt von Lao-tse«, sagt er.
»Ich finde, ihr klingt alle ähnlich dämlich, ihr Dichter-Philosophen«, sage ich.
Dies ist der neueste Trip in der langen Reihe wichtiger Fälle, die mit der Rassenfrage zusammenhängen. Verfassungsrechtler und Kulturpaläontologen werden vermutlich über meine Stellung auf der historischen Zeitleiste diskutieren. Sie werden meine Pfeife mit der Radiokarbonmethode datieren, um zu ergründen, ob ich ein direkter Nachfahre von Dred Scott bin, diesem rätselhaften Farbigen, der, als Sklave in einem freien Staat lebend, Manns genug für Frau und Kinder war, Manns genug, gegen seinen Herrn die Freiheit einzuklagen, nicht aber Manns genug gemäß der Verfassung, denn nach Auffassung des Gerichts war er nur ein Stück Besitz: ein schwarzer Zweibeiner »ohne Rechte, die der weiße Mann zu achten habe«. Sie werden über Rechtsgutachten und Prä-Bürgerkriegs-Pergamenten brüten, um herauszufinden, ob das Urteil in meinem Prozess jenes im Verfahren Plessy gegen Ferguson bestätigt oder widerlegt. Sie werden die Plantagen abgrasen, die Sozialsiedlungen und politisch korrekten Vorstadt-Parzellen mit ihren Wohnpalästen im Tudor-Stil, sie werden Hinterhöfe umgraben und Fossilien von Würfeln und Dominosteinen auf Spuren von Gespenstern aus der Ära der Diskriminierung untersuchen, den Staub von versteinerten Gesetzbüchern voller Rechte und Erlasse bürsten und mich zu einem »überraschenden Vorläufer der Hiphop-Generation« erklären, ähnlich wie Luther »Luke Skywalker« Campbell, den Rapper mit Zahnlücke, der für sich in Anspruch nahm, den weißen Mann genauso veralbern und verarschen zu dürfen, wie es dieser seit jeher mit uns tut. Hätte ich auf der anderen Seite der Richterbank gesessen, dann hätte ich dem Vorsitzenden Richter Rehnquist allerdings den Füllfederhalter entrissen und mein einsames abweichendes Urteil notiert, endgültig klargestellt, dass »ein durchgeknallter Rapper, dessen Erkennungssong Me So Horny heißt, keine Rechte besitzt, die der weiße Mann oder jeder andere Break-Boy, der sich seiner Wildleder-Pumas als würdig erweist, zu achten habe.«
Der Rauch beißt in meiner Kehle. »Gleiches Recht für alle!«, rufe ich in den Saal, Beweis für die Macht des Marihuanas und für meine schwache Konstitution. In Vierteln wie jenem, in dem ich aufgewachsen bin, Orten mit wenig Praxis, aber reicher Rhetorik, haben die Homies ein Sprichwort: Besser von zwölf Leuten verurteilt als von sechs zu Grabe getragen. Ein Leitsatz, ein oft benutzter Rap-Vers, ein letzter Strohhalm und ein Algorithmus für das harte Pflaster, der den Glauben an die Justiz zu belegen scheint, aber eigentlich bedeutet: Schieß als Erster, setz auf deinen Pflichtanwalt und sei froh, wenn du mit heiler Haut davonkommst. Ich bin nicht besonders abgebrüht, aber soweit ich weiß, gibt es kein Berufungsgericht für weise Sprüche. Mir ist noch kein Eckladen-Schluckspecht untergekommen, der am Billigbier genippt und gesagt hätte: »Besser von neun Personen verurteilt als von einer.« Menschen haben darum gekämpft und sind dafür gestorben, Anteil an dem »gleichen Recht für alle« zu haben, das die Fassade dieses Gebäudes so dummdreist preist, aber die meisten Angeklagten, ob schuldig oder unschuldig, schaffen es nicht bis in das Oberste Gericht, sondern müssen sich damit begnügen, dass ihre Mom tränenreich den lieben Gott anfleht, oder das Haus ihrer Grandma mit einer zweiten Hypothek belasten. Würde ich an solche Slogans glauben, dann müsste ich sagen, dass ich einen mehr als fairen Anteil am Recht erhalten habe, aber das ist nicht der Fall. Wenn Leute den Drang haben, ein Gebäude mit Phrasen wie »Arbeit macht frei« oder »Größte Kleinstadt der Welt« oder »Schönster Ort auf Erden« zu verzieren, dann zeugt das von Unsicherheit, ist eine hohle Ausrede dafür, dass sie dir Raum und Zeit rauben wollen, und beides hat man nur in Maßen. Schon mal in Reno, Nevada, gewesen? Das ist die Beschissenste Kleinstadt auf der ganzen Welt, und wäre Disneyland tatsächlich der Schönste Ort auf Erden, dann würde man das entweder geheimhalten oder der Eintritt wäre frei und würde sich nicht auf das jährliche Pro-Kopf-Einkommen einer kleinen Sub-Sahara-Nation wie Detroit belaufen.
Ich habe das nicht immer so gesehen. In jüngeren Jahren glaubte ich, alle Probleme des schwarzen Amerika wären gelöst, wenn wir ein Motto hätten. Ein knackiges Liberté, egalité, fraternité, über knarrende, schmiedeeiserne Pforten montiert, auf Küchenwandbehänge und Zeremonialflaggen gestickt. Wie die besten Frisuren und die beste Folklore der Afroamerikaner müsste es sowohl griffig als auch tiefgründig sein. Würdevoll, aber egalitär. Die Visitenkarte einer ganzen Rasse, auf den ersten Blick nicht mit dieser in Verbindung zu bringen, von Eingeweihten aber als tiefschwarz verstanden. Keine Ahnung, wie man als Junge auf so etwas kommt, aber wenn all deine Freunde ihre Eltern mit Vornamen anreden, muss etwas faul sein. Wäre es in dieser Zeit ständiger Krisen und Katastrophen nicht nett, wenn bankrotte schwarze Familien, vor dem Kaminsims versammelt, Trost aus den Worten schöpfen könnten, die einen Set handgetöpferter Gedenkteller oder eine limitierte Auflage von Goldmünzen schmücken, mit einer hoffnungslos überzogenen Kreditkarte bei einem nächtlichen Infomercial gekauft?
Andere Ethnien haben ein Motto. »Unbesiegt und unbesiegbar« steht auf der Visitenkarte der Chickasaw, obwohl das natürlich weder zu ihren Kasinospieltischen noch zu der Tatsache passt, dass man im Bürgerkrieg auf Seiten der Konföderierten kämpfte. Allahu Akbar. Shikata ga nai. Never Again. Harvard-Jahrgang 96. To Protect and to Serve. Das sind nicht nur Grüße oder lahme Sprüche. Das sind revitalisierende Codes. Das ist linguistisches Tai-Chi, das die Lebensenergie erneuert und uns mit Menschen verbindet, die gleich denken, die gleiche Hautfarbe haben, die gleichen Schuhe tragen. Wie heißt es so schön in Italien? Stessa facia, stessa razza. Das gleiche Gesicht, die gleiche Rasse. Jede Rasse hat ihr Motto. Sie glauben mir nicht? Kennen Sie den dunkelhaarigen Typen aus der Personalabteilung? Der sich so weiß verhält, so weiß redet, aber nicht wirklich weiß aussieht? Sprechen Sie ihn mal an. Fragen Sie ihn, warum mexikanische Torhüter so brutal spielen, oder ob man das Essen des Taco-Wagens draußen tatsächlich bedenkenlos futtern kann. Na los. Fragen Sie ihn. Haken Sie nach. Streicheln Sie seinen flachen Indio-Hinterkopf, und dann schauen wir mal, ob er nicht mit dem Ruf Por La Raza – todo! Fuera la Raza – nada! herumfährt. (Für die Rasse – alles! Wider die Rasse – nichts!)
Mit zehn Jahren kuschelte ich abends unter der Steppdecke mit Sonnenscheinbärchi, meinem schärfsten Kritiker, dem Literaten unter den Glücksbärchis, der sich durch ein rätselhaft schaumiges Sprachgefühl und einen Dogmatismus à la Harold Bloom auszeichnete. In der stickigen Dunkelheit der kunstseidenen Fledermaushöhle bemühte er sich mit seinen steifen gelben Armen darum, die Taschenlampe zu halten, während wir gemeinsam versuchten, die schwarze Rasse mit maximal acht Wörtern zu retten. Ich überlegte mir ein Motto, mein selbst beigebrachtes Latein dabei einer sinnvollen Verwendung zuführend, und hielt es ihm dann zwecks Zustimmung vor die herzförmige Plastiknase. Mein erster Anlauf, Schwarzes Amerika: Veni, vidi, vici – Fried Chicken! Sorgte nur dafür, dass Sonnenscheinbärchi die Ohren umklappte und enttäuscht die Knopfaugen schloss. Semper Fi, Semper Funky ließ ihm die Polyester-Nackenhaare zu Berge stehen, und als er in seiner Wut auf die Matratze trommelte und sich dann auf die gelben Stummelbeine stellte, bärige Fänge und Krallen bleckte, zerbrach ich mir den Kopf darüber, welchen Rat das Handbuch der Kuschelbären-Scouts für den Fall gab, dass man sich einem wütenden Plüschtier gegenübersah, trunken von seiner editorischen Macht und aus dem Sideboard stibitztem Wein. »Wenn man einem tobsüchtigen Bären begegnet – Ruhe bewahren. Mit sanfter Stimme reden, nicht vom Fleck rühren und klare, schlichte, erhebende lateinische Sätze schreiben.«
Unum corpus, una mens, una cor, unum amor.
Ein Körper, ein Geist, ein Herz, eine Liebe.
Gar nicht übel. Das hatte einen netten Autokennzeichen-Klang. Ich sah es in kursiver Schrift vor mir, auf den Rand eines Rassenkriegsordens gestanzt. Sonnenscheinbärchi fand es zwar nicht ganz schlecht, aber vor dem Einschlafen sah ich seiner gerümpften Nase an, dass er den Slogan zu verallgemeinernd fand, und beklagten sich die Schwarzen nicht darüber, immer in einen Topf geworfen zu werden? Ich hütete mich, seinen Traum mit der Antwort zu zerstören, alle Schwarzen dächten gleich. Sie würden es nie zugeben, aber jeder Schwarze glaubt, er wäre besser als jeder andere Schwarze. Da ich weder von der NAACP noch von der Urban League eine Antwort bekam, existiert das Credo der Schwarzen noch immer nur in meinem Kopf und wartet ungeduldig auf eine Bewegung, eine Nation und, da Branding heute alles ist, wohl auch auf ein Logo.
Vielleicht brauchen wir kein Motto. Wie oft habe ich jemanden sagen hören: »Nigger, du kennst mich, mein Motto lautet …« Wäre ich clever, dann würde ich mein Latein zu Geld machen. Zehn Dollar pro Wort. Fünfzehn, wenn die Leute nicht aus meinem Viertel stammen oder von mir verlangen, »Hasse nicht den Spieler, hasse das Spiel« zu übersetzen. Wenn es stimmt, dass jeder Körper ein Tempel ist, dann könnte ich damit gutes Geld verdienen. Am Boulevard einen kleinen Laden eröffnen, vor dem eine lange Schlange tätowierter Kunden steht, deren Körper sich in konfessionslose Orte der Anbetung verwandelt haben: Auf dem Bauch kämpfen Anch, Sankofa und Kreuz mit aztekischen Sonnengöttern und Davidstern-Galaxien um Platz. Chinesische Schriftzeichen ziehen sich über das Rückgrat und die rasierten Unterschenkel. Sinologische Botschaften an geliebte Verstorbene, die angeblich lauten: »Ruhe in Frieden, Grandma Beverly!«, obwohl sie in Wahrheit besagen: »Kein Abholschein! Kein bilaterales Handelsabkommen!« Mann, ich wäre eine Goldgrube. Für den Preis einer Schachtel Zigaretten würden die Kunden mir die ganze Nacht die Bude einrennen. Ich könnte hinter einer dicken Plexiglasscheibe sitzen, mit einer Metallschublade, wie man sie von Tankstellen kennt. Ich würde sie aufschieben, und meine Kunden würden ihre Slogans so verstohlen hineintun wie Knackis einen Kassiber weitergeben. Je härter der Mann, desto sauberer die Handschrift. Je weicher die Frau, desto kämpferischer die Phrase. »Du kennst mich«, würden sie sagen, »mein Motto lautet …«, und sie würden das Bargeld und die Shakespeare-Zitate oder solche aus Scarface hineintun, Worte aus der Bibel, Schulhof-Aphorismen und Gangster-Gemeinplätze, mit allen erdenklichen Flüssigkeiten geschrieben, von Blut bis Eyeliner. Und ich würde den Job ernst nehmen, egal, ob die Worte auf einer zerknitterten Bar-Serviette stehen, auf einem Pappteller mit Spuren von Barbecuesauce und Kartoffelsalat oder auf einer Seite, behutsam aus einem geheimen Tagebuch gerissen, das seit einem Krawall in der Jugendstrafanstalt geführt wurde, dies mit der Drohung, ich wäre erledigt, wenn ich je jemandem davon erzähle, Ya estuvo (was auch immer das heißt). Denn es sind Typen, für die die Phrase »Tja, wenn du mir eine Pistole auf die Brust setzt …« nicht nur rhetorisch ist, und sollte einem mal eine kalte Pistolenmündung auf das Yin-und-Yang-Tattoo über dem Herzen gedrückt worden sein, und hätte man das überlebt, dann müsste man sicher nicht erst das I Ging lesen, um die kosmische Ausgewogenheit des Universums und die Macht des Arschgeweihs würdigen zu können. Denn wie sollte das Motto in diesem Fall anders lauten als »Was man sät, das wird man ernten«, frei übersetzt: Quod circumvehitur, rehevitur.
Wenn Flaute herrscht, tanzen sie an, um mir die Früchte meiner Arbeit zu präsentieren. Altenglische Lettern, im Schein der Straßenlaternen glitzernd, auf verschwitzte, in Tank- und Tubetops steckende Muskulatur tätowiert. »Geld stinkt nicht« … Pecunia non olet. Auf Drosselvenen glänzende Dativ- und Akkusativkonstruktionen, und wenn die Sprache der Liebe und der Wissenschaft über die Fettwülste eines Homegirls tanzt, dann ist das schon speziell. »Ganz auf Schwanz« … Austerus verpa. Dem Sein als Weißer, dem Lesen als Weißer kämen die meisten von ihnen niemals näher als durch die Deklination, die sich zitternd wie ein Lochstreifen über ihre Stirnen zöge. »Knast oder Knarre« … Magnum vel vinculum. Das ist nicht-essenzieller Essenzialismus. »Mitgehangen, mitgefangen« … Comprehensus consuspensus. Die Befriedigung liegt darin, das eigene Motto im Spiegel zu betrachten und zu denken: »Jeder Nigger, der nicht paranoid ist, muss verrückt sein« … Ullus niger vir quisnam est non insanus est rabidus, ein Satz wie von Julius Cäsar. »Wahre Größe gibt sich keine Blöße« … Vera maiestas numquam implicatur. Und sollte ein immer pluralistischeres Amerika jemals ein neues Motto in Auftrag geben wollen, dann hätte ich schon eines parat, denn ich kenne ein besseres als E pluribus unum.
Tu dormis, tu perdis … »Du pennst, du verlierst.«
Irgendjemand nimmt mir die Pfeife aus der Hand. »Na, komm, Mann. Der Stoff ist alle. An die Arbeit, Homie.« Hampton Fiske, mein Anwalt und alter Freund, wedelt gelassen letzten Haschrauch weg, zückt eine Sprühdose und hüllt mich in eine antifungale Raumduftwolke. Ich kann nichts sagen, denn ich bin zu high, also begrüßen wir uns, indem wir das Kinn heben, tauschen ein Was-geht-ab-Nicken und ein wissendes Lächeln, denn wir kennen den Duft. Tropische Brise – mit dem gleichen Scheiß haben wir den verräterischen Mief vor unseren Eltern verborgen, denn er riecht wie Angel Dust. Wenn die Mutter heimkehrte, die Espadrilles von den Füßen schüttelte und in unserem Zimmer einen intensiven Duft nach Apfel-Zimt oder Erdbeer-Sahne witterte, wusste sie, dass wir geraucht hatten, aber wenn das Zimmer nach Phencyclidin roch, schob man »Onkel Rick und den anderen« die Schuld in die Schuhe. Manchmal fehlten der Mutter auch die Worte, dann war sie zu müde, um die Möglichkeit in Erwägung zu ziehen, dass ihr einziges Kind süchtig nach Phencyclidin war, und hoffte, das Problem würde sich von selbst lösen.
Eigentlich gehört es nicht zu Hamps Kernkompetenzen, Plädoyers vor dem Obersten Gerichtshof zu halten. Er ist ein Strafverteidiger alter Schule. Wenn man seine Kanzlei anruft, geht er nie ran. Nicht, weil er zu beschäftigt wäre oder keine Anwaltsassistentin hätte oder weil gleichzeitig ein anderer Schwachkopf anruft, der Hamps Werbung auf der Bank einer Bushaltestelle erblickt oder die Nummer 800 (1-800-FREIHEIT) entdeckt hat, die von rasch wieder auf freien Fuß kommenden Typen zu Werbezwecken in die Metallspiegel der Gefängniszellen oder in die Plexiglasscheiben von Polizeiwagen geritzt wurde. Nein, stattdessen hört er gern die Ansage seines Anrufbeantworters, eine zehnminütige Rezitation seiner juristischen Siege und der von ihm erreichten Prozesseinstellungen.
»Dies ist die Fiske-Gruppe – Wer auch immer die Anklage erhebt, wir entkräften die Anklage. Nicht schuldig – Mord. Nicht schuldig – Fahren unter Alkoholeinfluss. Nicht schuldig – Widerstand gegen die Staatsgewalt. Nicht schuldig – sexueller Missbrauch. Nicht schuldig – Kindesmissbrauch. Nicht schuldig – Missbrauch von Senioren. Abgewiesen – Diebstahl. Abgewiesen – Fälschung. Abgewiesen – häusliche Gewalt (über tausend Fälle). Abgewiesen – sexueller Verkehr mit Minderjährigen. Abgewiesen – Kind zum Drogenkonsum verleitet. Abgewiesen – Kidnapping …«
Hamp weiß, dass nur vollkommen verzweifelte Angeklagte die Geduld aufbringen, sich diese Litanei anzuhören, in der fast jede im Strafgesetzbuch von Los Angeles County aufgelistete Straftat vorkommt, und das zuerst auf Englisch, danach auf Spanisch und schließlich auf Tagalog. Und genau diese Leute will er vertreten. Er nennt uns die Elenden der Erde. Leute, die einerseits zu arm sind, um sich Kabelfernsehen leisten zu können, und andererseits zu blöd, um zu wissen, dass sie gar nichts verpassen. »Hätte ich Jean Valjean vertreten«, erzählt er oft und gern, »dann wäre Die Elenden heute nur sechs Seiten lang. Abgewiesen – Diebstahl von Brot.«
Meine Vergehen fehlen in der Ansage. Bei der Vernehmung im Bezirksgericht verlas der Richter, bevor ich mich erklären musste, eine endlose Liste teuflischer Anklagepunkte. Unter dem Strich umfassten sie so gut wie alles, von der Entweihung des Homelands über Verschwörung bis zum Umstoßen eines Karrens voller Äpfel, dies just in dem Moment, als alles wie am Schnürchen lief. Ich stand verblüfft vor dem Richter und fragte mich, ob es zwischen »schuldig« und »unschuldig« noch etwas gab. Warum nur diese zwei Alternativen?, dachte ich. Warum nicht »beides« oder »sowohl als auch«?
Nach langem Schweigen wandte ich mich an die Richterbank und sagte: »Euer Ehren, ich plädiere auf menschlich.« Das führte zu einem verständnisvollen Kichern des Richters und zu einer Strafe wegen Missachtung des Gerichts, aber Hamp erreichte umgehend eine Anrechnung auf meine bisherige Haftzeit, erhob dann Einspruch und verlangte in Anbetracht der gravierenden Vorwürfe einen neuen Gerichtsort, schlug mit Unschuldsmiene Nürnberg oder Salem, Massachusetts, vor. Und obwohl er sich mir gegenüber nie dazu äußerte, nehme ich an, dass ihm plötzlich die Komplexität dessen dämmerte, was er zunächst für einen Standardfall gehalten hatte, eine schwarze Großstadt-Groteske, denn gleich am nächsten Tag stellte er einen Antrag auf Verhandlung vor dem Obersten Gerichtshof.
Aber das ist passé. Denn jetzt bin ich hier, in Washington, D. C., baumele am Ende der Kette juristischer Instanzen, bin total dicht, zugedröhnt mit Erinnerungen und Marihuana. Mein Mund ist wie ausgedörrt, und ich habe das Gefühl, in einem Bus der Linie 7 aufgewacht zu sein, sturzbesoffen nach einem sinnlosen, nächtlichen Saufgelage und der Jagd auf junge Mexikanerinnen auf dem Santa Monica Pier, um dann bei einem Blick aus dem Busfenster zu der marihuanatrüben Erkenntnis zu gelangen, dass ich meine Haltestelle verpasst habe und nicht weiß, wo ich bin oder wieso mich alle anglotzen. Etwa die Frau, die sich über das Holzgeländer vor den Publikumsplätzen beugt und ihre schmalen, manikürten Mittelfinger mit den künstlichen Nägeln in meine Richtung ausstreckt, ihr Gesicht ein verzerrtes, verwickeltes Gewölle der Wut. Schwarze Frauen haben schöne Hände, und die Hände dieser Frau werden mit jedem Kakaobutter-»Fick dich«-Luftstoß eleganter. Es sind die Hände einer Poetin, einer dieser Lehrerinnen-Poetinnen mit Naturhaar und Messingarmreifen, die in ihren elegischen Versen alles mit Jazz vergleichen. Gebären ist wie Jazz. Muhammad Ali ist wie Jazz. Philadelphia ist wie Jazz. Jazz ist wie Jazz. Alles ist wie Jazz, nur nicht ich. In ihren Augen gleiche ich einem der weißen Musiker, die sich an schwarzer Musik vergreifen. Ich bin Pat Boone mit schwarzem Gesicht, der eine verwässerte Version von Fats Dominos Ain’t that a Shame trällert. Ich bin jede Note britischen Non-Punk-Rock’n’Rolls, die gezupft und geklimpert wurde, seit die Beatles auf den geistesreverberierenden Akkord kamen, der A Hard Day’s Night eröffnet. Aber was ist mit Bobby-What You Won’t Do for Love-Caldwell, Gerry Mulligan, Third Bass oder Janis Joplin?, würde ich ihr gern zurufen. Was ist mit Eric Clapton? Halt, das nehme ich zurück. Scheiß auf Eric Clapton. Sie hüpft über das Geländer, stattlicher Busen voran, stiehlt sich an den Justizwachtmeistern vorbei und saust auf mich zu. Ihr daumennuckelndes Mündel klammert sich verzweifelt an den »Siehst du nicht wie irre lang, weich, glänzend und teuer er ist? DUWIRST mich behandeln wie eine Königin, Motherfucker!«-Toni-Morrison-Markenzeichen-Pashmina-Schal, den sie hinter sich herzieht wie einen Drachenschweif aus Kaschmirwolle.
Und dann steht sie vor mir, erzählt leise, aber wirr von schwarzem Stolz, den Sklavenschiffen, der Drei-Fünftel-Klausel, Ronald Reagan, der Kopfsteuer, dem Marsch auf Washington und dem Mythos des Drop-back Quarterback, erklärt sogar die in Weiß gehüllten Pferde des Ku-Klux-Klans zu Rassisten und fordert voller Leidenschaft, man müsse den viel zu formbaren Geist der immerwährend-zunehmend überflüssigen »jungen schwarzen Jugend« schützen. Und siehe da, der Geist des kleinen, wasserköpfigen Jungen, die Arme um die Hüften seiner Lehrerin geschlungen und das Gesicht in ihrem Schoß vergraben, braucht ganz klar einen Beschützer oder wenigstens ein geistiges Präservativ. Er dreht sich luftschnappend um, sieht mich so erwartungsvoll an, als solle ich erklären, warum ich seiner Lehrerin so verhasst bin. Als ich schweige, wendet er sich wieder der feuchten Wärme seines Lieblingsortes zu, ohne zu ahnen, dass sich schwarze Männer laut eines Stereotyps nie zu diesem hinablassen. Was hätte ich auch sagen sollen? »Hast du beim Leiterspiel auch schon mal kurz vor dem Ziel eine sechs gewürfelt und bist auf der langen, kurvigen roten Rutsche gelandet, die dich von Feld siebenundsechzig auf Feld vierundzwanzig zurückbefördert?«
»Ja, Sir«, würde er höflich sagen.
»Tja«, würde ich sagen und dabei seinen Kugelhammerkopf streicheln, »ich bin diese lange rote Rutsche.«
Die Lehrerinnen-Poetin verpasst mir eine schallende Backpfeife. Und ich weiß, warum. Sie will, dass ich Reue zeige oder in Tränen ausbreche, um dem Staat Geld und ihr die Peinlichkeit zu ersparen, mein Schwarzsein teilen zu müssen. Und auch ich warte darauf, dass mich das vertraute, überwältigende Gefühl schwarzer Schuld in die Knie zwingt. Schlagt einen bedeutungslosen idiomatischen Pflock nach dem anderen weg, bis ich mich demütig vor Amerika krümme, unter Tränen gestehe, mich gegen Heimat und Hautfarbe versündigt zu haben, meine stolze schwarze Geschichte um Vergebung anflehe. Aber da ist nichts. Nur das Brummen der Klimaanlage und mein Marihuanarausch, und als Sicherheitsleute die Frau wieder an ihren Platz führen, im Schlepptau den Jungen, der sich an den Schal klammert, als ginge es um das liebe Leben, tut meine Wange schon nicht mehr weh, obwohl sich die Frau sicher wünscht, sie möge bis in alle Ewigkeit brennen, und ich merke, dass es mir unmöglich ist, auch nur den leisesten Hauch eines Schuldgefühls aufzubringen.
Das ist schon eine Ironie – vor Gericht geht es um mein Leben, und ich fühle mich zum allerersten Mal nicht schuldig. Das omnipräsente Schuldgefühl, so typisch schwarz wie Fast-Food-Apfelkuchen und Basketball im Knast, ist endlich verpufft, und es fühlt sich fast weiß an, jene Rassenscham losgeworden zu sein, die den bebrillten Studienanfänger voller Grauen an die Fried-Chicken-Freitage in der Mensa denken lässt. Ich stand für die »Vielfalt«, die das College in den Hochglanzbroschüren pries, aber keine noch so hohe finanzielle Unterstützung hätte mich dazu gebracht, vor den Augen der versammelten College-Frischlinge die Knorpel von einem Hühnerbein zu lutschen. Ich habe mich aus dem Gefühl der Kollektivschuld ausgeklinkt, die das dritte Cello, die Verwaltungssekretärin, die Regalauffüllerin, die Sie-ist-nicht-wirklich-attraktiv-aber-schwarz-Siegerin des Schönheitswettbewerbs davon abhalten, am Montagmorgen bei der Arbeit jeden weißen Motherfucker über den Haufen zu schießen. Ein Schuldgefühl, das mich zwang, ständig »meine Schuld« zu murmeln, bei jedem Fehlpass, bei jeder FBI-Ermittlung gegen einen Politiker, bei jedem glubschäugigen Komödianten mit Rastus-Stimme und bei jedem seit 1968 gedrehten schwarzen Film. Aber jetzt fühle ich mich nicht mehr dafür verantwortlich. Mir wird klar, dass sich Schwarze nur dann nicht schuldig fühlen, wenn sie tatsächlich Mist gebaut haben, weil uns das von der kognitiven Dissonanz erlöst, schwarz und schuldlos zu sein, und die Aussicht, im Knast zu landen, ist geradezu eine Erleichterung. So wie es eine – wenngleich nur kurzfristige – Erleichterung ist, als Schwarzer die Republikaner zu wählen, auf weiße Mädchen zu stehen oder sogar eines zu heiraten.
Voller Unbehagen, weil mir so behaglich zumute ist, versuche ich ein letztes Mal, mich meinen Leuten verbunden zu fühlen. Ich schließe die Augen, lege den Kopf auf den Tisch, vergrabe meine breite Nase in der Armbeuge. Ich konzentriere mich auf das Atmen, vergesse Flaggen und Fanfaren und krame in meinem breiten Repertoire an Tagträumen des Schwarzseins, bis ich die knisternden Archivaufnahmen finde, die den Kampf für die Bürgerrechte dokumentieren. Ich hole sie an den zarten Rändern vorsichtig aus der heiligen Dose, fädele sie auf geistige Transporttrommeln und durch seelische Schlitze, vorbei an der Glühlampe in meinem Kopf, die ab und zu mit einer halbwegs passablen Idee aufflackert. Ich schalte den Projektor ein. Konzentration ist überflüssig. Gemetzel unter Menschen filmt und erinnert man stets in höchster Auflösung. Die Bilder sind kristallklar, für immer eingebrannt in unser Gedächtnis und die Plasmafernsehbildschirme. Die Endlosschleife des Black History Month mit bellenden Hunden, sprudelnden Feuerwehrschläuchen und Furunkeln, aus denen Blut in Zwei-Dollar-Haarschnitte suppt, farbloses Blut, das über Gesichter rinnt, schweißglänzend, angestrahlt von den Scheinwerfern des Nachrichtenteams – das sind die Bilder, die unser kollektives 16-mm-Über-Ich ausmachen. Heute bin ich aber nur Medulla oblongata und kann mich nicht konzentrieren. Der Film in meinem Kopf beginnt zu springen und zu spotzen. Der Ton fällt aus, und die Protestierenden in Selma, Alabama, ähneln immer mehr Stummfilm-Negern, die massenhaft auf Bananenschalen ausrutschen und auf die Straße knallen, ein Chaos aus Beinen und Träumen. Die Demonstranten in Washington, hunderttausend Mann, verwandeln sich in Bürgerrechtszombies, die wie Schlafwandler in Reih und Glied durch die Mall marschieren und sich mit starren, gierigen Fingern ihr Pfund Fleisch krallen. Der Oberzombie wirkt erschöpft, denn er wird jedes Mal von den Toten erweckt, wenn man klarmachen will, was Schwarze dürfen und was nicht, was sie bekommen sollen und was nicht. Er ahnt nicht, dass das Mikro an ist und gesteht halblaut, er hätte das ganze Bürgerrechtstrara abgeblasen, wenn er nur ein einziges Mal von der ungesüßten Brühe hätte kosten dürfen, die an den nach Rassen getrennten Lunch-Theken des Südens Eistee genannt wird. Vor den Boykotten, den Schlägen, den Morden. Er stellt eine Dose Diätlimonade auf das Podest. »Mit Cola geht alles besser«, sagt er. »It’s the real thing!«
Trotzdem fühle ich mich weiter unschuldig. Und sollte ich tatsächlich für historische Rückschritte gesorgt haben und das ganze schwarze Amerika mit in den Abgrund reißen – was soll’s. Ist es meine Schuld, dass das einzige greifbare Ergebnis, das die Bürgerrechtsbewegung erzielt hat, darin besteht, dass Schwarze heute weniger Angst vor Hunden haben? Nein, ist es nicht.
Die Justizwachtmeisterin erhebt sich, lässt den Hammer knallen und stimmt die Gerichtslitanei an: »Der Ehrenwerte, der Vorsitzende Richter und die beigeordneten Richter des Obersten Gerichtshofes der Vereinigten Staaten.«
Hampton hievt mich auf meine zitternden Beine, und als die Richter hereinkommen, erheben wir uns feierlich, gemeinsam mit allen anderen Anwesenden. Die Richter, mit Frisuren aus der Eisenhower-Ära und ausdrucklosen Alltagsmienen à la »Ein neuer Tag, eine neue Chance«, geben sich Mühe, unparteiisch zu wirken. Zu dumm, dass sich etwas Bombast nicht vermeiden lässt, wenn man eine schwarze Seidenrobe trägt, und der farbige Richter hat in seiner Zerstreutheit obendrein versäumt, die 50 000-Dollar-Platin-Rolex abzulegen. Hätte ich eine noch bessere Jobgarantie als dieser Kronos, dann wäre ich bestimmt auch ein so selbstzufriedener Motherfucker.
Höret! Höret! Höret!
Nach fünf Jahren der Urteile, Urteilsaufhebungen, Berufungen, Vertagungen und Anhörungen vor Prozessbeginn weiß ich nicht mehr, ob ich Kläger oder Angeklagter bin. Ich weiß nur, dass mich der Richter mit dem post-rassistischen Chronometer am Handgelenk unverwandt anstarrt, sauertöpfisch und ohne mit der Wimper zu zucken. Der Blick seiner Knopfaugen ist unversöhnlich, er ist wütend, weil ich die Vorzeigerolle torpediere, die ihm von der Politik zugeteilt wurde. Aller Welt sein lauschiges Versteck verraten habe wie ein Kind, das zum ersten Mal den städtischen Zoo besucht und schließlich, nachdem es an mehreren scheinbar leeren Reptilienkäfigen vorbeigetrabt ist, vor einem Gehege innehält und ruft: »Da ist es!«
Da ist es, das Chamaeleo africanus tokenus, hinten im Gebüsch verborgen, die schleimigen Füße fest um den gerichtlichen Ast gekrallt, schlaff und still und doch an den Blättern der Ungerechtigkeit knabbernd. »Aus den Augen, aus dem Sinn« lautet das Motto des schwarzen Arbeiters, aber nun hat das ganze Land dieses Tierchen vor Augen, alle drücken sich die Nase an der Scheibe platt, erstaunt darüber, dass es seinen pechschwarzen Alabama-Arsch so lange vor dem rot-weiß-blauen Hintergrund der amerikanischen Flagge camouflieren konnte.
»Alle Personen, die vor dem Ehrenwerten, dem Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten eine Sache zu verhandeln haben, sind aufgefordert, vorzutreten und aufzumerken, denn die Sitzung ist eröffnet. Gott schütze die Vereinigten Staaten und dieses Ehrenwerte Gericht!«
Hamp knetet meine Schulter, eine Erinnerung daran, den windelköpfigen Richter oder die Republik, die er vertritt, nicht zu nerven. Dies ist der Oberste Gerichtshof, nicht die Show The People’s Court. Ich muss nichts tun. Ich brauche weder Kopien von Quittungen der chemischen Reinigung noch Polizeiberichte noch das Foto einer eingedellten Stoßstange. Hier argumentieren die Anwälte, die Richter stellen Fragen, und ich kann mich einfach zurücklehnen und genießen, dass ich high bin.
Der Vorsitzende Richter nennt den Fall. Seine leidenschaftslose Art, typisch Mittlerer Westen, trägt viel dazu bei, die Spannung im Saal zu lösen. »Am heutigen Morgen hören wir zunächst die Stellungnahmen im Fall 09-2606 …« Er verstummt, reibt seine Augen, gewinnt die Fassung dann wieder. »Im Fall 09-2606, Heros gegen die Vereinigten Staaten von Amerika.« Kein Aufruhr im Saal. Nur leises Lachen, man verdreht die Augen, und jemand sagt laut: »Für wen hält sich der Motherfucker?« Schon klar, dass Heros gegen die Vereinigten Staaten etwas großkotzig klingt, aber was soll ich sagen? Ich bin ein Heros. Wortwörtlich. Als nicht gerade stolzer Abkömmling der Familie Heros aus Kentucky, eine der schwarzen Pionierfamilien, die sich im südwestlichen Los Angeles niederließen, kann ich meine Wurzeln bis zu dem ersten Gefährt zurückverfolgen, das der staatlich sanktionierten Unterdrückung im Süden entkam – dem Greyhound-Bus. Eigentlich hießen wir Herros, aber bei meiner Geburt beschloss mein Vater – in der listigen Tradition jüdischer Entertainer, die ihren Namen ändern und von armen, unterprivilegierten Schwarzen darum beneidet werden –, sich des zweiten r zu entledigen, wie sich Jack Benny des Namens Benjamin Kubelsky entledigte, Kirk Douglas des Namens Danielovitch, wie sich Jerry Lewis seines Partners Dean Martin entledigte und Max Schmeling durch Max Baer seines Bewusstseins entledigt wurde. Wie Third Bass sich der Wissenschaft entledigte oder Sammy Davis Jr. seiner jüdischen Herkunft insgesamt. Pops wollte vermeiden, dass man mich hänselt. Er sagte oft, er habe meinen Nachnamen weder anglisiert noch afrikanisiert, sondern aktualisiert. Dadurch hätte ich mein Potenzial schon bei der Geburt voll entfaltet, könne Maslow, die dritte Klasse und Jesus überspringen.
Hamp, ein Verteidigungsanwalt, der aussieht wie ein Verbrecher, weiß genau, dass die hässlichsten Filmstars, die weißesten Rapper und die tumbsten Intellektuellen oft die am höchsten geachteten Vertreter ihrer Zunft sind, und so legt er seinen Zahnstocher auf das Pult, fährt mit der Zunge über die goldene Krone eines Schneidezahns und zieht den Anzug straff, ein babyzahnweißes, zweireihiges, kaftanweites Ensemble, das wie ein leerer Heißluftballon an seiner Gestalt schlappt und, je nach Musikgeschmack des Betrachters, entweder zu der pechschwarzen, chemischen Kleopatra-Dauerwelle und der Sofortiger-Knockout-durch-Mike-Tyson-Schwärze seiner Haut passt oder nicht. Ich erwarte halb, dass er das Gericht mit den Worten anspricht: »Kollegen und Kolleginnen Zuhälter, Ihnen mag zu Ohren gekommen sein, dass mein Klient nicht ganz ehrlich ist, aber das trifft es nicht, denn mein Klient ist ein Schuft!« In einem Zeitalter, in dem Sozialaktivisten Fernsehshows und ein Millionenvermögen haben, gibt es kaum noch Leute wie Hampton Fiske, also Pro-bono-Arschlöcher, die an Staat und Verfassung glauben und zugleich die Kluft zwischen Realität und Rhetorik erfassen. Schwer zu sagen, ob er tatsächlich an mich glaubt, aber das ist wohl egal, wenn er zu verteidigen beginnt, was er nicht zu verteidigen vermag, denn auf seiner Visitenkarte prangt das Motto: »Für die Armen ist täglich Casual Friday.«
Fiske hat die Formel »Mit Erlaubnis des Hohen Gerichts« kaum ausgesprochen, da rutscht der schwarze Richter auf seinem Stuhl ein klitzekleines bisschen nach vorn. Das wäre gar nicht aufgefallen, aber ein quietschendes Rädchen seines Drehstuhls verrät ihn. Bei jeder Bezugnahme auf einen obskuren Abschnitt des Civil Rights Act oder einen Präzedenzfall rutscht der Richter ungeduldig hin und her, und das Quietschen des Stuhls wird mit jeder rastlosen Verlagerung des Körpergewichts von einer schlaffen, zuckerkranken Arschbacke auf die andere lauter. Man kann eine Person assimilieren, nicht aber den Blutdruck, und dieser Mann verrät sich durch die Zornesader, die mitten auf seiner Stirn pocht. Er starrt mich auf diese verrückte, rotäugige, eindringliche Art an, die wir bei uns zu Hause den Willowbrook-Avenue-Blick nennen. Willowbrook Avenue ist der vierspurige Styx, der im Dickens der 1960er die weißen Wohnviertel von den schwarzen trennte, aber heute, in der post-weißen Zeit, dieser Jeder-der-mehr-als-Hemd-und-Hose-hat-haut-ab-Zeit, liegt die Hölle auf beiden Seiten der Straße. Die Flussufer sind gefährlich, und wenn man am Zebrastreifen auf Grün wartet, kann es passieren, dass sich das ganze Leben ändert. Ein vorbeifahrender Homie, für irgendeine Hautfarbe, irgendeine Clique oder irgendeine der fünf Phasen der Trauer stehend, kann seine Knarre aus dem Beifahrerfenster eines zweifarbigen Coupés recken, dir den Schwarzer-Oberster-Bundesrichter-Blick zuwerfen und fragen: »Woher bist du, Spinner?«
Die korrekte Antwort lautet natürlich: »Von nirgendwo«, aber manchmal hört man dich nicht, weil der Motor zu laut knattert, weil deine Bestätigung im Amt strittig ist, weil liberale Medien deine Glaubwürdigkeit bezweifeln oder weil dir eine intrigante schwarze Schlampe sexuelle Belästigung vorwirft. Manchmal reicht die Antwort »von nirgendwo« schlicht nicht aus. Es ist nicht so, dass man dir nicht glaubt, weil »jeder von irgendwo sein muss«, sondern weil man dir nicht glauben will. Und dieser auf dem Drehstuhl mit hoher Rückenlehne sitzende, wütende Richter, dem der Lack des vornehmen Patriziers abgeplatzt ist, ähnelt dem auf der Willowbrook Avenue hin und her rasenden Gangbanger, der sich durch den Ruf »Shotgun« einen vorderen Platz im Auto gesichert hat und obendrein tatsächlich eine Shotgun besitzt.
Der schwarze Richter stellt die erste Frage seiner langen Amtszeit am Obersten Gericht. Er ist ratlos, denn er hat noch nie nachgehakt. Er sieht den italienischstämmigen Richter an, als wolle er um grünes Licht bitten, und hebt eine dickliche Zigarrenfingerhand, ist aber so aufgebracht, dass er nicht abwartet, sondern mit den Worten herausplatzt: »Bist du irre, Nigger?« Für einen schwarzen Mann seiner Statur klingt er erstaunlich schrill. Der Objektivität und des Gleichmuts verlustig, hämmert er mit Schweineschinkenfäusten so heftig auf die Richterbank, dass die riesige, verschnörkelte, vergoldete Uhr, die über dem Vorsitzenden Richter an der Wand hängt, zu wackeln beginnt. Der schwarze Richter schiebt den Mund zu dicht ans Mikro, brüllt hinein, denn obwohl ich direkt vor der Richterbank sitze, sind wir aufgrund unserer Unterschiede Lichtjahre voneinander entfernt. Er will wissen, wie ein schwarzer Mann heutzutage dazu komme, das geheiligte Prinzip des Dreizehnten Zusatzartikels zu verletzen, indem er sich einen Sklaven halte. Wie könne ich, fragt er, den Vierzehnten Zusatzartikel vorsätzlich ignorieren, noch dazu mit dem Argument, Rassentrennung bringe die Menschen einander näher. Wie jeder Staatsgläubige verlangt er Antworten. Er will glauben, dass Shakespeare wirklich all die Stücke geschrieben und dass Lincoln im Bürgerkrieg für die Befreiung der Sklaven gekämpft hat, dass die Vereinigten Staaten im Zweiten Weltkrieg für die Rettung der Juden und eine demokratische Welt gefochten haben, dass Jesus und das Doppelprogramm im Kino ihre Wiederkehr feiern. Aber ich bin keiner dieser unerschütterlich optimistischen Amerikaner. Und was ich getan habe, habe ich getan, ohne an unveräußerliche Rechte oder die stolze Geschichte unseres Volkes zu denken. Ich habe es getan, weil es funktionierte, und ich finde, ein bisschen Sklaverei und Rassentrennung haben noch niemandem geschadet. Und wenn doch, tja, dann ist es halt so, verdammte Scheiße.
Wenn man so high ist wie ich, kann die Grenze zwischen Denken und Reden verschwimmen, und nach dem Schaum zu urteilen, den der schwarze Richter vor dem Mund hat, habe ich die letzten Worte laut gesagt. »… tja, dann ist es halt so, verdammte Scheiße.« Er fährt auf, als wolle er sich mit mir schlagen. Auf seiner Zungenspitze türmt sich ein Berg Spucke, den tiefsten Tiefen seines Jurastudiums an der Yale Law School entquollen. Nach einer Ermahnung durch den Vorsitzenden Richter beherrscht sich der schwarze Richter und sackt wieder auf den Stuhl. Schluckt die Spucke hinunter, aber nicht seinen Stolz. »Rassentrennung? Sklaverei? Ich weiß genau, dass dich deine Eltern besser erzogen haben, Motherfucker! Die Lynchparty kann beginnen!«
DIE SCHEISSE, DIE MAN SCHAUFELT
1
Das ist vermutlich genau das Problem – aufgrund meiner Erziehung weiß ich es nicht besser. Mein Vater (Ruhe in Frieden, Carl Gustav Jung) war ein nicht ganz unbedeutender Sozialwissenschaftler. Als Begründer und, soweit ich weiß, einziger Praktizierender der Freiheitspsychologie lief er gern im Laborkittel durchs Haus, das bei uns auch die »Skinner-Box« hieß. Dort erzog er mich, sein schlaksiges, zerstreutes schwarzes Versuchskaninchen, strikt im Geiste von Piagets kognitiver Entwicklungspsychologie. Ich wurde nicht ernährt, sondern lauwarmen, appetitfördernden Reizen ausgesetzt. Ich wurde nicht bestraft, sondern meiner angeborenen Reflexe beraubt. Ich wurde nicht geliebt, sondern in einer Atmosphäre präzise kalkulierter Intimität und Hingabe erzogen.
Wir wohnten in Dickens, einer Ghetto-Gemeinde am Südrand von Los Angeles, und ich wuchs, auch wenn das seltsam klingt, mitten in der Stadt auf einer Farm auf. Dickens, gegründet 1868, war wie alle kalifornischen Städte, mit Ausnahme von Irvine, das als Zuchtstation für dumme, fette, hässliche weiße Republikaner und Chihuahuas sowie jene Flüchtlinge aus Ostasien entstanden war, die diese Pinscher so heiß und innig lieben, anfangs agrarisch geprägt. Laut Gründungsurkunde sollte »Dickens von Chinesen, Spaniern aller Art, Dialekten, Hüten, Franzosen, Rothaarigen, Schlitzohren und ungelernten Juden frei bleiben.« Die Gründer sorgten in ihrer etwas beschränkten Weisheit jedoch dafür, dass die fünfhundert Hektar Land am Kanal auf ewig der sogenannten »heimischen Landwirtschaft« vorbehalten blieben, und so entstand mein Viertel, das aus zehn quadratischen Parzellen bestand und inoffiziell »Farms« genannt wurde. Wenn man es betritt, merkt man das sofort, denn die großstädtischen Bürgersteige lösen sich in Luft auf, genauso die Stereoanlagen, die Zierfelgen, die Geduldsfäden und die progressive Wählerschaft, nur der Gestank von Kuhmist bleibt und, wenn der Wind richtig steht, von gutem Hasch. Erwachsene Männer radeln gemächlich auf Dirtbikes und Fixie Bikes durch Straßen, verstopft von schnatternden Geflügelschwärmen und Federviehscharen, alles von Huhn bis Pfau. Sie fahren freihändig, zählen dabei kleine Geldbündel, heben nur so lange den Kopf, wie es braucht, um fragend eine Augenbraue hochzuziehen und »Hola! Was geht ab?« zu brummen. An Zäune und Vorgartenbäume montierte Wagenräder verleihen den Ranchhäusern etwas Pionierzeit-Authentizität, was aber darüber hinwegtäuscht, dass jedes Fenster, jede Eingangstür und jede Hundeklappe mit mehr Gitterstäben und Vorhängeschlössern gesichert ist als der Einkaufsladen im Knast. Verandasenioren und Ü-Achtziger, für die es auf Erden nichts Neues mehr gibt, sitzen auf ihren wackligen Stühlen, schnitzen mit Klappmessern und lauern darauf, dass etwas passiert, weil ja immer irgendetwas passiert.
Ich erlebte meinen Vater zwanzig Jahre, und während dieser Zeit war er interimsweise Dekan am Institut für Psychologie des West Riverside Community College. Als Sohn eines Stallmeisters einer kleinen Pferdefarm in Lexington, Kentucky, hatte die Landwirtschaft etwas Nostalgisches für ihn. Und als er in den Westen ging, um eine Lehrstelle anzutreten, wollte er sich die glänzende Gelegenheit, in einer schwarzen Community zu leben und gleichzeitig Pferde zu züchten, nicht durch die Lappen gehen lassen, obwohl er kaum die Hypothek bedienen konnte, von der Instandhaltung des Grundstücks ganz zu schweigen.
Wäre er vergleichender Psychologe gewesen, dann wären manches Pferd oder manche Kuh vielleicht älter als drei Jahre geworden und die Tomaten weniger wurmstichig gewesen, aber sein wahres Interesse galt weder der Schädlingsbekämpfung noch dem Wohlergehen des Tierreichs, sondern der Freiheit der Schwarzen. Und bei seiner Suche nach dem Schlüssel zur geistigen Freiheit war ich seine Anna Freud, seine kleine Fallstudie, und wenn er mir nicht gerade Reitunterricht gab, stellte er berühmte sozialwissenschaftliche Experimente nach, bei denen ich sowohl Kontroll- wie auch Versuchsgruppe war. Wie jedes »primitive« schwarze Kind, das das Glück hat, die formal-operationale Phase zu erreichen, dämmerte mir irgendwann, dass ich eine beschissene Kindheit gehabt hatte, die ich niemals würde verdauen können.
Wenn man bedenkt, dass die Erziehungsmethoden meines Vaters von keiner Ethikkommission kontrolliert wurden, dann begannen seine Experimente harmlos. Zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts setzten die Behavioristen Watson und Rayner den neun Monate alten »kleinen Albert« neutralen Stimuli wie weißen Ratten, Affen und brennenden Zeitungsseiten aus, um zu beweisen, dass Angst antrainiert ist. Anfangs ließ sich das Versuchsbaby durch die Affen, Nagetiere und Flammen nicht aus der Ruhe bringen, doch als Watson den Auftritt der Ratten mit krachend lauten Geräuschen kombinierte, entwickelte der »kleine Albert« nicht nur eine Angst vor weißen Ratten, sondern vor allem, was Fell hatte. Als ich sieben Monate alt war, tat Pops Spielzeugpolizeiautos, kalte Pabst-Blue-Ribbon-Bierdosen, Wahlkampfbuttons von Richard Nixon und eine Ausgabe von The Economist in meinen Kinderwagen, konditionierte mich aber nicht etwa durch lautes Scheppern, sondern jagte mir Angst ein, indem er mit unserer Familienwaffe, einer 38er Special, mehrere scheibenklirrend laute Schüsse an die Decke abfeuerte und so laut »Verpiss dich wieder nach Afrika, Nigger!« brüllte, dass er sogar den Song Sweet Home Alabama übertönte, der im Wohnzimmer auf der Vierkanal-Stereoanlage lief. Ich ertrage bis heute nicht mal den harmlosesten Fernsehkrimi, ich habe eine bizarre Vorliebe für Neil Young, und wenn ich nicht einschlafen kann, lausche ich nicht etwa Aufnahmen von Gewittern oder Meeresbrandung, sondern höre die Watergate-Bänder.
Laut Familienlegende band er mir bis zum Alter von vier Jahren die rechte Hand auf den Rücken, damit ich mit linker Hand und rechter Gehirnhälfte aufwuchs und so ein perfekt ausbalancierter Mensch wurde. Als ich acht war, wollte mein Vater testen, ob sich der »Zuschauereffekt« auch auf die »schwarze Community« übertragen ließ. Er spielte den berüchtigten Fall von Kitty Genovese durch, wobei mein präpubertäres Ich den Part der armen Miss Genovese übernehmen musste, die 1964 in den Straßen New Yorks ausgeraubt, vergewaltigt und erstochen wurde, wobei dutzende Gaffer und Anwohner ihre kläglichen Hilferufe wie aus dem Psychologie-Lehrbuch völlig ignorierten. Daher »Zuschauereffekt«: Je größer die Zahl möglicher Helfer, desto geringer die Wahrscheinlichkeit, dass einem geholfen wird. Dad stellte die Hypothese auf, dass dies auf Schwarze nicht zutreffe, eine liebevolle Rasse, deren Überleben stets davon abhing, dass man einander in Notzeiten half. Also musste ich mich auf die betriebsamste Kreuzung des Viertels stellen, die Taschen vollgestopft mit Dollarscheinen, den neuesten und trendigsten elektronischen Schnickschnack in den Ohren, eine tonnenschwere Hiphop-Goldkette um den Hals und rätselhafterweise zwei Fußmatten eines Honda Civic über dem Unterarm wie der Kellner das Geschirrtuch, und dann wurde ich, bittere Tränen weinend, von meinem eigenen Vater ausgeraubt. Er schlug mich vor einem ganzen Pulk von Gaffern nieder, die jedoch nicht lange gafften. Ich hatte gerade mal zwei Hiebe ins Gesicht kassiert, da kamen die Leute angerannt, nur halfen sie nicht mir, sondern meinem Vater. Sie halfen ihm dabei, mir den Arsch zu versohlen, traktierten mich fröhlich mit den Ellbogen und warfen sich auf mich wie beim TV