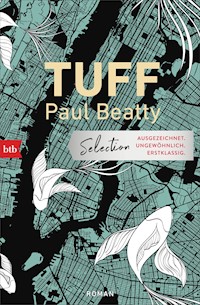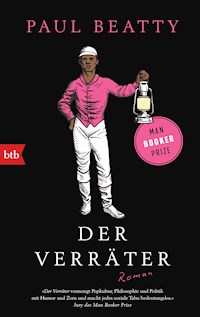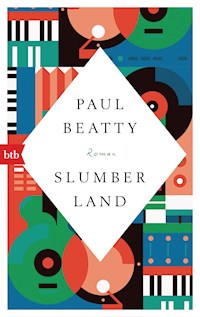
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Berlin-Roman, wie es noch keinen gibt: DJ Darky kommt aus New York in die deutsche Hauptstadt, um einen abgetauchten Jazzer aufzuspüren. Es ist die Zeit des Mauerfalls, in der plötzlich alles möglich scheint. In der Bar "Slumberland", wo DJ Darky sich als "Jukebox-Sommelier" verdingt, entdeckt er seine sexuelle Macht, den Musikgeschmack von Neonazis und das Leben der Ostdeutschen, das ihn zusehends an das Leben der Afroamerikaner im amerikanischen Bürgerkrieg erinnert... Virtuos spielt Paul Beatty mit den Verhältnissen zwischen den Geschlechtern, zwischen Schwarz und Weiß, Ost und West, Jazz und Techno und mischt daraus einen aufregenden neuen Sound.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 367
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Ein Berlin-Roman der besonderen Art: DJ Darky kommt aus New York in die deutsche Hauptstadt, um einen abgetauchten Jazzer aufzuspüren. Es ist die Zeit des Mauerfalls, in der plötzlich alles möglich scheint. In der Bar »Slumberland«, wo er sich als Jukebox-Sommelier verdingt, entdeckt DJ Darky seine sexuelle Macht, den Musikgeschmack von Neonazis, das Leben der Ostdeutschen und erstaunliche Parallelen zum Leben der Afroamerikaner im amerikanischen Bürgerkrieg …
Virtuos spielt Paul Beatty mit den Verhältnissen zwischen den Geschlechtern, zwischen Schwarz und Weiß, Ost und West, Jazz und Techno und mischt daraus einen aufregenden neuen Sound.
PAUL BEATTY, 1962 geboren, zählt zu den bedeutendsten amerikanischen Autoren der Gegenwart. Begonnen hat er als Lyriker, schnell avancierte er zum Star der New Yorker Slam-Poetry-Szene. Seine Romane haben in den USA Kultstatus. Für seinen letzten Roman »Der Verräter« wurde Beatty mit dem National Book Critics Circle Award sowie – als erster Amerikaner – mit dem Man Booker Prize ausgezeichnet. Paul Beatty lebt in New York.
Paul Beatty
Slumberland
Roman
Aus dem Amerikanischenvon Robin Detje
btb
Die Originalausgabe erschien 2008 unter dem Titel »Slumberland« bei Bloomsbury, New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Juli 2019btb Verlag in der Verlagsgruppe Random House GmbH,Neumarkter Str. 28, 81673 MünchenCopyright © der Originalausgabe 2008 by Paul Beatty All rights reservedDie deutsche Erstausgabe erschien 2009im Blumenbar Verlag, Berlin.Covergestaltung: semper smile, München Covermotiv: ©Getty Images/Kaivocb · Herstellung: scISBN 978-3-641-22251-2V001
www.btb-verlag.dewww.facebook.com/btbverlag
Für Yvonne W. Beatty, meine Mutter
INHALT
ERSTER TEIL: DIE BARTKRATZER
KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
ZWEITER TEIL: GERMANY OVER EVERYTHING
KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
DRITTER TEIL: THE SOULS OF BLACK VOLK
KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
VIERTER TEIL: DIE ZUHÖRERFAHRUNG
KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
EPILOG ZU VORGESTERN
DANKSAGUNG
ERSTER TEIL
DIE BARTKRATZER
KAPITEL 1
Man sollte doch glauben, sie hätten sich allmählich an einen gewöhnt. Ich meine, wissen sie denn nicht, dass es nach eintausendvierhundert Jahren aus ist mit der Scharade des Schwarzseins? Dass wir Schwarzen, die einstmals ewig Hippen, die Typen, die so hier und jetzt waren wie die Zeitansage, ab heute genauso von gestern sind wie der Faustkeil, das Veloziped und der Strohhalm aus Papier? Der Neger ist jetzt offiziell Mensch. Alle sagen das, sogar die Briten. Ob es wirklich einer glaubt, ist einerlei; wir sind so mittelmäßig und gewöhnlich wie der Rest der Gattung. Den ruhelosen Seelen unserer Toten steht es endlich frei zu sein, was sie unter ihrer modern-primitiven Patina immer schon waren. Josephine Baker darf sich den Knochen aus der Nase ziehen, dann hat sie wieder die original 206 Stück davon im x-beinigen Klappergestell. Der liebeskranke Geist von Langston Hughes darf seinen (geschenkten) Montblanc-Füller beiseitelegen und weit den Mund aufreißen. Nicht, um seine ranschmeißerischen Reime zu rezitieren, sondern um irgendeinem Harlemer Halunken das sagenhafte Gemächt zu lecken und zu blasen, worin sich die eigentliche mündliche Überlieferung schließlich vollendet. Die Revoluzzer unter uns dürfen die Waffen niederlegen. Der Krieg ist vorbei. Es kommt nicht darauf an, wer ihn gewonnen hat, nehmt euren Schießprügel, die Taschenflak, die Wumme, die Knarren, die ihr einst »ein-Weißer-weniger-trunken« vor euren Kindern schwenktet, nehmt diese Knarren und bahrt sie auf hinter Glas, auf dass sie müßig neben der Donnerbüchse und der portugiesischen Arkebuse und der Muskete der Milizen Neuenglands auf dem roten Samt ruhen mögen. Der Schlachtruf noch der Tapfersten unter uns lautet längst nicht mehr »Wir sehen uns in der Hölle!«, sondern »Wir sehen uns vor Gericht«. Wenn du der Geschichte also noch immer böse bist, dann ruf einen Anwalt an und versuch, dir für die Sklaverei Entschädigung einzuklagen. Schwarzsein ist passé, und ich für meinen Teil könnte darüber nicht glücklicher sein, denn jetzt kann ich ins Bräunungsstudio gehen, wenn ich will, und ich will.
Ich reiche der Dame am Empfang den Gutschein. Vorne drauf ist eine Hochglanzluftaufnahme karibischer Gestade. Sie dreht das Kärtchen um und senkt misstrauisch den Blick von meinem Gesicht auf seine Rückseite. Dort steht: BRÄUNUNGSSTUDIO ELECTRIC BEACH: BUCHEN SIE 10 SONNENBÄDER, UND SIE BEKOMMEN EINS UMSONST. Unter dem Angebot sieht man zwei Reihen Zehn-Pfennig-Stückgroßer Kreise und in jedem Kreis den roten Stempelabdruck einer heiß brennenden Sonne mit Sonnenbrille, breitem Lachen und gebleckten Zähnen. Heute ist der große Tag, an dem ich mein Gratissonnenbad bekomme. Aber irgendwie zögert diese Frau, die mindestens sieben der zehn lachenden Sonnen aufgestempelt hat, mir einen Bräunungsraum zuzuweisen. Normalerweise stempelt sie meine Karte ab, murmelt kaum hörbar Malibu, Waikiki oder Ibiza, und ich trotte los.
Ein verwirrt-vertraulicher Ausdruck schleicht sich in ihr Gesicht. Ein Blick, der sagt: Habe ich Sie nicht schon mal gesehen? Haben Sie mich nicht letzten Dienstag vergewaltigt? Sind Sie nicht der Stepptanzlehrer von meinem Sohn?
»Acapulco.«
Endlich. Sie trägt meinen Namen ins Merkbuch ein. Ich deute auf die Sonnencreme in der Vitrine hinter ihr.
»Avon Bronze«, sage ich.
Wie ein Minitorpedo kommt die Tube über den Schalter geschossen. Lichtschutzfaktor zwei. Nicht stark genug. Wenn das Vanillelipgloss der Empfangsdame LSF 3 hat, brauche ich bei meinem Hauttyp mindestens eine sechs. Ich feuere zurück und schieße die Lotion wieder in ihre Richtung ab. »Tzu schwack. Ick braucke ehtuas Stäkkerres«, sage ich.
Vielleicht sollte man Säugetiere nach ihrem Lichtschutzfaktor klassifizieren. Frau, LSF 3, 35, verheiratet, sucht Nichtraucher, diskret spontan LSF 4 oder heller, für Affäre. LSF-7-Nashorn von Ausrottung bedroht. Ich bin hier der verantwortliche LSF-50-Leiter. Der Wal war LSF 2 – und das entsetzte mich mehr als alles andere. Doch wie kann ich hoffen, mich hier zu erklären? Erklären aber muss ich mich, sei es auch nur dunkel und ungefähr, sonst wäre alles vergebens, was ich in diesen Kapiteln schreibe und geschrieben habe. Der fensterlose Raum »Acapulco« hat die makabere Anmutung einer Krebsstation in Tijuana. Ganz wie drüben in der Alten Heimat die Schnapsläden, Bolzplätze und Ladenkirchen sind in Berlin die Bräunungsstudios allgegenwärtige Stätten der Zuflucht. Letzte Ausfahrt für die unheilbar Kranken, die unheilbar Armen und Sündigen, die unheilbar Blassen. Dein Ort, wenn der Arzt dir sagt, dass er nichts mehr für dich tun kann. Wenn die Welt dir sagt, dass du nicht genug tust.
Eifrig verwirbelt ein Deckenventilator die dumpfige Luft. An einer schäbigen, meerblau gestrichenen Wand hängen zwei gerahmte, offiziöse Blatt Pergament, das eine die Kontrollbescheinigung des Berliner Gesundheitsamtes, das andere, in Schnörkelschrift, das Abschlusszeugnis einer Hochschule namens »Goldener Herbst« in einem Fach namens Solarologie. In der Mitte des Raums steht die Sonnenbank, eine mit Glas und Chrom verkleidete Wunderkiste aus dem Himmel oder, genauer, Taiwan. Ich ziehe mich aus und creme mich ein, wobei ich die Tür einen winzigen Spalt offen lasse.
Nach langen Jahren des Bräunens hat meine Haut das meiste an Elastizität eingebüßt. Ich kneife mir in den Unterarm, und der kleine Fleischberg hält sich ein paar Sekunden lang, bevor er langsam wieder versinkt. Mein Teint ist etwas nachgedunkelt; noch immer ein nettes, unbedrohliches Bill-Cosby-Braun, jetzt allerdings mit einem granatroten Unterton, der mir in einem gewissen Licht einen leicht schurkischen Schimmer verleiht. Die Hälfte dessen, was ich über das Neueste aus der afroamerikanischen Popkultur weiß, erfahre ich von Berlinern, die mich auf der Straße anhalten und sagen: Tu sssiehst auss fie …, und dann gehe ich nach Hause und suche im Internet nach Urkel, Homey the Clown und Dave Chappelle. Seit Neuestem erinnere ich die Leute eher an anrüchige schwärzliche Gestalten aus den B-Movie-Verfilmungen der Schundromane von Elmore Leonhard.
Ich leihe mir diese Filme aus – Jackie Brown, Out of sight, Schnappt Shorty –, sehe sie mir an und laufe dabei zwischen Bildschirm und Badezimmerspiegel hin und her. Ich finde überhaupt nicht, dass ich wie diese Männer aussehe, diese grundschlechten, eindimensionalen Charakterdarsteller, deren Ausstrahlung einzig im Bass ihrer Stimmen zu liegen scheint und im Tonfall, mit dem sie motherfucker sagen. Sam Jackson, Don Cheadle, das fette Arschloch aus Be Cool, immer sind sie schlau und finster, aber nie schlau genug, um den weißen Heini auszutricksen, und nie finster genug für wirklich böse Taten.
Oft denke ich, dass es einfacher gewesen wäre, in den Tagen meines Vaters aufzuwachsen. Als er groß wurde, gab es nur vier Nigger, denen er ähnlich sehen konnte: Jackie Robinson, Bill »Bojangles« Robinson, Louis Armstrong und Uncle Ben, den dicklippigen Mann mit der Kochmütze auf der Instantreispackung. Heute sieht jeder männliche Schwarze nach irgendwem aus. Irgendeinem Sportler, Sänger oder Leinwanddeppen. Wenn man zu Papas Zeit jemandem einen schwarzen Mann beschreiben wollte, den dieser Jemand nicht kannte, sagte man: Der sieht aus wie die Art Nigger, die dir tierisch den Arsch versohlt. Heute sagt man: Der sieht aus wie Magic Johnson oder Chris Rock, die Art Nigger, die dir ratzfatz in den Arsch kriecht.
Die meisten Einreibemittel sind kühl und wohltuend, nicht aber Sunblocker. Das Zeug stinkt nach Pökellauge und ist so zäh wie ranzige Butter. Meine schmuddelige Haut stößt es offenbar ab. Egal, wie feste ich reibe, ich bekomme die Creme nicht einmassiert, und Feuchtigkeit spendet sie schon gar nicht. Die schmierigen Wirbel kleben mir einfach auf der Haut wie Autopolitur. Mit einem kräftigen Zug an der Kordel will ich den Deckenventilator zum Schweigen bringen. Unmöglich zu sagen, ob er langsamer oder schneller geworden ist. Ich reiße noch einmal daran. Dasselbe Ergebnis. Unbeholfen klettere ich auf die Sonnenbank und hebe die Hand, bis die Ventilatorflügel über meine Finger hüpfen und langsam zum Halt kommen. Ein fettiger, fusseliger Rückstand bleibt an meiner Hand zurück, und ich wische ihn an der Wand ab.
Ich setze die Schutzbrille auf. Die Sonnenbank ist kalt, wird aber schnell warm. Wie ein Fieber, das man als Kind bekommt, heizt das Solarium dich von innen auf. Meine aschfahlen Knochen verwandeln sich in Kalziumkohlen, Briketts der Seele. Schon liege ich wieder unten in meiner Etagenbettkoje, und die ultravioletten Strahlen sind ein Ersatz für meine überängstliche Mutter, die eine Decke nach der anderen auf ihren lieben Kleinen stapelt. Die Wärme aus den Bräunungsröhren lässt sich nicht mehr von der Wärme der trockenen, schwieligen Hände meiner Mutter unterscheiden. Meine Haut scheint mir zu verglasen, und solange ich die Arme noch bewegen kann, schiebe ich eine CD in die eingebaute Anlage und drücke auf Play.
Musik. Meine Musik. Nicht meine in dem Sinn wie Rücksitzfummler »ihr Lied« haben oder der Rock’n’Roll der Fünfziger des Teufels ist, sondern meine in dem Sinn, dass sie mir gehört. Ich habe sie geschrieben. Mir gehört der Vertrieb. Alle Rechte vorbehalten. Der Song trägt den Titel »Southbound Traffic Jam«. Er beginnt mit einer rumpelnden Melodie, zehn Fahrspuren morgendlicher Berufsverkehr Stoßstange an Stoßstange über einem gesampelten Kokomo-Arnold-Gitarrensolo. Im Hintergrund, zwei Ausfahrten weiter und dem Gitarrenriff immer hinterher, das Intermezzo, ein riesiger Peterbilt-Truck, der sich mit jaulendem Getriebe und doppeltem Trompetenstoß aus der Drucklufthupe in das Lied einfädelt. Nach sechzehn Takten Bottleneckgitarre und Autos im engen Flaschenhals des Staus (niemand hat diesen Witz je kapiert) steigt plötzlich ein kleiner Japaner in die Bremsen. Die Räder blockieren. Er schlittert unheilvoll lange und gleichmäßig dahin. Ich kann nicht mehr zählen, wie oft ich den Track schon gehört habe, und doch wappne ich mich bei diesem schrillen Quietschen jedes Mal für den Aufprall. Für das Geräusch knitternden Blechs in Stereo. Eine Windschutzscheibe birst, und in zehntausend Würfelchen regnet das Sicherheitsglas mit dem knackigen digitalen Klimpern eines brasilianischen Schlaginstruments auf den Asphalt der Überholspur. Sun Ras hämisches Falsett unterstreicht die Dringlichkeit:
So rise lightly from the earth.And try your wings. Try them now.While the darkness is invisible.
Die Gitarre tritt in den Vordergrund, der Verkehr tuckert weiter. Kokomo brummt und jault. Die Empfangsdame wippt in den Knien. Sie steht an der Tür und lugt durch den Spalt. Starrt die Wölbung meiner Badehose an, hört meine Musik und fragt sich, wieso. Wie kann so etwas passieren?
Man möchte meinen, ich hätte mich inzwischen daran gewöhnt – an den Sonnenmangel hier. Aber der Winter in Berlin ist eher eine Epoche als eine Jahreszeit. Acht Monate undurchdringlichen Himmels, grau wie die Wolldecke auf einer Gefängnispritsche, der, im Verein mit dem verrauchten Nachtleben und der Schwerstiefeligkeit des Berliner Fußballs, dieser Stadt den Zauber einer Matinee in Schwarz-Weiß verleiht. Wenn es nicht so kalt wäre, würde ich glauben, ich absolvierte einen Gastauftritt in einem alten Hollywoodreißer. Um die von September bis April währende, bleierne Monochromie abzuschütteln, ertappe ich mich dabei, wie ich die Dinge koloriere. Die Augen von Ingrid Bergman, die Sprache der polnischen Nutte, die Teigspritzer auf den Schokotalern im Schaufenster der Bäckerei, die kleinen Fetzen klaren Himmels an einem teilweise-bewölkt-bis-überwiegend-wolkig-Tag bekommen alle einen von der Erinnerung verfälschten Blauton. Ein Blau, das in der Natur nicht vorkommt, das nur in meinem Kopf Wohnung hat und im Schwirren von Kokomos Gitarre.
An Tagen mit wolkenlosem Himmel, von einem Blau, so rein, wie ich es längst vergessen hatte, sprinte ich raus aus der Wohnung, hinein in den grellen Nachmittag, auf der Suche nach Zuwendung und Serotonin. Einen Augenblick lang weiß ich nicht mehr, wo ich bin, dann fällt mir der niedrige Radstand der so präzise wie beim Autohändler am Straßenrand geparkten Wagen auf. An der Kreuzung Schlüter- und Mommsenstraße warten Hunde, Hundehalter und Schulkinder ohne Begleitung, alle ganz artig und geduldig, auf Grün. Ich blicke auf meine komischen Schuhe hinab, und da weiß ich es wieder. Börlinn, yupp, Börlinn.
Die skurrile Funktionalität deutschen Schuhwerks, genau wie die von Volkswagen und Bauhaus, wächst einem mit der Zeit ans Herz. Verfechtern der Schöpfungslehre sind der Bowlingschuh und die Krankenschwesternlatschen Adam und Eva. Darwinisten wie ich halten den dreihundert Jahre alten Birkenstock für den Lungenfisch der Spezies. Ich nenne ein hoch entwickeltes Paar Birkenstockschuhe mein Eigen, eine Allwetterkreuzung aus Hush Puppies und Bergstiefeln, die sich an die sich ständig verändernde Umwelt anpasst wie ein Wildlederchamäleon. Dieses robuste Wunderwerk der natürlichen Auslese ist es, in dem ich die Stadt abklappere, auf meiner verzweifelten Suche nach der Sonne, so panisch, wie ich sonst nach meinen Schlüsseln wühle. Die Standardformeln der Deduktion rauschen mir durchs Hirn: Wann hast du die Sonne zum letzten Mal gesehen? Bis du sicher, dass du sie eingesteckt hast, als du losgegangen bist? Ich arbeite mich rückwärts vor, von den Schatten der Cinzano-Sonnenschirme in den Straßencafés, und mache mich in Richtung Ku’damm auf. Quarzstaub glitzert aus den Gehsteigplatten. Vom Sonnendeck der Doppeldeckerbusse winken die Touristen. Wahrlich, die Sonne zieht ihre Bahn, nur kann ich sie am Himmel nie finden.
Keiner der Germanenstämme besaß einen Sonnengott. Sie mögen so heidnisch gewesen sein wie Philosophieprofessoren, aber so dumm, an etwas zu glauben, das man nicht sehen konnte, waren die Westgoten, die Franken und die Vandalen nicht. Ra, Helios, Huitzilopochtli – ich rufe die Sonne Charlie. Ich schlängele mich zwischen den Fußgängern hindurch und stelle mir vor, wie vor zweitausend Jahren irgendein fauler Hunne – nicht in Birkenstock-, sondern in Strohsandalen – in dieser nun Beton gewordenen Wildnis auf demselben Pfad nach Sonnenfährten suchte. Aber ich erhasche nur kurze Blicke auf die gelbe Gottheit, ihren durch die Blätter der Baumblüten im Tiergarten schimmernden Strahlenkranz, ihren Kräutershampooglanz in den Hippielocken einer großen Blondine, ihren Widerschein auf der Gletschereisfassade eines Hochhauses vielleicht. Nie sichte ich mehr als eine partielle Sonnenfinsternis; Burgzinnen oder Kirchturm, irgendetwas ist immer im Weg.
Wohl wissend, dass die Ägypter in den letzten dreitausend Jahren nichts Bemerkenswertes mehr zustande gebracht haben, müssen die Berliner Baumeister doch dem antiken Fingerzeig gefolgt sein. Einst richteten die Gelehrten von Gizeh die Cheopspyramide am Himmelspol aus, und die Stadtplaner Berlins taten es ihnen gleich, als sie Bauvorschriften erließen, nach denen ein beliebiges Bauwerk – sei es Haus, Plakatwand, Straßenlaterne oder Vogelnest – immer so zu errichten ist, dass seine Höhe oder Ausrichtung einem jeden Menschen von durchschnittlichem Wuchs von jedem beliebigen Standort innerhalb der Stadtgrenzen aus den freien und unbehinderten Blick auf die Sonne versperrt.
Praktischerweise gebe ich die Suche immer am Winterfeldtplatz auf; in der Abenddämmerung läuten die Glocken von St. Matthias das Ende meiner Hetzjagd ein. Der Himmel verdunkelt sich. In der Luft hängt der ätzende Geruch von verbranntem Pitabrot und Schawarma. Auf einem knatternden Zweitakter fährt ein alter Mann vorbei. Eine Frau schimpft ihre obstinate Tochter. Im Slumberland gehen flackernd die Lichter an. In der ganzen Zeit, die ich hier lebe, habe ich erst einen Sonnenuntergang erlebt. Und ohne die deutsche Wiedervereinigung wären es noch weniger gewesen.
Der Summer ertönt, aber noch bevor ich herausklettern kann, stellt die Empfangsdame den Timer der Sonnenbank eine Viertelstunde weiter, lässt meinen Song wieder anlaufen und bedeutet mir, mich wieder hinzulegen. Zurück an ihrem Platz hört sie der Musik zu, einen Mundwinkel zu einem tief beeindruckten Lächeln hochgezogen. Plötzlich senkt sich dieser Mundwinkel, und sie verzieht nachdenklich das Gesicht. Ihre Finger tanzen nicht mehr. Ihre Füße klopfen nicht mehr. Sie will es wissen. Warum. Warum ich mich bräune. Warum ich nach Deutschland gekommen bin. Ich erkläre ihr, dass es länger als fünfzehn Minuten bräuchte, um diese Frage zu beantworten. Dass wir dazu eine dieser guten alten Horizontalbeziehungen würden eingehen müssen, wie sie das alltägliche vertikale miteinander Ausgehen, Joggen und Schaufensterbummeln schließlich meistens nach zwei Jahren zerstöre. Wenn ich so weit wäre, ihr Postkarten mit zufälligen, hastig auf Rückseiten gekritzelten Haikus zu schicken …
In bed we cool. Kiss.Soon as my feet hit the floor –The shit goes haywire.
(oder auf Berlinerisch:
Im Bett Küsschen. Allet dufte.Kaum steh ick feste auf dem Boden –wieder dicke Luft.)
… würde ihre Frage noch immer unbeantwortet sein, dann würde ich sie greinend anrufen: »Ich habe dir eine Postkarte geschrieben, bitte nicht lesen.« Sie würde sich von mir trennen wollen, es aber nicht durchziehen, weil sie noch immer nicht genau wissen würde, warum.
Sie ruckelt mit ihrem dicken Hintern auf dem Stuhl. Der Stuhl quietscht. Mein Schließmuskel verkrampft sich. Ansonsten rühre ich mich nicht. Jede Bewegung würde mir die Behaglichkeit nehmen, und mir war schon seit Jahren nicht mehr so wohl.
Als wir den Electric Beach verlassen, verliert mein frisch bestrahltes Gesicht schnell den Kampf gegen die steinkalte Nacht. Berlin ist immer eine saubere Stadt, aber in Winternächten ist es besonders antiseptisch. Ich schwöre, oft liegt ein Hauch Ammoniak in der Luft. Wir haben es dabei nicht mit der hermetischen Sterilität einer Schweizer Privatklinik zu tun, sondern mit dem feuchten Meister-Proper-Glanz eines Supermarktgangs, bei dem ich mich frage, welche historischen Ölflecken hier wohl gerade weggeschrubbt worden sind.
Die allgegenwärtigen Gedenktafeln, höchst sorgfältig so platziert, dass sie irgendwie unaufdringlich auffallen, rufen diese Katastrophen aus wie müde Kassierer in der letzten Nachtschicht. Achtung, ein Holocaust in Gang zwei. Kaputtes Schaufensterglas in Gang fünf. Milli Vanilli in der Gefrierwarenabteilung. Diese metallenen Klebezettel sind keine Glaubens- oder Therapiesprüche, wie man sie an Badezimmerspiegel und Kühlschranktüren pappt, sie sollen uns helfen, nie zu vergessen; moralische Demarkationslinien, an Pfeiler geschmiedet, in Gehsteige eingelassen, in Granitwände geätzt und uns hoffentlich ins Gedächtnis eingebrannt. IN URALTER ZEIT IST GENAU DA, WO DU JETZT STEHST, ETWAS PASSIERT, UND WAHRSCHEINLICH PASSIERT MORGEN WIEDER WAS. WAS AUCH IMMER ES WAR ODER SEIN WIRD, MINDESTENS EINEM MENSCHEN WAR ES NICHT SCHEISSEGAL UND MINDESTENS EINEM DOCH. WELCHER WÄREST DU GEWESEN? WELCHER WIRST DU SEIN?
Am U-Bahnhof Nollendorfplatz ertappen wir uns dabei, wie wir mit leerem Blick die Marmortafel anstarren, die an die homosexuellen Opfer des Nationalsozialismus erinnert. Die Inschrift beschreibt ihre Körper (»totgeschlagen«) und ihre Geschichten (»totgeschwiegen«).
»Was hast du gestern Abend gemacht?«
Eine komische Frage. Eine, die üblicherweise nur von einem engen Freund gestellt wird, nach dem Zug an einer geschnorrten Zigarette oder nachdem man ein fremdes Haar von einer vertrauten Schulter gezupft hat. Aber ich bin dafür dankbar. Die Frage will sich nicht mit der nicht so fernen Vergangenheit aufhalten, und ich will es auch nicht. »Nichts. Und du?«
»Nichts.«
»Und was ist mit vorgestern?«, fragt sie und tritt nahe genug heran, mir die Luft aus der Daunenjacke zu quetschen.
»Vorgestern?«, sage ich, lange nach hinten und löse ihre Umarmung. »Vorgestern war ich sehr beschäftigt.«
Dass ich ihr nichts sagen will, verletzt sie, aber vorgestern ist zu privat. Vorgestern war der wichtigste Tag meines Lebens.
Auf den Hochbahnschienen über uns kommt ein Zug zum Stehen. Sie versucht, meinen Blick zu halten, aber ich bin ganz auf einen Ort konzentriert, den ich nicht sehen kann und von dem ich trotzdem weiß, dass es ihn gibt. Einen Ort, zwei Straßen hinter ihr und dann links – das Slumberland. Meinen herablassenden Abschiedskuss auf die Stirn kontert sie rasch selbst mit einem Kuss. Einem nachhaltigen Schmatz auf die Lippen, der mir einen Vorgeschmack darauf gibt, wie unsere gemeinsame Zukunft aussehen könnte, auf viele, viele Übermorgen, weich, impulsiv, etwas salzig und fünf Zentimeter größer als ich. Bing bong. Die elektronische Zweitonmelodie erklingt, zischend schließen sich die Luftdrucktüren, und auf gewisse Weise haben wir beide unseren Zug verpasst.
Weil die erwartete Antwort von mir ausbleibt, verschränkt die Empfangsdame schnell entrüstet die Arme vor der Brust und vergräbt die Hände in den Achselhöhlen. Am liebsten würde ich sie bitten, das noch einmal zu tun. Nicht das Küssen, sondern das Armeverschränken. Das Schleifpapiergeräusch der Baumwollärmel ihres Kittels lässt mir die Schwanzspitze kribbeln. Zeit, good-bye zu sagen. Ich streckte die Hand nach dem schlecht ans Revers gepinnten Namensschild aus. Darauf steht: Empfangsdame.
Ich leite meinen langsamen Rückzug ein und erwarte, dass ihre Gestalt mit der Dunkelheit verschwimmt. Tut sie aber nicht. Der Kittel ist zu hell. Sie steht da wie ein störrisches Gespenst aus meiner Satyrvergangenheit, -gegenwart und -zukunft, das sich weigert zu verschwinden.
An diesem Montagabend ist im Slumberland nicht viel los. Nur das Flackerlicht der Jukebox und ein Nigerianer, der eine Blondine mit seinem Zippo beeindrucken will, durchdringen die muffige Stille. Ich bestelle ein Weizenbier, dann stecke ich Geld in die Jukebox. Ich drücke 4711,» In a sentimental mood«. Auf weichen Sohlen tänzelt Duke Ellingtons träges Legato ins Lokal und versetzt mich wie angekündigt in einen sentimental mood, macht mich rührselig, betreffs vorgestern.
In den meisten Sprachen gibt es ein Wort für den Tag vor gestern. Spanisch: anteayer. Französisch: ante-hier. Deutsch: vorgestern. Im Englischen gibt es kein Wort dafür. Man muss the day before yesterday sagen. In meiner Sprache hat man die Vergangenheit gern einfach und vollendet, frei von allen Möglichkeitsformen, in denen Erinnerungen und Stimmungen einander überlagern könnten. Ich nehme einen Stift heraus und trommele mit der Spitze ungeduldig auf einer Serviette herum, während ich nach einem englischen Wort für the day before yesterday suche.
Ich halte mich für einen politisch-linguistischen Flüchtling, der in Deutschland Asyl sucht, einem Land, in dem ich die Menschen nicht nonplussed sagen hören muss, wenn sie nonchalant meinen, oder dazu gezwungen bin, einem Militärsprecher mein Ohr zu leihen, der einen Hubschrauberabsturz an einem Berghang euphemistisch hard landing nennt; und ich kann gar nicht oft genug sagen, wie befreiend es ist, an einem Ort zu wohnen, an dem ich einen Herbst aus lauter Sonntagen durchleben kann, ohne auch nur einmal jemanden The only thing the prevent defense does is prevent you from winning sagen zu hören. Heute Amerika zu lauschen, das ist, als lausche man dem gestürzten König Lear, der in seinem königlichen Gebrabbel Schatten und Mäuse zu wahren Feinden erklärt. Ständig bringt Amerika Leerformeln hervor wie keeping it real, intelligent design, hiphop generation und first responders, um seine Leere und Banalität zu übertünchen.
Obwohl der Sound der amerikanischen Rhetorik einer der Gründe ist, dass ich dort weg bin, bleibt er absurderweise die letzte Verbindung zum Land meiner Geburt. Der Einzige, mit dem ich in der Heimat noch korrespondiere, ist Cutter Pinchbeck III, leitender Redakteur des Kensington-Merriwether Dictionary of Standard American English. Unsere Beziehung ist angespannt, und wie ein Wortrevolutionär im Exil befinde ich mich im Kampf gegen die sprachliche Repression aus der Ferne. Bis heute habe ich vier Begriffe zur Aufnahme in die nächste Ausgabe eingereicht: etymolophile, Corfunian, hiphopera und phonographic memory. Ich mag meine Worte; man versteht sie von selbst und sie werden, wie ich finde, dringend benötigt. Unglaublich, dass Englisch als einzige indogermanische Sprache ohne Begriff zur Beschreibung der Bewohner Korfus auskommt. Corfunian brauchen wir nicht, sagt Cutter Pinchback. In seinen schnöseligen Ablehnungsschreiben erklärt er, man nenne die Einwohner Korfus Griechen, Greeks, und etymolophile bezeichne keinen Liebhaber der Worte, sondern einen Liebhaber des Ursprungs der Worte. Ganz von oben herab teilt er mir mit, hiphopera verdiene beinahe einen eigenen Eintrag als innovative Verschmelzung von E- und U-Kultur, doch leider verfüge der Begriff nicht über die »unverstellt gossenmäßige, niggerische Ausdrücklichkeit der Neueinträge dieses Jahres, wie z. B. badonkadonk, bling, bootylicious, dead presidents, hoodrat, peeps und swol«, um nur einige wenige Slang-Eintagsfliegen anzuführen. Und obwohl ich eine eidesstattliche Erklärung meiner Mutter und ein Video beigefügt hatte, das mich zeigt, wie ich als Zwölfjähriger bei Erkennen Sie die Melodie fünfundzwanzigtausend Dollar gewinne, will Cutter Pinchback nicht glauben, dass ich oder ein anderer der hundert Milliarden Menschen, die in den vergangenen fünfzigtausend Jahren auf unserem Planeten ihr Dasein gefristet haben, je über phonographic memory, ein phonographisches Gedächtnis verfügte – doch ich tue es. Ich erinnere mich an alles, was ich jemals gehört habe. An jeden heruntergefallenen Cent, jedes Regentropfentröpfeln, jedes Turnschuhsohlenquietschen und jedes Schafsblöken. Jedes Seilhüpflied, jedes Abzählreimklatschen und jede Ene-mene-muh-Methode, um festzustellen, wer raus ist. Ich erinnere mich an jeden schmalzigen R&B-Radiosongtext und verzerrten Hendrix-Riff. Jedes Zupfen von Itzhak Perlman und jeden Schmatzer einer rückenschädigenden Rücksitz-Rummachsession. Ich höre noch jedes Hey you, jedes You the man und John Philip Sousas Euphonium-Tuten und jedes Rauschen der Blätter am Baum und jeden kleinen Streit am Zaun. Ich erinnere mich an jeden Laut, den ich je gehört habe. Als wäre mein ganzes Leben ein Song, den ich nicht mehr aus dem Kopf bekomme.
»Autsch.« Der Nigerianer hat sich verbrannt. Heftig wedelt er mit der Hand und zieht Luft durch die Zähne ein. Seine Verabredung lacht, packt seine Hand, hätschelt ihm die versengten Finger und lutscht daran.
Die Weise aus der Jukebox endet mit einem Ton, von Ellington mit der Sanftheit eines kleinen Kindes hingelegt, das ein verletztes Vögelchen in einen mit Seidenpapier ausgepolsterten Schuhkarton bettet. Eine Reihe englischer Worte für »vorgestern« erstirbt mir in der Kehle – penultidiem … prepretoday … yonyesterday … – und als litte ich am Tourettesyndrom, platze ich unwillkürlich mit einem Wort für »vorgestern« heraus. »Retrothence!« Die Blondine und der Nigerianer werfen mir einen komischen Blick zu. Das werde ich Cutter Pinchback III vom Kensington-Merriwether schicken. Retrothence wird sich auf Seite 1147 der vierten Collegeausgabe wirklich fein machen, zwischen retrospective und retroussé gekuschelt.
»Sie haben noch ein paar Songs übrig.«
Der Nigerianer steht an der Jukebox.
»Drücken Sie 1007. Danach können Sie spielen, was Sie wollen.«
Rock schlendert in den Raum. Die Gitarrenriffs im Overdub kommen nicht zu effekthascherisch daher, das Schlagzeug treibt den Song mit dem strengen Stakkato eines liebevollen Exerziermeisters voran, und der Bass, der Bass steht über dem Getümmel, hängt über Streichern, Synthesizern und Percussion, brummt vor präpotenter Selbstsicherheit, immer nah am Prahlerischen, ohne jemals die Grenze zu überschreiten.
»Wer ist das?«
»›The Magnum Opus‹.*«
Sie sind das wahre Südkalifornien, ausufernd, nebulös, wankelmütig, so undergroundmäßig, wie eine Rockgruppe mit zwanzigtausend verkauften Platten es nur sein kann. Die Kritiker bejubeln Gruppen wie die Smashing Pumpkins und Pearl Jam als Standartenträger des neuen Rock und ziehen schalen Heroinrausch der Tiefe vor, hippe Frisuren dem Musikerhandwerk, reinrassige Kopf-bis-Fuß-Weißenblässe einer politischen mexikanischen/schwarzen/amerikanischen/guapo-Band, deren Musik nichts damit zu tun hat, dass man mexikanisch, amerikanisch, schwarz oder gut aussehend ist. Schrill, eben noch kreischend und dann überzeugend, glitscht der Gesang über die Melodie hinweg.
»Die sind gut«, sagt der Nigerianer.
»Die sind gut«, wollte ich erwidern, »aber retrothence Abend, fast dort, wo Sie gerade stehen, habe ich mit den größten Musikern, von denen man nie je gehört hat, zwei Minuten und siebenundvierzig Sekunden musikalischer Perfektion hingelegt, so zeitlos wie das Wasserstoffatom und Saturday Night Live. Einen Beat, so vollkommen, dass seither sämtliche musikalischen Genreeinteilungen null und nichtig sind. Eine Melodie, so überirdisch, dass Schwarzsein offiziell passé ist. Endlich wird man uns Nichtweiße mit munterer Gleichgültigkeit betrachten, und nicht mit erotisiertem Mitleid oder der Abscheu freudianischer Projektionen. Ist es nicht das, was wir angeblich immer schon gewollt haben? Dass man uns ›nicht nach unserer Hautfarbe, sondern nach unserem Charakter‹ beurteilen möge? Alter, aber was wir da hingelegt haben, hatte nichts mit Charakter zu tun, das war total jenseits von Charakter. Das war einfach irgendwie schwarz und einfach tierisch funky.«
*Obskure, aber einflussreiche Garagenband aus Los Angeles, deren Sänger Manuel Ozuna bei einem bahnbrechenden Auftritt 1982 im Roxy angeblich das Crowdsurfing erfunden hat.
KAPITEL 2
Ich vermisse Los Angeles, den Ort, wo ich zum ersten Mal die Klänge in meinem Kopf gehört habe. Ich vermisse den Mittagssmog; ich mochte das Brennen in den Lungen, wenn ich meinen Hund um die Feigen- und Zitronenbäume im Hintergarten gejagt hatte und er mir, beinahe genauso außer Atem wie ich, die Staubkruste vom Gesicht und das Stechen aus den Augen leckte. Ich vermisse meinen Job bei Trader Joe’s, einem Verbrauchermarkt für glutenfrei essende Besserverdiener, die, während ich mit der Hand Orangen zu frischem Saft presste, mit zwei Flaschen Wein ankamen und mich fragten, welchen ich zu leichtem indonesischen Essen empfehlen würde, den Chianti oder den Beaujolais? Das war einer der Vorteile des Jobs: Man durfte »Beaujolais«, »Gouda« und »Reblochon« sagen. Ich vermisse das »Reblochon«-Sagen. Ich vermisse die Erdrutsche und die Buschfeuer. Für uns, die wir unterhalb der Armutsgrenze lebten, welche in Los Angeles ungefähr fünfhundert Fuß über dem Meeresspiegel verläuft, war Mutter Natur die große Gleichmacherin der bedauernswerten Flachlandbewohner. Ach, die offen zum Ausdruck gebrachte Schadenfreude, wenn man in den Abendnachrichten eine der Matronen aus dem Coldwater Canyon auf dem Dach ihres Ranchhauses stehen sah, wie sie sich vor den fliegenden Funken duckte und, bewaffnet mit einem Gartenschlauch, gegen die von der steifen Brise und meinem Zynismus angefachten Flammen ankämpfte! Ich vermisse die Villen Malibus, wie sie die regensatten Berghänge herunterrutschen. Ihre Besitzer, wie sie in italienischen Regenjacken durch die Matsche patschen, ihre Traumhäuser mit Meerblick fünf Millionen Dollar Treibholz. In Los Angeles sind die denkwürdigen Nächte so zahlreich wie die Permutationen des Fatburger »Double King Chili Cheese«. Sie sind so lau und widerstandsfähig wie die Santa-Ana-Winde, die ihnen vorausgehen, und sie laufen sich tot wie Studentenfilme, kratzig, ohne klaren Erzählstrang, experimentell, selbstverliebt und überbelichtet. Nächte, geschmiert mit geklautem Volnay, Bordeaux und Louis Roederer in Magnumflaschen. Nächte, die sich selbst aufgaben, wenn die Cartoonfiguren auf Psilocybin aufhörten, sich munter auf dem Flokati zu tummeln, zurück in die Glotze krochen und sich in Männer verwandelten, die klassisch amerikanisch gedehnt fragten: »Hat Gott Sie heute berührt?«
Ich vermisse diese Nächte, doch was ich nicht vermisse, ist die Angst. In Los Angeles konnte man meine Angst hören. Was geht ab, cuz?Was läuft, blood? Pinche mayate, was hast du in diesem Viertel zu suchen, ese?Hände hinter den Kopf, und das Gesicht auf den Boden! Bist du dir sicher, dass du dir das hier leisten kannst? Bei dem ganzen Posing, den gnadenlosen finsteren Blicken, der Hip-Hop-Bravura, der Was?-Schiss?-ich?-Mittelschicht-Nonchalance und dem heimlichen B-Boy-Ficken ohne Gummi würde man nie darauf kommen, dass uns schwarzen Männern Vieles Angst macht, unter anderem die Polizei, Wasser und Mathefragen in der Eignungsprüfung fürs College. Was wir jedoch mehr als alles andere fürchten, ist die Möglichkeit, dass sich unter den 450 Millionen anderen schwarzen Männern, die diesen Planeten bevölkern, ein noch nicht gefasster Gewohnheitsverbrecher befindet, ein Mann, doppelt so übel wie Stagger Lee und nur halb so sympathisch, ein Keine-Bewegung-sonst-blas-ich-dir-den-Kopf-weg-Nigger auf der Flucht, der uns bis aufs Haar gleicht.
Der Umzug nach Berlin hat meine Angst vor Verwechslungen fast auf null heruntergefahren. Ich wurde nicht mehr immer wieder von dem gleichen Albtraum gequält, wie ich im Postamt stehe und an einer Anschlagtafel ein Plakat mit der Aufschrift sehe: GESUCHT WEGEN SCHWEREN DIEBSTAHLS, MÄDCHENHANDELS UND VERBRECHEN GEGEN DIE MENSCHLICHKEIT. Beschreibung und Verbrecherfoto sehen mir nicht nur ähnlich, das bin wirklich ich. Ein Ich allerdings, das ich nicht kenne. Ein hartes, höhnisch grinsendes Ich mit zusammengekniffenen Augen und einer Sammlung von Decknamen, die alles sagen: Pol Pot Johnson, Steve Mussolini, Mugabe von Quisling. Unter den Hintergrundinformationen standen Verhaltensregeln und die ausgelobte Belohnung aufgelistet: »Dieser Mann gilt als bewaffnet, gemein und so gefährlich wie eine nukleare Kernschmelze. Wenn Sie über Kenntnisse über den Aufenthaltsort dieser Person verfügen, informieren Sie bitte umgehend die zuständigen Behörden! Belohnung: 500.000 Dollar und die ewige Dankbarkeit Ihrer Regierung und Ihrer Mitbürger.«
Aber diese Angst vor mir selbst, das war ich. Sie war alles, was ich und ein Haufen anderer kleiner Los Angelesitos besaßen. Ich wartete darauf, aus der Masse auserwählt und vom weißen Amerika auf eine höhere Verwirklichungsebene gehoben zu werden, und wenn nicht von ihm, dann würde es ein Kuss von Velma Reinhardt, der vollbusigen blonden Sexbome von nebenan, auch tun. Aber wie der Zufall es wollte, kam Amerika Velma zuvor.
Mit fünfzehn erhielt ich einen Brief vom Schulbezirk Los Angeles, der mich benachrichtigte, dass ich mich zu »Sonderuntersuchungen bei der University of California Los Angeles« zu melden habe. Endlich hatte man mich erkannt, aus der Menge herausgepickt. Der Brief versetzte meine Eltern und mich in Angst und Schrecken, denn vor gar nicht langer Zeit hatte man schwarze Männer vorsätzlich mit Syphilis infiziert, sie gezwungen, hohe Dosen LSD zu schlucken, und sie im Vierzig-Meter-Lauf auf ihre Tauglichkeit als Footballspieler geprüft, alles unter dem Vorwand einer »Sonderuntersuchung«. Mit belegter Stimme rief Daddy die Schulaufsicht an. »Jawohl, Sir. Ich habe verstanden, Sir.« Er deckte die Sprechmuschel mit der Hand ab und hauchte: »Es geht um eine Matheprüfung. Es sind noch drei andere Negroes, zwei Chicanos und ein Eskimojunge dabei.« Mutter nahm die Brille ab und formte lautlos die Worte: »Auch weiße Jungs?«
»Ja«, nickte Vater. Der Hund kratzte an der Hintertür. Meine Mutter weinte und blätterte die Seiten in ihrem Buch um. Ich glaubte nicht, dass außer ihr jemand so schnell E. L. Doctorow lesen konnte.
Ich gehörte zu den Kindern, die gerne Erster waren, sorgte dafür, dass ich als Erster in diesem Klassenzimmer saß, ohne dabei zu lausbubenhaft zu wirken, und tat, als wäre ich der erste schwarze Student mit einem Nicht-Sportstipendium, der an der UCLA nach dem Dahinscheiden der Quotenregelung wieder für Rassengleichheit sorgen würde. Ich suchte mir einen Platz nahe den offenen Fenstern zum Hof und steckte den Kopf aus dem Elfenbeinturm, ein krausköpfiges Rapunzel. Bei den Weißen ist die Luft erfrischender, dachte ich so bei mir. Der Wind munterer, belebender. Der Schatten schattiger. Und die Backenhörnchen sind backiger. Die Aufsicht rief meinen Namen – He! – und winkte mich dann mit dem Daumen in die letzte Reihe, wo inzwischen zwei schwarze Jungen in Sonntagsanzügen und ein nichtweißes Mädchen saßen; sie trug offenbar das kleiner gemachte Hochzeitskleid ihrer Mutter. Der Eskimojunge, die Unterlippe dick vom Kautabak, kam als Letzter.
»Uukkarnit Kennedy?«, fragte die Aufsicht.
Ohne zu zögern sagte Uukkarnit lang gedehnt mit tiefer, rauchiger Stimme: »Na, Ladies Love Cool James bestimmt nicht.« Alles lachte, weil wir an der Westküste den schmalzigen LL Cool J hassten und viel lieber die perversen Rap-Limericks von Too Short hörten.
»Sie können sitzen, wo Sie wollen, Mr. Kennedy«, bekam er gesagt, und obwohl in der Weißenabteilung noch viele Plätze frei waren, setzte Uukkarnit sich zu uns. Er nickte zum Gruß negromäßig mit erhobenem Kinn. Nachdem er ganz cool einen Batzen braunen Sabbers in seinen Spucknapf abgelaicht hatte, stellte er selbigen an den Rand seines Tischs. Sich zu uns zu setzen war ein Akt der Solidarität, ein Lunch-Counter-Sit-in des ausgehenden zwanzigsten Jahrhunderts; und dass er seinen Styroporspucknapf mitten in den Sichtkreis der weißen Kids auf dem Tisch platzierte, war das Wagemutigste, was ich bis dahin erlebt hatte. Manchmal ist es schon revolutionär, es sich einfach gemütlich zu machen.
Die Aufsicht lief zwischen den Gängen auf und ab und legte jedem einen Druckbleistift und ein versiegeltes Aufgabenheft auf den Tisch.
»Wenn Sie in diesem Klassenzimmer sitzen, dann, weil Sie im Tennessee-Mathematikleistungstest für nichtasiatische Achtklässler achtundneunzig Prozent der Fragen richtig beantwortet haben. Das Heft vor Ihnen enthält die Prüfungsaufgaben zur Matheeinstufung der University of California in Los Angeles. Öffnen Sie das Heft erst, wenn ich es Ihnen sage.«
Ein nervöses Hüsteln. Unten, aus dem Hof, der Lärm eines Mädchenfootballspiels. Ich beugte mich vor und fragte Uukkarnit, was sein Name bedeute. Ohne sich umzudrehen, antwortete er: »Wenn du den Eisbär rasierst, wirst du entdecken, dass seine Haut schwarz ist.«
»Ist das wahr?«
»Was der Name bedeutet oder die Scheiße mit der schwarzen Haut?«
»Beides.«
»Ersteres stimmt; was Letzteres angeht, weiter nördlich als bis Santa Barbara bin ich nie gekommen und einen scheiß rasierten Eisbären habe ich bestimmt noch nie gesehen.«
Die Testergebnisse wurden in absteigender Reihenfolge vor der Tür angeschlagen. Das war der erste Computerausdruck, den ich je gesehen hatte. Meinen Namen und mein Ergebnis – FERGUSON W. SOWELL: 100/100 – in der futuristischen Telex-Schrift, die man damals benutzte, ganz oben auf der Liste zu finden, war eine schöne Bestätigung. Jetzt war es offiziell. Es gab mich. Einer nach dem anderen wurden wir in ein kleines Büro gerufen. Als ich an der Reihe war, ließ der Mann hinter dem Schreibtisch schnellfeuermäßig eine Suada über den Kalten Krieg ab und dass man »geeignete Kandidaten für die Ausbildung in der Aeronautik und Nuklearwissenschaft« brauche. Bei »geeignet« wurde er langsamer und unterbrach sich schließlich mitten in seiner Verkaufe. Als ihm meine ererbte Nichteignung dämmerte, hatte er mir nichts anderes mehr zu sagen als: »Den Druckbleistift können Sie behalten.«
Die weißen Schüler kamen in einen Mathekurs für Fortgeschrittene an der Uni; uns Negroboys und dem einen Mädchen gaben sie Musikinstrumente und steckten uns in die Musikhochschule Wilmer Jessop. Uukkarnit habe ich nie wieder gesehen.
Ich will nicht sagen, dass ich auf der Wilmer Jessop nichts gelernt hätte, aber was sie einen nicht lehrten, war, warum? Warum spielte ich? Warum war Musik so machtvoll? Was kann ich mit Musik anfangen? Kann sie heilen? Kann sie töten? Wer Wilmer Jessop war, haben sie mir auch nie beigebracht, jetzt, wo ich darüber nachdenke. Beim Spencer-Tracy-Filme- Gucken im Bezahlfernsehen habe ich mehr über Musik gelernt als in jedem Kompositionskurs. Such dir einen Film aus, irgendeinen – Teufelskerle, Stadt in Angst –, wenn Spencer Tracy in ein Zimmer kommt, senkt er konzentriert den Blick und sucht nach seiner Bodenmarkierung. Er zottelt zu ihr hin, zwinkert ihr zu, stupst sie mit den Zehen an, stützt nachlässig die Hände in die Hüften, hebt das breite, glückselige Gesicht, und dann spielt er sich den scheiß Arsch ab. Ich versuchte, mir beizubringen, als Musiker so zu spielen wie Spencer Tracy als Schauspieler. Das Nach-der-Bodenmarkierung-Suchen in meine Trompetensoli einzubauen, mit dem Wissen zu spielen, dass die Suche nach Identität und ein Sinn für den eigenen Ort im Raum Weg und Ziel zugleich waren und der Trick darin bestand, dem Publikum vorzumachen, dass man genau wusste, wo man hinwollte. Dieses Mathetestergebnis, das war das erste Mal, dass ich meine Markierung auf dem Bühnenboden gefunden hatte. Ich wusste, wo ich mich hinstellen musste. Ich existierte und würde mich fürderhin vom Rest der schwarzen Männerwelt mit einem Matheresultat absetzen, das ich bis heute in der hinteren Hosentasche trage, damit ich es vorweisen kann, falls jemand meine Papiere sehen will, und erklären: »Ich weiß nicht, welcher Nigger da wem was angetan hat, aber ich kann es nicht gewesen sein. Sehen Sie mal, 100/100.«
Damals träumte ich noch davon, ein sorgloser Jazzer zu werden, und war mir sicher, schon mein Name, Ferguson W. Sowell, würde dafür sorgen, dass meine pfeifenrauchende Visage in ein paar Jahren die Cover einer ganzen Reihe von Blue-Note-Alben zierte. Ich hatte eine Schublade voller Zettel mit diesen unveröffentlichten Titeln: Sowell Brother, Sowell Survivor, O Sowell Mio, Sowell’d Out, Summer Sowellstice. Ich war sogar begabt; mein phonographisches Gedächtnis erlaubte mir, jedes gewünschte Musikstück perfekt wiederzugeben. Aber ich wusste nie, was ich spielte. Wie oft mein Musiklehrer mich auch daran erinnerte, dass die Stücke wie ihre Titel klangen, ich konnte eine Thelonius-Monk-Komposition nicht von der anderen unterscheiden.
»Bum baba bum. Bum baba bum«, sang er dann. »Bum ba bum ba bum bababa bum. Welches Stück ist das, Mr. Sowell?«
»›Epistrophy?‹«
»›Blue Monk‹, Sie unmusikalischer Ignorant!«
Man gliederte mich stufenweise aus dem Studiengang Jazz an der Jessop aus, und ich wurde der einzige Student des Fachbereichs »Audiovisuelle Studien«, was an der Musikhochschule dem Programm für Lernbehinderte entsprach. Den größten Teil meiner Zeit brachte ich damit zu, mich auf eine Zukunft als Roadie vorzubereiten, indem ich Schlagzeuge aufbaute, Instrumente stimmte und Projektoren und Lautsprecher von Kursraum zu Kursraum rollte. In meiner Freizeit schloss ich mich in die Abstellkammer ein und machte mit den Computern und Plattenspielern rum. Für meinen Abschluss sollte ich eine Arbeit darüber einreichen, wie man einem Drummer, der Background Vocals singt, anständig das Mikro einstellt, aber stattdessen gab ich eine Fassung von Händels Messias ab, komplett aus Versatzstücken des Albums Licensed to Ill von den Beastie Boys. Mein barockes Brat-Rap/Mash-up-Oratorium wurde die Abschiedsrede meines Jahrgangs. Nach dem Abschluss beschloss ich, die Trompete aufzugeben, mich für Vorbereitungskurse zum College einzuschreiben und DJ zu werden.
DJ sein, das war viel einfacher. Eigentlich zu einfach. Du legst auf der Hochzeitsfeier »Knee deep« auf, und noch die Großmutter des Bräutigams wird locker auf die Tanzfläche hüpfen, die morschen Hüften schwingen und die Hängetitten schwenken.
Ich gebe es ja selber zu, ich bin nicht der technisch versierteste DJ, der je die Nadel in die Rille schob. Akute Linkshändigkeit, Angst vor Menschenmassen und das, was ich meinen gesunden Selbsthass nenne, fügen sich zu meinem einprägsamen Künstlernamen: DJ Darky – »Der selbstverliebte agoraphobische Rechte-Gehirnhälfte-Bubi«, ganz und gar nicht der prototypische, Beats jonglierende, speedmixende Derwisch, der nach jeder Verrenkung und jedem Scratch »Kunstform! Kunstform!« brüllt. Das meiste von dem bisschen Scratchen, das ich zustande bringe, ist ein Unfall, und so kompensiere ich meinen Mangel an Handwerk und Negritude mit einem Übermaß an gutem Geschmack und einer Plattensammlung, die, wie ich finde, für die DJ-Kunst das darstellt, was der Louvre für die Malerei ist.
Ich beneide den Direktor des Louvre. Wer immer es ist, die haben es besser als ich. Müssen nicht nach der nächsten impressionistischen Trüffel graben. Diesen Knaben Monet musst du dir ansehen. Seine Pinselführung, makellos. Müssen keine Mappen durchblättern, sich keine Mixtapes anhören und hoffen, dass ihr tiefes Seufzen Interesse vermittelt und nicht totale Verzweiflung. Keiner fragt einen, was man von Jeff Koons hält. Zwei Mal im Jahr lässt sich der Direktor in einem langsamen, klimatisierten Fahrstuhl in den Keller fahren, grüßt mit herablassendem Winken den bewaffneten algerischen Wachmann in seinem burgunderroten Polyestersakko, fragt ihn nach einem Buchstaben, irgendeinem Buchstaben, und bläst den Staub vom Degas und Delacroix. Dahn tseigen ouir ihnähn die, oui?
Alle wichtigen Entscheidungen sind ihm damals, 1793, abgenommen worden, als der Louvre seine vergoldeten Pforten öffnete und sprach: Enculez le chic, scheiß auf cool. Ende des achtzehnten Jahrhunderts war Neoklassizismus Pop. Goya war ein Graffitisprayer. Lithografie war Computergrafik. Mozart ließ die Wände wackeln, ein Rocker, geschmückt mit einer Suzy-Q-Dauerwelle, bei der sich jeder zeitreisende L.A.-Gangster-Rapper, der seinen Lockenstab wert ist, gefragt hätte, wo er eine dieser Perücken abziehen kann, sans Puder. Als Zerezo den Bolero, einen spanischen Volkstanz, in französisches Ballett verwandelte, hätte er ebenso gut Crazy Legs oder Rock Steady sein können, der den Doyens der Großstadt, erst die Haare, dann auch die Gliedmaßen zu Knoten gebunden, den Breakdance beibringt.
… und roller-skate, roller-skate … und demi-plié, demi-plié.