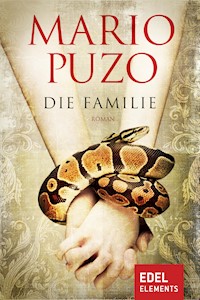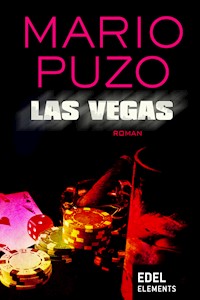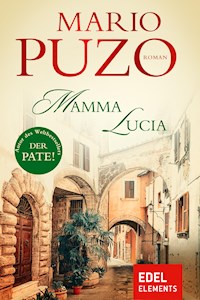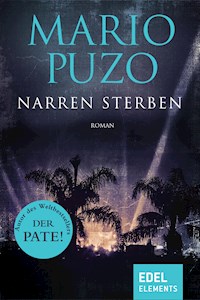Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Francis Xavier Kennedy, Präsident der Vereinigten Staaten, steht als fiktiver vierter Kennedy ganz in der demokratischen Tradition seiner berühmten Namensvettern. Von privaten Schicksalsschlägen zermürbt, ist er amtsmüde geworden und erwägt, für die nächste Legislaturperiode nicht mehr zu kandidieren. Doch dann entführt ein internationales Terrorkommando eine amerikanische Linienmaschine in das kleine Öl-Sultanat Sherhaben. An Bord befindet sich Kennedys Tochter Theresa …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 809
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mario Puzo
Der vierte Kennedy
ins Deutsche übertragen von Gisela Stege
Roman
Edel Elements
Inhalt
Erstes Buch
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Zweites Buch
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Drittes Buch
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Viertes Buch
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Fünftes Buch
Kapitel 21
Kapitel 22
Sechstes Buch
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Erstes BuchKarfreitag – Ostersonntag
1. Kapitel
Am Karfreitag trafen in Rom sieben Terroristen letzte Vorbereitungen für ein Attentat auf den Papst der römisch-katholischen Kirche. Die Angehörigen dieser Gruppe, vier Männer und drei Frauen, hielten sich für Befreier der Menschheit. Sie nannten sich Christen der Gewalt.
Anführer dieser Gruppe war ein junger, mit den Methoden des Terrors gründlich vertrauter Italiener. Für diese spezielle Operation hatte er den Codenamen Romeo angenommen – ein Name, der seinem jugendlichen Sinn für Ironie entsprach und mit der ihm innewohnenden Sentimentalität Romeos rein intellektueller Menschenliebe ein wenig mehr Herz verlieh.
Am Spätnachmittag des Karfreitags kam Romeo endlich dazu, sich in einem von den Internationalen Hundert zur Verfügung gestellten, »sicheren« Haus ein wenig auszuruhen. Er lag auf den zerwühlten, mit Zigarettenasche und altem Nachtschweiß verschmutzten Laken und las in einer Taschenbuchausgabe der Brüder Karamasow. Seine Beinmuskeln verkrampften sich vor Anspannung, vielleicht auch vor Angst – egal was, es würde, wie immer, bald aufhören. Doch dieser Auftrag war so ganz anders, so komplex und brachte so große Gefahren für Körper und Geist mit sich! Dieser Auftrag würde ihn im wahrsten Sinne des Wortes zu einem Christen der Gewalt machen, ein Name, der so jesuitisch war, daß er immer wieder darüber lachen mußte.
Romeo hieß eigentlich Armando Giangi und war der Sohn reicher Eltern aus der High-Society, die ihm eine wenig aktive, jedoch luxuriöse und sehr religiöse Erziehung hatten angedeihen lassen, eine Kombination, die seiner asketischen Natur so sehr widersprach, daß er sich mit sechzehn Jahren sowohl von allem weltlichen Besitz als auch von der katholischen Kirche lossagte. Daher konnte es nun, mit dreiundzwanzig Jahren, wohl kaum eine wirksamere Rebellion für ihn geben als ein Attentat auf den Papst. Und dennoch regte sich in Romeo noch immer eine gewisse abergläubische Scheu. Als Kind hatte er von einem Kardinal in rotem Hut die heilige Kommunion empfangen. Diesen unheilverkündenden, roten, mitten im Höllenfeuer gefärbten Hut würde Romeo niemals vergessen.
Somit also von Gott in allen Ritualen konfirmiert, machte sich Romeo bereit, ein so furchtbares Verbrechen zu begehen, daß Hunderte Millionen Menschen seinen Namen verfluchen mußten, denn sein wahrer Name würde bekanntwerden. Er würde verhaftet werden. Das gehörte zu ihrem Plan. Alles, was dann geschah, hing von Yabril ab. Inzwischen aber würde er, Romeo, als Held gefeiert werden, der dazu beigetragen hatte, diese grausame Gesellschaftsordnung zu verändern. Was in einem Jahrhundert noch als Grausamkeit betrachtet wurde, galt im nächsten als gottgefällig. Und vice versa, dachte er lächelnd. Der allererste Papst, der vor Jahrhunderten den Namen Innozenz gewählt hatte, hatte mit einer päpstlichen Bulle die Folter sanktioniert und war dafür gefeiert worden, daß er den wahren Glauben verbreitete und die Seelen der Ketzer rettete.
Außerdem sprach es Romeos jugendlichen Sinn für Ironie an, daß die Kirche den Papst, den er umbringen wollte, kanonisieren würde. Er würde also einen neuen Heiligen schaffen. Und wie er sie haßte, all diese Päpste! Diesen Papst Innozenz IV., diesen Papst Pius, diesen Papst Benedikt, o ja, sie sanktionierten viel zuviel, diese Anhäufer von Reichtümern, diese Unterdrücker des wahren Glaubens an die Freiheit der Menschen, diese pompösen Hexenmeister, die die elenden Massen der Erde mit ihrer Magie der Ignoranz, ihren eifernden, die Leichtgläubigkeit ausnutzenden Behauptungen überschütteten.
Er, Romeo, einer der sogenannten Hundert innerhalb der Christen der Gewalt, würde diese krude Magie beseitigen helfen. Die Ersten Hundert, gemeinhin als Terroristen bezeichnet, waren über Japan, Deutschland, Italien, Spanien und sogar die tulpenreichen Niederlande verteilt. Zu bemerken wäre allerdings, daß es in Amerika keine Mitglieder der Ersten Hundert gab. Denn in dieser Demokratie, dieser Geburtsstätte der Freiheit, gab es nur intellektuelle Revolutionäre, die beim Anblick von Blut in Ohnmacht fielen; die ihre Bomben in leeren Gebäuden hochgehen ließen, nachdem sie die Bewohner gewarnt und aufgefordert hatten, das Haus zu verlassen; die öffentlichen Geschlechtsverkehr auf den Treppen von Staatsgebäuden für einen Akt idealistischer Rebellion hielten. Wie verachtenswert sie doch waren! Kein Wunder, daß Amerika keinen einzigen Mann zu den Revolutionären Hundert beigesteuert hatte.
Romeo gebot seinen Tagträumereien Einhalt. Verdammt, er wußte ja noch nicht einmal, ob es überhaupt einhundert waren. Vielleicht waren es fünfzig oder sechzig, die Zahl war rein symbolisch gemeint. Doch solche Symbole mobilisierten die Massen und faszinierten die Medien. Ihm war nur eine einzige Tatsache unwiderleglich bekannt: daß er, Romeo, ebenso einer der Hundert war wie sein Freund Yabril.
In einer der zahlreichen Kirchen Roms läuteten die Glocken. Es war kurz vor sechs, am Abend dieses Karfreitags. In einer Stunde würde Yabril eintreffen, um noch einmal sämtliche Mechanismen dieser komplizierten Operation durchzusprechen. Das Attentat auf den Papst sollte der Eröffnungszug eines brillant konzipierten Schachspiels werden, einer Serie wagemutiger Taten, die Romeos romantische Seele labten.
Yabril war der einzige Mensch, der in Romeo jemals Bewunderung geweckt hatte, körperlich sowohl als geistig. Yabril kannte die Niedertracht der Regierungen, die Scheinheiligkeit der Behörden, den gefährlichen Optimismus der Idealisten, den überraschenden Treuebruch selbst der leidenschaftlichsten Terroristen. Vor allem aber war Yabril ein Genie in revolutionärer Kriegführung. Auf das kleinkarierte Mitleid und das infantile Erbarmen der meisten Menschen blickte er mit Verachtung hinab. Yabril kannte nur ein einziges Ziel: den Menschen der Zukunft die Freiheit zu bringen. Und Yabril war weit unbarmherziger, als Romeo es je werden könnte. Romeo hatte unschuldige Menschen getötet, Eltern und Freunde verraten, einen Richter, der ihn einmal beschützt hatte, ermordet. Romeo begriff, daß politischer Mord eine Art von Wahnsinn sein konnte, und war bereit, diesen Preis zu bezahlen. Aber als Yabril zu ihm sagte: »Wenn du nicht bereit bist, eine Bombe in einen Kindergarten zu werfen, bist du kein echter Revolutionär«, hatte Romeo ihm erwidert: »So etwas könnte ich niemals tun.« Aber einen Papst konnte er töten.
Dennoch quälten ihn in diesen letzten dunklen römischen Nächten Alpträume, nur winzige Feten von Alpträumen, wie gräßliche kleine Ungeheuer, die bewirkten, daß Romeo am ganzen Körper der Schweiß ausbrach, aus Eis destillierter kalter Schweiß.
Seufzend wälzte sich Romeo aus dem verschmutzten Bett, um sich zu duschen und zu rasieren, bevor Yabril eintraf. Yabril würde es als gutes Zeichen deuten, wenn er sauber und ordentlich aussah, als moralische Aufrüstung für die bevorstehende Mission. Denn Yabril achtete, wie viele Sensualisten, auf eine gewisse Sauberkeit und äußere Form. Während Romeo als echter Asket durchaus im Dreck zu leben vermochte.
Auf dem Weg zu Romeo beachtete Yabril auf den Straßen von Rom die üblichen Vorsichtsmaßregeln. Im Grunde aber stand und fiel das Ganze mit der internen Sicherheit, der Loyalität der Kampfkader, der Integrität der Ersten Hundert. Aber weder sie noch sogar Romeo kannten das wahre Ausmaß dieser Mission.
Yabril war ein Araber, den man ohne weiteres für einen Sizilianer halten konnte, wie viele Leute es ja auch taten. Er hatte das schmale, dunkle Gesicht dieses Menschenschlages, Kinn und Kiefer jedoch waren viel schwerer und grober, fast so, als wären sie mit einer zusätzlichen Knochenschicht bedeckt. In seiner Freizeit ließ er sich, um diese plumpen Linien zu verbergen, einen kurzen, seidigen Bart stehen. Sobald er jedoch an einer Operation teilnahm, erschien er wieder glattrasiert. Als Engel des Todes zeigte er dem Feind sein wahres Gesicht.
Yabrils Augen waren blaßbraun, seine Haare von einzelnen grauen Strähnen durchzogen, und die schwere Form der unteren Gesichtshälfte wiederholte sich in Brust und Schultern. Seine Beine waren im Verhältnis zu dem kurzen Oberkörper lang und kaschierten die physische Kraft, die er entwickeln konnte. Doch nichts vermochte die wache Intelligenz in seinen Augen zu tarnen. Yabril verabscheute das gesamte Konzept der Ersten Hundert. Er hielt es für einen modischen Public-Relations-Trick und verachtete den damit verbundenen formellen Verzicht auf die Welt des Materiellen. Diese Revolutionäre von der Universität, wie Romeo, waren zu romantisch in ihrem Idealismus, verachteten zu Unrecht jeglichen Kompromiß. Yabril dagegen begriff durchaus, daß der Sauerteig der Revolution ein bißchen Korruption brauchte, um so richtig aufgehen zu können.
Yabril hatte vor langem schon jede moralische Eitelkeit abgelegt. Er besaß das reine Gewissen jener, die glauben und wissen, daß sie sich mit ganzer Kraft für die Verbesserung der Welt einsetzen. Aber noch nie hatte er sich für jene Handlungen geschämt, die seinen eigenen Interessen dienten. Wie etwa seine persönlichen Übereinkünfte mit verschiedenen Ölscheichs für Attentate auf deren politische Rivalen; oder gelegentliche Mordaufträge für diese neuen afrikanischen Staatsoberhäupter, die während ihrer Ausbildung in Oxford gelernt hatten zu delegieren; oder bisweilen ein Terrorangriff im Auftrag gewisser angesehener Politiker. Kurz, für alle Männer auf der Welt, die Macht über alles besitzen, nur nicht über Leben und Tod.
Von diesen Aufträgen war den Ersten Hundert nichts bekannt, und Romeo vertraute er sich erst recht nicht an. Yabril wurde von holländischen, englischen und amerikanischen Ölgesellschaften bezahlt, von moskautreuen Gruppierungen und, zu Beginn seiner Karriere, von der amerikanischen CIA für eine ganz besondere, geheime Hinrichtung. Das alles war jedoch schon lange her.
Jetzt lebte er gut, er war kein Asket, schließlich war er einmal, wenn auch nicht arm geboren, so doch eine Zeitlang arm gewesen. Er schätzte guten Wein und Gourmetküche, bevorzugte Luxushotels, liebte das Glücksspiel und überließ sich oft der Ekstase, die ihm der Körper einer Frau schenkte. Er bezahlte für diese Ekstase jedoch mit Geld, Geschenken und seinem ganz persönlichen Charme, denn vor der romantischen Liebe fürchtete er sich.
Trotz dieser »revolutionären« Schwächen war Yabril in seinen Kreisen für seine Willenskraft berühmt. Er hatte überhaupt keine Angst vor dem Tod, was nicht ganz außergewöhnlich war, vor allem aber fürchtete er sich nicht vor Schmerzen. Und das war möglicherweise der Grund dafür, daß er so furchtbar grausam sein konnte. Yabril hatte seine Fähigkeiten im Laufe der Jahre unter Beweis gestellt. Er war durch keine Form körperlichen oder psychologischen Drucks zu brechen. Er hatte Gefangenschaft in Griechenland, Frankreich und Rußland sowie zwei Monate währende Verhöre durch den israelischen Sicherheitsdienst überstanden, dessen Geschicklichkeit ihm Bewunderung abnötigte. Er hatte sie besiegt – möglicherweise, weil er den Trick beherrschte, unter Zwang jegliches Gefühl zu verlieren. Und letztlich hatten es alle begriffen: Sobald man ihm Schmerz zufügte, biß man bei Yabril auf Granit. Wenn jedoch er es war, der Gefangene machte, bezauberte er die Opfer häufig mit seinem Charme. Und daß er sich eines gewissen Wahnsinns in seinem Verhalten bewußt war, gehörte zu diesem Charme und zu der Angst, die er anderen einflößte. Ebenso die Tatsache, daß in seiner Grausamkeit nicht die geringste Niedertracht lag. Alles in allem jedoch hatte er Freude am Leben, war er ein eher sinnenfroher Terrorist. Und so genoß er selbst jetzt, da er mit den Vorbereitungen für die gefährlichste Operation seines Lebens beschäftigt war, die Düfte in den Straßen von Rom und die Abendluft.
Alles war an seinem Platz. Romeos Gruppe war bereits vor Ort; Yabrils eigene Gruppe sollte am folgenden Tag in Rom eintreffen. Die beiden Gruppen würden verschiedene »sichere« Häuser benutzen; ihre einzige Verbindung waren die beiden Führer. Es war ein großer Augenblick, das wußte Yabril. Dieser kommende Ostersonntag und die Tage danach würden sich zu einem glanzvollen Kunstwerk gestalten.
Er, Yabril, würde ganze Nationen zwingen, Wege einzuschlagen, die ihnen zutiefst zuwider waren. All seine zwielichtigen Herren würde er abschütteln; er würde sie zu seinen Schachfiguren machen und ohne Zögern allesamt opfern, sogar den armen Romeo. Nur der Tod konnte seine Pläne durchkreuzen, oder ein Versagen der Nerven. Oder, ehrlich gesagt, einer von hundert möglichen Fehlern beim Timing. Aber die Operation war so großartig, so genial konzipiert, daß es ihn selbst begeisterte. Yabril blieb auf der Straße stehen, um ausgiebig den Anblick der Kirchtürme, die glücklichen Gesichter der Römer zu genießen und seine eigenen melodramatischen Mutmaßungen über die Zukunft anzustellen. Aber wie alle Menschen, die glauben, durch ihren Willen, ihre Intelligenz, ihre Kraft den Lauf der Geschichte ändern zu können, maß Yabril weder den Zufällen und Fügungen der Geschichte noch der Möglichkeit ausreichend Bedeutung bei, daß es Menschen gab, die noch schlimmer waren als er. Menschen, die in der strikten Ordnung der Gesellschaft erzogen worden waren und die Maske gütiger Gesetzgeber trugen, konnten weit skrupelloser und grausamer sein als er.
Während er die frommen Pilger in den Straßen von Rom beobachtete, die fröhlich und rückhaltlos an einen allmächtigen Gott glaubten, war er von der eigenen Unüberwindlichkeit überzeugt. Von Stolz erfüllt gedachte er über jede Möglichkeit zur Vergebung durch ihren Gott hinauszugehen, denn an der äußersten Grenze des Bösen mußte ja das Gute beginnen!
Inzwischen hatte Yabril die ärmeren Viertel der Stadt erreicht, wo die Menschen leichter einzuschüchtern und zu bestechen waren. Bei Einbruch der Dunkelheit stand er vor Romeos »sicherem« Haus. Die Wohnungen in diesem uralten, vierstöckigen Gebäude mit seinem großen, halb von einer Steinmauer umgebenen Garten waren alle in der Hand der Untergrundbewegung. Yabril wurde von einer der drei Frauen in Romeos Gruppe eingelassen, einer mageren Person in Jeans und blauem Drillichhemd, das fast bis zur Taille offenstand. Da sie keinen BH trug, war die Rundung der Brüste zu erkennen. Sie hatte schon einmal an einer von Yabrils Operationen teilgenommen. Er mochte sie zwar nicht, bewunderte aber ihre wilde Entschlossenheit. Als sie einmal in Streit gerieten, hatte sie keinen Millimeter nachgegeben.
Die Frau hieß Annee. Das pechschwarze Haar trug sie zu einem Bubikopf geschnitten, der ihren strengen, groben Zügen alles andere als schmeichelte, jedoch die Aufmerksamkeit auf ihre lodernden blauen Augen lenkte, die jeden, sogar Romeo und Yabril, mit zornigem Fanatismus zu mustern schienen. Sie war nicht über den ganzen Umfang des Unternehmens unterrichtet, erkannte aber an Yabrils Auftauchen, daß es von fundamentaler Bedeutung sein mußte. Nachdem Yabril eingetreten war, schloß sie mit einem flüchtigen Lächeln wortlos die Tür.
Voll Abscheu registrierte Yabril, wie schmutzig es in diesem Haus war. Überall im Wohnzimmer standen gebrauchte Teller, Gläser und Essensreste herum, der Fußboden war mit Zeitungsblättern übersät. Romeos Gruppe bestand ausschließlich aus Italienern, vier Männern und drei Frauen. Die Frauen weigerten sich, zu putzen, denn die Übernahme häuslicher Pflichten während einer Operation verstieß so lange gegen ihre revolutionäre Überzeugung, wie die Männer nicht ebenfalls ihren Teil dazu beitrugen. Die Männer, alle noch sehr junge Studenten, glaubten zwar ebenfalls an die Rechte der Frauen, waren jedoch die verzogenen Lieblinge ihrer italienischen Mütter und wußten überdies, daß später, nachdem sie fort waren, eine Spezialgruppe das Haus säubern und alle verräterischen Spuren beseitigen würde. Also hatten sie sich auf den unausgesprochenen Kompromiß geeinigt, den Unrat einfach zu übersehen. Ein Kompromiß, der einzig Yabril ärgerte.
»Ihr seid Schweine«, sagte er zu Annee.
Annee musterte ihn mit kühler Verachtung. »Ich bin keine Haushälterin.«
Und Yabril erkannte sofort wieder, was sie auszeichnete: Sie fürchtete sich weder vor ihm noch vor irgendeinem anderen Menschen. Sie war eine echte Fanatikerin und durchaus bereit, auf dem Scheiterhaufen zu verbrennen. Alle Alarmglocken schrillten in seinem Schädel.
Romeo, so hübsch, so lebenssprühend, daß Annee die Augen niederschlug, kam von der oberen Wohnung die Treppe heruntergelaufen, um Yabril mit aufrichtiger Zuneigung zu umarmen; dann führte er ihn in den Garten hinaus, wo sie sich auf einer kleinen Steinbank niederließen. Die Abendluft war mit dem Duft der Frühlingsblumen erfüllt, und mit dem Duft trug der Wind ein leises Summen herüber, die lauten und leisen Stimmen zahlloser Tausende von Pilgern in den Straßen des österlichen Rom.
Romeo steckte sich eine Zigarette an. »Endlich ist unsere Zeit gekommen, Yabril«, sagte er. »Und was auch geschieht, unsere Namen werden den Menschen auf ewig in Erinnerung bleiben, wir werden berühmt sein.«
Angesichts dieser übertrieben romantischen Vorstellung persönlichen Ruhms lachte Yabril verächtlich. »Berüchtigt, würde ich sagen«, entgegnete er. »Wir konkurrieren mit einer langen Geschichte des Terrors. «Yabril dachte an Romeos Umarmung: seinerseits ein Ausdruck professioneller Zuneigung, durchzogen jedoch vom Entsetzen gemeinsamer Erinnerung, wie bei zwei Brüdern vor dem Leichnam des Vaters, den sie gemeinsam ermordet haben.
Entlang der Gartenmauer brannten matte elektrische Lichter, ihre Gesichter jedoch lagen im Dunkeln. »Nach und nach werden sie alles erfahren«, sagte Romeo. »Aber werden sie unsere Motive erkennen? Oder werden sie uns als Wahnsinnige hinstellen? Aber was soll’s, die Dichter der Zukunft werden uns verstehen.«
»Darüber wollen wir uns jetzt nicht den Kopfzerbrechen«, mahnte Yabril. Es war ihm peinlich, wenn Romeo theatralisch wurde, und allmählich begann er an der Verwendbarkeit des anderen zu zweifeln, obwohl der Freund dies schon oft unter Beweis gestellt hatte. Denn Romeo war trotz seiner eleganten Schönheit und seiner etwas wirren Vorstellungen ein überaus gefährlicher Mann. Nur ein grundlegender Unterschied bestand zwischen den beiden Kampfgefährten: Romeo war allzu draufgängerisch, während Yabril möglicherweise allzu ausgebufft war.
Erst ein Jahr zuvor waren sie beide durch die Straßen von Beirut geschlendert. Vor ihnen auf dem Pflaster lag eine braune, scheinbar leere Papiertüte, fettfleckig von den Lebensmitteln, die sie enthalten hatte. Yabril machte einen Bogen um sie. Romeo beförderte die Tüte mit einem kräftigen Tritt in die Gosse. Unterschiedliche Instinkte. Yabril war überzeugt, daß alles auf dieser Erde gefährlich sei. Romeo besaß ein gewisses naives Vertrauen.
Aber es gab noch mehr Unterschiede. Yabril mit seinen kleinen, braun gesprenkelten Augen war häßlich, Romeo dagegen nahezu schön. Yabril war stolz auf seine Häßlichkeit, Romeo schämte sich seiner Schönheit. Yabril hatte schon früh begriffen, daß es, wenn ein naiver Mensch sich ganz der politischen Umwälzung verschreibt, zu Mord führen muß. Romeo hatte das erst spät begriffen, und auch dann nur zögernd. Seine Bekehrung war eine rein intellektuelle gewesen.
Romeo hatte mit seiner zufälligen körperlichen Schönheit sexuelle Eroberungen gemacht, das Geld seiner Familie hatte ihn vor wirtschaftlichen Demütigungen geschützt. Und da er intelligent genug war, um zu erkennen, daß sein glückliches Schicksal moralisch ungerecht war, verabscheute er sein schönes Leben. Er versenkte sich in die Literatur und seine Studien, die ihn in seinen Erkenntnissen bestärkten. So war vorauszusehen gewesen, daß es seinen radikalen Professoren schließlich gelang, ihm einzureden, er müsse helfen, die Welt zu verbessern.
Er wollte nicht wie sein Vater werden, ein Italiener, der mehr Zeit beim Friseur verbrachte als eine Edelnutte bei ihrem Haarstylisten. Romeo wollte sein Leben nicht mit der Jagd nach schönen Frauen vergeuden. Auf gar keinen Fall aber wollte er Geld ausgeben, an dem der stinkende Schweiß der Armen klebte. Zuerst mußten die Armen befreit und glücklich gemacht werden, dann konnte auch er sein Glück genießen. Also griff er, als eine Art zweiter Kommunion, nach den Schriften von Karl Marx.
Yabrils Bekehrung war eher aus dem Bauch erfolgt. Als Kind hatte er in Palästina wie im Paradies gelebt. Er war ein fröhlicher Junge gewesen, extrem intelligent und seinen Eltern liebevoll ergeben. Vor allem dem Vater, der ihm täglich eine Stunde lang aus dem Koran vorlas.
Die Familie bewohnte mehrere große Villen mit vielen Dienstboten auf weitläufigen Grundstücken, die inmitten der dürren Wüste auf wundersame Weise in üppigem Grün prangten. Eines Tages jedoch, als Yabril fünf Jahre alt war, wurde er aus diesem Paradies vertrieben. Seine geliebten Eltern verschwanden, Villa und Gärten lösten sich in eine Wolke aus purpurrotem Staub auf. Und plötzlich lebte er als Waise in einem kleinen, schmutzigen Dorf am Fuß eines Berges, abhängig von der Wohltätigkeit seiner Verwandten. Sein einziger Schatz war der Koran des Vaters, auf Pergament gedruckt mit kolorierten Figuren aus Gold und wundervoller Schönschrift in leuchtendem Blau. Immer wieder erinnerte das Buch ihn daran, wie der Vater ihm nach Moslembrauch wortgetreu daraus vorgelesen hatte. Alle Befehle Gottes an den Propheten Mohammed, Worte, über die niemand diskutieren oder streiten durfte. Als Erwachsener hatte Yabril einmal zu einem jüdischen Freund gesagt: »Unser Koran ist nicht eure Torah«, und beide hatten darüber gelacht.
Die Wahrheit über seine Vertreibung aus dem Paradies war ihm fast sofort offenbart worden, verstanden hatte er sie jedoch erst einige Jahre später: Sein Vater hatte heimlich für die Befreiung Palästinas aus der Gewalt des Staates Israel gearbeitet, war ein Führer der Untergrundbewegung gewesen. Der Vater war verraten, bei einer Polizeirazzia niedergeschossen worden, und seine Mutter hatten sie umgebracht, als die Villa und das gesamte Grundstück von den Israelis in die Luft gejagt wurden.
Daher war es selbstverständlich für Yabril, daß er zum Terroristen wurde. Seine Blutsverwandten und die Lehrer seiner Schule lehrten ihn, alle Juden zu hassen, hatten aber nicht hundertprozentigen Erfolg damit. Er haßte seinen Gott dafür, daß er ihn aus dem Kindheitsparadies vertrieben hatte. Als er achtzehn Jahre alt war, verkaufte er den Koran seines Vaters für einen immensen Geldbetrag und immatrikulierte sich an der Universität von Beirut. Dort brachte er den größten Teil seines Vermögens mit käuflichen Damen durch, wurde nach zwei Jahren Mitglied des palästinensischen Untergrunds und mit der Zeit zu einer tödlichen Waffe im Dienste der Organisation. Aber die Freiheit seines Volkes war nicht sein Endziel, denn irgendwie war seine Arbeit auch eine Suche nach innerem Frieden.
Als sie jetzt miteinander im Garten des »sicheren« Hauses saßen, brauchten Romeo und Yabril etwas mehr als zwei Stunden, um noch einmal jede Einzelheit ihres Vorhabens durchzusprechen. Romeo rauchte eine Zigarette nach der anderen, doch seine Nervosität hatte nur einen einzigen Grund. »Bist du sicher, daß die mich rausgeben werden?« erkundigte er sich.
Und Yabril antwortete ruhig: »Wieso denn nicht, bei der Geisel, die ich in meiner Gewalt haben werde? Glaube mir, Romeo, du wirst bei denen sicherer sein als ich in Sherhaben.«
Als sie einander im Dunkeln ein letztes Mal umarmten, ahnten sie nicht, daß sie sich nach dem Ostersonntag nie mehr wiedersehen sollten.
Als Yabril fort war, rauchte Romeo im dunklen Garten eine letzte Zigarette. Hinter der Mauer konnte er die Turmspitzen der großen Kathedralen von Rom erkennen. Dann ging er ins Haus: Es war Zeit, seine Gruppe zur Einsatzbesprechung zusammenzurufen.
Annee, Waffenmeisterin ihrer Gruppe, schloß die große Kiste auf, um Waffen und Munition auszugeben. Einer der Männer breitete ein schmutziges Bettlaken auf dem Wohnzimmerfußboden aus, während Annee Gewehröl und Lappen holte. Bei der Instruktion sollten die Gruppenmitglieder ihre Waffen reinigen. Stundenlang lauschten sie, stellten Fragen, rekapitulierten jeden Schritt. Als Annee die Kleidung für den Einsatz verteilte, rissen sie ihre Witze darüber. Schließlich setzten sie sich alle zu einem Essen hin, das Romeo mit den anderen Männern zubereitet hatte, und stießen mit jungem Frühlingswein auf den Erfolg ihres Unternehmens an. Dann spielten einige von ihnen noch eine Stunde lang Karten, bevor sie sich auf ihre Zimmer zurückzogen. Einen Wachtposten brauchten sie nicht; sie hatten das Haus fest verschlossen und ihre Waffen griffbereit neben dem Bett. Trotzdem vermochten sie kaum zu schlafen.
Es war nach Mitternacht, als Annee, die Waffenmeisterin, an Romeos Tür klopfte. Romeo las noch. Er ließ sie ein. Annee schleuderte seine Ausgabe der Brüder Karamasow zu Boden und sagte verächtlich: »Liest du schon wieder diesen Mist?« Lächelnd zuckte Romeo die Achseln. »Es amüsiert mich; die Personen kommen mir vor wie Italiener, die sich verzweifelt bemühen, ernsthaft zu sein.« Hastig, fast verstohlen zogen sie sich aus und legten sich nebeneinander auf die verschmutzten Laken. Ihre Körper waren gespannt, doch nicht von sexueller Erregung, sondern von einer unerklärlichen Angst. Romeo starrte zur Decke empor, während Annee, die links von ihm lag, die Augen schloß und ihn mit der Rechten langsam und behutsam zu masturbieren begann. Ihre Schultern berührten sich ganz leicht, doch ihre Körper lagen getrennt nebeneinander. Als Annee spürte, daß Romeo erigiert war, setzte sie die Bewegungen ihrer Rechten fort, während sie sich gleichzeitig mit der linken Hand selbst befriedigte. Es war ein steter, langsamer Rhythmus, und Romeo streckte nur einmal tastend die Hand aus, um ihre kleine Brust zu berühren, wobei sie wie ein kleines Kind die Augen zukniff und eine angewiderte Grimasse zog. Nun wurden ihre Bewegungen fester und stärker, bis Romeo zum Orgasmus kam. Während sein Sperma sich über Annees Hand ergoß, kam auch sie zum Höhepunkt; sie riß die Augen auf, ihr magerer Körper schien sich aufzubäumen, und sie wandte sich Romeo zu, als wolle sie ihn küssen, zog aber den Kopf zurück und barg ihn statt dessen sekundenlang an seiner Brust, bis ihr Körper erschauernd zur Ruhe kam. Kurz danach richtete sie sich resolut auf und säuberte ihre Hand an dem verschmutzten Bettlaken. Dann nahm sie Romeos Zigaretten und Feuerzeug von der Marmorplatte des Nachttischs und fing an zu rauchen. »Jetzt ist mir wohler«, stellte sie fest.
Romeo ging ins Badezimmer und befeuchtete ein Handtuch. Als er zurückkam, reinigte er ihre Hände und sich selbst. Dann reichte er ihr das Handtuch, und sie säuberte sich zwischen den Beinen.
Dasselbe hatten sie schon bei einem anderen Einsatz getan, daher begriff Romeo, daß dies die einzige Form von Zuneigung war, die sie sich zu gestatten vermochte. Denn aus irgendeinem Grund war sie so fanatisch auf ihre Unabhängigkeit versessen, daß sie es nicht ertragen konnte, wenn ein Mann, den sie nicht liebte, in sie eindrang. Und sowohl Fellatio als auch Cunnilingus, die er ihr vorschlug, waren für sie nur eine andere Form der Unterwerfung. Was sie mit ihm gemacht hatte, war für sie die einzige Möglichkeit, ihr Verlangen zu befriedigen, ohne ihr Ideal der Unabhängigkeit zu verraten.
Romeo beobachtete ihr Gesicht. Jetzt war ihre Miene nicht mehr so streng, ihr Blick nicht mehr ganz so fanatisch. Sie ist noch so jung, dachte er; wie hat sie in einer so kurzen Zeit nur so absolut tödlich werden können? »Möchtest du heute nacht bei mir schlafen – nur um nicht allein zu sein?« fragte er sie.
Annee drückte ihre Zigarette aus. »O Gott, nein!« antwortete sie. »Warum sollte ich? Wir haben doch beide gehabt, was wir brauchen.« Sie begann sich anzukleiden.
»Du könntest mir wenigstens was Liebes sagen, bevor du gehst«, gab Romeo scherzend zurück.
Sekundenlang blieb Annee an der offenen Tür stehen; dann wandte sie sich zu ihm um. Flüchtig glaubte er, sie werde zu ihm ins Bett zurückkehren, denn sie lächelte. Zum erstenmal sah er in ihr das junge Mädchen, das er hätte lieben können. Doch dann schien sie sich auf die Zehenspitzen hochzurecken und entgegnete: »Romeo, o Romeo, warum bist du Romeo?« Damit machte sie ihm eine lange Nase und verschwand.
An der Brigham Young University in Provo, Utah, trafen David Jatney und Cryder Cole, zwei Studenten, ihre Vorbereitungen für die traditionell einmal pro Semester organisierte Mörderjagd, ein Spiel, das mit der Wahl von Francis Xavier Kennedy zum Präsidenten der Vereinigten Staaten wieder in Mode gekommen war. Nach den Spielregeln mußte ein Studententeam innerhalb von vierundzwanzig Stunden das Attentat ausführen, das heißt, die Spielzeugpistolen aus einer Entfernung von höchstens fünf Schritten auf eine Pappfigur des Präsidenten der Vereinigten Staaten abfeuern. Dies zu verhindern suchte das aus über hundert Verbindungsstudenten bestehende Team für die Verteidigung von Law and Order. Mit dem Gewinn der Geldwette wurde nach Beendigung der »Jagd« das Siegesbankett bezahlt.
Obwohl der Lehr- und Verwaltungskörper des von der Mormonenkirche beeinflußten Colleges diese Spiele mißbilligte, waren sie an allen Universitäten der Vereinigten Staaten populär geworden - eines der Ärgernisse einer freien Gesellschaftsform. Diesem Übermut der Jugend lag zum Teil schlechter Geschmack und eine Neigung für die primitiveren Aspekte des Lebens zugrunde. Außerdem war er ein Ventil für das Aufbegehren gegen die Autorität, ein Protest all jener, die noch nichts erreicht hatten, gegen jene, die schon erfolgreich waren. Ein symbolischer Protest und ganz gewiß besser als politische Demonstrationen, spontane Gewalttätigkeiten und Sit-ins. Das Jägerspiel war ein Sicherheitsventil für rebellierende Hormone.
David Jatney und Cryder Cole, die beiden »Jäger«, schlenderten Arm in Arm über den Campus. Da Jatney der Planer und Cole der Ausführende war, übernahm Cole das Reden, während Jatney nur nickte, als sie auf die Verbindungsstudenten zugingen, von denen die Präsidentenpuppe bewacht wurde. Die Pappfigur von Francis Kennedy wies eine gewisse Ähnlichkeit mit ihm auf, war aber auffallend farbig gekleidet: in einen blauen Anzug mit grüner Krawatte, roten Socken und ohne Schuhe. An der Stelle der Schuhe befand sich die römische Ziffer IV.
Da die Law-and-Order-Gruppe Jatney und Cole mit Spielzeugpistolen bedrohte, schwenkten die beiden »Jäger« ab. Cole ließ eine muntere Schimpfkanonade los, doch Jatney zog eine finstere Miene. Er nahm seinen Auftrag mehr als ernst. Jatney rekapitulierte seinen eigenen Plan und sah bereits jetzt mit grimmiger Genugtuung, daß er mit Sicherheit Erfolg haben würde. Dieser Vormarsch im Angesicht der Feinde diente ausschließlich dazu, den Gegnern zu zeigen, daß sie Skikleidung trugen, das heißt ein bestimmtes Erscheinungsbild zu fixieren und dadurch eine spätere Überraschung vorzubereiten. Und den Eindruck zu erwecken, sie verließen den Campus fürs ganze Wochenende.
Wichtiger Bestandteil bei diesem »Jägerspiel« war es, daß der Terminplan der Präsidentenpuppe bekanntgegeben werden mußte. Am selben Abend sollte sie an dem Siegesbankett teilnehmen, das vor Mitternacht stattfinden würde. Jatney und Cole hatten sich vorgenommen, unmittelbar vor dem Ende um Mitternacht zuzuschlagen.
Alles verlief genau wie geplant. Um sechs Uhr nachmittags trafen sich Jatney und Cole in dem vorgesehenen Restaurant. Der Besitzer hatte keine Ahnung von ihrem Plan. Für ihn waren sie nur zwei junge Studenten, die während der vergangenen vierzehn Tage bei ihm gearbeitet hatten. Sie waren ausgezeichnete Kellner, vor allem Cole, und der Besitzer hatte seine Freude an ihnen.
Um neun Uhr abends, als die Law-and-Order-Wache, einhundert Mann stark, mit der Präsidentenpuppe Einzug hielt, wurden an allen Eingängen des Restaurants Posten aufgestellt. Die Puppe wurde ins Zentrum eines Kreises aus Tischen gesetzt. Der Besitzer rieb sich die Hände vor Genugtuung über das gute Geschäft, das er machte. Erst als er in die Küche ging und sah, wie seine beiden jungen Kellner Spielzeugpistolen in den Suppenterrinen versteckten, ging ihm ein Licht auf. »O Gott, nein!« stöhnte er. »Das heißt ja, daß ihr beiden heute abend bei mir aufhört!« Cole grinste ihn an, David Jatney dagegen schenkte ihm einen finsteren Blick, als sie, die Suppenterrinen hochgestemmt, damit ihre Gesichter dahinter nicht zu sehen waren, in den Speisesaal marschierten.
Die Wachen tranken bereits auf ihren Sieg, als Jatney und Cole die Terrinen auf den Mitteltisch stellten, die Deckel abnahmen und die Spielzeugpistolen herausholten. Sie richteten ihre Waffen auf die grellbunt gekleidete Puppe und feuerten sie mit kleinen Plop-Geräuschen ab. Cole gab einen Schuß ab und brach in Lachen aus. Jatney feuerte drei sorgfältig gezielte Schüsse und warf seine Pistole zu Boden. Er rührte sich nicht und lächelte auch nicht, bis die Wachmannschaft ihn fluchend beglückwünschte und sie alle zum Dinner Platz nahmen. Jatney beförderte die Puppe mit einem Tritt zu Boden, wo sie nicht mehr zu sehen war.
Das war eine der einfacheren »Jagden« gewesen. An anderen Colleges im ganzen Land verlief das Spiel wesentlich ernsthafter. Nicht nur wurden ausgeklügelte Sicherheitssysteme eingesetzt, sondern auch Puppen, die synthetisches Blut verspritzten. Die Presse vermutete, daß dieser Brauch durch die Wahl Francis Xavier Kennedys zum Präsidenten wieder zum Leben erweckt worden war. An den liberaleren Colleges war die Puppe gelegentlich schwarz.
In Washington D.C. jedoch verfügte Christian Klee, Justizminister der Vereinigten Staaten, über eine eigene Kartei all dieser verspielten Attentäter, wobei das Foto und Memo über Jatney sein besonderes Interesse erregten. Er nahm sich vor, ein Ermittlungsteam auf David Jatneys Vergangenheit anzusetzen.
An diesem selben Karfreitag fuhren zwei weit ernsthaftere junge Männer mit weit idealistischeren Überzeugungen als Jatney und Cole und weit besorgter um die Zukunft ihrer Welt vom Massachusetts Institute of Technology nach New York und deponierten in einem Gepäckschließfach der Hafenbehörde einen kleinen Koffer. Vorsichtig suchten sie sich einen Weg durch die Menge der betrunkenen, obdachlosen Penner, der scharfäugigen Zuhälter, der mit ihrer Arbeit beginnenden Huren in den Hallen. Die beiden waren Wunderkinder: mit zwanzig Jahren bereits Physikprofessoren und Mitarbeiter eines wissenschaftlichen Forschungsprogramms der Universität. Der Koffer enthielt eine winzige Atombombe, die sie aus gestohlenem Labormaterial und dem erforderlichen Plutoniumoxyd zusammengebaut hatten. Zwei Jahre hatten sie gebraucht, um dieses Material Stück für Stück aus den Vorräten ihres Programms zu stehlen, indem sie Berichte und Experimente fälschten, um ihre Diebstähle zu kaschieren.
Sie hießen Adam Gresse und Henry Tibbot und hatten bereits mit zwölf Jahren als kleine Genies gegolten. Von ihren Eltern waren sie dazu erzogen, sich ihrer Verantwortung gegenüber der Menschheit bewußt zu sein. Sie hatten keine Laster, es sei denn, ihr immenses Wissen. Auf Grund ihrer brillanten Intelligenz verachteten sie all jene Verlockungen, die sie als Läuse im Pelz der Menschheit betrachteten: Alkohol, Glücksspiel, Frauen, Völlerei und Drogen.
Der übermächtigen Droge des klaren Denkens jedoch waren sie verfallen. Die beiden besaßen ein soziales Gewissen und erkannten das Ausmaß des Bösen in der Welt. Sie wußten, daß der Bau von Atomwaffen ein Fehler war, daß das Schicksal der Menschheit auf dem Spiel stand, und beschlossen, alles zu tun, was in ihren Kräften stand, um eine endgültige Katastrophe abzuwenden. Deshalb beschlossen sie nach einem Jahr kindlichen Geredes, der Regierung einen Schrecken einzujagen. Sie würden beweisen, wie einfach es für einen blindwütigen Fanatiker war, der Menschheit einen schweren Schaden zuzufügen. Also bauten sie eine winzige Atombombe, nur eine halbe Kilotonne stark, um sie irgendwo zu deponieren und die Behörden vor ihr zu warnen. Sie hielten sich selbst und ihre Tat für einzigartig, göttergleich. Sie wußten nicht, daß eben diese Situation bereits von den psychologischen Berichten eines hochrangigen, von der Regierung eingerichteten think tank, einer Art Strategiekommission, als eine der Möglichkeiten des Atomzeitalters vorausberechnet worden war.
Noch während sie sich in New York aufhielten, gaben Adam Gresse und Henry Tibbot ihr Warnschreiben an die New York Times auf, in dem sie ihre Beweggründe darlegten und baten, den Brief zu veröffentlichen, bevor er an die Behörden weitergesandt wurde. Mit der Formulierung dieses Briefes hatten sie sich sehr große Mühe gegeben – nicht nur, weil er sorgfältig abgefaßt werden mußte, um eindeutig klarzustellen, daß nichts Böses beabsichtigt war, sondern auch, weil sie gedruckte Wörter und Buchstaben aus alten Zeitungen benutzten, die sie ausschnitten und auf leere Papierbogen klebten.
Die Bombe sollte nicht vor dem folgenden Donnerstag losgehen. Bis dahin würde das Schreiben bei den Behörden eingetroffen und die Bombe gefunden worden sein. Als Warnung an die Herren der Welt.
Oliver Ollifant war hundert Jahre alt, sein Verstand aber war noch so scharf wie eine Messerschneide. Zu seinem Unglück.
Es war ein so brillanter und doch subtiler Verstand, daß er Ollifant, obwohl er zahllose moralische Gesetze gebrochen hatte, immer wieder ein reines Gewissen bescherte. Ein so gerissener Verstand, daß Oliver Ollifant kein einziges Mal in die fast unvermeidlichen Fallen des Alltagslebens getappt war: Er hatte niemals geheiratet, niemals für ein politisches Amt kandidiert und niemals einen Freund gehabt, dem er uneingeschränkt vertraute.
Auf seinem riesigen, abgelegenen und schwer bewachten Besitz, nur zehn Meilen vom Weißen Haus, erwartete Oliver Ollifant, der reichste Bürger und vermutlich mächtigste Privatmann von ganz Amerika, die Ankunft seines Patensohnes Christian Klee, Justizminister der Vereinigten Staaten.
Oliver Ollifants Charme vermochte es durchaus mit seinem brillanten Verstand aufzunehmen, und seine Macht stützte sich auf beide Eigenschaften zugleich. Sogar im fortgeschrittenen Alter von einhundert Jahren baten ihn noch immer zahlreiche große Männer um Rat und verließen sich so sehr auf seine analytischen Fähigkeiten, daß man ihm den Beinamen »das Orakel« verliehen hatte.
Als Berater von Präsidenten hatte das Orakel Wirtschaftskrisen, Wall-Street-Zusammenbrüche, Dollarkursstürze, die Flucht ausländischen Kapitals, die Phantasien von Ölprinzen ebenso vorausgesagt wie die politischen Schachzüge der Sowjetunion und die unerwartete Versöhnung von Rivalen der demokratischen oder republikanischen Partei. Vor allem aber hatte er zehn Milliarden Dollar angehäuft. Daß man den Rat eines so reichen Mannes schätzte, selbst wenn er sich einmal irrte, war verständlich. Das Orakel hatte aber so gut wie immer recht.
Heute, an diesem Karfreitag, beschäftigte sich das Orakel jedoch nur mit einem einzigen Problem: der Geburtstagsparty zur Feier seiner einhundert Erdenjahre. Eine Party, die am Ostersonntag im Rosengarten des Weißen Hauses stattfinden und deren Gastgeber kein anderer sein sollte als der Präsident der Vereinigten Staaten, Francis Xavier Kennedy höchstpersönlich.
Es war eine verständliche Eitelkeit, daß sich das Orakel ganz unmäßig auf dieses spektakuläre Ereignis freute. Einen kurzen Augenblick lang würde die Welt sich wieder seiner erinnern. Es wird, dachte er traurig, mein letzter Auftritt auf dieser Bühne sein.
In Rom schließlich bereitete sich an diesem Karfreitag Theresa Catherine Kennedy, Tochter des Präsidenten der Vereinigten Staaten, auf das Ende ihres europäischen Exils und die Rückkehr ins Weiße Haus vor, wo sie mit ihrem Vater zusammenleben sollte. Ihr Team von Sicherheitsbeamten des Secret Service hatte bereits alle Reisevorbereitungen getroffen. Auf ihre Anweisung hin hatten sie einen Platz für den Flug Rom–New York am Ostersonntag gebucht.
Theresa Kennedy war dreiundzwanzig Jahre alt und hatte in Europa studiert – zuerst an der Sorbonne in Paris und dann in Rom, wo sie zur beiderseitigen Erleichterung soeben eine recht ernsthafte Affäre mit einem radikalen italienischen Studenten beendet hatte.
Sie liebte ihren Vater, fand aber die Tatsache, daß er Präsident war, ausgesprochen unangenehm, weil sie zu loyal war, um ihren eigenen Ansichten öffentlich Ausdruck zu verleihen. Sie glaubte an den Sozialismus, glaubte daran, daß alle Menschen Brüder und alle Frauen Schwestern seien. Sie war Feministin auf amerikanische Art: Da finanzielle Unabhängigkeit für sie die Grundlage der Freiheit war, hatte sie auch kein schlechtes Gewissen hinsichtlich des Treuhandfonds, der ihr diese Freiheit gestattete.
Aus einer merkwürdigen, aber sehr menschlichen Moralauffassung heraus lehnte sie alle Privilegien ab und besuchte ihren Vater nur selten im Weißen Haus. Außerdem gab sie dem Vater -möglicherweise unbewußt – die Schuld am Tod ihrer Mutter, weil er, während sie im Sterben lag, weiter um die politische Macht gekämpft hatte. Später hatte sie versucht, in Europa unterzutauchen, mußte sich aber aus Sicherheitsgründen als enges Mitglied der Präsidentenfamilie vom Secret Service beschützen lassen. Ihr Versuch, sich diesem Schutz offiziell zu entziehen, war ebenfalls gescheitert: Ihr Vater hatte sie gebeten, es nicht zu tun. Wie Francis Kennedy ihr erklärte, würde er es nicht ertragen können, wenn ihr etwas zustoßen sollte.
Und so wurde Theresa Kennedy durch ein zwanzig Mann starkes, über drei Tagesschichten verteiltes Team bewacht. Wann immer sie ein Restaurant besuchte oder mit ihrem Freund ins Kino ging - sie waren dabei. Sie mieteten Wohnungen im selben Haus, operierten von einem Kommandowagen aus und ließen sie niemals allein. Außerdem mußte sie an jedem einzelnen Tag dem Chef des Sicherheitstrupps ihren Terminplan mitteilen.
Ihre Wachen waren janusköpfige Ungeheuer, halb Diener, halb Herren. Mit ihrer modernen elektronischen Ausrüstung vermochten sie sie sogar bei der Liebe zu belauschen, wenn sie einen Freund in ihre Wohnung mitnahm. Und sie wirkten einschüchternd, bewegten sich wie Wölfe, lautlos schleichend, den Kopf aufmerksam schräggelegt, als wollten sie Witterung aufnehmen, während sie in Wirklichkeit auf die Ohrhörer ihrer Funkgeräte lauschten.
Gegen ein absolut lückenloses Sicherheitsnetz, das heißt eine enge Überwachung in der Wohnung, ja sogar im Auto, hatte Theresa Kennedy sich erfolgreich gewehrt. Sie fuhr ihren Wagen selbst und weigerte sich, das Sicherheitsteam in die Nachbarwohnung einziehen oder die Männer auf der Straße neben sich gehen zu lassen. Sie bestand auf einer »peripheren« Sicherheitsüberwachung, bei der die Männer eine Art Mauer um sie errichteten, als bewege sie sich in einem großen Garten. So vermochte sie wenigstens ein gewisses Privatleben zu führen. Aber auch das führte zu peinlichen Momenten. Eines Tages ging sie einkaufen und brauchte Kleingeld für ein Telefongespräch. In der Nähe hatte sie einen ihrer Sicherheitsbeamten entdeckt, der so tat, als kaufe er ebenfalls ein. Sie ging auf ihn zu und fragte ihn: »Könnten Sie mir einen Gettone geben?« Der Mann starrte sie völlig entgeistert an, und ihr wurde klar, daß sie einen Fehler gemacht hatte, daß er gar kein Sicherheitsbeamter war. Sie prustete vor Lachen und entschuldigte sich. Der Mann überreichte ihr vergnügt eine Telefonmünze. »Für eine Kennedy – mit Freuden«, erklärte er scherzend.
Wie so viele junge Leute glaubte auch Theresa Kennedy, ohne einen bestimmten Beweis dafür zu haben, daß die Menschen »gut« seien; ebenso wie sie sich selbst für »gut« hielt. Sie marschierte für die Freiheit, sprach sich für das Recht und gegen das Unrecht aus. Sie versuchte, niemals jene kleinen, aber gemeinen Dinge des Alltagslebens zu tun. Als Kind hatte sie ihr Sparschweinchen den amerikanischen Indianern geschenkt.
Für Theresa als Tochter des Präsidenten der Vereinigten Staaten gehörte es sich nicht, für die Abtreibung einzutreten und ihren Namen für radikale oder linksgerichtete Organisationen herzugeben, die Schelte der Medien und die Beleidigungen politischer Gegner ertrug sie jedoch gelassen. In Liebesdingen war sie in ihrer Naivität betont gewissenhaft und fair, glaubte an absolute Offenheit und verabscheute Hinterlist.
Sie hätte aus ein paar nützlichen Lektionen lernen sollen. In Paris versuchte zum Beispiel einmal eine Bande Clochards, die unter einer Brücke lebten, sie zu vergewaltigen, als sie die Stadt auf der Suche nach Lokalkolorit durchstreifte. In Rom versuchten ihr zwei Bettler die Handtasche zu entreißen, als sie ihnen gerade Geld geben wollte, und jedesmal hatten ihre geduldigen, wachsamen Secret-Service-Beschützer sie retten müssen. Das alles aber vermochte ihren Glauben daran, daß der Mensch im Grunde gut sei, daß jeder Mensch den Keim des Guten in sich trage und niemand für die Erlösung verloren sei, nicht im geringsten zu beeinflussen. Als Feministin hatte sie natürlich von der Tyrannei der Männer über die Frauen gehört, konnte sich im Grunde aber keine Vorstellung von der brutalen Gewalt machen, die Männer anwandten, um mit ihrer Umwelt fertig zu werden. Sie begriff nicht, wie es ein Mensch über sich bringen konnte, einen anderen Menschen auf übelste und grausamste Weise zu hintergehen.
Der Chef ihres Bewacherteams, der zu alt war, um wichtigere Regierungsbeamte zu beschützen, war über ihre Naivität entsetzt und versuchte sie aufzuklären, indem er ihr Horrorstorys über die Menschen im allgemeinen erzählte, Storys aus seinen langen Jahren im Geheimdienst, wobei er freimütiger sprach als sonst, denn dies war sein letzter Auftrag vor der Pensionierung.
»Sie sind zu jung, um die Welt zu verstehen«, erklärte er. »Und in Ihrer Position müssen Sie äußerst vorsichtig sein. Sie glauben, weil Sie jemandem etwas Gutes tun, müsse derjenige zu Ihnen auch gut sein.« Erst am Tag zuvor hatte Theresa einen Anhalter mitgenommen, der sich einbildete, das sei eine Aufforderung zum Tanz. Der Sicherheitschef hatte sofort eingegriffen, und die beiden Begleitwagen drängten Theresas Auto genau in dem Moment an den Straßenrand, als der Anhalter ihr unter den Rock greifen wollte.
»Ich möchte Ihnen eine Geschichte erzählen«, sagte der Chef. »Ich habe früher mal für den klügsten und nettesten Mann des ganzen Regierungsapparates gearbeitet. Abteilung Geheimoperationen. Ein einziges Mal nur wurde er reingelegt, in eine Falle gelockt und war einem dieser schrecklichen Kerle ausgeliefert. Einfach umlegen hätte der ihn können. Aus irgendeinem Grund aber ließ er meinen Boß laufen und sagte: ›Vergiß nicht, daß du mir etwas schuldig bist.‹
Sechs Monate lang haben wir diesen Kerl gejagt und schließlich gestellt. Und mein Boß legte ihn um, ohne ihm eine Chance zur Kapitulation oder zum Überlaufen zu geben. Und wissen Sie, warum? Er hat es mir persönlich erklärt. Dieser Kerl hatte ein einziges Mal die Macht über Leben und Tod in der Hand und war daher zu gefährlich geworden, um ihn am Leben zu lassen. Außerdem war ihm mein Boß keineswegs dankbar, denn die gute Tat dieses Mannes sei nur eine Laune gewesen, und beim nächstenmal könne man nicht mit Launen rechnen.« Eines jedoch verschwieg der Sicherheitschef Theresa Kennedy: daß sein Boß ein Mann namens Christian Klee gewesen war.
All diese Ereignisse liefen an einem einzigen Punkt zusammen: Francis Xavier Kennedy, dem Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika.
Präsident Francis Xavier Kennedy und sein Wahlerfolg galten als Wunder in der amerikanischen Politik, denn obwohl er vor seiner Wahl zum Präsidenten nur eine einzige Amtsperiode im Senat abgeleistet hatte, war er aufgrund seines magisch wirkenden Namens und seiner außergewöhnlichen physischen und intellektuellen Fähigkeiten in das hohe Amt gewählt worden.
Er war der »Neffe« von John F. Kennedy, genannt Jack, dem Präsidenten, der 1963 ermordet wurde, betätigte sich aber außerhalb des organisierten Kennedy-Clans noch immer aktiv in der amerikanischen Politik. In Wirklichkeit war er ein Cousin, und zwar der einzige in der zahlreichen Familie, der das Charisma seiner beiden berühmten Onkels John und Robert Kennedy geerbt hatte.
Francis Kennedy war ein junges Genie auf dem Gebiet der Jurisprudenz gewesen, mit vierundzwanzig Jahren bereits Professor in Harvard. Später hatte er eine eigene Anwaltskanzlei gegründet, die sich für weitgehende liberale Reformen in der Regierung und auf dem Sektor der Privatwirtschaft einsetzte. Daß seine Anwaltskanzlei nicht sehr viel Geld einbrachte, war für ihn unwichtig, da er beträchtlichen Reichtum geerbt hatte, aber sie machte ihn im ganzen Land bekannt. Er trat für die Rechte von Minderheiten und für das Wohl Erwerbsunfähiger ein und trat als Verteidiger all derer auf, die auf die Hilfe anderer angewiesen waren.
All diese guten Taten hätten ihm politisch jedoch nichts eingebracht, wären da nicht seine übrigen Eigenschaften gewesen. Mit den strahlendblauen Augen seiner beiden ermordeten Onkels, der weißen Haut und dem pechschwarzen Haar sah er überdurchschnittlich gut aus. Er verfügte über einen Verstand, der messerscharf war, zugleich war er aber so humorvoll, daß er seine Gegner ohne auch nur eine Spur kleinkarierter Bosheit tödlich treffen konnte. Er war nie großspurig, nie arrogant. Er war gut bewandert in den Natur- und Geisteswissenschaften und schätzte vor allem menschliche Werte.
Die Hauptsache aber war, daß er im Fernsehen überwältigend gut ankam. Auf dem Bildschirm wirkte er faszinierend. Diese Eigenschaften sowie der Name Kennedy hatten ihm die Präsidentschaft eingebracht. Vier seiner engsten Freunde hatten seine Wahl organisiert: Christian Klee, Arthur Wix, Eugene Dazzy und Oddblood Gray, die er zu seinen persönlichen Beratern ernannte.
Als er zum demokratischen Präsidentschaftskandidaten gewählt wurde, tat Francis Kennedy etwas Merkwürdiges: Statt seinen ererbten Reichtum in Treuhandfonds anzulegen, stiftete er ihn für wohltätige Zwecke. Seine Frau und seine Tochter besaßen Treuhandfonds, die für ihre Bedürfnisse genügten; er selbst war talentiert genug, sich selbst einen luxuriösen Lebensunterhalt zu verdienen. Es sei kein großes Opfer, behauptete er wie einige seiner Gegner, aber er wollte eine Art Beispiel geben. Es gehörte zu seinen festen Überzeugungen, daß kein einzelner Mensch außerordentlichen Reichtum anhäufen dürfe. Nicht etwa, daß er ein Kommunist gewesen wäre – o nein, ein jeder Mann sollte selbst für seine Frau, seine Kinder, seine Familie sorgen dürfen. Warum aber sollte ein einzelner Mensch Milliarden Dollar besitzen? Seine Handlungsweise und seine Worte weckten bei Millionen Bewunderung und bei Tausenden glühenden Haß.
Große Dinge wurden von ihm erwartet, unglücklicherweise jedoch weigerte sich der mit Kennedy zeitgleich gewählte demokratische Kongreß, sein ehrgeiziges Sozialprogramm zu genehmigen. Im Fernsehen hatte Francis Kennedy versprochen, daß jede Familie eine menschenwürdige Unterkunft erhalten werde, er hatte außergewöhnliche Bildungspläne angekündigt, medizinische Versorgung für jeden Bürger zugesagt und erklärt, ein reiches Amerika könne ohne weiteres ein soziales Netz schaffen, das jene Unglücklichen auffangen werde, die auf die unterste Stufe der gesellschaftlichen Leiter absanken. Im Fernsehen wirkten diese Versprechen, zusammen mit seiner einschmeichelnden Stimme und seiner blendenden Erscheinung, begeisternd. Und nachdem er gewählt worden war, versuchte er aufrichtig, sie einzulösen. Der Kongreß aber stimmte gegen ihn.
An diesem Karfreitag traf er sich mit seinem Beraterstab sowie dem Vizepräsidenten, um ihnen allen eine Mitteilung zu machen, die ihnen bestimmt nicht gefallen würde.
Er hatte sie in den Yellow Oval Room des Weißen Hauses bestellt, sein Lieblingszimmer, das größer und bequemer war als das berühmtere Oval Office. Der Yellow Room glich eher einem Wohnzimmer, wo sie es sich bequem machen konnten, während englischer Tee serviert wurde.
Sie erwarteten ihn gemeinsam und erhoben sich, als seine Leibwächter vom Secret Service ihn hereinbegleiteten. Kennedy winkte ihnen, sich wieder zu setzen, während er die Leibwächter bat, draußen auf ihn zu warten. Zwei Dinge ärgerten ihn an dieser kleinen Szene: erstens, daß er die Männer vom Secret Service dem Protokoll entsprechend persönlich hinausbefehlen mußte, und zweitens, daß der Vizepräsident sich respektvoll vor dem Präsidenten zu erheben hatte. Was ihn besonders daran störte, war die Tatsache, daß der Vizepräsident eine Dame war und das politische Protokoll die gesellschaftliche Höflichkeit überwog. Hinzu kam, daß Vizepräsidentin Helen DuPray zehn Jahre älter war als er, immer noch eine schöne Frau war und über eine außergewöhnliche politische und gesellschaftliche Intelligenz verfügte. Das war natürlich auch der Grund, warum er sie als Mitkandidatin erkoren hatte, obwohl die Parteioberen der Demokraten dagegen gewesen waren.
»Verdammt, Helen«, sagte Francis Kennedy, »stehen Sie doch nicht jedesmal auf, wenn ich ein Zimmer betrete! Jetzt muß ich allen den Tee einschenken, um zu beweisen, wie bescheiden ich bin.«
»Ich wollte Ihnen meine Dankbarkeit ausdrücken«, erwiderte Helen DuPray. »Wenn die Vizepräsidentin zu Ihrer Stabsbesprechung eingeladen wird, dann meistens nur, um sich vorschreiben zu lassen, wie sie das Geschirr zu spülen hat.« Beide lachten. Die anderen nicht.
Francis Kennedy wartete, bis alle ihren Tee bekommen hatten; dann sagte er: »Ich habe beschlossen, nicht mehr für eine zweite Amtszeit zu kandidieren. Das ist der Grund, warum ich Sie zu dieser Sitzung gebeten habe. Helen«, wandte er sich an die Vizepräsidentin, »ich möchte, daß Sie sich auf die Kandidatur für die Präsidentschaft vorbereiten. Ich sichere Ihnen meine volle Unterstützung zu. Was immer das Ihnen nützen mag.«
Alle Anwesenden waren wie vom Donner gerührt; dann lächelte Helen DuPray dem Präsidenten zu. Die Herren erkannten nicht nur an, daß sie ein bezauberndes Lächeln besaß, sondern auch, daß dieses Lächeln eine ihrer mächtigsten politischen Waffen war. »Ich glaube, Francis«, entgegnete sie, »dieser Entschluß, nicht wieder zu kandidieren, erfordert eine eingehende Diskussion mit Ihrem Stab, und zwar ohne mein Beisein. Bevor ich mich also verabschiede, möchte ich noch folgendes sagen: Ich weiß, wie entmutigt Sie zu diesem speziellen Zeitpunkt durch das Verhalten des Kongresses sind. Für den Fall jedoch, daß ich gewählt werde, könnte ich bestimmt nichts besser machen als Sie. Ich finde, Sie sollten etwas geduldiger sein. In einer zweiten Amtszeit könnten Sie möglicherweise viel mehr erreichen.«
Ungeduldig widersprach Präsident Kennedy: »Sie wissen genausogut wie ich, Helen, daß ein Präsident der Vereinigten Staaten in der ersten Amtszeit weitaus mehr Einfluß hat als in der zweiten.«
»Das trifft zwar in den meisten Fällen zu«, bestätigte Helen DuPray. »Aber vielleicht bekommen wir für Ihre zweite Amtszeit ein anderes Repräsentantenhaus. Und noch etwas in meinem eigenen Interesse: Als Vizepräsidentin für nur eine Amtszeit bin ich in einer schwächeren Position als mit zweien. Außerdem wäre Ihre Unterstützung als Präsident mit zwei Präsidentschaftsperioden wertvoller für mich als die eines Präsidenten, der sich von seinem eigenen demokratischen Kongreß aus dem Amt hat jagen lassen.«
Als sie ihren Memo-Ordner nahm und sich zum Gehen wandte, sagte Francis Kennedy: »Sie können ruhig bleiben.«
Helen DuPray schenkte allen Herren ein liebenswürdiges Lächeln. »Ich bin sicher, daß Ihr Stab weit freier sprechen kann, wenn ich nicht anwesend bin«, erwiderte sie und verließ den Yellow Oval Room.
Die vier Männer um Kennedy schwiegen. Nachdem sich die Tür hinter ihr geschlossen hatte, entstand eine kurze Unruhe, als sie in ihren Memo-Ordnern blätterten oder nach Tee und Sandwiches griffen. Der Stabschef des Präsidenten, Eugene Dazzy, bemerkte beiläufig: »Helen ist so ziemlich die intelligenteste Person in dieser Regierung.« Dazzy war bekannt dafür, daß er eine Schwäche für schöne Frauen hatte.
Francis Kennedy sah ihn lächelnd an. »Und was meinen Sie, Euge?« erkundigte er sich. »Finden Sie auch, ich sollte geduldiger sein und ein zweites Mal kandidieren?«
Die Herren rutschten unruhig auf ihren Stühlen herum. So intelligent Helen DuPray auch sein mochte – sie kannte Francis Kennedy nicht so gut wie sie. Jeder der vier anwesenden Herren hatte eine weitaus engere Beziehung zum Präsidenten als sie. Alle waren sie entweder seit dem Beginn seiner politischen Laufbahn oder sogar noch länger bei ihm und sie wußten, daß hinter seiner leicht hingeworfenen, fast scherzhaften Bemerkung, er werde Helen DuPray unterstützen, eine praktisch unverrückbare Entscheidung stand. Und ebenfalls wußten sie, daß dies das Ende ihrer eigenen Macht bedeuten würde. Sie kamen recht gut aus mit der Vizepräsidentin, machten sich jedoch keinerlei Illusionen über das, was sie tun würde, sobald sie Präsidentin wurde: ihren eigenen, handverlesenen Beraterstab mitbringen.
Eugene Dazzy, Kennedys Stabschef, war ein fülliger, umgänglicher Mann, dessen Kunst darin bestand, zu vermeiden, daß Menschen, deren wichtige Wünsche und spezielle Anliegen der Präsident ablehnen mußte, zu seinen Feinden wurden. Als Dazzy den nahezu kahlen Kopf über seine Notizen beugte, spannten sich die Nähte des perfekt geschnittenen Jacketts über seinem faßformigen Oberkörper.
»Warum denn nicht kandidieren?« fragte er beiläufig. »Das wird doch ein richtig schöner Bummeljob. Der Kongreß wird Ihnen vorschreiben, was Sie zu tun haben, und sich weigern zu tun, was Sie von ihm verlangen. Alles wird so bleiben wie bisher. Nur nicht in der Außenpolitik; da können Sie sich ein bißchen Spaß erlauben. Und vielleicht sogar was Gutes tun. Gewiß, die Welt bricht auseinander, und die anderen Länder scheißen sozusagen auf uns, selbst die kleinen Fische tun das, unterstützt, wie wir ja wissen, von den großen amerikanischen Konzernen mit ihren internationalen Töchtern. Unsere Army liegt zahlenmäßig um fünfzig Prozent unter der Quote; wir haben unsere Kinder so prachtvoll erzogen, daß sie zu schlau sind, um Patrioten zu sein. Na schön, wir haben unsere Technologie, aber wer kauft unsere Produkte? Unsere Zahlungsbilanz sieht hoffnungslos aus. Japan verkauft weit mehr als wir, Israel besitzt eine effektivere Armee. Sie können nur davon profitieren. Ich sage, lassen Sie sich wiederwählen, entspannen Sie sich und genießen Sie die nächsten vier Jahre. Teufel noch mal, das ist doch kein schlechter Job, und das Geld können Sie auch ganz gut gebrauchen.« Lächelnd hob Dazzy die Hand, um zu zeigen, daß er es zumindest halb scherzhaft meinte.
Trotz ihrer scheinbar lässigen Haltung beobachteten die vier Herren den Präsidenten genau. Keiner von ihnen hatte das Gefühl, Dazzy habe sich respektlos verhalten; der etwas lässige Ton seiner Bemerkungen war von der Art, zu der Kennedy sie alle während der letzten drei Jahre ermutigt hatte.
Arthur Wix, der Berater für Nationale Sicherheit, war ein dicker Mann mit Großstadtgesicht, Sohn eines jüdischen Vaters und einer italienischen Mutter; er konnte auf recht bissige Art humorvoll sein, zeigte aber einen gewissen Respekt sowohl vor dem Präsidentenamt als auch vor Kennedy persönlich. Jetzt nahm er sich besonders zusammen. Außerdem fand er, daß seine schwere Verantwortung als Berater für Nationale Sicherheit von ihm einen ernsthafteren Ton verlangte als von den anderen. Also sprach er in einem ruhigen, überzeugenden Tonfall, der noch immer ein wenig den New Yorker verriet. »Euge«, sagte er, auf Dazzy deutend, »mag denken, daß er Witze macht, aber Sie können einen wertvollen Beitrag zur Außenpolitik unseres Landes leisten. Wir haben einen weit größeren Einfluß, als Europa oder Asien glauben. Ich halte es für unabdingbar, daß Sie für eine weitere Amtszeit kandidieren. Denn in der Außenpolitik besitzt der Präsident der Vereinigten Staaten schließlich die Macht eines Monarchen.«
Wieder beobachteten die vier Berater Kennedys Reaktion, der Präsident wandte sich jedoch ganz einfach an den Mann, der ihm freundschaftlich am nächsten stand, näher noch sogar als Dazzy.
»Was meinst du dazu, Chris?« erkundigte sich Kennedy.
Christian Klee war Justizminister der Vereinigten Staaten und durch einen außergewöhnlichen Schachzug Kennedys darüber hinaus zum Direktor des FBI und Chef des Secret Service ernannt worden, der für die Sicherheit des Präsidenten verantwortlich war. Im wesentlichen kontrollierte er das gesamte interne Sicherheitssystem der Vereinigten Staaten. Politisch hatte Kennedy einen hohen Preis dafür bezahlt: Er hatte dem Kongreß dafür die Ernennung zweier Richter des Obersten Gerichtshofes, dreier Kabinettsposten und das Botschafteramt in England abtreten müssen.
»Du mußt dir über zwei Dinge klarwerden, Francis«, antwortete Christian Klee. »Erstens, willst du wirklich wieder für das Amt des Präsidenten kandidieren? Du könntest allein mit deiner Stimme und deinem Lächeln im Fernsehen gewinnen. Deine Regierung hat einen Scheißdreck für dieses Land getan. Willst du es also wirklich tun? Die zweite Frage lautet: Willst du immer noch etwas für dieses Land tun? Willst du alle seine Feinde, innen und außen, bekämpfen? Willst du dieses Land wirklich auf den richtigen Weg bringen? Denn ich bin der Meinung, daß dieses Land im Sterben liegt, ich halte es für einen Dinosaurier, der ausgelöscht werden wird. Oder willst du dir nur einen vier Jahre langen Urlaub gönnen und das Weiße Haus als deinen privaten Country Club benutzen?« Christian Klee hielt einen Moment inne; dann sagte er lächelnd: »Drei Fragen.«
Christian Klee und Francis Kennedy hatten sich schon im College kennengelernt. Obwohl Christian einer der einflußreichsten jungen Männer in Harvard war, während Kennedy nur seinen eigenen kleinen Kreis von Bewunderern hatte, war Christian einer der Ihren geworden.
Jetzt blickte Präsident Kennedy zu Christian Klee hinüber. Mit einer Andeutung von Ironie erklärte er: »Die Antwort auf alle drei Fragen ist nein.« Dann wandte er sich an seinen politischen Chefberater und Verbindungsmann zum Kongreß, Oddblood Gray, den jüngsten seines Stabes, der erst seit zehn Jahren das College hinter sich hatte.
Oddblood Gray kam via Harvard und Rhodes-Stipendium aus der linken Schwarzenbewegung. Sein jugendlicher Idealismus war möglicherweise von seinem instinktiven politischen Genie korrumpiert worden. Er wußte genau, wie eine Regierung arbeitete, wo Einfluß geltend gemacht werden, wann die brutale Macht der Protektion ausgeübt werden mußte, wann es besser war, auf der Stelle zu treten, und wann man mit Anstand kapitulierte. Kennedy hatte seine Warnung vor dem Versuch ignoriert, seine neuen Programme durch den Kongreß zu bringen. Gray hatte die schwere Niederlage vorausgesehen.
»Was meinen Sie, Otto?« fragte ihn Kennedy.
»Geben Sie auf«, antwortete Oddblood Gray. »Solange Sie noch nur so eben verlieren.« Kennedy lächelte, die anderen Herren lachten. Oddblood Gray fuhr fort: »Der Kongreß scheißt auf Sie, die Presse tritt Sie in den Arsch. Die Lobbyisten und die Großindustrie haben Ihren Programmen die Luft abgedreht. Die Arbeiter sind von Ihnen enttäuscht, die Intellektuellen meinen, daß Sie sie hintergangen haben. Der rechte und der linke Flügel in diesem Land sind sich in einer Hinsicht einig: daß Sie ein Waschlappen sind. Da lenken Sie diesen verdammt großen Cadillac von einem Land, aber das Lenkrad funktioniert nicht. Und darüber hinaus kriegt jeder verdammte Wildgewordene in diesem Land noch einmal vier Jahre Zeit, Sie zu erledigen. Der Hattrick. Laßt uns lieber alle zusammen machen, daß wir hier rauskommen, aus diesem verdammten Weißen Haus.«
»Meinen Sie, ich würde wiedergewählt werden?« erkundigte sich Kennedy lächelnd.
Oddblood Gray spielte den Erstaunten. »Selbstverständlich«, gab er zurück. »In diesem Land werden nutzlose Präsidenten stets wiedergewählt. Selbst Ihre schlimmsten Feinde wollen, daß Sie wiedergewählt werden.«
Kennedy lächelte. Sie versuchten ihn zu einer zweiten Kandidatur zu überreden, indem sie an seinen Stolz appellierten. Keiner von ihnen wollte dieses Zentrum der Macht, dieses Washington, dieses Weiße Haus wirklich verlassen. Lieber ein zahnloser Löwe sein als überhaupt keiner.
Dann begann Oddblood Gray wieder zu sprechen. »Wir könnten einiges erreichen, wenn wir nur ein bißchen anders arbeiten würden. Wenn Sie wirklich mit dem Herzen dabei sind.«
Und Eugene Dazzy sagte: »Sie sind wirklich unsere einzige Hoffnung, Francis. Die Reichen sind zu reich, die Armen zu arm. Dieses Land wird zum Futterplatz für die Großindustrie, die Wall Street. Die rennen einfach drauflos, ohne einen Gedanken an die Zukunft. Es mag jahrzehntelang gutgehen, doch die Probleme, Riesenprobleme, sind uns gewiß. Und Sie haben die Möglichkeit, diesen Lauf der Dinge in den nächsten vier Jahren zu stoppen.«
Sie warteten auf seine Antwort – mit unterschiedlichen Gefühlen. Es war ungewöhnlich, daß politische Berater ein so enges persönliches Verhältnis zu ihrem Präsidenten hatten, doch diese vier Männer empfanden eine Art hebevoller Ehrfurcht vor ihm. Francis Kennedy besaß ein überwältigendes Charisma. Nicht nur, daß er körperlich äußerst eindrucksvoll wirkte, ja, über eine Art physische Schönheit verfügte, die an seine beiden berühmten »Onkels« erinnerte; er besaß auch einen brillanten Intellekt, der bei einem Politiker selten, wenn nicht sogar exotisch war. Er war als Anwalt erfolgreich gewesen, als Autor naturwissenschaftlicher Schriften, besaß Kenntnisse in Physik und einen unfehlbaren Geschmack für Literatur. Selbst Wirtschaftstheorien begriff er ohne die Hilfe von Fachberatern. Und er zeigte ein Verständnis für die einfachen Menschen, das ungewöhnlich war bei einem Mann, der reich geboren war und niemals unter finanziellem Mangel zu leiden gehabt hatte.
Eugene Dazzy brach das Schweigen. »Sie sollten es sich noch mal überlegen, Francis. Helen hat recht.« Ihnen allen war natürlich klar, daß Kennedys Entschluß eisern feststand: Er würde nicht noch einmal kandidieren. Es war das Ende des Weges für sie alle. Kennedy zuckte die Achseln. »Nach der Osterpause werde ich eine offizielle Bekanntmachung herausgeben. Eugene, Sie setzen Ihre Leute an den Bürokram. Und außerdem möchte ich Ihnen allen raten, nach lukrativen Jobs bei den großen Anwaltsfirmen und in der Rüstungsindustrie zu suchen.«
Die Herren faßten seine Worte als Entlassung auf und gingen hinaus. Bis auf Christian Klee.
Christian fragte beiläufig: »Wird Theresa zu den Feiertagen nach Hause kommen?«
Francis Kennedy zuckte die Achseln. »Sie ist in Rom, mit einem neuen Freund. Sie fliegt ausgerechnet am Ostersonntag. Weil sie Wert darauf legt, religiöse Feiertage zu ignorieren.«
»Ich bin froh, daß sie da endlich rauskommt«, sagte Christian. »In Europa kann ich sie nicht beschützen. Dabei glaubt sie, da drüben den Mund aufreißen zu können, ohne daß es bis hierher durchsickert.« Einen Augenblick hielt er inne. »Wenn du wieder kandidierst, wirst du deine Tochter auf Abstand halten oder sie verleugnen müssen.«
Kennedy lachte. »Unwichtig. Ich werde nicht wieder kandidieren, Christian. Du mußt deine Pläne ändern.«
»Okay«, antwortete Christian. »Und jetzt zu der Geburtstagsparty für das Orakel. Er freut sich wirklich sehr darauf.«