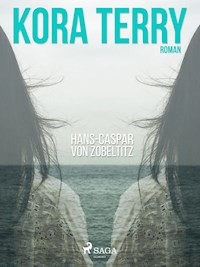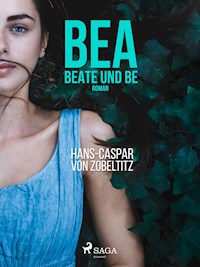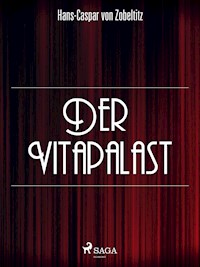
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Drei Generationen leben in der Frohweinvilla mit ihrem großen Garten. Das Berlin der goldenen Zwanziger wächst, hinter der Villa eröffnen lauter neue Geschäfte und auch das Kino will sich vergrößern. Kinobesitzer Berstel spricht im Frohweinhaus vor, mit einem glänzenden Angebot in der Tasche und fertigen Plänen seines Sohns, des jungen Architekten Bruno. Der große Vitapalast soll auf dem Gartengrundstück entstehen und tatsächlich verkauft der alte Frohwein schweren Herzens angesichts der finanziellen Lage der Familie. Tochter Inge versteht ihren Großvater. Zornig versucht sie bei einem Besuch der Berstels, den Verkauf rückgängig zu machen, obwohl fasziniert vom Modell des Kinos und heimlich auch von Bruno. Doch ihr Vater und ihre lebenslustige Schwester Etta, die auf dem Familiengut in Rechstein vor den Toren Berlins versauert, sind hingerissen von der neuen Welt des Films. Bis der Kinopalast öffnet, ist das Leben dieser liebenswerten Familie auf den Kopf gestellt und nichts ist mehr so, wie es einmal war.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 351
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hans-Caspar von Zobeltitz
Der Vitapalast
Roman
Saga
Ebook-Kolophon
Hans-Caspar von Zobeltitz: Der Vitapalast. © 1929 Hans-Caspar von Zobeltitz. Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2015 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen 2015. All rights reserved.
ISBN: 9788711488515
1. Ebook-Auflage, 2016
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com - a part of Egmont, www.egmont.com.
Friedrich Frohwein schob den Teller nach der Mitte des Tisches zu und breitete seine Serviette zwischen Teller und Tischkante aus, um sie unter energischem Glattstreichen sorgfältig zusammenzufalten. Er liess das Tuch in den silbernen Ring gleiten, drehte die weisse Rolle noch ein paarmal in den Händen und legte sie endlich neben den Teller, den er wieder an seinen alten Platz zog. Ein wenig lehnte er sich im Armstuhl zurück, nestelte sein Zigarettenetui aus der Westentasche, verbeugte sich leicht gegen seine Tochter: „Darf ich rauchen?“
„Bitte, Papa, ich hole dir einen Aschbecher.“
Inge Frohwein stand auf. Die Bewegung war kurz und federnd, ohne hastig zu sein. Sie schritt am Vater vorbei zur Tür, die vom Esszimmer ins Herrenzimmer führte, schob die Flügel auseinander und ging in den unerleuchteten Raum. Sie fand den Platz der Aschenschale auch im Dunkeln; sie sorgte ja dafür, dass sie immer an der gleichen Stelle stand.
Die Augen des Vaters folgten ihr. Ein wenig kniff er die Lider: ‚Guter Gang, gute Beine,‘ dachte er, ‚sie ist jetzt aus der letzten Streckung heraus. Ganz erwachsen. Merkwürdig, wie schnell das mit den beiden Mädels gegangen ist; — mit beiden. Trotz der acht Jahre Altersunterschied. Und mit Inge fast noch schneller als mit Etta.‘ Er strich sich langsam über das volle Haar, als wollte er die paar grauen Strähnen beiseite schieben. ‚Ich muss nun wohl langsam anfangen, alt zu werden. Das ist nicht schön. Wirklich nicht. Grossvater ist man auch schon. Hm —’
Die Zigarette brannte. Behaglich zog er den Rauch ein und blies ihn über die Brandfläche, dass sie stärker aufglühte.
Inge kam zurück. Die Aschenschale war aus Kristall und hatte einen breiten silbernen Rand. Friedrich Frohwein warf das Streichholz auf den Teller, lächelte, nahm es wieder auf und legte es mitten in den gläsernen Behälter, mit spitzen Fingern. Dabei blinzelte er seiner Tochter zu. „Siehst du, Kleines, beinahe hätte ich wieder etwas Verbotenes getan. Etwas, was mein Mädel nicht leiden kann. Leutnantsangewohnheiten nannte Mama das. Du hast doch viel von ihr.“
„Das freut mich.“
„Auch äusserlich, meine ich. Dasselbe blonde Haar. Fast die gleiche Augenfarbe, nur dass Mamas Augen noch tiefer blau waren. Nicht so vergissmeinnicht. Und ein bisschen rundlicher war Mama, als sie so alt war, wie du jetzt. Neunzehn. Da lernten wir uns gerade kennen. Auch hier im Haus. Mutter — Grossmutter, weisst du, — gab einen Ball für Tante Hedda ...“
„... und da waren Fehrenbachs auch eingeladen. Vier Wochen später war die Verlobung, ein halbes Jahr darauf eure Hochzeit. Ich weiss, Papa.“
„Ja, ich erzählte es dir wohl schon.“
„Mama hat es uns oft erzählt. Etta und mir. Als wir noch Kinder waren.“ Es zuckte ein wenig um Inges Mundwinkel. Sie stand noch immer, ihre Hände lagen auf der Lehne ihres Stuhles; lange, schmale Hände waren es mit kurz geschnittenen Nägeln, sie fassten das Holz fest an, so fest, dass die Fingerspitzen weiss wurden. Sie sprach nicht gern so leichthin von Mama, das tat weh. Sie musste dann immer die zwölf Jahre zurückdenken, die sie nun ohne Mutter verbracht. Halbwaise. Und ernst konnte sie eigentlich mit niemand von Mama sprechen. Nicht einmal mit Etta. Etta war wie Papa. Etta dachte immer zuerst an sich, dann erst an ihren Jungen und ihren Mann. Und an sie, die Schwester, wohl nie. Oder doch nur selten. Wenn sie etwas wollte. Dann ja. Mit Grosspapa oben, ja mit dem konnte Inge von den vergangenen Zeiten sprechen; aber er war wohl der einzige. Bei ihm hing auch das grosse Bild von Mama, das sie so liebte. Das feine Gesicht mit der edlen, schmalrückigen Nase, die Etta geerbt hatte. Nur dass Etta brünett war. Schön war Mama gewesen. Wunderschön. —
Friedrich Frohwein drückte den Rest seiner Zigarette aus. Er sah zu seiner Jüngsten hinüber. „Weisst du, Inge, was der Kerl, der Fontane, einmal in einem Roman schreibt? ‚Ein schöner alter Mann von fünfzig Jahren trat in das Zimmer!‘“
„Wie kommst du darauf, Papa?“
„Ich weiss nicht. Ich meine nur so: Schöner alter Mann von fünfzig Jahren. Alter Mann! Muss eine putzige Zeit gewesen sein damals.“ Er lachte, kurz, hell, richtig vergnügt. Beide Hände stützte er auf die Tischplatte, erhob sich, rückte den Stuhl zurecht, zog seine Uhr. „Also kommst du mit, Mädel? In einer Viertelstunde geht’s los. Grossartiger Zauber. Hab’ mir die Bilder im Kasten angesehen. Harry Liedtke im Turban, Erna Morena als indische Fürstin (Fürschtin, sagte er), dazu Tempelbauten, Elefanten, schöne Landschaftsbilder. Herz, was willst du noch mehr?“
„Ich mach’ mir nichts aus Kino.“
„Ach was.“
„Und dann bin ich müde. Es war heute ein anstrengender Tag. Doktor Lorenz hatte erst eine Konferenz, dann hat er mir das Protokoll diktiert, fast zwei Stunden. Als er endlich fertig war, musste ich es noch ins reine schreiben. Da fühlt man seinen Rücken.“
„Die blödsinnige Tipperei. Du hast’s doch nicht nötig.“
„Ich hab’s nötig, Papa.“
„Unsinn. Ich kann dir genug geben. Und geb’ dir genug. Natürlich ist’s nicht wie früher. Aber es ist nirgends wie früher. Leider. Ihr könntet es ja anders haben, aber ihr wollt es ja nicht. Du nicht und Grossvater nicht. Ihr müsst ja diesen blödsinnigen alten Kasten halten.“
„Papa!“ Scharf rief es Inge.
Sofort lenkte er ein. „Ich weiss ja — ich weiss ja. Tradition. Alte Liebe zum Ererbten.“ Er trat an die Tochter heran, legte seinen Arm um sie. Jetzt wirklich mit einer liebevollen Bewegung. Fast einen Kopf grösser war er als Inge, schlank wie sie. Sehr gerade hielt er sich, sehr jugendlich. Wenn er so neben ihr stand, hätte er ebensogut ihr Mann sein können. Eine Reiterfigur hatte er immer noch, obwohl er den Sechzigern näher war als den Fünfzig. Sein blauer Sakko sass tadellos. Tadellos gebügelt war die Hose. Der hellila Schlips war richtig zum farbigen Hemd abgetönt, das Haar war sorgfältigst gescheitelt, das gut rasierte Gesicht zeigte kaum ein Fältchen. Er zog Inge an sich. „Sei kein Frosch, Mädel. Komm mit. Glaubst du, ich mach’ mir was aus dem Film in dem kleinen Kaff? Nee. Aber lesen kann ich heut abend nicht. Hab’ auch nichts Vernünftiges. Zeitung ist ekelhaft. Bücher sind teuer. Und für dich ist es auch nur gut. Nirgends ruht man sich besser aus als im Kino. Braucht nicht nachdenken, es ist schön still, keiner quasselt, die Musik dudelt so nebenbei. Und nachher schläft man wie in Abrahams Schoss.“
Inge sah zum Vater auf. Sie war schon wieder versöhnt. Sie liebte doch ihren jungen grossen Vater, für den sie eigentlich sorgen musste wie für einen Bruder. Und manchmal auch ein bisschen erziehen wie einen Bruder. Aber sie wehrte sich noch einen Augenblick.
„Etta hat geschrieben. Ich wollte ihr noch antworten.“
„So, — so, Etta. Was schreibt sie denn? Kannst es mir auf dem Weg erzählen. Nun marsch, marsch, ’raus! Hut brauchst du nicht aufzusetzen. Es sind ja nur hundert Schritt bis zur Ecke. Nett von dir, dass du mich nicht allein laufen lässt.“
Er gab ihr einen Kuss und stob davon. Forsch, fix. Wie ein Junge.
Inge lächelte. So war Vater, man konnte letzten Endes nie nein sagen. Eine Tür klappte, seine Schlafzimmertür. Jetzt holte er sich Hut, Mantel und Stock. Schnell, schnell, um nur nicht zu spät zu kommen zu Harry Liedtke und Erna Morena. — Ja, der Vater ... Papa.
Sie griff zur Klingel, die aus dem grossen Glockenschirm der Esstischlampe herabhing.
Das Mädchen kam.
„Decken Sie bitte ab, Gertrud. Und sagen Sie dem alten Herrn Frohwein, dass ich nicht hinaufkommen könnte. Ich wäre mit Herrn Rittmeister in die Schöneberger Lichtspiele gegangen.“
*
Der Film, „Das Schloss in Indien“, flimmerte über die Leinwand. Erna Morena wandelt perlenbehängt durch pappene Prunkbauten, umworben von Harry Liedtke, dem als Maharadscha verkleideten Europäer. Er war sehr schön, und das Stammpublikum des kleinen Eckkinos schwelgte zwischen Lachen und Weinen.
Aber mehr im Lachen. Das war heute besonders herzhaft, wie immer, wenn der Rittmeister Frohwein da war, der mit seinem breiten, lauten und schütternden „Haha — haha!“ die anderen mitzureissen verstand. Sie kannten den Rittmeister, die Stammgäste. Die Gegend hier war ja ein Stück Kleinstadt mitten im grossen Berlin geblieben, hier auf dem Urgrund des alten Dorfes Schöneberg. Kleinstadt trotz der vier- und fünfstöckigen Häuser, die die alte Dorfstrasse schon seit Jahrzehnten säumten. Kleinstadt trotz des Riesenverkehrs, der sich zwischen den Häusern entlang wälzte. Kleinstadt, in der einer vom anderen wusste, weil man in den gleichen Läden kaufte und den gleichen Postboten hatte und echt schönebergisch gern sein Schwätzchen zwischen Tür und Angel machte. Drüben der Bäcker Krause sass nun schon in der dritten Generation in seinem Eckladen und Fritz Zimmerling, der Kolonialwarenhändler, in der zweiten. Meister Henke, der Tischler, war wie sie echter Schöneberger und ebenso Karl Müller, der in Seifen, Besen, Waschleinen und anderen nützlichen Haushaltartikeln machte. Und die anderen Geschäftsleute, Angestellten und Beamten, die noch nicht so lange in Läden und Etagenwohnungen der Häuserblöcke um das Frohweinsche Grundstück hockten, hatten sich akklimatisiert und waren in gewisser Weise auch stolz auf ihr Schönebergertum und auf ihre solide Grossstadtgegend an der Hauptstrasse geworden.
Und ein bisschen stolz auch auf die Frohweins in ihrer Mitte; denn die waren so ein Rest aus der guten alten Zeit, an die alle noch gern zurückdachten. Bauern waren die Frohweins einst gewesen, Schöneberger Bauern. Der Urgrossvater hatte noch den Pflug geführt, hatte aber auch die ersten Grundstücke verkauft, der Grossvater hatte dann die Villa gebaut und den Garten neben ihr an der Ecke der Hauptstrasse und der Frohweinstrasse angelegt, den Garten, der jetzt als letzte grüne Insel im Häusermeer lag. Der Grossvater hatte auch das Gut in der Priegnitz gekauft. Von den Badows hatte er es erworben und den Sohn draufgesetzt, als der die schöne Anna Fehrenbach heiratete. An die Hochzeit entsann sich Bäckermeister Krause noch ganz genau: er hatte die Brötchen ins Frohweinsche Haus geliefert, nicht aber die Torten; die waren von Telschow am Potsdamer Platz gekommen; er konnte sich heute noch darüber ärgern, denn so gut wie Telschow hätte er sie auch gebacken. Aber der Bräutigam wollte es damals besonders fein haben, und deshalb musste natürlich der grosse Telschow herangezogen werden; er war ja immer etwas hoch hinaus gewesen, der Friedrich Frohwein, hatte dann auf Rechwitz ein Leben wie ein Grandseigneur geführt und vielleicht mehr Geld ausgegeben, als er durfte. Und das wollte was heissen, denn die Frohweins waren damals viele Millionen schwer und er der einzige Sohn.
Man wusste so allerlei in der Schöneberger Hauptstrasse. Auch dass die Ehe des Rittmeisters — Reserveoffizier bei den Brandenburger Kürassieren war er gewesen — nicht besonders glücklich geworden; die zarte, kleine, blonde Frau und der grosse, lebhafte, dunkle Mann, in dem noch immer ein Schuss Bauernblut und Bauerngrossspurigkeit sass, hatten nicht zusammengepasst. Und beide hatten unter einem gelitten: es fehlte der Erbe, der echte Frohwein. Nur die zwei Mädchen kamen in grossem Zwischenraume zur Welt, die Henriette, die dann Etta genannt wurde, und die Inge. Während des Krieges war Frau Anna Frohwein leise ausgelöscht, in Rechwitz war sie gestorben, wo sie die Gutsverwaltung übernommen hatte, während ihr Mann im Felde stand. Das war wohl zuviel für ihren schwachen Körper gewesen. Die Mädchen kamen nach dem Tode der Mutter zum Grossvater ins Frohweinhaus, die Etta damals ein Backfisch, die Inge noch ein Kind. Rechwitz wurde von fremder Hand verwaltet. Als der Rittmeister nach Kriegsende zurückkehrte, dachten die Schöneberger, er würde auf sein Gut ziehen und seine Töchter mitnehmen. Aber er machte es anders, er blieb in Berlin. Und dann war eines Tages Etta verlobt. Frau Zimmerling hatte es zuerst gewusst; die Frohweinsche Köchin hatte es ihr erzählt, als sie im Laden stand und gern mehr Butter haben wollte, als es auf die Karten gab. Eine Kinderfreundschaft, der Sohn eines Gutsnachbarn von Rechwitz, ein Herr von Wahlen. Natürlich vom Adel. Unter dem machte es der Rittmeister doch nicht für seine schöne Tochter. Und die Etta war erst siebzehn Jahre. „Ein rechter Blödsinn“, hatte die Köchin damals zu Frau Zimmerling gesagt. Und Frau Bäckermeister Krause hatte diesem Ausspruch beigestimmt, als die Zimmerling ihr die grosse Neuigkeit erzählte. „Vielleicht will die Etta aus dem Haus,“ hatte sie hinzugefügt, „so bloss mit Vater und Grossvater, das ist doch nicht das Rechte für so ’n junges Ding. Und dann gibt’s in Rechwitz natürlich mehr zu futtern als hier in Berlin.“
Ja, ja, man wusste allerlei über die Frohweins in Schöneberg. Man wusste auch, dass es mit den Millionen längst zu Ende war. Auf der einen Seite hatte der Grossvater während der Inflation an seinen Preussischen Konsols und seiner Kriegsanleihe festgehalten, auf der anderen Seite hatte der Rittmeister ziemlich heftig spekuliert und nicht immer mit Glück. Da war der Glanz wie überall zerflossen. Nur das Eckgrundstück war geblieben. Schuldenfrei; auch das wusste man. Da hielt der Grossvater, der alte Ernst Frohwein, die Hände drauf. Und auf dieses Eckgrundstück waren die Anlieger stolz, auf die Villa, auf den Garten, weil es ein Stück alter Bauernherrlichkeit war. Ein Rest. — —
Wieder lachte der Rittmeister, und wieder stimmten die Stammgäste der Schöneberger Lichtspiele ein. Harry Liedtke hatte gerade dem indischen Fürsten ein Schnippchen geschlagen und war zu Erna Morena in das Prunkzelt geschlüpft, das ein riesiger Elefant, der dem grossen Hans aus dem Zoologischen Garten sehr ähnlich sah, auf seinem breiten Rücken trug.
Inge sah nicht viel von dem Film. Sie hielt die Augen oft geschlossen. Ihre Gedanken waren bei Ettas Brief und dem Gespräch, das sie über ihn mit dem Vater auf dem kurzen Weg zum Kino geführt hatte.
„Was hat denn Etta geschrieben?“
„Wie immer, Papa. Sie klagt. Sie fühle sich einsam. Sie passe nicht aufs Land.“
„Na, das kennen wir ja. Und was will sie?“
„Ich soll ihr ein Kleid besorgen. Sie hätte nichts anzuziehen. Sie könnte sich nichts kaufen. Paul hielte sie so knapp. Nie hätte er Geld für sie. Aber neue Maschinen könnte er kaufen und Leutehäuser bauen. Doch wenn sie etwas wollte ... Ach, du weisst ja, Papa.“
Der Vater hatte genickt und gesagt: „Was wird denn solch Kleid kosten?“
„Zweihundert bis zweihundertfünfzig Mark mindestens.“
Durch die Zähne hatte Friedrich Frohwein gepfiffen. „Donnerwetter — soviel. Da musst du mit Grossvater sprechen. Ich hab’s nicht.“
Das war auch immer das gleiche Lied. Sie musste mit Grossvater sprechen. Wenn Vater Geld brauchte, wenn Etta Geld brauchte. Sie musste bitten. Für beide. Nur dass sie einmal für sich selber bitten könne, müsse, daran dachte niemand. Sie verdiente ja gut beim Notar Lorenz, eine glänzende Stellung, fast zweihundert Mark im Monat, und im Hause doch auch alles frei. „Was fängst du bloss mit dem vielen Geld an?“ hatte der Vater sogar einmal gefragt. Dass sie sich alles selbst kaufen musste, was sie an Kleidung, Wäsche, Schuhzeug und den unentbehrlichen Kleinigkeiten weiblicher Jugend gebrauchte, damit rechnete Vater nicht. Wirklich, es war manchmal schwer, nicht bitter zu werden. —
Der Film war zu Ende. Ein Ozeandampfer fuhr über das Meer und liess eine lange Rauchfahne hinter sich. Zum erstenmal machte Inge Frohwein die Augen weit auf. Da lag etwas von südlicher Sonne über dem Bild, von Weite, von Ferne, von Freiheit. Aber schon wurde abgeblendet. An der Reling stand ein glückliches Paar und sah auf eine entschwindende Küste zurück. Und dann Grossaufnahme: Harry Liedtke beugte sich über Erna Morena, Filmaugen klapperten. Geschminkte Lippen trafen sich. Kuss. Schluss. — ‚Scheusslich, dieser Kitsch‘, dachte Inge.
Die Beleuchtung flammte auf, die Musik — Klavier, Geige und Cello — schwieg. Die Stammgäste erhoben sich und klatschten. Männer und Frauen stülpten sich die Kopfbedeckungen auf und schoben sich aus den engen Sitzreihen. Vater Frohwein und Inge wurden mitgeschoben, dem einzigen Ausgang des Kinos zu.
In der Tür stand Karl Berstel, der Besitzer der Schöneberger Lichtspiele. Er stand da, klein, behäbig und tadellos angezogen. Er entliess sein Publikum, hatte für den und jenen einen freundlichen Zuruf. Er kannte seine Leute und wusste, was zum Geschäft gehört. Er hatte eine feine Nase für das, was die Schöneberger sehen wollten und was er bieten musste. Alle Schlager rollten bei ihm, sowie sie aus den grossen Uraufführungstheatern heraus waren. Immer hatte er ein volles Haus. „Eine Goldgrube ist dieser kleine Kientopp,“ hatte Friedrich Frohwein schon oft zu Inge gesagt, „wahrhaftig, ich hätte Lust, mit dem dicken Berstel zu tauschen.“
Als sie zum Ausgang kamen, schob sich Karl Berstel an die beiden Frohweins heran. „Guten Abend, Herr Rittmeister. Hat’s gefallen? Eine fabelhafte Person, die Morena. Und die Landschaftsbilder — was? Haben Sie einen Augenblick Zeit, Herr Rittmeister? Ich würde Sie gern einmal sprechen. Nein, nicht hier. Kann ich nicht einmal zu Ihnen kommen? Morgen oder übermorgen. Am liebsten nachmittags. Abends hab’ ich ja hier zu tun.“
„Um was handelt es sich denn, Herr Berstel?“
„Eine rein private Sache, Herr Rittmeister. Nichts Unangenehmes. Im Gegenteil. Ich kann’s Ihnen aber hier nicht so schnell auseinandersetzen. Ein bisschen Zeit brauch’ ich schon. So’n halbes Stündchen vielleicht.“
„Ist es eilig, Herr Berstel?“
„Bald wäre mir schon lieb, Herr Rittmeister.“
„Gut, Herr Berstel, sagen wir also übermorgen um fünf.“
„Sehr wohl, Herr Rittmeister. Ich bin pünktlich auf die Minute. Und ich danke auch schönstens. Guten Abend, die Herrschaften.“
*
Etta sass am Frühstückstisch, als ihr Mann von seinem Morgenritt zurückkam.
Paul von Wahlen war nicht in bester Stimmung. Es sah böse aus auf den Rechwitzer Feldern. Im Frühsommer hatte eine Riesenernte auf dem Halm gestanden, der Spätsommer hatte Regen gebracht, nichts wie Regen. Die Ahle hatte die Wiesen überschwemmt, der zweite Schnitt war zum Teufel gegangen, dann hatte sich das Korn gelegt, war ausgewachsen; es hatte kaum das Mähen gelohnt. Heute früh hatten die Leute angefangen, Kartoffeln auszumachen. Wahlen hatte seine Hoffnungen schon tief geschraubt, die Stichprobe, die er in den letzten Wochen vorgenommen hatte, war schlecht gewesen. Aber dass es so miserabel ausfallen würde, wie es sich jetzt auf dem Stück am Hundsberg offenbarte, hatte er doch nicht gedacht. Industriekartoffeln hatte er dort, die in Vorjahren immer viel gebracht hatten — was sie heute morgen herausgeholt, war nicht nur wenig, die Frucht war auch klein, wässerig, zum Teil faul. Einfach versoffen war der Acker selbst auf dem Hundsberg; wie würde es erst am Roten Loch und am Lehmwerder aussehen, wo der Boden schwerer war.
Es war zum Verzweifeln. Die Kartoffeln waren noch eine letzte Hoffnung gewesen, wenigstens etwas bares Geld hereinzubekommen, wenigstens so viel, dass die dreimal verfluchten Steuerschulden abgedeckt werden konnten und ein Teil der Kredite, die bei der Genossenschaft aufgenommen waren, um die Löhne zahlen zu können. Und nun war es wieder nichts. Wieder hiess es, auf die nächste Ernte hoffen. Wieder hiess es, alle persönlichen Wünsche zurückstellen, die eigenen und Ettas. Die eigenen, das war noch leicht. Aber Ettas, das war schwer.
Paul von Wahlen war im Schritt heimwärts geritten. Er fürchtete sich vor dem Rechwitzer Haus, in dem ihm die Frau, die er doch liebte, mit trübem Gesicht entgegentreten würde, verständnislos für die Nöte der Felder, verständnislos für seine Sorgen. Und nicht einmal sein eigenes Haus war es, nur Verwalter war er an fremdem Eigentum; fremd, wenn es auch aus nächster verwandtschaftlicher Hand kam, wenn ihm auch Grossvater Frohwein alles überantwortet, alle Einnahmen ihm und Etta zur Verfügung gestellt hatte. Es blieb doch fremd und deshalb mit doppelter Verantwortung belastet. Auch dafür hatte Etta kein Verständnis. „Ich erbe doch Rechwitz einmal“, sagte sie immer wieder. Jawohl, sie würde es einmal erben, sie oder Hansi. Deshalb hiess es um so mehr, den Besitz erhalten, schuldenfrei erhalten. —
Etta stand nicht auf, als Paul in das Esszimmer trat. Sie sah nur flüchtig auf, nickte ihm flüchtig zu. „’Morgen.“
Er nahm sich zusammen. Er wollte kein bekümmertes Gesicht machen. An den Tisch trat er, küsste ihr die Hand. „Guten Morgen, Etta. Siehst du, jetzt haben wir Sonne. Schöne Herbsttage. Ersatz für den Regensommer.“ Er setzte sich. „Giess mir bitte eine Tasse Tee ein, ich bin durstig geworden.“
Mit einer müden Bewegung holte sie die Teekanne heran, goss ein, schob ihm die Zuckerdose zu. Kein Wort.
Er wartete einen Augenblick, dann fuhr er fort: „Und wie schön sich das Laub verfärbt, das ist immer so nach vieler Nässe. Wie ich vom Hof kam und das Haus sah, freute ich mich: Blutrot ist der Wein, und die grosse Buche im Park leuchtet vor den Tannen. So war es lange nicht.“
Schinken legte er sich aufs Brot. Ass einen Bissen, trank einen Schluck. Wartete.
„Ich hörte Hansis Stimme. Er arbeitete oben mit Fräulein Wagenschmidt. Sie hatten das Fenster offen, es ist ja so warm draussen. Eine ganze Weile hörte ich zu. Er rechnete: zwei und zwei ist vier. Und zwei und drei ist fünf. Ganz bei der Sache schien er. Ist Fräulein Wagenschmidt eigentlich mit ihm zufrieden?“
Nun hob Etta den Kopf, legte ihn ein wenig zur Seite. Ein ganz kleines Lächeln war um die schmalen Lippen. Die Hand, schmal und weiss, keine Landfrauenhand, spielte nervös mit einem Brief, der neben dem Teller lag.
„Inge hat mir geschrieben. Sie wird mir das Kleid besorgen.“
Er sah sie starr an. „Hast du sie darum gebeten?“
„Ja.“
„Etta!“
Sie schob den Teller zurück, mit derselben Bewegung, die ihrem Vater eigentümlich war. „Bitte, tu nur nicht beleidigt. Willst du mir vielleicht sagen, wie ich anders handeln sollte? Hast du mir nicht erklärt, dass du mir die paar lumpigen Kröten nicht geben könntest? Nun?“
„Ich kann es auch nicht, Etta.“
„Und ich brauchte das Kleid. Grossvater wird es bezahlen.“
„Du weisst, dass ich das nicht will.“
„Und deshalb soll ich in Fetzen gehen. Damit sie alle lachen, wenn ich nach Gorsdorf komme. Damit die lieben Nachbarinnen die Nase rümpfen und sagen: ‚Frohweins sind pleite.‘ Ich danke.“
„Es hat noch keiner und keine die Nase gerümpft, Etta. Ausserdem konnten wir in Gorsdorf absagen; wir brauchten ja nicht zu dem Brandtschen Festessen zu fahren. Es war absolut nicht nötig. Du wolltest hin, nicht ich.“
Kurz stand Etta auf. „Jawohl, ich wollte hin. Absagen, das könnte dir so passen. Damit ich hier noch mehr versaure. Damit ich keinen Menschen mehr habe. Einkapseln soll ich mich. Verkommen. Verbauern. Ich danke dafür.“
Sie schritt zur Tür, nahm die Klinke in die Hand.
„Etta“, sagte er.
Da drehte sie sich noch einmal um. „Etta!“ stiess sie hervor, seinen Ton nachahmend. „Etta — Etta. Jawohl, so heiss’ ich. Und ich habe die Misere bis hier, bis zum Halse, sage ich dir. Diese ewige Misere!“
Hart stiess sie die Tür auf und warf sie ins Schloss. Die Treppe stürmte sie hinauf, lief den Korridor entlang bis zum Schlafzimmer. In den Stuhl vor ihrem Frisiertisch liess sie sich fallen und weinte — weinte. Das Gesicht barg sie in beide Hände; ihre Schultern zitterten. Und dann liess sie die Finger langsam über die Stirn gleiten, bis hinein in das dunkle, wellige, kurz geschnittene Haar. Wie weich das Haar war!
Ruhe kam über sie. Ihr Blick fiel in den Spiegel. Mit grossen Augen sah sie sich selbst an. Lange. Langsam strich sie den leichten Stoff ihres Morgenkleides zurück, dass der Hals frei wurde. Weiter beugte sie sich vor, ihre Lippen bewegten sich. ‚Warum bin ich schön? Für wen bin ich schön?‘
Hinter ihr öffnete sich die Tür. Sie hörte es. Sie wusste, jetzt kam Paul. Über ihren Körper lief ein Zittern. Sie rührte sich nicht.
Er trat hinter sie. Sein Bild erschien im Spiegel; sein braunes, verwittertes Gesicht, in dem die blauen Augen so leuchten konnten, aber auch so traurig sein, so todtraurig.
Jäh sprang sie auf, drehte sich um und warf die Arme um seine Schultern. Ihren Mund presste sie auf seine Lippen. Sie schloss die Augen.
„Nicht sprechen jetzt, Paul, nicht sprechen.“
*
Karl Berstel war pünktlich. Er wusste, dass man die Menschen nicht warten lassen dürfe, wenn man etwas von ihnen wollte. Seine Kinobesucher hielten auch auf präzisen Anfang der Vorstellungen, sie liebten es nicht, lange im halb verdunkelten Raum zu sitzen. Pünktlichkeit war ein Teil des Geschäfts: gefiel ein Film einmal nicht, so war der Ärger doppelt gross, wenn man um ihn noch Zeit vertrödelt hatte.
So trat er eine Minute vor fünf durch die Eisengittertür in den Vorgarten des Frohweinschen Grundstückes ein und drückte Schlag fünf Uhr auf den Klingelknopf neben der hohen Eichentür, zu der einige etwas ausgetretene Stufen hinaufführten. Gertrud, das Hausmädchen, öffnete ihm und nahm ihm Hut, Mantel und Stock ab, die sie in einen kleinen Garderoberaum trug, der neben dem Eingang lag. Sie kannte Berstel natürlich auch, denn wie die ganze Gegend hatte auch sie bei ihm Henny Porten und Fern Andra, Lia de Putti und Lilian Gish, Emil Jannings, Wegener, Georg Alexander, Charlie Chaplin, Buster Keaton, Harald Lloyd und die vielen, vielen weiteren Grössen des Kinohimmels kennengelernt, er war ihr Mentor der Kinokultur gewesen.
‚Was will der nur bei unserem Rittmeister?‘ dachte sie, während sie Berstel durch die Halle führte, die wie ein Lichthof in der Mitte der Frohweinschen Villa stand, hoch und holzgetäfelt, die breite Treppe zum Obergeschoss bergend. Sie war ein imposanter Raum, aber sie machte wenig Eindruck auf Karl Berstel, er hatte dergleichen vermutet und war von seinen Films mehr Prunk gewöhnt. Trotzdem: Reiche Leute mussten die Frohweins doch noch immer sein. Auch das Zimmer, in das Gertrud ihn leitete, konnte ihm nicht imponieren. Gross war es, gewiss, aber die Möbel! So was hatte man doch eigentlich nicht mehr, in keinem modernen Kinostück stand bei wohlhabenden Leuten so etwas herum. Plüsch mit Fransen und Tischdecken mit Troddeln, die Venus auf der Säule und der Glasschrank mit den Nippesfiguren. Berstel begann, sich zu wundern. Er schritt mit schweren Schritten auf und ab, sah zum Boden: der Teppich wenigstens war schön; Berstel hatte allerlei gelernt bei seinen Kinoatelierbesuchen, Buchara schätzte er, vielleicht Belutschistan, auf jeden Fall echt, wertvoll. Dann sah er nach oben: die Decke konnten Frohweins eigentlich einmal neu weissen lassen, sie hatte einen grauen, verrauchten Ton, an sie hatte sicher zwanzig Jahre keine Hand gerührt.
Der Rittmeister liess warten. ‚Leute, die nichts zu tun haben, lassen immer warten‘, dachte Berstel und trat vor einen kleinen Schreibtisch mit Konsolenaufbau, auf dem eine Unzahl Photographien in Goldbronzerahmen standen. Berstel wusste sofort: der Schreibtisch der verstorbenen Frau Frohwein, an dem wahrscheinlich auch schon die Grossmutter gesessen hatte. Da war ein Bild vom Rittmeister in Kürassieruniform und dann Photos von den beiden Töchtern als Kinder in weissen Hängekleidchen: niedliche Mädels, dunkel die eine, blond die andere, beide mit offenen Locken, die über die Schultern hingen, wie es damals vor dem Kriege Sitte gewesen. Und da hing ja auch ein Bild von der Mutter, ein grosses Ölbild. „Donnerwetter“, sagte Berstel unwillkürlich halblaut; breitbeinig stellte er sich vor das Gemälde: Das war ein Gesicht! Wahrhaftig, die da oben war zu früh geboren und zu früh gestorben, an der hätte man eine Entdeckung machen können, eine Henny Porten hätte die werden können, aber mit einem pikanten Einschlag und mehr Linie. Berstel wiegte den Kopf hin und her. Schade — jammerschade.
Da kam der Rittmeister — endlich.
„Guten Tag, mein lieber Herr Berstel.“ Er reichte ihm die Hand, schlug ihm leicht auf die Schulter. „Kommen Sie in mein Arbeitszimmer, da sprechen wir besser.“
Dann sassen sie sich gegenüber: Der Rittmeister an seinem Diplomatenschreibtisch grossen Formats, Karl Berstel dicht bei ihm in einem Ledersessel. Hier war schon etwas mehr Wohnungskultur, und der Kinomann hockte nun doch ein wenig auf der vorderen Kante des ungewohnt tiefen Stuhles, ein bisschen unsicher, ein bisschen verlegen.
„Also, mein Bester, um was handelt es sich? Was führt Sie zu mir?“ Laut war Friedrich Frohweins Stimme, sie dröhnte im Raum.
Karl Berstel rieb sich die Hände. „So einfach ist das nicht, Herr Rittmeister. Da muss ich schon ins Weite ausholen. Sie kennen mich ja. Ich habe meine Lichtspiele so Stücker zwanzig Jahr, war unter den ersten, die an den Film glaubten, und hab’ recht behalten. Es ist immer gut gegangen, und es geht auch jetzt gut. Ich bin sogar tadellos über die Inflation weggekommen, hatte nach dem Krieg mein Erspartes — und es war nicht wenig — in die Produktion gesteckt — in die Filmproduktion, wissen Sie. Das fluschte damals. War ja auch klar. Musste ja so sein. Denn während des Krieges war kaum was gedreht worden. Verdient hab’ ich nichts daran, wenigstens nichts zuverdient. Aber erhalten hab’ ich meine Moneten, und das war die Hauptsache. Ich bekam immer wieder, was ich in die Filme ’reinsteckte, und zwar im neuen Wert. Manchmal auch in Devisen. Damals habe ich meinen Laden ausgebaut. Als dann die Produktion anfing, schief zu liegen, hab’ ich mich dünn gemacht. Ich sah’s kommen. Sie wirtschafteten zu toll drauflos, als ob das Geld Mist wäre, das neue Geld, die Rentenmark, die Reichsmark. Da habe ich meine Einlagen aus der Produktion peu à peu herausgezogen und auf die Bank getragen und noch den Verdienst aus meinem Kino dazu. Es war ’ne ganze Masse. Wir haben fast keine Ansprüche, meine Frau und ich. Und die Anni, meine Tochter — Sie kennen sie ja, Herr Rittmeister, von der Kasse her — auch nicht. Seit drei Jahren verdient der Bruno, mein Junge, selbst und zahlt Muttern eine kleine Pension. Er ist Architekt und hat einen guten Posten bei der Berliner Bau-Union, müssen Sie wissen, Herr Rittmeister.“
Bis hierher hatte Friedrich Frohwein ruhig zugehört, wenn auch seine Hände nervös bald mit dem Briefbeschwerer, bald mit der Papierschere auf der Schreibtischplatte gespielt hatten. Was wollte der Mann nur von ihm? Jetzt riss ihm die Geduld; wirklich ihn interessierten die Berstelschen Familienverhältnisse herzlich wenig, höchstens die Tochter, die also Anni hiess, und deren niedliche Stupsnase ihm in Erinnerung war.
„Sagen Sie mal, warum erzählen Sie mir das alles eigentlich?“
Berstel rückte auf seiner Stuhlkante noch ein wenig mehr nach vorn. „Nur Geduld, Herr Rittmeister, es kommt schon. Sie sollten nur wissen, dass bei mir eine solide Grundlage vorhanden ist und dass ich bisher Glück im Leben gehabt habe. Und Glück ist heute eine seltene Sache. Wenn man es einmal am Schopf hat, soll man’s festhalten. Das hab’ ich mir immer wieder gesagt. Und da ich nun ein nettes Pöstchen auf der Bank habe — es geht stark ins Sechsstellige, Herr Rittmeister ...“
Jetzt legte Friedrich Frohwein die Schere energisch auf den Tisch; es klappte ordentlich. „Was geht mich denn Ihr Geld an, Herr Berstel?“
„Es geht Sie was an, Herr Rittmeister, hören Sie doch nur zu; ich will mich vergrössern, energisch vergrössern, und dazu brauche ich Sie.“
Der kleine Kinomann tat einen tiefen Atemzug und fasste fester Posto auf seinem Sessel: ‚So, jetzt war es ’raus.‘ Aber gleich darauf musste er ein höchst erstauntes Gesicht machen, denn der Rittmeister lachte laut auf, lachte sein helles, schütterndes Lachen, das er aus dem Kino kannte, das er dort immer so gern hörte, weil es die anderen mitriss und gute Laune im Zuschauerraum machte, — das ihm hier aber gar nicht passte.
„Geld wollen Sie von mir? Geld? Aber, mein lieber Berstel, wo denken Sie hin? Sie träumen von den Frohweinschen Millionen. Die sind futsch, mein Guter. Wenigstens zum grössten Teil. Nee — ich kann Ihnen nichts geben: keine tausend Mark hab’ ich flüssig.“
Karl Berstel bekam sein Gleichgewicht wieder. „So ist es doch nicht gemeint, Herr Rittmeister. Im Gegenteil, Sie sollen Geld bekommen. Flüssiges Geld, bares Geld ...“
Nun war Frohwein am Staunen. Unwillkürlich rückte er den Schreibtischstuhl zur Seite, so dass er Berstel genau gegenübersass. Fest sah er ihn an. Aufs höchste interessiert. „Und woher? Wie denken Sie sich das?“
„Ich hab’ einen Plan, Herr Rittmeister. Das heisst, er kommt eigentlich nicht von mir. Der Junge, der Bruno, hat ihn zuerst ausgeheckt. Ganz heimlich, weil ihn als Architekt die Sache reizte. Er hat zu mir erst davon gesprochen, als er die Pläne auf dem Papier bereits fertig hatte.“
„Und was sind das für Pläne?“
„Da müssen Sie mich eine halbe Stunde noch ganz ruhig erzählen lassen, Herr Rittmeister, ganz ruhig ...“
Es dauerte auch wirklich eine halbe Stunde, ehe Berstel alles entwickelt hatte. Frohweins sollten ihm den unbebauten Teil ihres Grundstücks abtreten, das heisst, nicht ihm allein, sondern einem Konsortium, dem er angehören würde, aber auch Frohweins. Die Ecke an der Haupt- und Frohweinstrasse würde von dem Konsortium gekauft werden, zur Hälfte bar bezahlt, die andere Hälfte der Kaufsumme bliebe als Hypothek eingetragen, zu sieben oder acht Prozent. Dann würde ein Riesenkino auf dem Grundstück gebaut; dreitausend Plätze, ein Uraufführungstheater. Die Gegend sei günstig: Sechs Strassenbahnlinien, fünf Autobuslinien hätten ihre Haltestellen fast vor der Tür. — Untergrundbahn und Vorortbahnstation in nächster Nähe. Keine wirkliche Konkurrenz weit und breit. Ein kinointeressiertes Publikum in nächster Umgebung: Berstels Stammkundschaft, die er oft genug zum Teil jetzt nach Hause schicken müsse, weil sein kleiner Raum ausverkauft sei. Dabei stets wachsende Beliebtheit der Gegend: Tietz plane ein Warenhaus zwei Ecken weiter, die grossen Schuhgeschäfte bauten sich bereits Läden aus, und die hätten immer die beste Nase. Die Hauptstrasse würde mehr und mehr Geschäftszentrum. Und Geschäftszentren brauchten grosse Kinos. Glänzende Verzinsung sei garantiert. Rechne man nur halbbesetzte Häuser bei zwei Vorstellungen und durchschnittlich eine Mark pro Platz, so mache das am Abend dreitausend Mark Einnahme. Rechne man weiter davon fünfundsechzig Prozent Unkosten — so kalkuliere man jetzt —, so blieben rund tausend Mark Gewinn, das mache 365 000 Mark im Jahr. Nach Abzug von spielfreien Tagen rund 300 000 Mark. Nehme man die Kosten für das Grundstück, Bau, Inneneinrichtung sehr, sehr hoch mit zwei Millionen Mark an, so bedeute das eine Verzinsung mit fünfzehn Prozent. „Was wollen Sie mehr, Herr Rittmeister? Fünfzehn Prozent. Und dabei können Sie den Preis für die Ecke so hoch ansetzen, wie Ihr ganzes Grundstück wert ist, und behalten Ihre Villa und einen anständigen Garten ausserdem. Fünfzehn Meter will Bruno mit dem Bau von Ihrem Hause abbleiben. Was haben Sie denn jetzt von der Ecke? Nur Kosten. In den Garten gehen Sie fast nie, aber den Gärtner müssen Sie bezahlen, und dazu die Grundsteuern, die doch verdammt hoch sind. Das Restgrundstück gewinnt aber an Wert. Es wird Ihnen später so viel bringen, wie jetzt das ganze. Sie bekommen alles zweimal bezahlt. So’n Riesenkino zieht alle Welt in die Gegend. Mit einemmal ist Ihr Grund und Boden dann der beste von Berlin ...“
Karl Berstel hatte sich mehr und mehr in Schwung gesprochen. Und Frohwein hatte aufmerksam und aufmerksamer zugehört. Der Plan leuchtete ihm ein; er sah das Geschäft, sah bares Geld, hohe Verzinsung. Was der Berstel wollte, deckte sich ja mit seinen Plänen: er war längst zum Verkauf bereit. Und hatte bisher mit sehr viel ungünstigeren Verhältnissen gerechnet. Was der Mann da entwickelte, war grossartig. Woher der das alles nur hatte: den Plan, die Kalkulationen, die Berechnungen. Da steckte noch jemand anderes dahinter als nur der Sohn, der Architekt. Aber das konnte Frohwein schliesslich gleichgültig sein. Die Hauptsache war bares Kapital und gute, sichere Verzinsung.
Er war einverstanden, ganz einverstanden. Nur dass die Sache einen Haken hatte — einen gewaltigen Haken: ihm gehörte das Frohweinsche Grundstück nicht — noch nicht. Da war sein Vater — Ernst Frohwein, Grossvater, wie sie ihn alle nannten. Neunundsiebzig, aber springfrisch, geistig und körperlich. Und Grosspapa hing an seiner Ecke, war der einzige, der durch den Garten schlenderte, der die Fliederbüsche liebte und sich selbst die Rosen schnitt; die Fenster seiner Zimmer sahen in die alten Bäume hinein, die er zum grossen Teil selbst gepflanzt hatte. Jeden Verkauf hatte er bisher abgelehnt, fest, bestimmt, bauernzäh. Es würde wieder einen harten Kampf geben, und Friedrich Frohwein erschien es sehr zweifelhaft, ob er diesmal siegen würde. Trotz aller Vorteile.
So nickte er Berstel zu. „Sehr schön, lieber Herr, sehr klar und scheinbar auch vorteilhaft. Wirklich sehr verführerisch. Ich kann mich natürlich nicht sofort entscheiden. So etwas will mehr als reiflich überlegt werden.“
„Gewiss, Herr Rittmeister, gewiss, ich verstehe vollkommen. Aber trotzdem, schneller Entschluss wäre gut. Wir haben jetzt Oktober. Im Februar könnten wir mit dem Bau anfangen. Das sind rund vier Monate, und es ist noch viel zu tun. Ich kann nur einen Teil des Baukapitals geben, der andere muss erst beschafft werden, was nicht leicht ist. Wir müssen dann schon an den Eröffnungsfilm denken, der natürlich ein ganz grosser Schlager sein muss. Brunos Pläne müssen durchgearbeitet werden. Ob die Berliner Bau-Union die Sache übernimmt, ist noch nicht klar. Verschiedene Firmen müssen Kostenanschläge machen. Das erfordert Zeit, Zeit, Zeit, Herr Rittmeister!“
„Ich weiss ...“
„Und gut wäre es, wenn Sie sich einmal vorher die Pläne ansehen würden. Damit auch Sie sehen, dass Ihr Haus wirklich nicht ins Hintertreffen kommt. Der Bruno hat das berücksichtigt, er sah in dieser Beziehung Schwierigkeiten. Dann müsste ich Sie allerdings bitten, einmal zu uns zu kommen. Die Pläne sind gross, vor allem die Modelle, die Bruno gebaut hat, lassen sich schlecht transportieren. Wir wohnen über unserem Kino. Die Wohnung war billig zu haben, weil die Leute sich vor der Musik scheuen. Na, und wir sind ja sowieso unten.“ Er stand auf, streckte Frohwein die Hand hin, die vor Aufregung etwas feucht war. „Also, ich würde mich sehr freuen, Herr Rittmeister, wenn Sie kämen.“
Friedrich Frohwein sagte nichts mehr. Er begleitete seinen Gast hinaus, half ihm in den Mantel, gab ihm nochmals die Hand. Als die Tür ins Schloss gefallen war, ging er in den Garderoberaum, liess Wasser in die Marmorwaschschüssel laufen, griff zur Seife. „Ekelhaft, die feuchten Pfoten.“
Dann sass er wieder an seinem Schreibtisch, rauchte Zigarette um Zigarette und dachte nach: ‚Wie bringe ich es Grossvater bei, wie gewinne ich ihn für den Plan? — Was war das Grundstück überhaupt wert? Wieviel Kapital kam bar herein? Was fiel an Zinsen ab?‘ Er nahm Papier und Bleistift, machte Phantasierechnungen.
Grosse Summen standen da, die plötzlich zum Verbrauch frei waren. Ein Auto tauchte schon vor ihm auf, Garage am Haus, und der Chauffeur wurde gleichzeitig sein Diener. Endlich würde er wieder Anschluss ans Leben gewinnen. Kinokreise, Filmkreise. Gar nicht schlecht. Das Volk war fidel. Lange genug hatte er brachgelegen, Trübsal geblasen, zugesehen, wie seine Tochter in ein Büro laufen musste. Schluss damit. Diesmal wollte er seinen Willen durchsetzen.
„Frische Fische, gute Fische! Ach spreche gleich mit Grossvater.“
Er warf den Zigarettenrest in den Aschbecher, ging an seinen Bücherschrank. Da stand immer eine Flasche Hennessy. „Der einzige Luxus, den ich mir noch leiste“, pflegte er zu sagen. Schnell goss er ein Glas Kognak hinunter. Er brauchte eine kleine Rückenstärkung.
*
Als Inge vom Büro des Doktor Lorenz heimkam, sah sie den fremden Mantel hängen. Richtig, Herr Berstel hatte sich ja bei Papa angesagt. Da wollte sie nicht stören.
Sie stieg die Treppe in der Halle hinauf, ihr Schlafzimmer und ihr Wohnzimmerchen lagen oben, unmittelbar neben dem kleinen Reich, das sich der Grossvater mit vier Zimmern, eigener Küche und eigener Wirtschafterin zurechtgemacht hatte, als Friedrich Frohwein sich entschloss, mit den Töchtern in Berlin zu bleiben. „Ich bin für klare Verhältnisse,“ hatte er gesagt, „und ich liebe meine Selbständigkeit.“
Inge zog in ihrem Schlafzimmer die Vorhänge zu und machte Licht. Schnell zog sie sich aus: herunter mit den Bürosachen, die ihr immer dunstig und verstaubt vorkamen, herunter mit Wäsche, Schuhen und Strümpfen. Und dann langgestreckt auf den Boden, die Beine langsam zur „Kerze“ gehoben, ein paar weit ausholende Kreise mit ihnen geschlagen. Das tat gut. Das frischte den Rücken wieder auf, der vom Sitzen an der Maschine müde geworden. Die Beine gesenkt und noch einmal gehoben, den Rücken dazu, dass das ganze Gewicht des Körpers auf den Schulterblättern lag.
Jetzt kalt Wasser. Der grosse Tub stand bereit, und an der Waschtischleitung hing der Gummischlauch. Selbstmassage folgte. Über Rücken und Leib, über Arme und Beine glitt der Punktroller.
Das alles dauerte nur wenige Minuten, war im täglichen Programm vorgesehen; im Frühjahr, Sommer und an schönen Herbsttagen ging es dann zu Rad auf den Tennis- oder Hockeyplatz. Jetzt war tote Zeit. Zum Rasensport zu spät, zum Eislauf noch zu früh.
Schlank und rank war Inge, der Körper straff, durchtrainiert. Die frische Wäsche lag bereit, ein dünnes Ganztrikot, eine Hemdhose, seiden, lichtfarbig, mit schlichten, schmalen, aber echten Spitzenkanten. Das Anziehen dauerte schon etwas länger; es tat so gut, in das kühle Zeug zu schlüpfen, das den Hauch persönlichen Parfüms aus dem Wäscheschrank mitgebracht hatte.
Am Frisiertisch löste Inge sich das Haar. Sie trug es noch lang, sie konnte sich nicht entschliessen, es abzuschneiden, trotzdem ihr die Sportfreunde dazu rieten, trotzdem es ihr oft selbst lästig war und sie Etta manchmal um den kurzen Schopf beneidete. Aber ihr Haar tat ihr selbst leid, sie war zu lange stolz darauf. Und auch heute wieder betrachtete sie es mit Wohlgefallen, während sie Kamm und Bürste arbeiten liess. Gewiss, man war Tippmädel, aber sollte man sich deswegen nicht pflegen? Gewiss, man musste sich einschränken, aber sollte man sich deswegen das bissel Seidenwäsche, das man doch selbst bezahlte, versagen, die paar Niedlichkeiten, die niemand sah, und über die man sich doch freute?
Ein helles Kleidchen zog sich Inge an, helle hauchdünne Strümpfe, leichte Schuhe. Wohlig streckte sie sich, als sie fertig war. So, nun war man ein anderer Mensch, der andere Mensch. Sie ging in ihr Wohnzimmer. Auf einem niedrigen Tisch neben der Chaiselongue standen Teebüchse, Zuckerdose und elektrischer Kocher bereit. Auch die Zigarettenschachtel und das Buch fehlten nicht. Diesmal war es eine neue Slevogt-Monographie, vorgestern hatte sie ein Werk über Strindbergs Frauengestalten zu Ende gelesen.
Inge liebte ihre Teestunde mit dem Alleinsein und der Ruhe nach dem Bürotrubel. Aber heute zögerte sie, als sie den Kessel anschalten wollte. Sie sah auf ihre Armbanduhr: vielleicht wartete Grossvater mit einer Tasse Kaffee auf sie. Kaffee natürlich. Grossvater trank immer Kaffee nachmittags, dieses Teufelszeug, und schlief danach wie ein Murmeltier. „Ihr Modernen mit euren verbrauchten Nerven könnt Tee labbern“, sagte er.
Richtig, Grossvater wartete. Er sass sehr aufrecht an dem sorgfältig gedeckten Tisch. Er hielt auf die altväterliche Kaffeetafel mit festem, ordentlichem Kuchen — Streuselkuchen nach Möglichkeit und nur vom Bäckermeister Krause drüben — und verachtete Teewagen mit Keks, Brötchen und Zitrone.
Inge klopfte an seine Tür, zweimal kurz hintereinander, wie sie als Kinder hatten anklopfen müssen, und wartete auf das „Herein!“