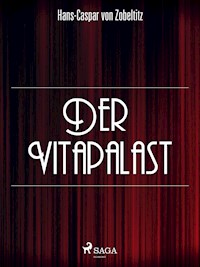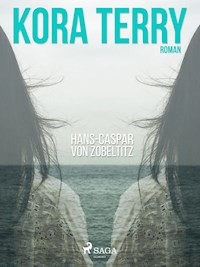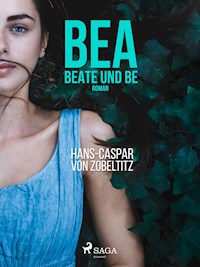Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sie hier – er dort, nur wenige Meter voneinander getrennt. Und doch scheinen Welten zwischen dem Ehepaar Doris und Peter zu liegen. Freundliches Schweigen herrscht zwischen den beiden und eine große Leere. Eines Tages tritt das junge Mädchen Grit in ihr Leben, aus der Ferienbekanntschaft entsteht ein loser Kontakt zu ihrer Familie. Besonders Peter findet Gefallen an dem Mädchen. Sogar ziemlich viel Gefallen, findet Doris. Um Abstand zu gewinnen bucht sie heimlich eine Schiffsreise in den Süden. Auf dem Schiff findet sich eine vergnügte Gesellschaft zusammen. Professor Klawitter, der unverbesserliche Romantiker, unterhält den Fünfertisch, der Schiffsarzt Dr. Heubach flirtet charmant mit ihr, die junge Ilse, die mit ihrer Freundin Else unterwegs ist, muss mütterlich getröstet werden. Und besonders der schweigsame Roland Schäfer weckt ihr Interesse. Mehr und mehr erfährt Doris von seinem besonderen Schicksal, während zu Hause Peter sich in eine Liebe ohne Zukunft verstrickt. -
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 247
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hans-Caspar von Zobeltitz
Kleine Frau auf großem Schiff
Roman
Saga
Ebook-Kolophon
Hans-Caspar von Zobeltitz: Kleine Frau auf großem Schiff. © 1937 Hans-Caspar von Zobeltitz. Originaltitel: Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2015 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen 2015. All rights reserved.
ISBN: 9788711488539
1. Ebook-Auflage, 2016
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com - a part of Egmont, www.egmont.com.
In Berlin hatte es geregnet, als Doris abgefahren war. In Bremen schien die Sonne, eine noch etwas blasse Februarsonne, aber immerhin: sie wärmte.
Anderthalb Stunden hatte Doris Zeit, bis der Lloydzug nach Bremerhaven weiterfuhr. Sollte sie ein Auto nehmen und zu Mechthild Pörtner fahren? Irgend etwas musste da wohl geschehen, ein Wort gesprochen, ein Dank gesagt werden, denn schliesslich hatte ihr Benno im letzten Augenblick noch die Kabine auf dem „General“ vermittelt. Aber zu Mechthild fahren, um dreiviertel Stunden auf einem ihrer schrecklich steifen Stühle zu sitzen und sich ausfragen zu lassen? Dreiviertel Stunden bei ihr um die Tatsachen herumreden müssen, halb die Wahrheit sagen, halb lügen? Nein. Ein Anruf würde es auch tun: „Liebe Mechthild, sei nicht böse, dass ich nicht selbst komme. Die Zeit ist so knapp. Ich habe auch noch einige Besorgungen. Haarnetze zum Beispiel. Es wird windig sein an Deck, und du weisst ja, mein Kopf sieht so leicht unordentlich aus. Sind die Kinder gesund? Grüsse Benno recht schön, und ich lasse danken, sehr herzlich danken. Ich will ihn auf seinem Büro nicht stören, er hat ja immer so viel zu tun. Was Peter macht? Danke. Gott, die Männer, immer dasselbe. Ob ich mich freue? Gewiss — sehr. Madeira — Teneriffa — Casablanca. Ja, auch Cadiz und Sevilla. Und dann ins Mittelmeer. Du kennst ja das alles. Mir ist es neu. Also: Nochmals Dank euch beiden und besonders Benno. Und grüsse die Kinder.“ So etwa sollte das Gespräch ablaufen. Das machte sich am Fernsprecher besser und vor allem leichter als Auge in Auge. Mechthild konnte eine so unangenehme Art haben, direkte Fragen zu stellen.
Überdies: Haarnetze. Das stimmte. Haarnetze brauchte sie wirklich. Gut, dass sie so daran erinnert wurde.
Schritt für Schritt war Doris die Strasse hinuntergegangen, die vom Bahnhof zum Rathaus führt, zum Riesen Roland und zum berühmten Bremer Ratskeller. Wie hiess der Dichter doch gleich, der ihn besungen? E. T. A. Hoffmann, Scheffel, Hauff? — Ganz in Gedanken war sie, es tat so wohl, dieses Schlendern in der blassen Sonne. Jetzt blickte sie sich suchend um: fremde Häuser — fremde Läden. In Berlin kannte sie im Westen jedes Schaufenster. Wo war hier ein Friseurgeschäft? Drüben auf der anderen Seite hing ein Schild, breit, einladend. Das schien das richtige.
Sie kreuzte den Fahrdamm, trat in den Laden, liess sich Haarnetze vorlegen, prüfte die Farben. Es war nicht ganz leicht, Passendes zu finden. Ihr Blond war selten.
„Haben gnädige Frau noch Wünsche?“
Doris sah nach der Uhr. Noch keine Viertelstunde war seit der Ankunft des Zuges verflossen. Wie die Zeit schlich. Was sollte sie nun mit dem Rest des Aufenthalts hier anfangen? Sie spürte keinen Hunger, keinen Durst. Es schien ihr sinnlos, sich in ein Café zu setzen, nur um die Zeit totzuschlagen.
„Sie können mir das Haar etwas schneiden.“
„Bitte sehr.“ Das Fräulein im weissen Kittel schob einen Vorhang zur Seite.
Doris zog die Kappe vom Kopf und setzte sich in den grossen Stuhl mit den bequemen Armlehnen. Ein Leinenmantel wurde ihr um die Schultern gelegt.
„Wie soll ich schneiden, gnädige Frau?“
„Nur im Nacken etwas kürzen.“ Doris hob die Arme, um zu zeigen, wie sie den Schnitt wünschte. Sie sah in den Spiegel, sah sich.
Die Schere klapperte. Sie hörte es kaum. Der Spiegel war ja da.
„Ein bisschen blass siehst du aus“, stellte sie fest. Kein Wunder. Heute zeilig aus dem Bett, viel zeitiger als sonst. Hastig gefrühstückt, hastig zum Bahnhof. Und zwischendrein den Brief an Peter noch einmal gelesen, diesen Brief, über den sie gestern bis tief in die Nacht gesessen und der doch nur wenige Zeilen lang geworden: „Ich verreise, erst einmal auf etwa vier Wochen. Ich muss Abstand gewinnen, und auch für Dich wird es gut sein, eine Weile ohne meine Nähe nachdenken zu können. Ich will Dir nicht im Wege stehen. Ich gebe Dir keine Adresse, denn ich will allein sein mit meinen Gedanken und Entschlüssen. Auch ohne Briefe von Dir. Ich versichere Dir, Du brauchst Dich nicht zu ängstigen. Ich tue mir nichts an oder so. Ich bin immer eine vernünftige Frau gewesen, das hast Du selbst oft genug zugegeben. Ich gebe Dir volle Freiheit. Wenn ich zurückkehre, werden wir ganz in Ruhe über unsere Zukunft sprechen können, eben mit Abstand voneinander. Ich hoffe, Du wirst meinen Schritt verstehen.“ Erst als die Zeit drängte, als Minna schon mit dem Portier die Koffer an den Wagen trug, war ihr aufgefallen, dass fast alle Sätze mit „Ich“ begannen. Nun war nichts mehr zu ändern gewesen. Und warum auch sollte sie das ändern? Schliesslich trug Peter ja allein die Schuld an allem. Er allein.
„Sollen die Seiten auch etwas kürzer ...?“
„Ja, bitte, aber wenig.“
Die Schere klapperte weiter.
Im vorigen Sommer hatte es angefangen in dem kleinen Ostseebad. Kaum zwanzig war das Mädel. Aber gerade dieses Alter ist gefährlich für Männer, die eben die Vierzig hinter sich haben. Zuerst hatte Doris gelächelt, wenn die beiden — die Strandkörbe standen nebeneinander — gemeinsam hinausschwammen. Dann hatte sie gelacht, dass Peter plötzlich eine Vorliebe für das kleine Tanzcafé zeigte. Aber das Lachen war doch etwas schmerzlich geworden, als er immer wieder mit diesem Mädel tanzte; gewiss: im schuldigen Wechsel mit ihr selbst; aber mit dem Mädel die Tangos, mit ihr die Steps. Es gibt da Unterschiede. Und im Herbst war seine Frage gekommen: „Wollen wir nicht einmal bei Schleusings anrufen und fragen, ob sie zum Tee zu uns kommen wollen?“ — „Wer sind denn Schleusings?“ Sie hatte wirklich vergessen, wie die Eltern dieses Mädchens hiessen. „Bitte rufe du an, wenn du es für richtig hältst“, hatte sie schliesslich erwidert. Es war zu einem losen Verkehr gekommen. Eine Villa draussen in Dahlem hatten Schleusings, er war Direktor irgendeines Industriewerkes. Und die Tochter hiess Grit. Zwei- oder dreimal hatte Doris sie wieder gesehen, schmal, schlank, sportlich war sie, wie die Mädels heute sind. Und sehr sicher. Sie wirkte in Abendkleidern überdies lange nicht so gut wie in ihren knappen Strandanzügen. Das schien auch Peter zu empfinden. Anfangs. Aber dann hatte Doris erfahren, dass sie sich doch des öfteren trafen, und vor zehn Tagen hatte sie ihn fragen müssen: „Liebst du sie?“ — „Rede doch keinen Unsinn, Doris!“ — „Ich glaube, es ist kein Unsinn.“ Kurz darauf, ehe er diese Reise, diese Geschäftsreise nach Düsseldorf antrat, sah sie ihn mit ihr auf der Strasse. Sie hatte Blumen in der Hand. Abschiedsblumen natürlich. Sie hätte darüber lächeln können. Aber wie lange war es her, dass er ihr die letzten Blumen mitgebracht hatte?
„Ist es so recht, gnädige Frau?“
Doris sah auf — wieder in den Spiegel. Blass, dachte sie von neuem, sehr blass. Und ein paar Falten um die Mundwinkel sind auch schon da. Ein bisschen früh für sechsunddreissig.
„Ja, danke.“
„Bitte sehr, gnädige Frau.“ Der weisse Mantel wurde ihr von den Schultern genommen, der Vorhang wieder zur Seite geschoben. „Wenn Sie bitte an der Kasse zahlen wollen ...“
Neben der Kasse stand der Fernsprecher. Der Besitzer des Geschäfts stellte die Verbindung mit dem Hause Pörtner her. Es dauerte eine Weile, bis Mechthild an den Apparat kam. Dann aber lief das Gespräch so ab, wie Doris es sich vorgenommen hatte, nur dass es immer wieder von Mechthild unterbrochen wurde: „Wie schade, dass ich dich nun nicht sehe. Ihr kommt doch nie nach Bremen und wir kaum nach Berlin.“ Und dann: „Vor fünf Jahren waren wir das letztemal zusammen.“ Und endlich: „Nun wird es sicher wieder Jahre dauern.“
Darum ja gerade, dachte Doris, darum ja gerade konnte ich Benno bitten, mir bei Besorgung der Karte zu helfen. Er fährt ja eher nach Amerika hinüber als nach Berlin. Er wird Peter nicht treffen. Und Mechthild schreibt nie. Von dieser Seite wird Peter nichts erfahren. Mechthilds Stimme war noch genau so spröde wie damals, als sie in Jungmädeljahren Freundschaft schlossen, und das „sp“ sprach sie immer noch getrennt.
„Dank euch beiden und besonders Benno. Und grüsse die Kinder.“ Das wurde der Schlusssatz, wie sie es geplant. Sie hörte noch, wie Mechthild sagte: „Also dann, Doris: Meeresstille und glückliche Fahrt.“ Das war wohl der übliche Abschiedsgruss hier an der Küste.
Doris legte den Hörer in die Gabel.
„Gnädige Frau fahren mit dem ‚General‘?“ fragte der Herr an der Kasse, als sie bezahlte. Sie nickte. Er öffnete ihr die Tür. „Der ‚General‘ ist ein herrliches Schiff. Das Wetter wird wundervoll werden.“ Doris ging an ihm vorüber. „Glückliche Fahrt“, sagte auch er als Beschluss.
Im Fenster eines Reisebüros hing eine Uhr. Doris erschrak: Jetzt wurde es Zeit, sie musste sich beeilen. Aber unter der Uhr sah sie noch das Bild, das grosse farbige Plakat: Palmen, blauer Himmel, blaues Meer mit weissen Schaumkronen an den Spitzen milder Wellen und davor ein junges Mädel in hellem, wehendem Kleid: „Frühlingsfahrten in den Süden.“ Es war das gleiche Plakat, das sie verführt hatte zu fliehen, das gelockt hatte, damals in Berlin, nachdem ihr Peter mit Grit begegnet war. Wann war das doch gewesen? Vor vier Tagen. Ihr schien es eine Ewigkeit.
Fast zwei Stunden dauerte die Fahrt von Bremen nach Bremerhaven. Doris war in ihrem Abteil nicht allein geblieben. Sie war in Bremen, nachdem der Träger ihr Handgepäck über ihrem Eckplatz ins Netz verstaut und sie ihn abgelohnt hatte, noch einmal auf den Gang des D-Wagens getreten und hatte sich zum Fenster hinausgelehnt. Vor dem Lloyd-Sonderzug drängten sich die Menschen, frohe Menschen, Ferienmenschen. Sie riefen, sie lachten. Sie waren laut, und dieses Lautsein gehörte wohl zu ihrer Stimmung. Doris aber tat es weh. Leichte Angst befiel sie: So viele Fremde, ein ganzer langer Zug voll, hunderte, und alle würden auf dem Dampfer sein, würden sich dort drängen und schieben, würden auch dort rufen und lachen, immer in ihrer Nähe, immer um sie und bei ihr. Sie versuchte, aus der Masse einzelne herauszuheben, sich Gestalten oder Gesichter einzuprägen. Unmöglich. Es stand ja niemand auch nur für einen Augenblick still, jeder hatte anscheinend noch irgend etwas zu tun, was unbedingt Hast und Eile verlangte: Ein Wirbel ging über den Bahnsteig, ein Wirrwarr füllte ihn.
Einmal stutzte Doris. Sie glaubte, ein Gesicht zu erkennen. Kurz vor Abgang des Zuges war es, der Mann in der roten Mütze mahnte schon zum Einsteigen, und die ersten Türen klappten; da kam noch, ruhig und gelassenen Schrittes, ein Herr auf den Bahnsteig. Er trug einen weiten Kamelhaarmantel, sehr breit in den Schultern, sehr gut gearbeitet; das fiel Doris zuerst auf. Mittelgross war er, die kamelhaarbraune Reisemütze hatte er tief in die Stirn gezogen, etwas zu tief, schien es ihr. Sehr sicher ging er durch die lauten drängenden Menschen, wirklich anders als alle, nicht einmal blickte er sich nach dem Träger um, der ihm folgte und nur zwei Gepäckstücke trug: einen kleinen hellen Toilettenkoffer und eine schweinslederne Tasche erheblichen Ausmasses, sehr sachliches, aber auch sehr teures Gepäck. Als er in der Höhe von Doris’ Fenster war, wandte er den Kopf, sah zu ihr herüber, nur für einen Augenblick, und da schien es ihr wieder, als ob sie diesem Mann schon einmal begegnet sei. Sie sah ihm nach; etwas müde war sein Gang, etwas geneigt seine Haltung. Nein, sie hatte sich geirrt, sie kannte ihn nicht, bestimmt nicht, denn diese Art zu gehen, war ihr fremd, und sie hatte gerade für solche Äusserlichkeiten ein sehr gutes Gedächtnis.
Der Bahnsteig wurde leerer, der Zug schluckte fast alles, was sich auf ihm befand. Nur ganz wenige blieben zum Abschiedwinken da.
Doris trat zurück in ihr Abteil. Ein Platz war inzwischen beseht worden, der Fensterplatz, dem ihren gegenüber. Aus ihm erhob sich ein Mann, ein Hüne. „Wir sind wohl Fahrtgenossen, gnädige Frau, Fahrtgenossen in den Frühling.“ Er sagte es dröhnend, pathetisch, in einem sonoren Bass. „Gestatten Sie, gnädige Frau, Klawitter, Professor Klawitter.“
Was tun? dachte Doris. Sie brauchte Sekunden, um sich zurechtzufinden. Richtig: Fahrtgenossen — nicht nur für einige Eisenbahnstunden, sondern für drei Wochen Leben auf dem Schiff. Das war ja etwas anderes. So streckte sie dem Fremden die Hand entgegen. „Es freut mich, Herr Professor.“
Doris setzte sich, und der Professor setzte sich auch; die Polster schienen zu ächzen.
Wenn ich jetzt nur nicht sprechen muss, wünschte sich Doris. Sie stand wieder auf, um sich ihre Handtasche aus dem Netz zu nehmen. In ihr lagen Bücher, lag auch eine Zeitung, vielleicht, dass sie sich hinter ihren Seiten verbergen konnte.
„Darf ich Ihnen behilflich sein?“ fragte der Bass und wuchtete sich gleichfalls wieder empor.
„Nein, danke.“ Doris beeilte sich. Die Tasche war leicht, sie hatte sie mit einem Griff neben sich gestellt und geöffnet.
„Sie machen zum erstenmal eine solche Fahrt?“
Doris faltete die Zeitung auseinander. „Ja“, antwortete sie.
„Es wird wieder wundervoll werden. Ich kenne die Route bereits — nur Teneriffa ist mir neu. Man kann diese Stätten des Südens nicht oft genug besuchen.“
Er ist Lehrer, er ist bestimmt Lehrer. Es gab für Doris keinen Zweifel mehr. Sie blickte über den Rand ihrer Zeitung, sah in dies Gesicht, das von einem grossen Vollbart umrahmt war. Ein unmöglicher Haarwulst, dachte sie, wie kann ein Mann nur so etwas tragen. Und plötzlich fiel ihr Hans ein, ihr Junge. Der hatte während seiner Ferien von einem Lehrer mit einem Vollbart erzählt, einem Lehrer, den er gar nicht mochte.
Hans — hatte sie ihn denn ganz vergessen in den letzten Tagen? Ihm hätte sie doch auch eine Abschiedszeile senden müssen, ihn darauf vorbereiten, dass er nun drei Wochen lang in seinem Internat nicht den üblichen Sonntagsbrief erhalten würde; sie durfte ihm ja jetzt nicht schreiben, wenn sie geheimhalten wollte, wo sie war.
Der Professor redete weiter, er verlangte anscheinend keine Antwort, ihm genügte, wenn sie dann und wann ein „Ach so“ oder ein „So“ einwarf. Das war eigentlich sehr bequem; die Gedanken konnten ruhig weiterwandern, ganz andere Wege.
Ja, wenn Hans noch zu Hause gewesen wäre, sässe sie wohl jetzt nicht hier; von ihrem Kind wäre sie nicht weggegangen. Aber das war auch so ein plötzlicher Einfall von Peter gewesen, dass der Junge nach Waldhausen musste. „Ein richtiges Muttersöhnchen wird er hier, du verweichlichst ihn. Kameraden braucht er.“ Es war der Ausklang eines alten Kampfes.
Peter war mit acht Geschwistern aufgewachsen und wollte, als sie heirateten, damals, gleich nach dem Kriege, auch ein Haus voller Kinder haben — vier oder fünf. Sie hatte sich gesträubt, die Zeiten waren so schwer gewesen, Nachkriegsmangel, Inflation; sie war froh, wenn sie genug Milch und Obst für den einen Jungen bekam, man musste ja um alles vor den Ladentüren anstehen. Und dann, als das Schlimmste vorbei war, als Peters Einkünfte stiegen, als die Geselligkeit wieder anfing aufzuleben, als es wieder Bälle gab, wollte sie erst einmal tanzen, wollte erst einmal ihr Leben geniessen, wollte nicht ans Haus und ein neues Säuglingsbett gefesselt sein. Sie hatte doch noch nichts von ihrer Jugend gehabt. „Alleinkinder sind Sorgenkinder“, hatte Peter gesagt. Sie hatte ihn vertröstet: später. Das war ein Fehler gewesen. Nun ging Hans ins vierzehnte Lebensjahr. Kein Sorgenkind — nein, forsch, frisch, sportbegeistert. Peter hatte schon recht gehabt: zu Hause hatte er immer ein wenig wie verloren herumgesessen, eben allein. Da hatte alle Mutterliebe die Lücke nicht ausfüllen können. Er war auch ohne Kummer von ihr gegangen, freute sich auf die Mitschüler, auf Wald und Land. Gewiss: er war schon lieb zu ihr, wenn er jetzt in den Ferien bei ihr war, aber sie fühlte es: im Grunde war ihm sein Rad wichtiger, und wenn es auf eine Fahrt gehen sollte, trennte er sich leicht. Manchmal überkam ihn wohl ein stürmischer Zärtlichkeitsausbruch zu ihr, aber wirklich kindlich gebunden war er nicht an ihr Haus.
„Ja, wenn mehr Kinder da wären, so wäre wohl Peter auch anders geworden. Oder er wäre so geblieben, wie er anfangs gewesen. Wenn sie zwei oder drei neben sich gehabt hätten, damals an der Ostsee, wäre er wohl nicht mit dem Mädel hinausgeschwommen.
Sie richtete sich auf. Sie wollte ja nicht an Peter denken.
„Jetzt kommt Geestemünde“, sagte der Professor, „wir fahren aber nur durch, der Sonderzug hält nicht. Und dann sind wir gleich an der Lloydhalle.“ Doris wollte ihr Gepäck ordnen, aber er hielt sie davon ab. „Sie können alles getrost liegenlassen. Ihre Kabinennummer steht ja auf den Anhängeschildern. Die Stewards kommen in den Zug und holen das Gepäck ab. Sie finden es nachher in Ihrer Kabine wieder.“ Er zeigte aus dem Fenster. „Sehen Sie, da ist die Weser und jetzt — dort die ersten Masten.“ Ganz begeistert war er, liess die Scheibe herunter, bog sich weit hinaus. „Der ‚General‘ hat über die Toppen geflaggt!“ rief er, und sein Vollbart wehte im Winde.
Der Zug hielt.
Vor der Lloydhalle stand die lange Reihe der Stewards: blaue Mützen, blaue Jacken mit goldenen Knöpfen und flotte, schwarze Binder um die blütenweissen Kragen. Ein vertrauenerweckender Anblick.
Doris nahm die kleine Tasche, in der ihr Schmuck war, an sich. Der Strom der Menschen trug sie durch die weite Halle. Aber dann stockte sie doch: vor ihr lag gross und mächtig das Schiff, hoch über die Kaimauer steigend, einer Häuserfront gleich mit vielen, vielen kleinen Fenstern und einem luftigen Dachaufbau mit Gängen und Terrassen, alles hell, leuchtend, einladend, alles überragt von den zwei Schornsteinen, aus denen feiner Rauch kräuselte, und den beiden Masten, von denen Hunderte fröhlicher bunter Fahnen flatterten. Also das nannte man „über die Toppen geflaggt“. Hübsch war das. Und viel grösser war das Schiff, als Doris sich gedacht.
Wieder war der Professor neben ihr. „Schön“, sagte er, „nicht wahr, schön.“ Das klang so ehrlich, so herzlich, dass Doris ihm alles verzieh, sein ewiges Schwatzen, seine Aufdringlichkeit, seine ungeschlachte Gestalt und seinen Bart.
„Nun kommen Sie aber“, mahnte er. „Und vergessen Sie nicht: gleich beim Obersteward einen guten Tischplatz besorgen und gleich beim Bademeister eine gute Zeit für das Bad sichern, möglichst früh — etwa um sieben. Es erscheint Ihnen wohl zu zeitig? Tun Sie es trotzdem, Sie werden es nicht bereuen.“
Doris dachte weder an den Obersteward noch an den Bademeister. Sie vergass alle Ratschläge, denn das Schiff nahm sie einfach gefangen.
Sie ging durch schmale Gänge, in denen jeder Schritt durch weiche Läufer gedämpft wurde, die hell waren von einer Fülle elektrischen Lichtes, in denen es blitzte und blinkte von geputzten Beschlägen. Sie stand in ihrer Kabine, zu der ein Page sie geleitet, war zuerst ein wenig erschrocken über die Kleinheit des Raumes; aber schon war ein freundlicher Steward da, begrüsste sie und zeigte ihr den Schrank und ein praktisches Netz zum Verstecken von Kleinigkeiten, liess kaltes und warmes Wasser zur Probe in die Waschschüssel laufen, stellte ihr Handgepäck an Stellen, wo es keinen Platz fortnahm. „Der Schrankkoffer kommt gleich“, sagte er, „aber heute abend brauchen sich gnädige Frau nicht umzuziehen, heute bleibt alles im Reiseanzug.“ Er verschwand. Doris sah durch das kleine, runde Fenster: draussen floss die Weser vorüber, breit und träge — ein Segelboot zog stromauf, es schien winzig klein. Hoch lag ihre Kabine über dem Wasserspiegel. Diese Erkenntnis beruhigte sie irgendwie.
Sie hörte Musik. Die Töne mussten von Deck kommen.
Auf den Gang trat sie hinaus, wusste zuerst nicht, ob sie sich rechts oder links wenden sollte, ging auf gut Glück nach links, kam an eine Treppe und stieg sie empor. Es musste der rechte Weg sein, denn andere nahmen ihn auch.
Sie kam auf das Promenadendeck, sah sich wieder suchend um. Von rechts tönte die Musik, sie ging dem Schall nach.
Hinten war das Deck breit und frei. Auf einer Seite lehnten die Menschen über der Reling, einer neben dem anderen, eine Kette. Sie fand noch einen Platz, stützte sich wie die anderen auf das Geländer und blickte hinab: tief unter ihr lag der Kai, lag die mächtige Lloydhalle, hinter der Schiffsmast neben Schiffsmast, Schornstein neben Schornstein aufragten, lauter winzigkleine Menschen, Zwerge im Vergleich zu dem grossen Schiff. Einzelne riefen noch Satzfetzen herauf, Abschiedsworte, Namen.
Doris verstand nichts. Sie freute sich nur an dem Bild.
Langsam fiel die Dämmerung. Erst blitzten die Lichter in der Lloydhalle auf, dann entzündete sich plötzlich eine leuchtende Lampenkette längs des Kais, in den Masten der Schiffe flammte es.
„Wir fahren“, rief jemand, und andere wiederholten es: „Wir fahren!“
„Muss i denn, muss i denn zum Städtle hinaus“, spielte die Kapelle.
Von Land her setzte ein stürmisches Winken ein, und vom Schiff flatterten Schals und Tücher zum Gegengruss. Doris konnte nicht anders, sie nestelte auch ihren Schal vom Hals und liess ihn wehen. Wenn ich auch niemand dort unten habe, dachte sie.
Auf dem Kai hatte sich eine Gruppe junger Leute zu einem Sprechchor zusammengefunden. „Jürgen — rechts! — Jürgen — rechts!“ riefen sie im Takt und zeigten in eine bestimmte Richtung.
Doris blickte in diese Richtung, suchte. Was meinten die dort unten? Dann glaubte sie zu verstehen: ganz am Heck standen zwei junge Mädel in Sportmänteln. Und wo war der Jürgen, den die anderen riefen? Der grosse Junge schien es zu sein, der seinen Hut wie toll schwenkte.
Jugend — glückliche Jugend. Doris fühlte plötzlich einen Abstand.
„Deutschland, Deutschland über alles.“ Die Kapelle setzte ein, die unten an Land nahmen die Melodie auf, die Menschen hier oben an der Reling richteten sich hoch und sangen mit. Die Arme hoben sich hüben und drüben zum Gruss. Das Horst-Messel-Lied folgte.
Das Schiff glitt weiter, kleiner wurden die Menschen, kleiner wurde die Halle. Wasser lag zwischen Kai und Schiff.
Doris stand aufrecht und sang mit. Ihr Herz klopfte, sie wusste nicht, warum. Sie fühlte nur: dies Loslösen vom Land war ein Erleben, ein grosses Erleben, Trennen von der Heimat, Trennen von Deutschland. Trennen — und dabei war es doch eine Fahrt ins Frohe, in den Frühling, in den Süden.
Die Tränen kamen ihr. Sie wandte sich ab, trat aus der Kette, schritt langsam hinüber an die andere Seite des Decks, wo keine Menschen waren. Über die weite Wasserfläche der Weser sah sie — dorthin ging die Fahrt dem Meere zu.
Langsam drehte das Schiff.
Noch einmal, nun schon ganz fern, tauchten die Lichter des Kais auf. Dunkler wurde das Wasser, dunkler wurde es um Doris.
Wenn ich nun ganz fort müsste, dachte sie, nach Amerika oder nach Indien, und niemand würde dort stehen und mir Abschied winken ...
Sie ärgerte sich: diese dummen Gedanken, diese dummen Tränen.
Aber die dummen Gedanken liessen sich an diesem Abend nicht vertreiben. Sie verfolgten sie auch noch, als sie sich zum erstenmal in ihr Kabinenbett legte.
Sie war nicht zufrieden mit sich und nicht zufrieden mit der Umwelt. Die ganze Reise schien ihr unsinnig. Sie hatte einen falschen Weg eingeschlagen, davon war sie jetzt überzeugt. Niemals würde sie Fühlung mit diesen Menschen an Bord bekommen.
Es hatte sich erst einmal gerächt, dass sie vergessen hatte, sich einen Tischplatz rechtzeitig zu besorgen. Sie hatte sich nicht von dem abendlichen Wasser trennen können, hatte an Deck gestanden, bis auch das letzte Fünkchen Licht auf Land erloschen war, hatte dann noch lange das Spiel der Leuchtfeuer beobachtet, dieses Aufzucken und Verschwinden hier, dies Bogenschlagen der Strahlenbündel dort, dieses Wechseln von Rot und Grün bald vom Ufer, bald von einer Leuchtboje her, die leise im Wasser auf und nieder tanzte. Bis ein Decksteward gekommen war: „Es ist Zeit zum Essen, gnädige Frau.“
Dann hatte sie sich doch noch umgezogen, schnell ein helles Kleid übergestreift. Aber ehe sie es aus dem Schrankkoffer genommen, ehe sie die Kleinigkeiten beisammen hatte, die doch für eine Frau notwendig sind, war mehr als eine halbe Stunde vergangen. Erst als sie in den Esssaal trat, war ihr eingefallen, dass sie keinen Platz belegt hatte. Der Obersteward war sehr höflich gewesen. „Die kleinen Tische sind alle besetzt, es tut mir leid. Aber da ist noch ein Platz an einem Fünfertisch. Allerdings bisher nur Herren. Zwei alte Stammgäste von uns sind dabei, und Doktor Heubach, unser Schiffsarzt.“ Er hatte sie quer durch den Saal geführt, die vier Herren hatten sich erhoben, als sie sich dem Tische näherte. Einer der Stammgäste war der Professor, der Hüne, der Mann mit dem Vollbart. „Wir kennen uns ja bereits, gnädige Frau“, hatte er dröhnend gesagt, „wie reizend, dass Sie zu uns kommen.“ Er hatte die anderen Herren vorgestellt. Der freie Stuhl stand zwischen dem des Schiffsarztes und dem eines Herrn Hofstetter. Doktor Heubach war jung, elegant, sehr gewandt. Er hatte Doris geholfen, sich im Labyrinth der Speisekarte zurechtzufinden. Herr Hofstetter zu ihrer Linken war Schweizer, seine harten Kehllaute hatten sie nervös gemacht. Sie hatte sehr schnell gegessen, besonders schnell, nachdem der Professor gesagt hatte: „Merken Sie es, gnädige Frau? Es beginnt zu schwanken. Jetzt kommen wir in die Nordsee, da wird es wohl Februarwellchen geben.“ Zwar hatte der Schiffsarzt gleich eingegriffen: „Sie brauchen sich nicht zu sorgen. Die Wetterlage ist denkbar günstig“, aber die Lust zum Essen war ihr doch vergangen.
An Deck war sie noch einmal gewesen. Die Luft schien ihr kalt. Keine Leuchtfeuer blitzten mehr, und wirklich: Wellen waren da mit weissen Schaumkronen, und der Schiffskörper hob und senkte sich. Es war ihr nicht ganz geheuer vorgekommen. Sie dachte an Seekrankwerden, und dieser Gedanke hatte sich zu den übrigen gesellt.
Eine Viertelstunde hatte sie dann noch in der Halle gesessen. Der Steward hatte ihr einen Kaffee gebracht. Auf der Parkettfläche in der Mitte des Raumes wurde getanzt. Aber sie hatte keine Freude am Zusehen. Nur die Frage war da: mit wem sollte ich hier wohl tanzen? Und nach einem kurzen Umblicken hatte sie auch gleich die Antwort gefunden: mit keinem.
Wenn sie wenigstens den Herrn wiedergetroffen hätte, der im Kamelhaarmantel in Bremen an ihrem Fenster vorübergegangen war. Er schien ihr der einzige lohnende Mensch unter lauter gleichgültigen Gesichtern. Aber er war nicht zu sehen.
Nun lag sie im Bett und fühlte sich jämmerlich einsam und verlassen. Das Schiff vibrierte leise vom Gang der Maschinen, sie fühlte, dass auch ihr Bett zitterte. Nie wirst du hier schlafen können, quälte sie sich. Sie beobachtete ängstlich, ob sie etwas vom Schwanken des Schiffes verspüre, und als sie glaubte, es zu empfinden, horchte sie in sich: meldete sich denn noch kein Übelsein? Bestimmt würde sie seekrank werden, wenn heute nicht, dann morgen, es gab da gar keinen Zweifel mehr. Die Tanzmusik, die dann und wann ganz zart bis hierher drang, störte sie: ja, die anderen konnten fröhlich sein, sie waren ja nicht allein, nicht auf der Flucht. Ja, war sie denn auf der Flucht? Natürlich: vor diesem Schicksal, das in Berlin nach ihr griff, das ihr ihren Mann nehmen würde, ihr Haus, ihre Sicherheit.
Sie begann sich auszuschelten: es war töricht, dass du das Feld geräumt hast, dass du feige warst.
Leise zitterte der Schiffskörper, leise wiegten ihn die Wellen, leise tönte die Tanzmusik.
Doris schlief ein.
Als Doris am nächsten Morgen erwachte, brauchte sie einige Zeit, um sich zurechtzufinden. Zuerst fühlte sie nur das leichte Zittern, das die Schiffsmaschinen auslösten; sie dehnte und streckte sich und empfand, dass sie in einem fremden Bett lag. Ehe sie die Augen aufschlug, stellte sie fest: Richtig, du bist ja an Bord. Sie fragte sich erstaunt: Bist du denn nicht seekrank? und musste zugeben: Nein, du bist in keiner Weise krank, im Gegenteil, du fühlst dich sehr wohl, du hast herrlich geschlafen, traumlos, sorgenlos. Es geht dir vorzüglich.
Sie blinzelte, hob vorsichtig die Lider: mildes Licht lag in der Kabine. Der Tag war also da.
Nun packte sie die Neugier. Mit einem Satz war sie aus dem Bett, mit zwei Schritten an dem kleinen Fenster: vor ihr lag das Meer in endloser Weite, leichte Wellen warf es auf, hier und da eine Schaumkrone. Wasser, Wasser bis an den Horizont, über dem ein paar Wölkchen schwebten, rosarote Wölkchen.
Doris war gebannt, erschüttert. Sie stand ganz still, die linke Hand noch immer an der Gardine, die sie zurückgezogen. Sie wagte kaum sich zu rühren, sie fürchtete, dass dann das Wunder schwinden würde.
Das rosa Wölkchen färbte sich am unteren Rande silbern. „Die Sonne geht auf“, sagte Doris leise vor sich hin, und plötzlich fiel ihr eine Schlagermelodie ein, die die Worte zum Text hatte: „Die Sonne geht auf.“
Wie spät mochte es sein? Sie blickte auf ihre Uhr — dreiviertel zwei. Das konnte nicht stimmen. Sie hatte also gestern abend vergessen, sie aufzuziehen.
Wieder warf sie einen Blick durch das Fenster: das Silber kroch langsam aufwärts.
„Die Sonne geht auf!“ Noch einmal sang sie es und noch einmal. Sie streifte ihren Morgenrock über, schlüpfte in ihre lackledernen Hausschuhe, sah in den Spiegel. Konnte sie es wagen, so an Deck zu laufen? Warum nicht? Der Morgenrock war sehr hübsch, seine Farbe passte zu der ihres Schlafanzuges, dessen Beinkleider unten hervorlugten, und auch die Hausschuhe fügten sich dem Bilde ein.
Über den Gang eilte sie, zwei Treppen stieg sie hinauf, fast im Tanzschritt, im Rhythmus: die Sonne geht auf. Keinem Menschen begegnete sie. Da war das Promenadendeck mit den vielen Fenstern seewärts auf der einen Seite und den Fenstern und Türen, die zu den Gesellschaftsräumen führten, auf der anderen. Sie sah nicht rechts, nicht links, sie lief dem Hinterdeck zu, sie wollte das Meer erst wieder vor sich haben, wenn der Blick ganz frei war.
Jetzt war es erreicht: die Sonne geht auf.
Blutrot hob sich der Ball aus dem Meer; ein leuchtender Streifen lief von ihm über die weite Wasserfläche bis fast zum Schiff, er färbte den Schaum der Kielwellen, färbte ihn so, dass er den Federwölkchen ähnelte: flüssiges Rosa und flüssiges Silber. Möwen schwebten darüber in lautlosem Flug, dreissig oder vierzig, und auch ihr Gefieder warf den Glanz des jungen Lichtes zurück.