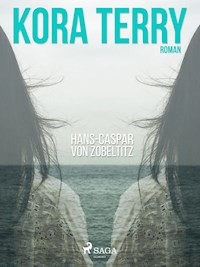
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Einst waren die Terry-Sisters, deren zwillingshafte Ähnlichkeit das Publikum faszinierte, durch alle Varietees von ganz Europa getourt. Immer treu an ihrer Seite der bucklige Tobs, der sie als Einziger auseinanderhalten kann. Sein Liebling ist Kora, die sich auch nach der Vorstellung um alles kümmert, während Maha die Nächte zum Tag macht und den Männern den Kopf verdreht. Auch der begabte Geiger Micha Verhany gerät in ihre Fänge. Freunde bitten Kora um Hilfe, um seine Karriere zu retten. Ein Solo-Engagement Mahas bringen Tobs und die Schwestern nach Argentinien und Maha wird zum Hauptverdiener. Als sie eines Tages entdeckt, das Kora einen Brief von Verhany unterschlagen hat und, in Erinnerung an die Bitte von damals, ihm – getarnt als Maha – einen Besuch abschlägt, geraten die Schwestern in Streit: versehentlich erschlägt Kora ihre Schwester. Es ist Tobs Idee, zu fliehen und als Maha nach Europa zurückzukehren. Eine neue Karriere beginnt, ein glanzvolles Leben unter falschem Namen, bis die Schatten der Vergangenheit Kora zerbrechen ...-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 444
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hans-Caspar von Zobeltitz
Kora Terry
Der Roman einer Künstlerin
Saga
In dem grossen Raum des „Odeon“ herrschte für einen Augenblick fast vollkommenes Dunkel, nur aus der Tiefe des halbversenkten Orchesters stieg gedämpftes Licht, und über den Ausgangstüren schwammen die roten Punkte der Notlampen.
Der Beifall nach der letzten Nummer war matt gewesen, sie war ein Fehlgriff der Direktion. Wer interessierte sich im Osten Berlins für einen Schulreiter? Die Leute, die hier gedrängt im Parkett und auf dem Rang sassen, wollten anderes — Stärkeres. Diese Leute hatten Hunger. Der Krieg war erst ein paar Jahre vorüber, und während des Krieges hatte es kein Varieté gegeben, wie es keinen Zucker gegeben hatte. Und für die Frauen keine Männer. Und für die Männer keine Frauen.
Jetzt warteten sie, bohrten ihre Blicke durch das Dunkel auf den Vorhang. Sie wussten, nun kam die Glanznummer des Abends: die Terry-Sisters, von denen die ganze Gegend spricht, die selbst in New York und London Aufsehen erregt haben sollen mit ihren Tänzen und ihren Songs. Auch in Paris. Das ging jetzt ja wieder hin und her.
Ein Scheinwerferstrahl stach durch den Raum, fasste das schlanke Mädel im Pagenkostüm, das, die Nummerntafel im Arm, vor dem roten Samtvorhang entlangtänzelte, um mit einem gezierten Lächeln ganz links zu verschwinden. Die Rampe flammte auf. Marschtempo warf sich über die Zuschauer. Der Vorhang teilte sich. Im grellen Licht blendeten die Kulissen. Und nun war kein Laut mehr im Raum, nur die Musik knallte ihren Marsch.
Die Terry-Sisters wirbelten auf die Bühne.
Eins — zwei, tati — tam — drei — vier, tati — tam.
Sofort hatten sie ihr Publikum gefasst. Der Begrüssungsbeifall wollte nicht enden. Sie tanzten sich durch ihn hindurch: Rechts — links, tati — tam, — vor — zurück, tati — tam. Dann setzten ihre Stimmen ein, hoch, schrill. Nur Wortbrocken verstand man, ein „Hunny-Sonny“ oder ein „Ever-never“. Aber alle riss es mit, alle, wenn sie sich auch wehrten.
Rotes Licht, gelbes Licht — tati — tam.
Arme werfen, Beine werfen — tati — tam.
Die grosse Nummer: Die Terry-Sisters.
Am Dirigentenpult stand Michael Verany. Er führte diesen langen dünnen Taktstab, von dem die zwölf Musiker unten im versenkten Orchester sich lächelnd erzählten: er habe ihn Toscanini abgesehen. Sie hatten wenig Blick, diese zwölf; sie waren kleinen Geistes; ihr Kunsthoffen war längst verschüttet; sie suchten nichts mehr in ihrer Musik, sie spielten nur noch Noten im Varieté Odeon. Sie sahen nicht, dass Michas Hand eines leichten Stabes bedurfte, diese schmale, langgliedrige Hand, unter deren Haut sich die blauen Aderstrassen wölbten. Sie spielten mechanisch, sie kannten den Takt vom Anklopfen bis zum Schluss, sie brauchten eigentlich keinen Dirigenten.
Jetzt war es ein Fox, den die Terry-Sisters wirbelten.
My golden Baby
you see me
alone ... taratam-taratii
won’t you come
tarati.
near to me
tarati
Wie seine Musiker spielten, dirigierte Michael Verany: mechanisch. Die beiden da oben brauchten nur scharfen Rhythmus; und der sass von selbst. Er sah kaum auf das Paar. Seine Gedanken waren anderwärts, mitten in der Stadt, wo in der Pfandleihe seine Geige lag.
Sie hatte ihre Geschichte, diese Geige. Weiss Gott. Eine Geschichte, blank von Kinderjubel und nass von Jünglingstränen. Und Schnaps war darüber gegossen, Wolken süsslichen Opiumtabaks wehten hinein, und eine verkorkste Liebe schrieb das Schicksal hinzu.
Morgen wollte sich Micha diese Geige wieder holen. Er hatte gespart, er konnte sie auslösen. Morgen. Daran dachte er, während er den leichten Stock schwingen liess.
Die Terry-Sisters wirbelten.
Hopp ollez
das ist noch Schwung
Hopp olla
Noch fühlt man sich jung
rammtata — rammtata
Nur nicht genant
rammtata — rammtata
Das ist pikant.
In der Mitte der dritten Reihe sass Möller, der Agent. Er hatte mit den Terrys abgeschlossen: Olympia in Brüssel. Das war drei Klassen besser als die kleine Bude hier. Ein Risiko für ihn: er stellte seinen Ruf aufs Spiel; dem Direktor Pelicier durfte er keine Niete schicken. Heute war er ganz sicher: die Nummer war gut, mehr noch: ausgezeichnet. Der Agent schnaufte, er witterte ein Geschäft. Die Gagen der beiden würden steigen, und sechs Prozent gingen in seine Taschen. Er sah nach rechts und links, sah in gespannte Gesichter. Er horchte: nirgends ein Laut, selbst kein Husten, kein Schnauben. Die beiden gefielen. Es würde wieder der Riesenbeifall wie an den letzten Abenden werden. Er wird die Terrys machen. Merkwürdig, dass sie noch keiner vorher entdeckte, dass sie so lange herumsauerten. Sie sind doch blendend gewachsen, und sie sind schön. Beim Henker, wirklich schön, selbst ohne Schminke: diese grossen dunklen Augen, diese tadellosen Zähne und vor allem dieses Haar, diese braunrote Mähne, ein Farbton, wie man ihn nur ganz selten findet und den merkwürdigerweise beide Schwestern haben. Nicht gefärbt, wahrhaftig nicht, der Agent wusste es, er liess sich nicht täuschen, er kannte sich aus. Und beide hatten das Haar in der gleichen üppigen Stärke und hatten den gleichen aufreizenden Haaransatz, der die Stirn ganz hoch werden liess, wenn sie mit einem Ruck den schimmernden Wust nach hinten warfen.
Der Agent hatte mit den Schwestern gesprochen auf seinem Büro, im Tageslicht. Die Ältere, die das Wort führte, hatte wohl mehr weg als die Jüngere, sie war rassiger, temperamentvoller. Er blickte schärfer zu: welches ist sie? Vergeblich. Auf der Bühne ist eine wie die andere: wie Zwillinge, nicht zu unterscheiden sind sie. Das ist vielleicht der grosse Reiz: die Männer wissen nicht, welche sie begehren, die Frauen nicht, auf welche sie eifersüchtig sein sollen. Der Agent rieb die Hände: es wurde ein Geschäft.
Die Terry-Sisters wirbelten.
In der ersten Kulisse stand Tobs, der Bucklige. Er hatte Frottier- und Schminktücher in den Händen, für den Augenblick, wo Maha und Kora nach hinten sprangen, wo sie für Sekunden Atem in sich pumpen durften, wo sie ihm die Lederfetzen aus den Händen rissen, um sich die Stirnen und Hälse abzutupfen, wo sie die Arme entspannend hängen liessen, wo die Gesichter schlaff wurden und die Lippen über die Zähne sanken. Bis die Musik wieder da war und sie wieder ins Rampenlicht stürzten.
Tobs stand in der Kulisse und beobachtete. Für ihn gab es keine Verwechslung, er unterschied die beiden genau. Er kannte jeden Schritt, jede Bewegung, jede Figur. Für ihn war es kein Wirbel, für ihn war es Arbeit, ausgeklügelte Arbeit, Mahas Kopf entsprungen. Maha war klug. Sie wusste, was das Publikum will. Und sie war hart; nicht gegen sich, aber gegen andere. Gegen ihn, gegen Kora.
Tobs liebte Kora, wie ein Vater seine Tochter liebt. Er war über die Fünfzig, und Kora war neunzehn. Und er hatte den Buckel, den verfluchten Buckel, dies Elend seines Lebens. Und Kora war schlank und gerade.
Er beobachtete, er zählte die Takte mit. Er war nicht zufrieden heute. Maha schludert, ihre Knie sind nicht fest; Maha hatte gestern wieder gebummelt, sie konnte es nicht lassen. Sie brauchte Männer, sie wollte lichte Nächte in bunten Lokalen und Wein. Sekt. Sie wollte Tanz, als ob sie hier nicht genug hätte. Sie wollte Liebe, frass Liebe, wie hungrige Hunde wahllos ihr Futter aus tiefen Schüsseln fressen, um sich satt in die Sonne zu legen und zu schlafen. Oft liegt Maha dann auch bis in den hellen Morgen hinein und schläft; während Kora auf Zehenspitzen geht, den Kostümtrödel flickt, denn jeden Abend ging irgend was zu Riss, während Kora wäscht. Manchmal liegt an solchem Morgen eine Handvoll Geld neben Mahas Bett, Geld, das sie in der nächsten oder übernächsten Nacht wieder hinauswirft.
Tobs streckte seinen Buckel ein wenig. Jetzt war es gleich zu Ende da vorn, noch zehn Takte. Jetzt sprang Kora zurück, ging in die Knie, sprang wieder vor. Gut so. Maha reckte die Arme, stemmte Kora. Alles in Ordnung. Mahas Knie waren jetzt fest, die Wadenmuskeln gespannt. Noch fünf Takte. Zwei Takte musste Kora oben im Gleichgewicht schweben. Richtig. Und nun kam der Durchsturz.
Tobs schrie auf.
Sein Schrei klang mit dem Koras zusammen.
Auch die Zuschauer schrien auf.
Tobs sah: Kora wollte wieder hoch, knickte aber zusammen, lag da — ohne Bewegung. Und nun bückte Maha sich nach ihr.
Da vergass Tob seinen Buckel, vergass seine Schminklappen, vergass seine Galoschen, vergass seine Hemdsärmel. Er stürzte vor, ehe ihn der Bühnenarbeiter an seiner Seite halten konnte; er rannte hinein ins Rampenlicht, in die Helle, die er eigentlich hasste, vor die Augen dieser Gaffer, die er eigentlich verachtete. Er preschte ins Offene, das er mied seit Jahrzehnten, er stellte sich wieder einmal der Welt. Er dachte nur an Kora.
Er kann sie nicht tragen, er ist ja klein und bucklig. Er packt sie unter die Arme, er zerrt sie hinter die Bühne. Koras Beine schleifen über die Bretter.
So schnell geht das, dass kein anderer vorher hinzuspringt, Sekunden, die zwei letzten Takte des Fox.
Im Parkett lachten drei, vier auf, als der hemdsärmlige Bucklige erschien. Vorher war Coleda dagewesen, der Clown. Der sass ihnen noch im Gedächtnis, und jetzt dachten sie: das ist der ulkige Schluss des Wirbels der Terry-Sisters. Sie grölten. Sie schütten sich. Sie steckten alle Umsitzenden an. Die Logen lachten, der Rang lachte. Die Stehplätze wieherten. Und dann war das Klatschen da, dröhnendes Klatschen.
Möller übersah alles, er kannte die Nummer, aber er klatschte mit. Er kannte auch solche Unfälle. Wird nicht schlimm sein, dachte er, diese Mädels sind ja wie die Katzen: immer auf die Beine! Aber den Buckligen wollte er sich langen, das war ja ein Mordsschluss. Den müssen sie von jetzt ab immer machen; die Gage für den Kleinen läuft mit, und wenn er sie für Brüssel aus seiner Tasche bezahlen soll; der Schluss steigert das Geschäft um fünfzig Prozent.
Maha hörte das Lachen. Sie war Varietékind, sie begriff sofort. Sie hatte schon wieder die Lippen von den Zähnen, sie verbeugte sich, sie lächelte. Nur ihre Augen waren verworren, ernst.
In diese Augen blickte Michael Verany. Er war der einzige, der erschrak, fassungslos erschrak. Herausgerissen war er aus seinen Gedanken, fort von seiner Geige. Er starrte auf Maha — seine Hand zitterte. Die Musiker hörten nur den Applaus, sie begriffen ihren Dirigenten nicht. Jetzt musste er doch den Tuscheinsatz geben. „Tusch“, schrie von links der erste Geiger. „Tusch“, schrie von rechts der Mann mit dem Waldhorn. Und wirklich: Micha hob den Taktstock. Dreimal spielte das Orchester den Tusch, und in jeden Tusch hinein fluchte Micha ein Wort: „Irrsinn!“
Der Vorhang ging zu, ging wieder auf, und Maha lächelte, verbeugte sich. Maha knickste, warf Kusshände. Sie wollte zur Schwester, aber immer stand hinter dem laufenden Vorhangstoff der Inspizient und schob sie wieder vor. Das Publikum raste weiter. Einige schreien: „Der Buckel soll kommen!“ Noch immer dröhnte Lachen.
Zwischen den Kulissen lag Kora. Ganz lang gestreckt, ganz ohne Bewegung. Nur der Atem ging leise. Das kleine Mieder war gerissen.
Da zerrte Tobs sich sein Hemd über den Kopf und breitete es über Kora. Nackt starrte sein Buckel.
„Bravo!“ schrie die Masse, brüllte, johlte vor dem Vorhang.
„Bestie“, sagte Tobs.
*
Sie hatten Kora ins Direktionszimmer getragen, wo ein Ruhebett war. In den kleinen Garderoben des Odeon gab es so etwas nicht.
Tobs war fortgesturzt, einen Arzt zu holen. Im Haus war natürlich keiner, obgleich es Vorschrift war. Aber um Vorschriften kümmerte man sich hier wenig im Berliner Osten. Es musste seine Zeit dauern, bis Tobs wiederkam. Wo sollte er einen Arzt finden, Sonntag in der Nacht.
Draussen ging die Vorstellung weiter. Nummer zehn: Die Chinesen, die Sun-ha-weis. Sie drehten Teller auf Bambusstöcken, jonglierten mit Messern und stellten Pyramiden. Alles dritter Klasse, aber das Parkett stierte doch und hatte die Terry-Sisters und den Buckligen längst vergessen.
Kora erwachte. Sie stöhnte vor Schmerzen. Den rechten Fuss hatte es gefasst, das Gelenk war dick geschwollen, blau vom Bluterguss. Es riss und biss in ihm. Es war zum Verrücktwerden.
Nur Maha stand im Zimmer. Einmal hatte Koleda, der Clown, die Nase hineingestreckt mit einem „Wie geht’s?“ Aber Maha hatte die Tür zugeworfen. Voll Wut war Maha, sie lief auf und ab, immer noch im Kostüm mit nackten Beinen, nackten Hüften, nackten Schultern. Ihr Mantel lag in der Ecke. Ihr war glühend heiss. Sie schimpfte: „Konntest du denn nicht zupacken, was? Wo hattest du deine Gedanken, wie? Was soll nun werden, bitte? Kannst du nicht antworten?“
Kora schloss angstvoll die Augen; sie wusste: Maha kann auch schlagen, prügeln. Sie dachte an die Proben, wenn Tobs am Klavier sass und die Takte zählte: „Eins — zwei — drei — vier, eins — zwei — drei — vier“, und Maha kommandierte, stundenlang; dann hatte sie plötzlich einen Stock. Mit fünfzehn Jahren hatte Kora herangemusst; als sie sechzehn gewesen, hatte Maha die Sister-Nummer fertig. Sisters waren gefragt. Vier Jahre Probe, vier Jahre Tempos, vier Jahre Schläge.
Wenn solch Hieb sass, meinte Maha: „Siehst du, das merkt sich dein Bein, nun wird es zur Zeit kommen. Vater hat’s auch nicht anders gemacht.“ Maha hatte ja noch mit den Eltern gearbeitet. Sie war sieben Jahre älter.
„Und Brüssel?“ schrie sie jetzt. „Das Olympia-Theater? Weg! Fort! Denkst du, dass du in zehn Tagen wieder herauskannst? Brüssel, das war doch was, endlich. Und nun? Engagement zum Deubel! Gage zum Deubel! Verfluchte Schweinerei!“
„Verfluchte Schweinerei!“ schrie auch der Direktor, der hereinkam, als die Arbeit der Sun-ha-weis draussen lief.
Aber jetzt machte Maha ein anderes Gesicht. Ganz freundlich war sie. „Ich mache diese Woche meine alte Solonummer, Herr Direktor, sie sitzt noch, jeder Schritt. Sie hat immer gefallen.“
„Halbe Gage“, meinte er trocken.
Dann war auch Möller plötzlich da. Auch er fluchte. Auch ihm erzählte Maha von der Solonummer. Sie schob sich an seinen schweren Körper heran, ein Strich war sie neben ihm, ein Nichts.
Endlich kam der Arzt und mit ihm Tobs. Der Arzt fragte erst nach Kasse und Krankenschein, er ging sicher. Alle standen um ihn herum, als er Koras Knöchel abtastete; er drehte den Fuss im Gelenk. Kora bäumte sich vor Schmerz. „Gebrochen ist nichts“, sagte er, „aber verstaucht und die Bänder gezerrt.“ Er hatte Binden mitgebracht, er wickelte den Fuss ein bis fast herauf ans Knie. „Hochlegen das Bein und Ruhe“, befahl er. Und als Kora immer noch ächzte, griff er zum Besteckkasten und gab ihr eine Spritze Morphium.
Völlig verwandelt war Maha jetzt, sie küsste die Schwester. „Mein Liebling, mein Kleines.“ Sie streichelte ihr Gesicht. „Du musst nicht verzweifelt sein, ich bin doch bei dir, ich werde dich pflegen, ich sorg’ für dich.“ Ganz weich war plötzlich ihre Stimme, zart legte sie Koras Kopf an ihre Brust. Sie wusste: so etwas wirkt. Sie weiss immer, was wirkt; es ist ihr gegeben, stets den Geschmack des Publikums zu treffen, das gerade da ist. Sie dachte: Jetzt, hier musst du liebende Schwester sein! Und sie spielte ihre Rolle hinreissend, überzeugend. Selbst dieser Kassenarzt wurde für einen Augenblick weich: „Ich werde morgen nach Ihnen sehen.“ Aber er meinte damit nicht die Kranke.
Möller hatte sich dicht an Tobs herangeschoben. Möller war Zauberkünstler gewesen, ehe er Agent wurde; er war abergläubisch wie alle beim Varieté. Er legte die Hand auf Tobs Buckel, während er fragte: „Wie lange wird’s dauern?“ Einen Buckel anfassen bringt Glück.
Der Arzt griff nach seinem Hut. „Vier Wochen oder sechs. Was weiss ich?“ meinte er. Dann ging er zur Tür.
Vielleicht wird doch noch was aus dem Terry-Geschäft, dachte Möller, man muss abwarten. Er hatte immer noch die Hand auf Tobs Buckel. Er war plötzlich milde gestimmt. Draussen stand sein Wagen, er erbot sich, Kora nach Hause zu fahren; er packte dann sogar mit zu, als sie sie in ihrem Chambre-garni-Haus über die Treppen hinauftragen mussten. Als Kora auf ihrem Bett lag, steckte er sich eine dicke Zigarre an und sagte zu Maha: „Zieh dich um, wir haben noch miteinander zu reden.“ —
Da ist nun Tobs. Er sitzt neben Koras Bett. Er hat Kora abgeschminkt — sie war ja ganz im Morphiumdusel —, er hat Kissen unter ihr Bein geschoben, Kissen aus seinem Bett, das im Zimmer nebenan steht und in das er sich ebensogut legen könnte, denn Kora schläft. Maha hat sich um nichts gekümmert, sie weiss ja: er ist da, er, Tobs. Sie ist auf und davon mit Möller; sie war wieder ganz obenauf. Tobs hat sie lachen hören, als sie über den Flur ging. Sie wohnen gemeinsam, die Terrys und Tobs, bei Frau Rübeisen, die immer „Künstler vom Odeon“ hatte, wie sie sagte; jeden Monat andere; sie lieferte morgens den Kaffee und gab auch Mittag- und Abendessen ab, wenn ihre Gäste es wollten. Und meist wollten sie es, denn die Leute vom Varieté sind solide und lieben gute bürgerliche Kost.
In Tobs ist ein Schmerz, der ihn elend macht, der ihm auf den Magen drückt. Er möchte weglaufen wie Maha und sich besaufen. Aber er fürchtet sich vor dem Suff, er kennt sich: er kommt dann nicht so leicht heraus; es dauerte drei, vier Tage, ehe er sich wieder hatte. Manchmal eine Woche. So sieht er in Koras Gesicht, als ob er dort Kraft fände, Hilfe vor sich selbst.
Kora schläft ganz ruhig.
Es ist fast dunkel im Zimmer. Tobs hat einen Strumpf über die Glühbirne gestreift, die als einzige Beleuchtung in einem Pendel von der Decke hängt; er hat die Birne gerade erreichen können, als er auf den Stuhl kroch.
Er denkt zurück. Auf der Schule hatten sie ihm zum erstenmal gesagt, dass er bucklig wäre. Er wird das nie vergessen, obgleich es ein Menschenalter zurückliegt. Er hatte zuerst gar nicht begriffen, was der Bengel, der neben ihm in der Bank sass, meinte. „Buckel.“ Zu Hause hatte er das Wort nie gehört. Und dann schrie es in der Pause plötzlich der ganze Schulhof, bis der Lehrer, der die Aufsicht hatte, dazwischenfuhr. Tobs hatte sich umgesehen und begriffen. Von da an stand er immer in der Ecke an der Tür mit dem Rücken zur Hofmauer. Und später auf dem Gymnasium hatte er auch solchen Platz in den Pausen. Denn nur die fürchtete er, in den Stunden war er sicher, da rückten sie zu ihm heran und sahen in seine Hefte. Tobs hatte Brüder und Schwestern, aber die schämten sich seiner, und auch Vater sagte: „Bleib nur hier“, wenn er mit Karl und Franz in den Stadtwald ging. Höchstens, dass Mutter ihn mitnahm, wenn sie Besorgungen machte, aber dann sagten die Leute immer: „Gott, der arme Junge!“, und er hatte scharfe Ohren bekommen. In Göttingen hatte ihn dann der Suff gepackt; er hatte gedacht: Nun ist es vorbei, jetzt bin ich unter verständigen Menschen. Arzt wollte er werden. Aber da war wieder das Wort gewesen: „Buckel“. Und wieder die Einsamkeit. Und eines Tages war der Zirkus gekommen und mit ihm Charles, der Zwerg. Den hatte er in der Kneipe getroffen; es hatte ihn an den Tisch gezogen, wo der Kleine sass, der Bruder. Charles sprach kaum deutsch, und trotzdem redeten sie bis tief in die Nacht und tranken. Dann war er mitgezogen und Tobs geworden, erst Tobs, der Clown, dann Tobs, der Dresseur, als ihm Jolly, der Hund, zulief, wie er dem Zirkus zugelaufen. Zu Jolly waren Hektor und Rita gekommen, und Persie, die Äffin, und Koko. So wurde Tobs eine Nummer. Zwei Jahre lang zog er immer mit den alten Terrys, die einen Luftakt machten. Maha arbeitete schon mit; bis sie plötzlich aussetzen musste. Er war damals dazwischengesprungen, als der Vater sie fast totgeschlagen hatte, weil sie ein Kind erwartete. Achtzehn war Maha gewesen, war hineingetapst in das Unglück, sie hatte nun doch einmal dies verfluchte leichte Blut.
Da war nun Tobs und dachte zurück und grübelte und hatte immer diesen Druck in der Magengegend. Er musste sich am Stuhl festhalten, um nicht wegzulaufen, die Treppen hinunter, in irgendeine Kneipe.
Kora begann sich zu bewegen, sie schüttelte den Kopf, sie schüttelte die Schultern, sie sprach. Tobs dachte: Sie wird wach. Aber ihre Augen blieben geschlossen. Er horchte. Ihr Atem ging schnell, unheimlich schnell, als ob sie hastete, liefe. Und jetzt verstand er auch ein Wort und noch eins: „Help — help!“ Er wusste: jetzt träumt sie, träumt von dieser Nacht in Dublin.
Majestic-Hall nannte sich das kleine Theater. Maha war nicht mit auf der Tour, sie war in Düsseldorf geblieben, weil das Kind kommen musste. Die Terry-Eltern arbeiteten gerade hoch oben über dem Fangnetz, als das Feuer ausbrach. Kora stand in einem Flitterkleidchen auf der Bühne und hielt das Seil, an dem die Eltern hinauf- und hinabkletterten. Aus den Kulissen zischte der Brand; und Kora liess das Seil fahren; die Flammen waren nach oben geschlagen. Tobs hatte die nächste Nummer, er stand schon bereit. Kora lief ihm gerade in die Arme; das Kind klammerte sich an ihn. Da hatte er Jolly vergessen und Rita und Persie und Hektor. Er hatte Kora aufgehoben und hinausgetragen. Seine Nummer aber war umgekommen, wie die Terrys umkamen, weil das Feuer das Seil frass, weil das Feuer das Netz frass. Dann war er mit Kora nach Düsseldorf gefahren. Als sie ankamen, hatte Maha ihr Kind, ein Mädchen. Ein Priester war gekommen und hatte es getauft, ohne viel zu fragen: Eva.
Tobs Hand lag jetzt auf Koras Stirn, und Kora war wieder ruhig.
Es hat alles seinen Sinn, dachte er, vielleicht auch das jetzt. Wäre Maha mit oben in den Seilen gewesen damals in Dublin, ständen Kora und ich jetzt allein. Denn ich war nichts ohne die Tiere. Und Kora war nichts. Aber Maha war etwas gewesen damals, Maha hatte sofort gewusst: Tanzen. Sie kannte keine Trauer, sie setzte Tobs ans Klavier und hatte in vier Wochen ihre Nummer fertig. Sie hatte die Agenten in die Tasche gesteckt und etwas aus sich zu machen gewusst. Rücksichtslos hatte sie ihr Ziel im Auge gehabt, sie verstand die Menschen zu nehmen.
Oh, Tobs kannte sie. Er wusste: ihr Leben ist Theater, auch wenn sie nicht auf der Bühne steht; ihr Leben ist eine Folge virtuos gespielter Szenen, immer setzt sie sich mit geradezu nachtwandlerischer Sicherheit in die richtige Pose, immer findet sie den richtigen Ton, die richtige Haltung. Sie lacht, sie weint, sie jubelt, sie leidet, wie es gerade der Augenblick fordert. In Sekunden kann sie ihr Wesen umstellen. Sobald sie Publikum wittert, und dieses Publikum braucht nur aus einem einzigen Menschen zu bestehen, durchzuckt es sie, sie wird eine andere, sie lebt auf, sie lässt ihre Künste spielen. Es ist dann wie ein Kampf, und sie ruht nicht eher, bis sie in diesem Kampf gesiegt hat, bis sie ihren Erfolg von dem Gesicht des Gegners ablesen kann.
Das war damals schon so gewesen, war heute noch so. Und dabei war dies Spiel nicht einmal gemeine Lüge. Nein — Tobs wusste, dass sie im Spiel alles glaubte, was sie da gaukelte; ihr Lachen war so echt wie ihre Tränen, sie freute sich wirklich, sie litt wirklich; sie steigerte sich selbst in all diese Gefühle hinein. Nur zu Hause, vor ihm und Kora, da liess sie sich gehen — da lohnte es ihr nicht, da war kein Widerhall, da wusste man zu viel von ihr.
Trotzdem: sie hatte sich nie um ihre Pflichten gedrückt.
Sie hatte Kora mitgeschleppt durch Deutschland, England, Frankreich, nach Wien, nach Budapest, nach Sofia, nach Warschau. Und er war bei ihnen geblieben. Was sollte sonst, während Maha tanzte, aus Kora werden, die nicht Mutter noch Vater hatte? Was sollte er ohne Jolly, Rita, Persie?
Und plötzlich sah er jetzt seine Tiere um sich. Ihm war, als schnupperten die Hunde um seine Beine. Sein Kopf sank vornüber. Tobs schlief.
Dann — nach Stunden — stand Maha im Zimmer. Mit krallen Augen und lachenden, blitzenden Zähnen. „Ich geh’ doch nach Brüssel. Aber ich muss üben, üben, die Solos. Such die Noten, Tobs: den Tango, den Walzer und den Marsch.“ Sie sang ein paar Takte. „Du weisst ja, was ich vor den Sisters getanzt habe. Such das Zeug heraus, Tobs. Ich will jetzt schlafen.“
Sie riss sich das Kleid von den Schultern, schlenkerte die Schuhe fort, streifte die Wäsche ab. Alles flog auf den Boden. Nicht einen Blick warf sie auf Kora.
Sie lag im Bett, den Körper zur Wand. Und Tobs bückte sich, hob das Kleid auf, die Wäsche. Er öffnete den Schrank und schloss ihn wieder. Er löschte das Licht und ging in sein Zimmer. Er wusste: Kora schläft. Aber die Tür lehnte er nur an.
In seinem Zimmer standen grosse Koffer: Kleider, Kostüme. Ganz unten lagen die alten Noten.
Tobs fand schnell, was Maha brauchte. Bei Frau Rübeisen stand ein Klavier. Er hatte manchmal nachmittags auf ihm gespielt: — Bach.
*
Sie haben alle ihre Schicksale, diese Menschen. So auch Michael Verany, der da am hellen Morgen des nächsten Tages durch die Strassen lief ins Zentrum der Stadt. Er war eigentlich unglücklich, dass er laufen, hasten musste, aber der Direktor hatte ihn zu elf Uhr zu einer Probe bestellt; er sollte seinen zwölf Musikern noch etwas einfuchsen für den Abend. Er wusste: die eine der Terrys wird etwas anderes tanzen, allein. Er wusste: die andere hat sich den Fuss verstaucht, aber es soll nicht schlimm sein. Dann, als er um eine Eckerannte, musste er einen Atemzug lang an diese verworrenen Augen denken, die ihn anstarrten gestern abend, während der Mund unter ihnen lachte.
Er würde viel lieber langsam gehen, dieser Micha. Er würde lieber schlendern, einen Sonntagmorgen aus diesem Montagmorgen machen, sich über die Sonne freuen, die hell scheint, sich über die Menschen freuen und über die grossen, blanken Autos. Er möchte zu seiner Geige gehen, wie man am Festtag zur Kirche geht, wenn man gläubig ist. Nun, da er selbst laufen musste, sah er, dass die Menschen neben ihm auch hetzten und Sorgen in ihre Gesichter eingeschrieben waren, sah, dass in den Wagen Hohlbrüste oder Rundbäuche sassen, die irgendwie auf der Jagd waren nach Dingen, an denen sicher auch keine Ruhe und kein Glück haftete.
Dann stand er an einem Schalter und legte seinen Schein hin und neben ihn das Geld. Hinter einem grossmaschigen Gitter sass ein altes Mädchen mit stumpfen, grauen Augen; es zog mit einer müden Bewegung sich den Schein näher und las die Nummer, es holte ein dickes Buch und blätterte, fuhr mit einem Bleistift eine Zahlenkolonne hinunter, machte an einer bestimmten Stelle halt. „Eine Geige?“ fragte es. Micha nickte. Nun zog sich das Mädchen sein Geld heran, Papier und Münzen. Viel Geld für Micha, zusammengehungertes Geld. „Noch zwei Mark vierzig Auslösungsgebühr“, tönte es durch das Gitter. Ein Schreck fiel auf Micha. Oh, er hatte das Geld noch, hatte sogar mehr in der Tasche; aber die kleine Summe bedeutete doch wieder: hungern, verzichten. Und das Verzichten fällt ihm schwer. Er zahlte. Sein Schein bekam einen grossen roten Stempel quer über das Gesicht; Micha war es, als ob der Fetzen Papier nun lache: er bedeutete ja jetzt keine Schuld mehr, er bedeutete Besitz.
Micha ging durch eine grosse Tür in einen grossen Raum, den ein breiter Tisch in zwei Hälften teilte. Die kleinere war diesseits des Tisches, und in ihr drängten sich viele Leute mit Packen unter den Armen, mit Bündeln über den Schultern, mit Koffern, Kisten und Kästen neben sich am Boden, manche pressten auch nur etwas Kleines, Glitzerndes in der Hand. Alle aber drängten dem einen Schild zu: „Annahme.“
Dahin brauchte Michael Verany heute nicht. Er ging auf den Teil des Tisches zu, über dem das Wort „Ausgabe“ hing. Da war kein Mensch, da war er ganz allein. Denn in dieser Zeit nach dem verlorenen Krieg kam niemand, um auszulösen, an was er einst sein Herz gehängt hatte.
Micha brauchte nicht zu warten hier, gleich war jemand da, nahm ihm seinen lachenden Schein ab und stelzte durch die grosse Raumhälfte hinter dem Tisch. Micha sah ihm nach. Der grosse Raum war erfüllt von Regalen, die bis an die Decke stiegen, und die Regale waren erfüllt von Ballen, Paketen; zwischen ihnen drängten sich Fahrräder und Kinderwagen und Nähmaschinen. Nein, es war hier gar nicht wie in einer Kirche, und vielleicht doch: man trägt ja auch hierhin Sorgen, und man geht ja auch leichteren Herzens fort, man hat ja wieder Geld in der Tasche — Geld, Geld ... verfluchtes Geld; man kann Brot kaufen oder Miete bezahlen oder zur Apotheke gehen oder zum Tanz oder zum Schnaps.
Da stellte der Mann den schwarzen Geigenkasten auf den Tisch. Micha schrak zusammen: er hatte gar nicht bemerkt, dass der Mann kam, er war mit seinen Gedanken bei den Sachen auf den Regalen gewesen, bei all dem fremden Schicksal. Er hatte sich selbst ganz vergessen.
Jetzt aber raffte er seinen Kasten an sich und wollte auf und davon. Doch der Mann hielt ihn fest: „Wollen Sie nicht erst nachsehen, ob drinnen alles in Ordnung ist?“ So hob Micha den Deckel und sah seine Geige wieder. Er dachte, er müsse aufjubeln, aber es blieb still in ihm. Er blickte auf das tiefbraune glänzende Holz, das da in blauem Samt gebettet ist. Merkwürdig: das Holz war tot; die Saiten waren schlaff, und der Steg war umgefallen. So lange hatte die Geige hier gelegen in der Sorgenkirche.
„Quittieren Sie, bitte“, sagte der Mann mit seiner blechernen Beamtenstimme. Und Micha schrieb: „Michael Verany“ auf den Schein, schrieb dahin, wo der dicke Finger des Mannes zeigte. Der Mann las den Namen und meinte: „Jetzt ist es gut, jetzt können Sie gehen.“ Nein, er wusste nicht, was dieser Name erzählte. Er wusste nichts vom Wunderkinde Michael Verany, dem die Menschen in den Konzertsälen einst zugejubelt hatten, als es siebenjährig Variationen spielte, an deren Schwierigkeiten Meister verzweifelten. Nein, er wusste nichts; er ist Beamter und wird sich Punkt elf Uhr auf einen Koffer voll Elend zwischen seine Regale hocken und sein Butterbrot essen.
Michael Verany aber stand um elf Uhr am Dirigentenpult des Odeon. Jetzt waren seine Taschen ganz leer: er hatte sich noch Saiten kaufen müssen und Kolophonium. Es war überhaupt alles nicht so gekommen, wie er es sich gedacht hatte. In seiner kleinen Mietsstube hatte er heute früh zum ersten Male die Geige wieder ansetzen wollen, und jetzt stand sie in ihrem Kasten neben dem Stuhl des ersten Geigers, der noch nicht da war.
Es war auch alles noch nicht eilig. Sie hatten ein Klavier oben auf die Bühne geschoben; an dem sass der Bucklige, über den die Leute gestern so gelacht hatten, und zerhackte eine Melodie. Neben ihm stand der Direktor und sah zu, wie die eine Terry-Sister tanzte. Er hatte ein Glas Bier oben auf das Klavier gestellt, ab und zu trank er einen Schluck.
Auch Micha sah eine Weile zu, dann langweilte es ihn, er hatte schon viele Tänzerinnen gesehen. Er kannte diese Schritte, dieses Biegen und Beugen, dieses Laufen und Trippeln, dieses Springen und Hinsinken. Er verliess sein Podium und ging zu seiner Geige; er öffnete den Kasten und zog die neuen Saiten ein; er spannte den Bogen fest; dann stimmte er leise. Das Klavier oben störte ihn nicht, er hörte den Ton seiner Geige; ganz sicher hörte er ihn. So sass er, seine Geige am Kinn, bis der Direktor ihn rief und ihm einen Notenpacken reichte. „Jetzt mit Orchester!“ Es war ja kein Zweifel, dass die zwölf das leichte Zeug gleich vom Blatt herunterspielten. Der junge Kerl, der das Schlagzeug bediente, teilte die Blätter wie üblich aus. Aber die erste Geige war noch nicht da. „Also los, los!“ schrie der Alte oben auf der Bühne, „Vorhang zu, fünfzehn Takte vor und Vorhang auf!“ Micha zögerte. Dann nahm er seine Geige mit zum Pult: er wird den Fehlenden vertreten, obgleich sich irgend etwas in ihm sträubt. Es kommt ihm wie eine Entweihung vor.
Michael Verany spielte. Er spielte diesen abgedroschenen, abgestandenen Tango, der schon seit Jahren durch alle Cafés und Nachtlokale lief. Spielte ihn, dass selbst die Notenhandwerker unten im Orchester aufhorchten.
Wie kam es nur, dass einst aus diesem Wunderkind Michael Verany nichts wurde, dass der Stern, der damals in Ungarn aufging, so schnell wieder erlosch? Micha wusste es selbst nicht. Er dachte jetzt vielleicht, während er spielte, endlich wieder einmal spielte, an seine junge Glanzzeit zurück; es ist für ihn nichts mehr als eine Kindheitserinnerung, schon halb aufgesogen in den Windungen des Hirns, zurückgepresst vom Leid. Viel klarer ist ihm die Zeit, wo er plötzlich so unendlich müde wurde, wo alles vor seinen Augen flimmerte, wenn er die Geige ansetzte, wo Noten und Tempi ineinanderliefen, wo ihn die Angst packte, wenn er auf ein Podium sollte, wo der Vater ihn zwang, wo die Mutter ihn schalt. Bis plötzlich alles aus war und er wieder in Temesvar in die Schule ging wie andere Jungen, nur dass die Väter der anderen arbeiteten, während sein Vater in der Villa mit den grossen Fenstern sass, durch den Garten mit den vielen Blumen ging, immer da war. Dass er den Eltern ein Vermögen erspielt hatte, wurde ihm erst später bewusst. Und dann kam das Konservatorium. Alle hatten ihm gesagt: „Jetzt beginnst du neu; jetzt kommt deine Laufbahn.“ Aber nichts kam; nur Enttäuschung, Enttäuschung, gerade weil er nun seine Geige wieder liebte, weil er nun wieder an sich glaubte. Doch die andern glaubten nicht an ihn; die Lehrer nicht, sie lächelten: „Wunderkind“; die Mitschüler nicht, sie lachten: „Wunderkind.“ Vielleicht glaubte Lola an ihn, sie sagte es wenigstens, und er liebte sie dafür. Sie nahm sich das Haus, sie nahm sich sein Geld, sie setzte sich breit, behäbig und bürgerlich in all das hinein, aus dem die Eltern herausgestorben waren, sie schwatzte am Zaun mit den Nachbarn und keifte, wenn immer wieder Absagen von den Agenturen kamen. Da floh er mit seiner Geige, floh in den Krieg. Er spielte in Offiziersmessen, er spielte in den Lagern hinter der Front, er spielte in den Unterständen, aber er wurde nicht froh. So zerbrach er, als der Krieg aus war und die Welt ihren zweiten Wahnsinnstanz begann: um Geld und Gier.
Ja, die lange Leidenszeit stand heute noch klarer vor Micha als die kurze Lustzeit. Aber in der war eigentlich sein Wesen verwurzelt. Er war wie seine Hände geblieben, die nichts Schweres halten konnten, nichts packen konnten. Dabei ist Micha noch jung: vierundzwanzig.
Die Notenhandwerker unten horchten auf. Und oben auf der Bühne horchte auch Maha auf. Nicht, dass sie lauschte — nein. Ihr fuhr es nur ins Blut, in die Glieder. Es riss sie hin, es setzte sich um in ihr, es wurde Bewegung.
Der Direktor hatte gar nicht gemerkt, dass der Verany spielte. Aber er sah, dass Maha anders tanzte: besser, vorzüglich. Er liess seinen Bierrest schal werden und wusste, dass ihm über die Programmlücke fortgeholfen war. So rief er sogar: „Bravo!“ als die Nummer beendet.
Da fällt ihn Maha gleich an. Sie ist ganz heiss. Sie schreit fast: „Der da muss spielen, wenn ich tanze, der da!“ Sie streckt ihren Finger gegen Micha aus, sie nimmt sich einfach Micha. Sie hat jetzt gar keine Zeit, sie ruft: „Weiter, den Walzer“, und sie tanzt wie besessen. „Weiter, den Marsch.“ Sie gibt jetzt das Tempo mit ihren nackten Armen und Beinen, mit ihren wirren, rotbraunen Haaren, die ihr über die Stirn fliegen und die sie mit einem Ruck wieder ins Genick schleudert. Und Micha folgt ihr mit den Augen und mit dem Bogen, er spielt ihr Tempo, ihren Willen. Er spielt und glaubt endlich einmal wieder, dass sein Spiel einen Sinn hat.
Maha aber stürzt nach dem letzten Takt an die Rampe. In ihrem Kopf hat sich ein Gedanke eingefressen. „Hast du nichts anderes?“ schreit sie Micha an, „du musst etwas anderes haben. Warte, ich hole dich.“ Sie läuft in die Garderobe, reisst sich das Kostüm herunter, wirft die Kleider über den nassen Körper, rennt die Steinstufen ins Orchester hinab. „So komm doch!“
Sie zerrt Micha mit sich über die Strasse bis an das Haus, wo sie Quartier haben. Sie weiss auch, dass da oben ein Klavier steht, weiss, dass Tobs hinter ihr herschleicht. Tobs muss begleiten, muss sich die Noten zusammensuchen; es muss gehen. Sie bringt die alte Rübeisen in Bewegung, der Tisch mit der Plüschdecke wird auf den Flur geschoben, der zertretene Axminster zusammengerollt. Sie hat nicht einen Blick, nicht ein Wort für Kora, sie rennt über den Flur, schreit nach Tobs, schubst ihn ans Klavier, steht vor Micha. „Spiel! Spiel! Du bist doch Ungar. Einen Czardas oder eure verfluchte Rhapsodie!“
Und in Micha ist plötzlich ein Rhythmus wach, einer von denen aus seinen Kindertagen, ein ganz toller Wirbel, den alle damals umstaunten. Er hat die Geige unter dem Kinn, er spielt.
Tobs sitzt da, die Hände auf den Tasten. Er rührt sie nicht. Er horcht nur auf die Geige.
Maha aber tanzt. Erst andeutend, nur dass sie einen Arm hebt, ein Bein, den Arm wieder senkt, das Bein wieder hinstellt, sie fühlt sich hinein. Dann aber beginnt ihr ganzer Körper mitzuarbeiten, ihre Bewegungen werden schneller. Plötzlich bricht sie ab. „Noch mal!“ befiehlt sie. Und Micha fängt von vorn an. „Schneller“, ruft sie aus ihrem Tanz heraus, und er gehorcht. Jetzt muss er zehn Takte wiederholen, jetzt zwanzig. Er gehorcht. Sie kommandiert, ihre Stimme ist hart. Sie fordert, fordert. Der Raum ist klein. Maha ist heiss. Micha spielt; der Duft, den Maha ausströmt, legt sich auf ihn, hüllt ihn ein. Er fühlt sich wieder müde, belastet, wie er sich als Kind müde fühlte. Da ist wohl ein Erinnern, ein Warnen; aber er spielt, er kann spielen. „So, jetzt das Ganze noch einmal“, keucht Maha. Sie keucht es, aber in ihr ist der Wille. Sie tanzt, sie hat jetzt den Rhythmus, sie hat die Folgen gefasst. Sie weiss, was ihre Glieder hergeben müssen, jede Bewegung.
Dann ist es vorbei. Sie steht vor ihm. „Schreib es auf für deine Leute. Übe es. Heute abend muss es sitzen.“ Sie sieht ihn an, ihre Augen fressen sich in sein Gesicht. „Du bist schön, wenn du spielst. Gefall’ ich dir?“ Sie steht vor ihm wie ein tändelndes Kind. Er aber hat keine Antwort.
Da lässt sie ihn allein, geht in das Zimmer, in dem Kora liegt. Kora hat Kissen im Rücken, hat Nadel und Faden in den Händen; vor ihr auf der Decke liegt das Kostüm, das Maha heute abend tragen soll, der weite Rock für die Walzernummer. „Es geht auch ohne dich“, sagt Maha, es klingt schneidend. Sie reisst ein Handtuch vom Ständer, setzt sich auf die Kante ihres Bettes, reibt sich ab. Sie beginnt sich die Beine zu massieren, die Arme. Man hört das Streichen ihrer Hände, sie summt, sie singt. Leise, spielerisch, und dann froh. Sie neigt den Kopf zur Seite, blickt zu Kora. „Nett von dir, Kleine, dass du so für mich nähst.“ Wirklich: sie hat ein Lachen.
Plötzlich springt sie auf, öffnet die Tür. Schritte gingen über den Flur. Sie zerrt Micha hinein. „Also du schreibst die Noten, nicht wahr?“ Er nickt, er kann sich das alles hier nicht erklären: nicht diese Tänzerin, die ihm befiehlt, nicht sich selbst, der ihr gehorcht; er will nicht in diesem Zimmer sein, in dem Frauenbetten stehen, er gehört nicht hierher. Aber es wehrt sich nur in ihm; er selbst wehrt sich nicht. Kraftlos hört er Maha weitersprudeln: „Und wir können es heute abend als Zugabe machen? Bestimmt?“ — und er nickt wieder. Er will sich umwenden, will gehen; aber da ist Maha ganz dicht bei ihm, hebt sich auf die Zehenspitzen. Micha sieht zwei Augen, die voll Glanz sind, die festhalten, wie kreisende Spiegelkegel mit zuckenden Lichtstrahlen die Sinne der Zuschauer bannen. Micha will fortsehen, etwa zu dem Bett, wo die Kranke liegt — vielleicht wäre dort Hilfe, oder zu den Fenstern, hinter denen die Luft frisch ist.
„Wie heisst du?“ fragt Maha.
„Micha“, antwortet er. Wirklich, er antwortet.
Er fühlt zwei Arme um seinen Hals, spürt ihren Druck in seinem Genick. Und er gibt diesem Druck nach, willenlos. Sein Kopf sinkt zu Mahas Kopf. Ihre Lippen sind voll, weich, halboffen. Sie küsst seinen Mund. Da vergisst er das Bett, die Kranke, die Fenster und die frische, gesunde Luft hinter den Scheiben. Alles ist tot für ihn, nur der Mund hat Leben.
Kora hatte die Geige gehört und das Stampfen der Tanzschritte. Jetzt blickte sie auf diesen Mann, dessen Züge müde waren vom Spiel, dessen Arme schlaff hingen. Den Kopf hob sie, sah alles, sah hindurch durch die Schwester, die sie kennt, hinein in den Mann, den sie nicht kennt. In ihr sträubte sich ein Gefühl der Reinheit, des Unverdorbenen. Ihre Hände griffen in das Kleid, das vor ihr lag, knüllten seinen Stoff. Sie schrie auf: „Geht, macht das draussen ab!“ Sie wollte hoch, hin zu den beiden, wollte sie auseinanderreissen. Aber da krampfte sich der Schmerz in ihrem Fuss. Nur das Kostüm konnte sie packen, sie warf es durch das Zimmer; dicht hinter Maha fiel es zu Boden. „’raus“, schrie sie, und ihre Stimme zitterte vor Wut, „’raus, du bist nicht allein hier!“
Ganz ruhig drehte sich Maha um, hob den Tanzrock auf und legte ihn zurück auf die Bettdecke. „Musst doch nicht blöd sein, Kora, kennst mich doch.“ Sie sah auf den Mann, sie lächelte.
Da stand in der Tür Tobs. Er schlich sich zu Michael Verany, zerrte ihn am Ärmel. „Gehen Sie, bitte. Ich komme nachher zu Ihnen und helfe, Noten ausziehen. Gehen Sie.“
Zwerghaft klein erschien Tobs neben diesem Michael Verany.
*
Kora war jetzt schon in der siebenten Woche im Kölner Krankenhaus. Sie hatten sie damals nicht mit über die Grenze genommen, als Maha mit Tobs nach Brüssel fuhr. Es war praktischer gewesen, dass sie auf deutschem Boden blieb — schon der Zahlungen der I. A. L. wegen. Die I. A. L. hatte natürlich geholfen, die Internationale Artisten-Loge; es war ja ein Betriebsunfall. Tobs war in Berlin auf das Büro in der Friedrichstrasse gelaufen mit dem Attest des Arztes und der Bestätigung des Direktors und hatte alles geregelt. Dann hatte Maha Köln bestimmt. Maha war jetzt schon wieder weiter: in Antwerpen. Und Tobs auch.
Er musste ja bei ihr bleiben, denn Maha kann nicht rechnen; bei ihr wäre nie Reisegeld in der Kasse gewesen, wenn es an den nächsten Platz ging. Sie konnte auch keine Koffer packen; sie würde sicher die Noten vergessen oder ein Kostüm oder die Schuhe. So musste Tobs mit, obgleich er lieber in Köln bei Kora gewesen wäre. Er musste ja auch verdienen, denn er lebte nicht etwa von Maha und Kora. Was er für sie tat, tat er freiwillig. Sie kannten ihn schon an den Bühnen und wussten, dass er mit den Terrys kam. Es fand sich auch immer Arbeit für ihn. Fast ist es merkwürdig, dass stets ein Posten frei war: da wurde der Hilfsinspizient krank oder ein Beleuchter, und Tobs sprang ein. Oder eine Kraft im Büro fehlte, und Tobs sass am Tisch und rechnete, oder an der Schreibmaschine und tippte Briefe in allen Sprachen. Er machte auch Schularbeiten mit den Kindern der Direktoren, gleich ob sie Franzosen waren oder Engländer oder Polen. Oder er versorgte die Tiere eines Dressuraktes, oder er verteilte Zettel, wenn es ganz arg kam. Nur auf die Bühne ging er nicht. Er hatte immer sein Reisegeld in der Tasche und mehr. So war Tobs.
Die Ärzte waren entsetzt gewesen, als sie Koras Verband geöffnet hatten. Der Knöchel war doch angebrochen, die Kallusmasse hatte sich schon festgesetzt, und der Fuss stand ein wenig schief. Sie machten Röntgenaufnahmen von allen Seiten; sie begriffen, was die Verletzung für Kora bedeutete, sie hatten Einsehen und Mitleid. Sie sahen ihre Angst. Sie holten noch einen Spezialisten aus Boun, von der Universitätsklinik; sie berieten und sagten dann: es gäbe nur einen Weg, den Fuss wieder in Ordnung zu bringen: er müsse neu gebrochen werden; sie könnten aber für nichts Gewähr leisten; Kora müsste deshalb ihr Einverständnis zu dem Eingriff geben. Kora lag bei dieser Eröffnung auf dem Operationstisch. Rings um sie weissgekachelte Wände, an den Wänden gläserne Schränke voll blitzender Instrumente, über sie selbst beugten sich weissbekittelte Ärzte und Schwestern mit weissen Hauben. Alles war weiss, hell und grell. Und in Kora war alles dunkel und voll Furcht. Sie fühlte Schmerzen, sie sah Blut. Sie war voll Sehnsucht nach andern Menschen in bunten Kleidern, aber die hätten ihr auch nicht helfen können, sie war ja allein. Sie hätte schreien mögen nach dem einzigen, den sie hatte, nach Tobs.
„Also Sie sind einverstanden?“ hatte einer der Ärzte gefragt. „Ja“, hatte Kora gesagt. Sie hätte ebensogut „nein“ sagen können, sie wusste nicht, was sie sagte. Dann hörte sie die gleiche Stimme: „Schwester, die Maske bitte.“ Man hielt ihr etwas Weisses, Starkriechendes über das Gesicht. „Zählen Sie“, befahl die Schwester und zählte vor: „Eins — zwei — drei — vier ...“ Kora sprach die Zahlen nach, mechanisch, dann war ihr, als wäre sie bei Tobs in Brüssel, und sie fiel ins Französische: „... neuf, dix, onze, treize ...“ Richtig, da war ja Tobs neben ihr: „... seventeen, eighteen, nineteen ...“
Das alles lag jetzt sechs Wochen zurück. Kora konnte schon wieder aufstehen und zwischen den Betten umhergehen. Der Knöchel sass gerade, die Ärzte waren zufrieden. Langsam musste Kora lernen, das Bein wieder zu gebrauchen. Es war noch schwach natürlich, das eine Band hatte sich gezerrt und war etwas locker, aber auch das würde sich geben. Massage, Zanderapparate würden helfen. Gut wäre eine Fangokur oder Schlammbäder, hiess es, Wiesbaden oder etwa Landeck oder Eilsen. Vorsichtig und langsam die Bewegungen steigern. Die Patientin war ja noch jung, noch im Wachsalter, der Körper war ausgezeichnet trainiert, organisch tadellos, wirklich eine Freude; man sah in diesen Jahren so etwas selten in der Grossstadt. Da würde die Zeit am besten helfen. Wie so Ärzte reden. Als ob das alles kein Geld kostete. Und Geld? Woher Geld?
Eigentlich hätte Kora schon entlassen werden und in Aussenbehandlung treten müssen. Da sie aber wohnungslos war, behielt man sie noch da. Sie hatten sie ja alle gern, das hübsche Mädel mit den dunklen Augen, den merkwürdigen braunroten Haaren, das stille Mädel, das immer zufrieden war. Selbst die Schwestern hatten sie gern, obgleich die Ärzte länger an Koras Bett standen als an andern, besonders die jungen Assistenzärzte, die die Abendvisiten machten. Sie fragten Kora aus, liessen sich von ihr erzählen. Die Schwestern hatten es zuerst nicht glauben wollen, dass das Mädel die halbe Welt kannte; sie hatten die Schwester Agnes von der Innenstation geholt, die ein Jahr in London gewesen war; aber die konnte nur bestätigen: tadelloses Englisch — fehlerfrei.
Ja, sie waren alle nett zu Kora. Sie gaben ihr die beste Verpflegung mit Zulagen aus der ersten Klasse, sie setzten sie in die Sonne auf den breiten Südbalkon, wo die Rekonvaleszenten nach Lungen- und Brustfellentzündungen lagen, sie liessen sie dann in den Garten.
Aber Kora blieb blass. Sie hatte Sehnsucht nach Tobs und nach Maha. Ja, auch nach Maha trotz der Angst. Es war schlimm mit ihr die letzte Woche vor der Abfahrt gewesen. Sie hatte grosse Erfolge mit diesem Tanz, den sie neu einstudierte. Sie war ganz besessen von diesem Geiger. Sie wollte ihn mit nach Brüssel haben. Aber davon wollte Möller nichts wissen. Die Noten genügten, meinte er. Maha tobte, sie schrie bei Tage Tobs an, schrie Kora an. Aber abends, wenn es ins Odeon ging, auf die Bühne, lachte sie und blieb die Nächte fort. Mit Micha, bei Micha. Sie kümmerte sich nicht um Kora, hatte nie einen Ton des Mitleids, nur Scheltworte. Und trotzdem hatte Kora jetzt Sehnsucht nach ihr. Und nach der Arbeit mit ihr. Die Untätigkeit machte sie krank; sie begriff die Menschen in den andern Betten nicht, die sagten: es wäre schön, hier so zu liegen und nichts zu tun.
Dann und wann kam ein Brief oder eine Karte von Tobs: es ginge ihnen gut, Maha gefiele. Möller hätte neue Engagements vermittelt: erst Lyon, dann Hamburg. Es wären ja keine grossen Sachen, aber sie wären zufrieden. In Hamburg rechneten sie bestimmt auf sie, da wollten sie trainieren, und dann für den nächsten Platz wieder die Sister-Nummer melden. So schrieb auch Möller. — Geld schickte Tobs auch, Geld kam auch von der I.A.L. Es sammelte sich in der Kasse des Krankenhauses, Kora brauchte ja nichts für sich; sie bekam alles: Leinenwäsche und blau gestreifte Lazarettkleider. Aber für eine Kur, da reichte es doch nicht.
So vergingen die siebente und achte Woche. In der neunten zog Kora zum erstenmal wieder ihre Kleider an und ihre Schuhe. Vor den Schuhen hatte sie Sorge. Oft hatte sie im Bett gesessen und ihre Füsse betrachtet; es war ihr dann, als ob der rechte dicker wäre als der linke. Aber nun kam sie glatt in den Schuh. Sie ging durch die Strassen, sie hatte einen Stock mit, um sich zu stützen; doch sie brauchte ihn kaum. Nur wenn sie zurückkam, war sie müde: die Strassen waren so laut und so voller Menschen. Aber auch das wurde besser.
In dieser neunten Woche ging sie zum Chefarzt und bat um Urlaub für zwei Tage. Maha und Tobs waren jetzt schon in Lyon, und bald war die Zeit hier um. Neben dem Chefarzt stand die Oberschwester. Wohin und zu wem sie Urlaub haben wollte? — „Nach Düsseldorf zu Verwandten.“ — Zu Verwandten? Dann hätte man sie doch entlassen können. — Kora wird rot. „Es ist nur ein Kind“, sagt sie. Etwas Hilfloses ist in ihrer Stimme. Der Chefarzt hört es wohl. Er spricht kurz, er schneidet alle weiteren Fragen der Oberschwester ab. „Gut, Sie können fahren.“ —
Nicht leicht war es, sich in Düsseldorf zurechtzufragen. Kora kannte viele Städte, aber sie war immer nur im Umkreis der Theater, in denen sie auftraten, gewesen. Dort hatte sich ihr Leben abgewickelt. Die Einkäufe machte Maha. So richtig durch Strassen laufen, das kannte Kora nicht. Sie war auch schon einmal in Düsseldorf gewesen, mit Tobs, damals als sie von Dublin kamen, als sie Maha holten. Aber das war lange her: acht Jahre. So alt musste auch das Kind jetzt sein.
Eine Frau riet ihr, die Tram zu nehmen, wenn sie zur Nymweger Strasse wolle; die Tram Nummer 23, und dann umsteigen in die Nummer 5; der Schaffner würde ihr schon Bescheid sagen. Kora dankte und wartete an der Haltestelle auf die Nummer 23. Dann sass sie in dem Wagen zwischen den fremden Menschen und dachte an den Priester, der gekommen war und sich das weisse Hemd über seinen dunklen Anzug gestreift, sich die gestickte Stola umgelegt, das schwarze Barett aufgesetzt hatte, um dann viele lateinische Sätze zu sprechen. Ein anderer hatte neben ihm gestanden, ihm Bücher und die Schale mit dem Taufwasser gereicht. „Nomine Eva Maria“ hatte der Priester gesagt und das Wasser über das Kind gestäubt. Seine Hand tauchte er in das Becken und malte ein nasses Kreuz auf die Stirn: „Eva Maria.“
‚Ich möchte wieder einmal in eine Kirche gehen —‘ dachte Kora. Sie hatte es auch schon im Krankenhaus gedacht, wenn sie die Schwestern morgens singen hörte.
Die Ecke, wo sie umsteigen musste, war da; der Schaffner sagte es ihr. Die Nummer 5 kam und dann die Nymweger Strasse. Es war keine schöne Gegend; hohe, steile Mauern mit Fensterlöchern, keine Baumreihen, keine Rasenstreifen. Sie stand vor dem Hause, in dem Frau Klüver wohnte, sie stieg die Treppen empor, las alle Mieterschilder: drei waren auf jedem Absatz. Sie klingelte. Sie musste warten. Endlich schlurrte es hinter der Tür, ein Schlüssel wurde umgedreht. „Ich möchte gern Eva Terry sprechen“, sagte Kora. —„Jott, det Evken“, antwortete die Frau. Sie hatte einen schwammigen Busen unter ihrer blauen Schürze und breite Hüften; die Stirn war flach, und die Backen hingen wulstig. Sie sah Kora mit kleinen Augen an. „Sind Sie von der Fürsorge?“ Kora wusste gar nicht, was Fürsorge ist. „Ich bin Kora Terry, die Schwester von Evas Mutter.“ — „Na, dann kommen Sie man ’rein.“
Kora stand in einem kleinen Zimmer, das aussah wie die Zimmer der Vermieterinnen, bei denen sie immer wohnten. Es war ihr nicht fremd. Aber sie hatte den Wunsch, das Fenster aufzumachen. Sie hörte Stimmen, auch Kinderstimmen. Es dauerte eine ganze Weile; die Stimme Frau Klüvers wurde lauter, die Kinderstimmen leiser. Dann ging die Tür auf. Eva war ein grosses Mädel geworden und ganz blond und helläugig. Das machte Kora stutzig, sie hatte immer gedacht, dies Kind müsse dunkel sein wie seine Mutter. Wenn sie überhaupt an das Kind gedacht hatte. Nun stand es da und war blond. Kora wusste nichts zu sagen, und das Mädel wusste auch nichts zu sagen. Aber da wusste Frau Klüver Rat. „Na los, Evken, gib der Tante die Hand.“ Und als das Kind näher kam und die Rechte ausstreckte, fuhr sie fort: „Es ist man gut, dass sich mal jemand um Evken kümmert. Ich wollt’ immer schon schreiben, dass ich mit dem Geld nicht auskomme, jetzt, wo alles teurer wird. Sie ist ja brav, aber in dem Alter zerreissen sie die Sachen. Wo ich für alles aufkommen muss. Und anständig angezogen muss sie doch sein, schon der Nachbarn wegen.“ — Kora hatte sich hingesetzt, damit sie Eva gerade in die Augen sehen konnte, sie hielt jetzt die Kinderhand in der ihren. Die Hand war heiss und feucht. Kora zergliederte das Gesicht, sie fand Züge von Maha, sie fand um den Mund etwas, was sie an ihre Kindheit erinnerte, an den Vater vielleicht, an die Mutter vielleicht; sie wusste es nicht, aber sie fühlte es warm, lebendig. „Geht es dir gut, Eva?“ fragte sie. Und das Kind blickte zu der dicken Frau und sagte: „Ja.“
Da weiss Kora, dass das Kind hier fort muss.
Kora hatte sich noch angesehen, wo Eva schlief: mit den drei Kindern von Frau Klüver zusammen, zwei davon waren Jungen, und der Älteste war dreizehn.
Kora war dann mit Eva durch die Stadt gefahren bis an den Rhein. Eva kannte alle Trambahnlinien und führte. Sie trank Schokolade in der Konditorei auf der Rheinterrasse und ass Kuchen, sie erzählte von der Schule, und sie klagte nicht. Aber sie nannte Kora immer ‚Sie‘.
Als die beiden später wieder vor dem Haus mit den Fensterlöchern standen, sagte das Kind: „Sie brauchen nicht mit ’raufkommen, ich finde schon allein“, und lief in den dunklen Flur — ohne Dank.
Kora wartete noch eine Weile, sie dachte, das Kind würde noch einmal zurückkommen, denn sie hatte das Paket Süssigkeiten noch in der Hand, das sie eingekauft hatte. Aber Eva kam nicht wieder. Da fuhr Kora

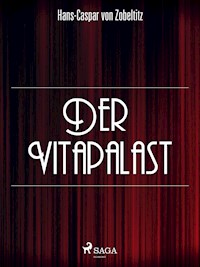
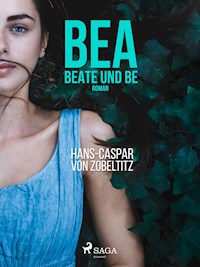













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)












