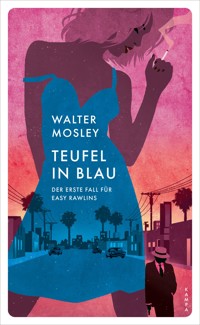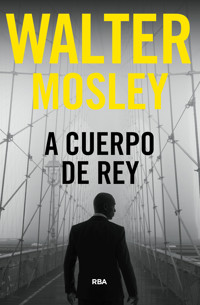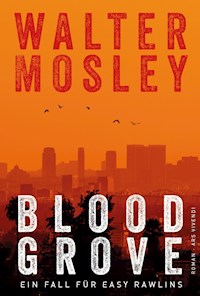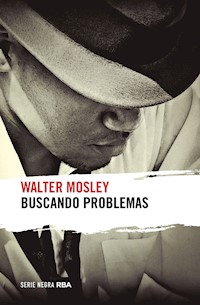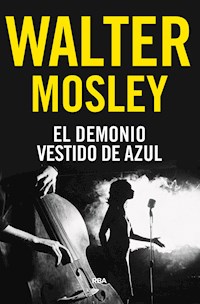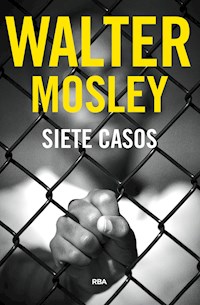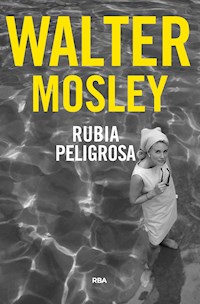Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kampa Pocket
- Sprache: Deutsch
Los Angeles, 1956: Im Stadtteil Watts ereignen sich drei rätselhafte Morde, die Opfer sind allesamt leichte Mädchen. Und sie sind schwarz. Polizei und Presse zeigen wenig Interesse an der Aufklärung. Erst als eine Weiße, noch dazu die Tochter eines Staatsanwalts, auf dieselbe Weise ermordet wird, gerät die Polizei in Zugzwang. Easy Rawlins wird mit inoffiziellen Ermittlungen beauftragt, denn er ist schwarz und kennt sich im Viertel und mit den Bewohnern aus, die die Polizei am liebsten sich selbst überlässt. Easy, der sich eigentlich um seine Frau und seine Kinder kümmern will, hat wenig Interesse, zwischen die Fronten zu geraten. Aber ihm bleibt nichts anderes übrig: Als Detektiv ohne Lizenz können die Behörden ihm gehörig an den Karren fahren, und er muss sich gut mit der Polizei stellen, auch um seinem Freund Mouse zu helfen. Der ist ständig in krumme Geschäfte verwickelt und steckt mal wieder in der Klemme.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 322
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Walter Mosley
Der weiße Schmetterling
Kriminalroman
Aus dem amerikanischen Englisch von Dietlind Kaiser
Kampa
Wegen der Geschichten,
die er immer erzählt,
widme ich dieses Buch
Leroy Mosley.
1
»Easy Rawlins!«, rief jemand.
Ich drehte mich um und sah, wie Quinten Naylor den Griff meiner Gartentür drehte.
»Issy«, krähte meine Kleine, Edna, während sie in ihrem Bettchen neben mir auf der Vorderveranda friedlich mit ihren Füßen spielte.
Quinten war von normaler Größe, aber breit, und sah kräftig aus. Seine Hände waren so groß wie Topflappen, und seine Schultern waren selbst unter dem Jackett runde Melonen. Quinten war braun, aber unter der Haut war eine Menge Rot. Es war fast, als wäre er vor Zorn rot angelaufen.
Als Quinten über den Rasen ging, zertrampelte er einen Streifen Schnittlauch, den ich dort seit sieben Jahren anbaute.
Der Mann mit der heftigen Röte im Gesicht lächelte mich an. Er streckte die fleischige Pranke aus und sagte: »Bin froh, dass ich Sie zu Hause antreffe.«
»Mhm.« Ich ging die Stufen hinunter, ihm entgegen. Ich schüttelte ihm die Hand und sah ihm in die Augen.
Als ich nichts sagte, war es dem Sergeant der Polizei von Los Angeles für einen Moment unbehaglich. Er schaute zu mir auf, wollte, dass ich fragte, warum er hier sei. Aber ich wollte nur, dass er verschwand, damit ich wieder zu meiner Frau und meinen Kindern zurückkonnte.
»Ist das Ihre Kleine?«, fragte er. Quinten kam aus dem Osten, er sprach wie ein gebildeter Weißer aus dem Norden.
»Ja.«
»Schönes Kind.«
»Ja. Und ob.«
»Und ob«, wiederholte Quinten. »Schlägt bestimmt nach seiner Mutter.«
»Was wolln Se denn von mir, Officer?«, fragte ich.
»Ich will, dass Sie mitkommen.«
»Bin ich festgenommen?«
»Nein, nein, keineswegs, Mr. Rawlins.«
Als er mich Mister nannte, wusste ich, dass das Los Angeles Police Department wieder mal meine Dienste brauchte. Von Zeit zu Zeit schickte die Polizei einen ihrer wenigen schwarzen Beamten zu mir, um mich darum zu bitten, Orte aufzusuchen, an die sie sich nicht hin trauten. Wenn die Cops etwas im Getto rauskriegen wollten, war ich so viel wert wie ein ganzes Revier voller Kriminalpolizisten.
»Und warum soll ich dann sonst wohin mit Ihnen? Verbring den Tag hier mit meiner Familie. Brauch keinen Sonntagsausflug mit den Cops.«
»Wir brauchen Ihre Hilfe, Mr. Rawlins.« Quintens Farbe unter der braunen Schale wechselte zu blutrot.
Ich wollte zu Hause bleiben, bei meiner Frau, wollte später mit ihr schlafen. Aber etwas an Naylors Bitte hielt mich davon ab, ihn abzuwimmeln. In der Bitte des Polizisten schwang eine Art Niederlage mit. Schwarze stecken eine Niederlage schwer weg; diesen Feind haben wir fast alle gemeinsam.
»Wo soll’s denn hingehen?«
»Es ist nicht weit. Zwölf Blocks. In der Hundertzehnten.« Noch während er sprach, drehte er sich um und ging in Richtung Straße.
Ich rief in Richtung Haus: »Ich fahr eben mal mit Officer Naylor weg. Bin bald zurück.«
»Was?«, rief Regina vom Bügelbrett hinter dem Haus.
»Ich geh für ne Weile weg!«, rief ich. Dann winkte ich meinem zwölf Meter hohen Avocadobaum zu.
Der kleine Jesus schaute von seinem Sitz dort oben herunter und lächelte.
»Komm da runter«, sagte ich.
Der kleine Mexikanerjunge kletterte den Baum herunter und lief mit einem Lächeln auf seinem Gesicht auf mich zu. Er hatte das Gesicht eines uralten Amerikaners, dunkel und weise.
»Ich will nicht, dass du heute Streifzüge machst, Jesus«, sagte ich. »Bleib hier und pass auf deine Mutter und Edna auf.«
Jesus schaute auf seine Füße und nickte.
»Sieh mir ins Gesicht.« Wenn ich mit Jesus sprach, übernahm ich das Reden allein, denn in den acht Jahren, seit denen ich ihn kannte, hatte er noch nie ein Wort gesprochen. Jesus sah mit zusammengekniffenen Augen zu mir auf.
»Ich will, dass du beim Haus bleibst. Verstanden?«
Quinten saß in seinem Wagen und schaute auf die Uhr.
Jesus nickte, sah mir diesmal in die Augen.
»Gut.« Ich fuhr ihm über seinen flaumweichen Bürstenschnitt und ging zu dem Cop.
Officer Naylor fuhr mich zu einem leeren Grundstück mitten im 1200er-Block der 110th Street. Davor parkte ein Notarztwagen, flankiert von Streifenwagen. Mir fiel ein leuchtender weißer Lacklederpumps im Rinnstein auf, als wir die Straße überquerten.
Auf dem Gehweg hatte sich eine Menge versammelt. Sieben weiße Polizisten standen Schulter an Schulter vor dem Grundstück, hielten die Leute fern. Die Stimmung war heiter. Die Polizisten waren ganz locker, rauchten Zigaretten und witzelten mit den Gaffern.
Das Grundstück zierten zwei verrostete Buicks, die auf kaputten Achsen im Unkraut kauerten. Am hinteren Ende des Grundstücks war eine abgestorbene knorrige Eiche. Quinten und ich gingen durch die Menge. Männer, Frauen und Kinder verrenkten sich die Hälse und schaukelten hin und her. Ein Junge sagte: »Lloyd hat se gesehn. Die is tot.«
Als wir an der Reihe Polizisten vorbeigingen, packte mich einer am Arm und sagte: »He, Bursche.«
Quinten bedachte ihn mit einem durchdringenden Blick, und der andere Officer sagte: »Oh, okay. Sie dürfen durch.«
Auch bloß einer von den vielen Weißen, die ich achselzuckend links liegen gelassen hatte. Seine instinktive Respektlosigkeit und Arroganz spielten so gut wie keine Rolle. Ich wandte mich ab, und er war aus meinem Leben verschwunden.
»Hier entlang, Mr. Rawlins«, sagte Quinten.
Vier Polizisten in Zivil standen hinter dem Baum und sahen zu Boden. Ich konnte nicht ausmachen, was es war, das sie so genau betrachteten.
Ich erkannte einen der Cops. Er war ein stämmiger Weißer, der Typ des Dicken, der überall dick ist, selbst im Gesicht und an den Händen.
»Mr. Rawlins«, sagte der Stämmige. Er streckte eine gepolsterte Hand aus.
»Sie erinnern sich bestimmt an meinen Partner«, sagte Quinten. »Roland Hobbes.«
Inzwischen waren wir um den Baum herum. Da saß eine Frau in einem rosa Partykleid, an der Brust ein Stück weit offen, mit dem Rücken gegen den Stamm gelehnt. Sie hatte die Beine gerade vor sich ausgestreckt, leicht auseinander. Ihr Kopf neigte sich zur Seite, weg von mir, und die Hände lagen mit den Handflächen nach oben neben ihren Oberschenkeln. Am linken Fuß trug sie einen weißen Pumps, der rechte Fuß war nackt.
Ich erinnere mich an die weiche und kraftstrotzende Hand von Roland Hobbes und an das Insekt, das ich auf der Schläfe der Frau sitzen sah. Ich fragte mich, warum sie es nicht wegwedelte.
»Freut mich, Sie zu sehen«, sagte ich zu Hobbes, als ich begriff, dass das Insekt ein getrocknetes Blutgerinnsel war.
Als Roland meine Hand losließ, wandte er sich Quinten zu und sagte: »Selbe Sache.«
»Wie beide?«, fragte Quinten.
Roland nickte.
Die Frau war jung und hübsch. Der Gedanke, sie sei tot, fiel mir schwer. Es sah aus, als könnte sie jeden Augenblick aufstehen, lächeln und mir ihren Namen sagen.
Jemand flüsterte: »Die Dritte.«
2
Sie trugen die Leiche auf einer Bahre weg, als die Fotografen fertig waren – Polizeifotografen, keine Reporter. 1956 war eine Schwarze, die umgebracht worden war, kein Fotomaterial für die Zeitungen.
Danach stiegen Quinten Naylor, Roland Hobbes und ich in Naylors Chevrolet. Er fuhr immer noch ein Modell Baujahr 1948. Ich stellte ihn mir an seinen freien Tagen vor, in kurzen Ärmeln, wie er sich unter der Haube damit abplagte und abkämpfte, diese Schrottmühle am Laufen zu halten.
»Kriegt ihr bei der Polizei denn kein Auto?«, fragte ich.
»Sie haben mich zu Hause angerufen. Ich bin direkt hergekommen.«
»Und warum kaufen Se sich kein neues Auto?«
Ich saß auf dem Vordersitz. Roland Hobbes war hinten eingestiegen. Er war ein respektvoller Mensch, immer höflich und korrekt; ich traute ihm nicht die Bohne.
»Ich brauch kein neues Auto. Das hier ist ganz in Ordnung«, sagte Naylor.
Ich sah auf den rissigen Vinylsitz zwischen meinen Schenkeln hinunter. Der goldfarbene Schaumstoff quoll unter meinem Gewicht heraus.
Wir fuhren ein ganzes Stück die Central Avenue entlang. Das war, bevor die ganze Gegend herunterkam. Die Straßen waren sauber, es gab nur wenige Säufer. Zwischen der 110th Street und dem Florence Boulevard zählte ich fünfzehn Kirchen. An dieser Kreuzung lag die Gummifabrik Goodyear. Ein riesiges Gelände mit zwei gigantischen Gebäuden an der Nordseite. Dort stand auch der Hangar für das Goodyear-Firmenflugzeug. Auf der anderen Straßenseite war eine World-Tankstelle. World war ein beliebter Treff für mexikanische Autobastler und Motorradliebhaber, die ihre deutschen Maschinen mit bis zu drei Zentnern Chrom und Klimbim verzierten.
Naylor fuhr zum Tor der Goodyear-Fabrik und zückte vor dem Wächter seine Marke. Wir fuhren auf einen großen Asphaltparkplatz, auf dem Hunderte von Autos säuberlich in Reihen parkten, als stünden sie zum Verkauf. Dort parkten immer Autos, weil in der Goodyear-Fabrik vierundzwanzig Stunden am Tag gearbeitet wurde, an sieben Tagen in der Woche.
»Machen wir einen kleinen Spaziergang«, sagte Naylor.
Ich stieg mit ihm aus. Hobbes blieb auf dem Rücksitz. Er griff nach dem Jet-Magazin, das Naylor dort hinten liegen hatte, und schlug sofort das Klappbild in der Mitte auf, das Foto mit der Schönen im Badeanzug.
Wir gingen bis zur Mitte des grasigen Geländes. Der Himmel wurde schon ganz dämmrig. Jedes vierte bis fünfte Auto auf dem Boulevard hatte die Scheinwerfer eingeschaltet.
Ich fragte Quinten nicht, was wir machten. Ich wusste, es musste etwas für ihn Wichtiges sein, wenn er mich damit beeindrucken wollte, dass er Zugang zu diesem noblen Rasen hatte.
»Haben Sie das mit Juliette LeRoi gehört?«, fragte Quinten.
Ich hatte von ihr gehört, von ihrem Tod, aber ich fragte: »Wer?«
»Sie war aus Französisch-Guayana. Hat als Cocktailkellnerin in der Champagne Lounge gearbeitet.«
»Ja?«, ermunterte ich ihn.
»Vor etwa einem Monat ist sie ermordet worden. Durchgeschnittene Kehle. Außerdem vergewaltigt. Sie ist in einer Mülltonne in der Slauson Avenue gefunden worden.«
Es war eine kleine Zeitungsmeldung gewesen. Das Fernsehen und der Rundfunk hatten darüber überhaupt nicht berichtet. Aber die meisten Schwarzen wussten Bescheid.
»Und dann Willa Scott. Sie war an die Rohre unter einer Spüle gefesselt, als wir sie fanden, in einem leer stehenden Haus in der Hoover Street. Ihr Mund war zugeklebt und ihr Schädel eingeschlagen.«
»Vergewaltigt?«
»Sie hatte Sperma im Gesicht. Wir wissen nicht, ob das vor oder nach ihrem Tod passiert ist. Zum letzten Mal ist sie im Black Irish gesehen worden.«
Ich spürte einen Krampf im Magen.
»Und jetzt haben wir Bonita Edwards.«
Ich musterte das Gelände und die Reihen von Fabrikgebäuden am Florence Boulevard dahinter. Während Naylor sprach, wurde es immer dunkler. In der Ferne blinkten Lichter.
»So heißt die Frau?«, fragte ich ihn. Ich bereute, dass ich mitgekommen war. Ich wollte nicht an diese Frauen denken. Die Gerüchte in der Nachbarschaft waren schlimm genug, aber Gerüchte konnte ich ignorieren.
»Ja.« Quinten nickte. »Eine Tänzerin, wieder eine Barfrau. Drei Partygirls. Bis jetzt.«
In der Dämmerung verfärbte sich das Gras von Grün zu Grau.
Ich fragte: »Und warum reden Se dann mit mir?«
»Juliette LeRoi hat zwei Tage in der Tonne gesteckt, bis jemand den Gestank gemeldet hat. Die Totenstarre hatte schon eingesetzt. Sie haben die Narben erst gefunden, als die Zeitungsmeldung schon erschienen war.«
Mein Magen stieß einen leisen Ächzlaut aus.
»Willa Scott und Bonita Edwards hatten dieselben Narben.«
»Was für Narben meinen Sie?«
Quintens Gesicht wurde finster wie die Nacht. »Brandmale«, sagte er. »Von Zigarren, auf … auf den Brüsten.«
»Also immer derselbe Mann?«, fragte ich. Ich dachte an Regina und Edna. Ich wollte nach Hause, mich vergewissern, dass die Türen abgeschlossen waren.
Der Polizeibeamte nickte. »Wir glauben, ja. Er möchte, dass wir wissen, was er da tut.«
Quinten sah mir in die Augen. Hinter ihm wurde L.A. mit einem Zischen zu einem Netz aus elektrischem Licht.
»Wo schaun Se denn hin?«, forderte ich ihn heraus.
»Wir brauchen Sie bei diesem Fall, Easy. Er ist übel.«
»Wen genau meinen Se denn, wenn Se sagen, ›wir‹? Wer is das? Sie und ich? Oder wolln wir noch wen anheuern?«
»Sie wissen, was ich meine, Rawlins.«
Früher hatte ich für das illegale Glücksspiel gearbeitet, für Kirchgänger, Geschäftsleute und sogar für die Polizei. Irgendwann im Lauf der Zeit war ich in die Rolle eines V-Mannes hineingeschlittert, der Menschen vertrat, wenn das Gesetz versagte. Und das Gesetz versagte so oft, dass ich genug zu tun hatte. Manchmal versagte es sogar für die Cops.
Als ich das letzte Mal mit Naylor zusammengearbeitet hatte, brauchte er mich, um einen Killer namens Lark Reeves aus Tijuana wegzulocken. Lark hatte sich in Compton an einem illegalen Würfelspiel beteiligt und an einen weißen Jungen namens Chi-Chi MacDonald, der sich im Milieu herumtrieb, fünfundzwanzig Dollar verloren. Als Chi-Chi sein Geld verlangte, wurde er ein bisschen zu frech, und Lark schoss ihm ins Gesicht. Die Schießerei war nichts Ungewöhnliches, aber die Farbgrenze war überschritten worden, und Quinten wusste, dass ihm der Fall eine Beförderung eintragen konnte, wenn er Lark fasste.
In der Regel liefere ich der Polizei keinen Schwarzen ans Messer. Aber als Quinten zu mir kam, war ich auf einen besonderen Gefallen angewiesen. Es war eine Woche bevor Regina und ich heiraten wollten, und ihr Cousin Robert Henry saß wegen eines Raubüberfalls im Gefängnis. Robert hatte sich mit einem Ladenbesitzer gestritten. Er sagte, ein Liter Milch, den er bei ihm gekauft habe, sei sauer gewesen. Als ihn der Ladenbesitzer einen Lügner nannte, griff Robert einfach nach einer Dreiliterkanne und ging zur Tür. Der Händler packte Bob am Arm und rief den Kassierer zu Hilfe.
Bob sagte: »Du hast nen Freund, was? Das geht in Ordnung, denn ich hab ein Messer.«
Das Messer brachte Bob ins Gefängnis. Sie nannten es einen bewaffneten Raubüberfall.
Regina liebte ihren Cousin, also machte ich Quinten ein Angebot, als er wegen Lark zu mir kam. Ich sagte ihm, ich würde in Watts ein besonderes Pokerspiel organisieren und dafür sorgen, dass Lark davon Wind bekam. Ich wusste, dass Lark einem guten Spiel nicht widerstehen konnte.
Poker mit hohem Einsatz brachte Lark nach San Quentin. Er brachte mich nie mit den Cops in Verbindung, die das Spiel auffliegen ließen und ihn zur Identifizierung aufs Revier schleppten.
Quinten bekam die Beförderung, weil die Cops glaubten, er habe den Daumen am Puls der schwarzen Gemeinde. Aber in Wirklichkeit hatte er nur mich. Mich und noch ein paar andere Schwarze, denen es nichts ausmachte, um ihr Leben zu würfeln. Aber nach meiner Heirat hatte ich damit aufgehört, solche Risiken einzugehen. Ich war kein Spitzel für die Cops mehr.
»Ich weiß nix über tote Frauen, Mann. Glauben Se nich, ich hätt’s Ihnen schon gesteckt, wenn ich nen Schimmer hätt? Glauben Se nich, ich hätt was dagegen, dass einer schwarze Frauen abmurkst? Hören Se, ich hab bei mir zu Haus ne hübsche junge Frau …«
»Ihr passiert nichts.«
»Woher wolln Se das wissen?« Ich spürte den Puls in den Schläfen.
»Der Mann bringt leichte Mädchen um. Er hat es nicht auf eine Krankenschwester abgesehen.«
»Regina arbeitet. Manchmal kommt sie nachts aus dem Krankenhaus heim. Der könnte ihr auflauern.«
»Deshalb brauche ich Ihre Hilfe, Easy.«
Ich schüttelte den Kopf. »Nö, Mann. Kann Ihnen nich helfen. Was könnt ich schon machen?«
Meine Frage brachte Naylor aus der Fassung. »Helfen Sie uns«, sagte er schwach.
Er war ratlos. Er wollte, dass ich ihm sagte, was er tun sollte, denn die Polizei wusste nicht, wie sie einen Mörder fassen sollte, aus dem sie nicht schlau wurde. Sie wussten, was zu tun war, wenn ein Mann seine Frau umbrachte oder ein Kredithai Schulden auf eine üble Weise eintrieb. Sie wussten, wie sie Zeugen verhören mussten, weiße Zeugen. Quinten Naylor war zwar schwarz, aber das brachte ihm beim harten Kern im Viertel Watts keine Sympathien ein; bei der Clique, die von allen »The Element« genannt wurde.
»Was ham Se denn bis jetzt?«, fragte ich, vor allem, weil er mir leidtat.
»Nichts. Sie wissen alles, was ich weiß.«
»Ham Se ne Sondereinheit, die dran arbeitet?«
»Nein. Bloß ich.«
Die Autos, die auf den fernen Straßen vorbeifuhren, surrten in meinen Ohren wie hungrige Moskitos.
»Drei tote Frauen«, sagte ich. »Und die konnten nur Sie auf die Beine bringen?«
»Hobbes arbeitet mit mir daran.«
Ich schüttelte den Kopf, wünschte mir, ich könnte den Boden unter meinen Füßen zum Erbeben bringen.
»Ich kann Ihnen nich helfen, Mann«, sagte ich.
»Jemand muss helfen. Wer weiß, wie viele Frauen sonst sterben?«
»Vielleicht kriegt Ihr Mann es einfach satt, Quinten.«
»Sie müssen uns helfen, Easy.«
»Nein, muss ich nich. Sie leben in einem Albtraum von nem Vollidioten, Mr. Polizist. Ich kann Ihnen nich helfen. Wenn ich wüsst, wie der Kerl heißt, wenn ich irgendwas wüsste. Aber Beweise sammeln is Copsache. Einer allein schafft das nicht.«
Ich konnte sehen, wie sich die Wut in seinen Armen und Schultern sammelte. Aber statt mich zu schlagen, wandte Quinten Naylor sich ab und stolzierte zum Auto. Ich schlenderte hinter ihm her, wollte nicht neben ihm gehen. Quinten trug das Gewicht der ganzen Gemeinde auf den Schultern. Die Schwarzen mochten ihn nicht, weil er redete wie ein Weißer und den Beruf eines Weißen hatte. Die anderen Polizisten hielten sich auch auf Distanz. Ein Wahnsinniger brachte schwarze Frauen um, und Quinten war ganz allein. Niemand wollte ihm helfen, und die Frauen starben weiter.
»Sind Sie mit von der Partie, Easy?«, fragte Roland Hobbes. Er legte seine Hand auf meine Schulter, als Naylor aufs Gas trat.
Ich schwieg weiter, und Hobbes zog die freundliche Hand zurück. Ich hatte es eilig, nach Hause zu kommen. Ich fühlte mich schlecht, weil ich dem Polizisten einen Korb gegeben hatte. Ich fühlte mich miserabel, weil junge Frauen sterben würden. Aber ich konnte nichts tun. Ich musste mich um mein eigenes Leben kümmern – oder nicht?
3
Ich bat Naylor, mich an der Ecke aussteigen zu lassen, weil ich vorhatte, die letzten Schritte nach Hause zu Fuß zu gehen. Aber stattdessen stand ich da und sah mich um. Die Nacht brach ein, und ich bildete mir ein, die Leute suchten rasch Schutz vor einem Gewitter, das bald um sie herum losbrechen würde.
Nicht alle hatten es eilig.
Rafael Gordon hatte vor dem Avalon, einer winzigen Bar am Ende meines Blocks, gerade ein Hütchenspiel laufen. Zeppo, der Spastiker, halb Italiener, halb Schwarzer, stand an der Ecke Schmiere. Zeppo, der immer Zuckungen hatte, konnte keinen Satz zu Ende bringen, aber lauter pfeifen, als die meisten Trompeter blasen konnten.
Ich winkte Zeppo zu, und er wackelte in meine Richtung, zog eine Grimasse und zwinkerte. Ich versuchte, Rafaels Blick einzufangen, aber er konzentrierte sich auf die beiden Schwachköpfe, die er angelockt hatte. Rafael war klein, die Hautfarbe mehr grau als braun. Die meisten Vorderzähne fehlten ihm, und das linke Auge lag tot in seiner Höhle. Die Schwachköpfe sahen Rafael an und wussten, den könnten sie übertölpeln. Und vielleicht glaubten sie, sie müssten nicht einmal bezahlen, wenn sie verloren; Rafael sah so aus, als ob er nicht einmal einem Pudel etwas zuleide tun könnte.
Aber Rafael Gordon trug ein schwarzes Fischmesser mit Korkheft im Ärmel, und er hatte immer eine meterlange Kette aus gehärtetem Stahl in der Tasche.
»Zeigt mir, wo die rote Kugel landet«, sang er. »Zeigt mir die rote Kugel und zwei Dollar. Verdoppelt euer Geld und macht heut Nacht einen drauf.« Er bewegte die getürkten Nussschalen hin und her, hob sie mehrmals hoch, um zu zeigen, wo etwas war und wo nichts.
Ein Hüne, den ich vorher noch nie gesehen hatte, zeigte auf eine Schale. Ich wandte mich ab und ging auf mein Zuhause zu.
Ich dachte an das tote Partygirl; daran, dass sie ohne Grund umgebracht worden war, ausgenommen vielleicht wegen ihres Aussehens oder weil sie jemandem ähnlich sah. Ich erschauerte bei der Erinnerung daran, wie natürlich sie gewirkt hatte. Wenn eine Frau vergisst, dass sie hübsch sein und sich zur Schau stellen soll, sieht sie wie diese Ermordete aus; einfach jemand, der müde ist und Ruhe braucht.
Das brachte mich auf Regina und ihr Aussehen. Natürlich ließ sich das nicht vergleichen. Regina war eine Königin. Sie trug niemals billige Kleidchen oder knalligen Modeschmuck. Wenn sie tanzte, bewegte sie sich nicht so ruckartig wie die meisten jungen Frauen. Regina tanzte leicht und anmutig wie ein Fisch im Wasser oder ein Vogel in der Luft.
Die Erinnerung an die tote Frau ließ mich nicht los. Ich ging zum Gartentor und sah nach, ob Regina und Edna wohlbehalten im Wohnzimmer waren. Ich konnte sie durch das Fenster sehen, dann stieg ich in mein Auto und fuhr zur Hooper Street. Damals befand sich Mofass’ Immobilienbüro in der Hooper Street. Es lag im ersten Stock eines zweistöckigen Gebäudes. Das Gebäude gehörte mir, aber niemand außer Mofass wusste das. Das Erdgeschoss war an einen Buchladen vermietet, der auf Erbauungsliteratur für Schwarze spezialisiert war. Die Mieter waren Chester und Edwina Remy. Wie alle Mieter in meinen sieben Häusern zahlten die Remys die Miete an Mofass. Danach gab er mir das Geld.
Ich wusste, dass Mofass da sein würde, weil er an sieben Abenden in der Woche Überstunden machte. Außer arbeiten und Zigarren rauchen tat er nichts.
Die Treppe, die zu Mofass’ Tür führte, war außen. Sie ächzte und sackte durch, als ich hinaufging. Schon ehe ich die Tür erreichte, hörte ich Mofass husten.
Als ich hereinkam, kauerte er in gebückter Haltung über dem Ahornschreibtisch. Er gab Geräusche von sich wie ein Motor, der nicht anspringen will.
»Ich hab Ihnen doch gesagt, Se solln mit dem Rauchen aufhörn, Mofass. Die Zigarre da könnt Se umbringen.«
Mofass hob den Kopf. Wegen der Hängebacken ähnelte er einer Bulldogge. Durch die klägliche Haltung sah er noch hündischer aus. Tränen von der vielen Husterei liefen ihm aus den wässrigen Augen. Er hielt sich die Zigarre vor das Gesicht und starrte sie entsetzt an. Dann zerquetschte er den schwarzen Stumpen in einem Glasaschenbecher und hievte sich im Drehstuhl hoch.
Er unterdrückte ein Husten und ballte die Fäuste.
»Wie geht’s denn so?«, fragte ich.
»Bestens«, flüsterte er, dann erstickte er fast an einem Hustenanfall.
Ich setzte mich in seinen Besucherstuhl und wartete darauf, dass er Geschäftliches zur Sprache brachte. Wir kannten uns schon viele Jahre. Vielleicht hatte ich deshalb zweierlei Ansichten über Mofass’ Krankheit. Einerseits tat es mir immer leid, wenn ich einen Menschen sah, dem es miserabel ging. Aber andererseits war Mofass ein Feigling, der mich einmal verraten hatte. Ich hatte ihn nur aus einem Grund nicht umgebracht: Ich hatte mich nicht als besserer Mensch erwiesen.
»Wie läuft’s?«, fragte ich.
»Tut sich nix bis auf die Miete.«
Darüber lächelten wir beide.
»Is wohl okay«, sagte ich.
Mofass hob die Hand, damit ich schwieg, und nahm einen Porzellantiegel vom Schreibtisch. Er schraubte ihn auf, hielt ihn sich an Nase und Mund und atmete tief ein. Der Geruch nach Kampfer und Menthol stach mir in die Nase.
»Ham Se das mit der neuesten Leiche schon gehört?«, fragte Mofass, dessen Stimme aus dem Grab wiederauferstanden war.
»Nein.«
»Die haben se in der Hundertzehnten gefunden. Nich weit von Ihnen. Hat geheißen, da sind fast zwanzig Cops gewesen.«
»Ja?«
»Amüsiermiezen. Nicht mehr ganz so amüsant«, sagte er. »So ein Irrer, macht junge Dinger alle. Eine Schande.«
Mofass zog eine Zigarre aus der Westentasche. Er wollte die Spitze abbeißen, als er meinen Blick sah. Er steckte den Sargnagel zurück und sagte: »Kann brenzlig für uns werden.«
»Wieso brenzlig?«
»Jede Menge von den Miezen sind Mieter von Ihnen, Mann. Leben allein oder sind sitzen gelassen worden. Haben ein Baby und einen Job, und Freitagabend ziehn se mit Freundinnen los und wolln nen Mann aufgabeln.«
»Na und? Glauben Se, der Kerl, der das macht, rottet unsere ganzen Mieter aus?«
»Nee, nee. Ganz so blöd bin ich nich. Hab zwar nix mit dem College am Hut gehabt wie Sie, aber ich seh so gut wie jeder andere, was ich vor der Nase hab.«
»Und was is das?«
»Georgette Wykers und Marie Purdue ham mir erzählt, sie ziehen zusammen – wegen de Sicherheit. Sie ham gesagt, dann können se besser auf ihre Kinder aufpassen, un sicherer isses auch. Türlich wolln se bloß die halbe Miete zahlen.«
»Und? Was soll ich da machen?«
Mofass lächelte. Grinste. Ich konnte noch den letzten, goldüberkronten Backenzahn sehen. Wenn Mofass sich diese Art von Vergnügen anmerken ließ, hieß das, er war im Zusammenhang mit Geld erfolgreich gewesen.
»Sie brauchen nix machen, Mr. Rawlins. Ich hab denen gesagt, das ist gegen de Vorschriften. Dann hab ich Georgette gesagt, wenn se zu Marie zieht, kann Marie se rausschmeißen, weil Georgettes Name nich im Vertrag steht.«
Falls Mofass an seinem Todestag Geld verdiente, würde er als glücklicher Mann sterben.
»Machen Se sich wegen so was keinen Kopf, Mann«, sagte ich. »Lassen Se die Frauen doch machen, was se wolln. Sie wissen doch, jeden Tag kommen tausend Leute hierher. Wenn einer auszieht, zieht einfach ein anderer ein.«
Mofass schüttelte traurig und langsam den Kopf. Er konnte nicht tief Luft holen, aber ich tat ihm leid. Wie konnte ich so blöd sein, wegen einem Dollar und ein bisschen Kleingeld nicht die ganze Welt bluten zu lassen?
»Ham Se mir noch was zu sagen, Mofass?«
»Diese Weißen da ham heute wieder angerufen.«
Ein Vertreter einer Firma namens DeCampo Associates hatte Mofass wegen eines Stücks Land in Compton angerufen, das mir gehörte. Sie hatten schon zweimal angeboten, es zu kaufen; beim letzten Mal für über das Doppelte dessen, was es wert war.
»Davon will ich nix hören. Wenn die das Land wollen, muss es mehr wert sein, als sie zahlen wollen.«
Ich ging zum Fenster hinüber, weil ich mich nicht wieder darüber streiten wollte. Mofass meinte, ich solle das Land verkaufen, weil es ein schneller Profit war. Im Tagesgeschäft war Mofass tüchtig, aber er wusste nicht, wie man für die Zukunft plant.
»Die ham jetzt ein neues Angebot«, sagte er. »Wolln Se Nein sagen zu hunderttausend Dollar?«
Vom Fenster aus sah ich einen kleinen Jungen, der einen blauen Handkarren an einer Straßenlampe vorbeizog. Er hatte große Wasserflaschen im Wagen. Sechs bis sieben. Im besten Fall waren das vierzehn Cent, was knapp für drei Schokoriegel reichte. Der Junge war braun, barfuß, in kurzen Hosen und einem gestreiften T-Shirt. Er war tief in Gedanken, während er den Karren zog. Vielleicht dachte er an seine Rechtschreibstunde von letzter Woche. Vielleicht überlegte er, wie man Känguru schrieb. Aber ich hatte den Verdacht, dass der Junge sich fragte, wie er an den einen Cent rankam, den er für einen dritten Schokoriegel brauchte.
»Hunderttausend?«
»Die wolln sich mit Ihnen treffen«, krächzte Mofass.
Ich hörte, wie er ein Streichholz anzündete, und drehte mich in dem Augenblick um, in dem er den ersten Zug nahm.
»Was wolln die von uns, William?« Mofass’ richtiger Name war William Wharton.
Mofass ging zu einem verschwörerischen Ton über und sagte: »Das County will Willoughby Place zu einer Hauptstraße ausbaun, vierspurig.«
Mir gehörten auf einer Seite von Willoughby Place dreieinhalb Hektar. Sie waren Teil einer Abmachung gewesen, falls ich das verschwundene Eigentum eines alten japanischen Gärtners wiederfinden würde.
»Na und?«, fragte ich.
»Die Männer da wolln Ihnen das Geld fürn Ausbau leihen. Hunderttausend Dollar, dann sind Se denen Ihr Partner.«
»Können’s nicht erwarten, mir das Geld zu geben, was?«
»Se brauchen mir bloß das Okay geben, Mr. Rawlins, dann sag ich denen, der Vorstand hat zugestimmt.«
Wenn jemand mit mir Geschäfte machen wollte, lief das über Mofass. Er vertrat die Firma, die ich für Geschäfte gegründet hatte. Der Vorstand war ein Einmannkomitee.
Ich musste lachen. Hier war ich, der Sohn eines Holzfällers. Ein Schwarzer, ein Waisenkind und außerdem aus dem Süden. Es war völlig ausgeschlossen, dass ich jemals fünftausend Dollar zu Gesicht bekam, aber hier war ich und wurde von weißen Grundstücksmaklern umworben.
»Machen Se nen Termin mit denen«, sagte ich. »Ich will mir die Männer mal anschaun. Aber machen Se sich keine gierigen Hoffnungen, Willy, vermutlich kommt nix dabei heraus.«
Mofass grinste, atmete Rauch durch die Zähne ein.
4
Es war ein warmer Abend. Ich parkte am Ende meines Blocks. Zeppo und Rafael waren fort. Der Pappkarton, den Rafael als Tisch benutzt hatte, lag zusammengefaltet auf dem Gehweg. Den Rinnstein zierte ein Klumpen Blut an einem ausgeschlagenen Zahn. Jemand hatte in Rafael Gordons Schule der Taschenspielerei eine bittere Lektion gelernt.
Das getrocknete Blut brachte mich wieder auf das tote Partygirl.
Nach allem, was geschehen war, wollte ich immer noch dringend allein sein. Deshalb beschloss ich, einen Schluck zu trinken, ehe ich zu meiner Frau zurückging.
Innen war das Avalon etwa so groß wie ein Schaufenster. Ein Tresen und sechs Hocker – das war alles. Rita Coe servierte Flaschenbier und Drinks mit Wasser oder Eis.
Es war nur ein Gast da, ein Hüne, der sich, mit dem Gesicht zur Wand, am Ende des Tresens über ein Münztelefon beugte.
»Was haste denn hier verlorn, Easy Rawlins?« Rita war kräftig und klein mit Knopfaugen und dünnen Lippen.
»Ich hab an Whisky gedacht.«
»Hab gedacht, du trinkst nix in ner Bar so nah bei dir zu Haus?«
»Heut tu ich’s mal.«
»Warum nicht?«, fragte der Hüne am Telefon. »Ich bin so weit.«
Rita goss meinen Scotch in einen Tumbler.
»Wie geht’s Regina und der Kleinen?«, fragte Rita.
»Gut, beiden gut.«
Sie nickte und schaute auf meine Hände hinunter. »Haste von den Frauen gehört, wo umgebracht worden sind?«
»Scheint’s hört man nix anderes.«
»Weißte, ich hab Angst, zu meinem Auto rauszugehen, wenn ich nachts abschließ.«
»Schließt du alleine ab?«, fragte ich sie. Aber ehe sie antworten konnte, knallte der Hüne den Hörer so heftig auf die Gabel, dass das Telefon sich mit einem kurzen Klingeln beschwerte.
Dupree Bouchard stand auf und wandte sich uns zu – mit seinen ganzen eins fünfundneunzig. Er sah mich und schaute sich um, als suchte er nach einer Hintertür. Aber die einzige Tür war die, durch die ich gekommen war.
Dupree und ich waren Freunde gewesen, als wir jünger waren. In einer Nacht trank er zu viel und sackte weg – und mir und seiner Freundin Coretta blieb nichts, an dem wir uns festhalten konnten als aneinander. Vielleicht hörte er unsere gedämpften Schreie durch seinen Alkoholrausch hindurch. Oder vielleicht gab er mir die Schuld an ihrer Ermordung am nächsten Tag.
»Hey, Dupree. Wie geht’s denn so bei Champion?«
Vor zehn Jahren hatten wir beide bei Champion Aircraft gearbeitet. Dupree war ein hervorragender Maschinenschlosser.
»Die taugen nix, Easy. Wenn de dich umdrehst, ham se jedes Mal ne neue Vorschrift, mit der se dich fertigmachen. Und wenn de n Nigger bist, ham se zwei Vorschriften.«
»Stimmt«, sagte ich. »Das stimmt. Überall das Gleiche.«
»Zu Haus im Süden isses besser. Da sticht dich wenigstens kein schwarzer Bruder in den Rücken.« Er sah mir in die Augen, als er das sagte. Dupree konnte nie beweisen, dass ich mit Coretta etwas angestellt oder ihr etwas angetan hatte. Er wusste nur, dass ich in einer Nacht bei ihnen gewesen und dass sie dann für immer gegangen war.
»Weiß nich, Dupree«, sagte ich. »So viel Lyncherei hat’s hier in L.A. County auch wieder nich gegeben.«
»Willste was trinken, Dupree?«, fragte Rita.
Der Hüne setzte sich, zwei Hocker von mir entfernt, und nickte ihr zu.
»Wie geht’s deiner Frau?«, fragte ich, damit er über etwas Erfreulicheres redete.
»Die is okay. Ich hab jetzt Arbeit im Temple Hospital«, sagte er.
»Wirklich? Meine Frau arbeitet dort. Regina.«
»Wie sieht se aus?«
»Dunkler Teint. Hübsch und ziemlich schlank. Arbeitet auf der Entbindungsstation.«
»Wann?«
»Meistens von acht bis fünf.«
»Dann hab ich se vermutlich noch nie gesehn. Bin erst zwei Monate dort und hab Nachtschicht. Muss im Keller die Wäsche machen.«
»Gefällt dir das?«
»Ja«, sagte er bitter. »Bin begeistert.«
Dupree nahm den Drink, den Rita brachte, und stürzte ihn mit einem Schluck hinunter. Er klatschte zwei Vierteldollar auf den Tresen und sagte: »Muss weg.«
Er ging an mir vorbei und zur Tür hinaus, schweigend und finster. Ich erinnerte mich daran, wie laut er in der letzten Nacht mit Coretta und mir gelacht hatte. Damals war sein Lachen wie Donner gewesen.
Ich wünschte mir, ich könnte rückgängig machen, was meinem Freund widerfahren war, meinen Anteil an seiner lebenslangen Verzweiflung. Ich wünschte es mir, aber was sind schon Wünsche.
»Andre Lavender«, sagte ich zu Rita.
»Was haste gesagt?«
»Andre. Kennste ihn?«
»Mhm.«
»Gib mir n Stück Papier.«
Ich schrieb Andres Namen und Telefonnummer auf und sagte: »Ruf ihn an und sag, ich will, dass er herkommt und dich nachts zum Auto bringt.«
»Der arbeitet für dich?«
»Hab ihm mal nen Gefallen getan. Jetzt kann er dir helfen.«
»Muss ich ihm was zahlen?«
»Schluck Whiskey reicht.«
Ich schob mein Glas zu ihr rüber, und sie schenkte noch mal ein.
Jesus schlug im Verandalicht auf dem Rasen Rad. Die kleine Edna hielt sich an den Gitterstäben des Kinderbetts aufrecht. Sie lachte und quietschte über ihren stummen Bruder. Ich trat durch das Tor und hob einen Football auf, der in den Dahlienbüschen am Zaun lag. Ich pfiff, dann warf ich den Ball, als sich Jesus nach mir umdrehte. Er fing den Football, hielt ihn in einer Hand und winkte mit der anderen Edna zu, als sollte sie herkommen. Sie rüttelte an dem Gitter, hüpfte auf den Fußballen und schrie, so laut sie konnte: »Bumm!«
Jesus trat den Ball so heftig, dass er gegen den Drahtzaun prallte. Für Großstadtkinder war das Klingeln von Stahl eine Art Musik.
»Was is denn hier draußen los?« Regina wurde einen Augenblick lang vom grauen Dunst der Fliegentür eingerahmt. Sie kam auf die Veranda und stellte sich vor unsere Kleine, als wollte sie sie beschützen. Edna heulte auf. Sie konnte wegen des Rocks ihrer Mutter weder Jesus noch den Garten sehen.
»Ach, komm schon, Schatz. Sie is okay«, sagte ich, als ich die drei Stufen zur Veranda hinaufging.
»Er könnt danebentreffen und ihr den Kopf abreißen!«
Edna ließ sich heftig auf den gewindelten Hintern fallen. Jesus kletterte auf den Avocadobaum.
»Du musst dich mehr kümmern, Easy«, sagte die Frau, mit der ich seit zwei Jahren verheiratet war.
»Issy«, echote Edna.
Mir fiel die Antwort schwer, denn wenn ich Regina anschaute, fiel mir das Denken immer schwer. Ihre Haut hatte die Farbe von gewachstem Ebenholz, und ihre großen mandelförmigen Augen lagen einen Zentimeter zu weit auseinander. Sie war groß und schlank, aber bei all ihrer Schönheit war da noch etwas, was mir zusetzte. Ich konnte in ihrem Gesicht keine Unvollkommenheit sehen. Keinen Makel, keine Falte. Nie ein Pickel, ein Leberfleck oder ein Härchen am Kinn. Hin und wieder machte sie die Augen zu, aber sie blinzelte niemals wie normale Menschen. Regina war in jeder Hinsicht vollkommen. Sie wusste, wie sie gehen, wie sie sich setzen musste. Aber sie ließ sich nie durch eine lüsterne Bemerkung aus der Fassung bringen oder durch Armut schockieren.
Jedes Mal, wenn ich Regina Riles ansah, verliebte ich mich in sie. Ich verliebte mich in sie, bevor wir auch nur ein Wort gewechselt hatten.
»Ich hab gedacht, es wär okay, Schatz.« Ich streckte unbewusst die Hände nach ihr aus, und sie wich aus, eine anmutige Tänzerin.
»Hör mal, Easy. Jesus weiß nich, was für Edna richtig is. Du musst für ihn denken.«
»Er weiß mehr, als du glaubst, Baby. Er ist mehr mit kleinen Kindern zusammen gewesen als die meisten Frauen. Und er versteht, auch wenn er nich spricht.«
Regina schüttelte den Kopf. »Er hat Probleme, Easy. Wenn du sagst, er is okay, so isses noch lange nich wahr.«
Jesus stieg vom Baum herunter und ging zur Seite des Hauses, in sein Zimmer.
»Ich weiß nich, was du meinst, Schatz«, sagte ich. »Jeder hat Probleme. Wie einer seine Probleme anpackt, das zeigt, was für ein Mann er wird.«
»Er is kein Mann. Jesus is bloß ein kleiner Junge. Ich weiß nich, was er Schlimmes erlebt hat, aber ich weiß, dass es zu viel für ihn gewesen is, deshalb kann er nich sprechen.«
Ich ließ es dabei bewenden. Ich hatte es nie über mich gebracht, ihr die wahre Geschichte zu erzählen. Wie ich den Jungen aus dem Haus einer verschwundenen Frau gerettet hatte, nachdem er von einem bösen Mann gekauft und missbraucht worden war. Wie hätte ich erklären können, dass der Mann, der Jesus misshandelt hatte, ermordet worden war, dass ich wusste, wer es getan hatte, es aber für mich behalten hatte?
Regina nahm Edna in ihre Arme. Die Kleine schrie. Ich hätte sie am liebsten beide gepackt und so heftig umarmt, bis ich die ganze Aufregung aus ihnen gedrückt hätte.
Manchmal war es schmerzlich für mich, mit Regina zu reden. Sie war sich so sicher, was richtig war und was nicht. Sie konnte mein Inneres völlig durcheinanderbringen. So sehr, dass ich manchmal nicht wusste, ob ich Wut oder Liebe empfand.
Ich wartete einen Augenblick lang draußen, als sie hineingegangen war, betrachtete mein Haus. Es gab so viele Geheimnisse, die ich mit mir herumtrug, so viele kaputte Leben, an denen ich Anteil hatte. Regina und Edna gehörten nicht dazu, und ich schwor mir, dass sie nie dazugehören würden.
Schließlich ging ich hinein, fühlte mich wie ein Schatten, der ins Helle tritt.
5
»Du hast getrunken«, sagte Regina, als ich hereinkam. Ich glaubte nicht, dass sie es riechen konnte, und so viel hatte ich nicht getrunken, dass ich nicht gerade gehen konnte. Regina kannte mich eben. Das gefiel mir, es machte mein Herz ganz wild.
Edna und Regina saßen beide auf der Couch. Als die Kleine mich sah, sagte sie: »Issy«, machte sich von ihrer Mutter los und krabbelte in meine Richtung. Regina packte sie, ehe sie auf den Boden fiel.
Edna brüllte, als hätte sie einen Klaps bekommen.
»Warst du auf dem Polizeirevier?«
»Quinten Naylor wollte mit mir reden.« Ich hatte immer ein schlechtes Gefühl, wenn die Kleine schrie. Ich hatte das Gefühl, es müsse etwas unternommen werden, ehe wir weitersprachen. Aber Regina hielt sie einfach fest und redete mit mir, als gäbe es kein Gebrüll.
»Und warum kommste dann besoffen nach Hause?«
»Mach halblang, Baby«, sagte ich. Alles kam mir langsam vor. Ich hatte das Gefühl, ich hätte reichlich Zeit, es ihr zu erklären, die Ruhe wiederherzustellen. Wenn nur Edna mit dem Geschrei aufhören würde, wäre alles okay. »Ich hab im Avalon bloß was getrunken.«
»Muss ein langer Zug gewesen sein.«
»Ja, ja. Ich hab was zu trinken gebraucht nach dem, was Officer Naylor mir gezeigt hat.«
Das verschaffte mir ihre Aufmerksamkeit, aber ihr Blick war immer noch hart und kalt.
»Er hat mich zu einem leeren Grundstück an der Hundertzehnten gebracht. Da war ne Tote. Kopfschuss. Derselbe Kerl, der auch die beiden anderen Frauen umgebracht hat.«
»Die wissen, wer’s war?«
Ich musste ein Lächeln unterdrücken. Ich hätte am liebsten getanzt, weil ich den zornigen Blick aus ihrem Gesicht vertrieben hatte.
»Nee«, sagte ich so nüchtern wie möglich.
»Woher wissen die dann, dass es derselbe Mann war?«
»Der is verrückt, deshalb. Er markiert sie mit ner brennenden Zigarre.«
»Vergewaltigung?«, fragte sie mit leiser Stimme. Edna hörte auf zu schreien und sah mich mit dem forschenden Blick ihrer Mutter an.
»Auch«, sagte ich und bereute plötzlich, dass ich überhaupt etwas gesagt hatte. »Und andere Sachen.«
Ich nahm Edna auf und setzte mich neben meine Frau.
»Naylor wollte, dass ich ihm helfe. Hat geglaubt, ich hätt vielleicht irgendwas gehört.«
Als Regina die Hand auf mein Knie legte, hätte ich am liebsten gejubelt.
»Wieso hat er das geglaubt?«