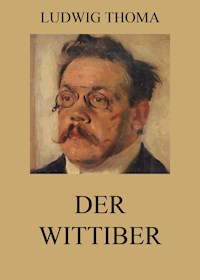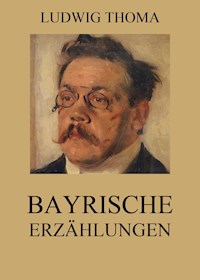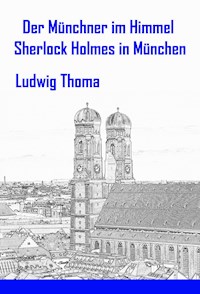1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Booksell-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In "Der Wittiber: Ein Bauernroman" entführt Ludwig Thoma den Leser in die ländliche Welt des bayerischen Bauernlebens, das durch den scharfen Blick des Autors auf zwischenmenschliche Beziehungen und soziale Strukturen geprägt ist. Der Roman folgt der Lebensgeschichte des Wittibers, dessen Schicksal von den Herausforderungen und Traditionen der ländlichen Gemeinschaft bestimmt wird. Durch seinen pointierten, oft humorvollen Stil und die lebendige Schilderung der Charaktere gelingt es Thoma, sowohl die Tragik als auch die Komik des Alltagslebens einzufangen. Das Werk steht im literarischen Kontext der Natur- und Heimatliteratur des frühen 20. Jahrhunderts und zeichnet sich durch eine authentische Sprache sowie regionale Dialekte aus, die das Setting lebendig werden lassen. Ludwig Thoma, geboren 1867, war nicht nur Schriftsteller, sondern auch Journalist und Theaterautor, der in einem bayerisch geprägten Umfeld aufwuchs. Diese persönlichen Erfahrungen und sein tiefes Verständnis der ländlichen Lebensweise spiegeln sich in seinem Werk wider. Als kritischer Beobachter der gesellschaftlichen Verhältnisse seiner Zeit thematisierte Thoma soziale Ungerechtigkeiten und die Auswirkungen von Traditionen, was seinen Arbeiten oft eine subversive Note verlieh. Sein literarisches Elan und seine feinsinnige Analyse der menschlichen Natur machen ihn zu einem wichtigen Vertreter der deutschen Literatur. "Der Wittiber" ist eine fesselnde Lektüre für jeden, der sich für die Verflechtungen von Tradition, Gemeinschaft und individueller Identität interessiert. Thomasiansche Komik und sein mitreißender Erzählstil laden dazu ein, in die facettenreiche Welt der bayerischen Bauern einzutauchen. Dieses Buch wird nicht nur Liebhaber klassischer Literatur ansprechen, sondern auch Leser, die das Leben im ländlichen Raum verstehen und reflektieren möchten. In dieser bereicherten Ausgabe haben wir mit großer Sorgfalt zusätzlichen Mehrwert für Ihr Leseerlebnis geschaffen: - Eine prägnante Einführung verortet die zeitlose Anziehungskraft und Themen des Werkes. - Die Synopsis skizziert die Haupthandlung und hebt wichtige Entwicklungen hervor, ohne entscheidende Wendungen zu verraten. - Ein ausführlicher historischer Kontext versetzt Sie in die Ereignisse und Einflüsse der Epoche, die das Schreiben geprägt haben. - Eine gründliche Analyse seziert Symbole, Motive und Charakterentwicklungen, um tiefere Bedeutungen offenzulegen. - Reflexionsfragen laden Sie dazu ein, sich persönlich mit den Botschaften des Werkes auseinanderzusetzen und sie mit dem modernen Leben in Verbindung zu bringen. - Sorgfältig ausgewählte unvergessliche Zitate heben Momente literarischer Brillanz hervor. - Interaktive Fußnoten erklären ungewöhnliche Referenzen, historische Anspielungen und veraltete Ausdrücke für eine mühelose, besser informierte Lektüre.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Der Wittiber: Ein Bauernroman
Inhaltsverzeichnis
Einführung
Im Zentrum steht die Reibung zwischen persönlichem Begehren und der engmaschigen sozialen Kontrolle eines Dorfes, in dem Besitz, Anstand und der gute Ruf härtere Währungen sind als Zuneigung, in dem Arbeitstakt und Jahreszeiten das Leben takten, in dem jede Entscheidung über Hof, Haus und Herz sofort öffentlich wird und nach Regeln beurteilt wird, die älter sind als die Handelnden, und in dem ein Mann, der seine Frau verloren hat, nicht nur um Ordnung und Brot, sondern um Haltung, Selbstbehauptung und die Möglichkeit eines künftigen Glücks ringen muss, ohne den moralischen Preis aus dem Blick zu verlieren.
Der Wittiber: Ein Bauernroman von Ludwig Thoma verortet seine Handlung in der bayerischen Provinz und bedient die Tradition des realistischen Heimat- und Sittenromans, ohne in bloße Folklore zu verfallen. Entstanden zu Beginn des 20. Jahrhunderts, spiegelt das Werk eine Gesellschaft im Übergang, in der überkommene Bindungen noch Kraft haben, ökonomischer Druck jedoch neue Härten erzeugt. Thoma, als scharfer Beobachter ländlicher Milieus bekannt, nutzt seine genaue Kenntnis regionaler Lebensformen, um ein dichtes Panorama von Alltag, Arbeit und Rangordnungen zu entwerfen. Der Roman bleibt dabei bodenständig, verständlich und zugleich analytisch, indem er Strukturen sichtbar macht, die Verhalten rahmen.
Ausgangspunkt ist ein Hof, der nach dem Tod der Bäuerin seinen Mittelpunkt verloren hat, und ein Mann mittleren Alters, der sich plötzlich in der Verantwortung für Besitz, Personal und soziale Erwartungen wiederfindet. Was zunächst als nüchterne Aufgabe erscheint – Arbeit organisieren, Ernte sichern, Haushalt ordnen –, öffnet sich zu einer Frage nach Zukunft und Zugehörigkeit: Wie lässt sich das Notwendige mit dem Wünschbaren verbinden, ohne die fragile Balance im Dorf zu stören. Mit jedem Besuch, jeder Hilfeleistung und jeder Bemerkung der Nachbarn entstehen neue Optionen und Zwänge, deren Tragweite der Erzähler unaufgeregt, aber präzise ausleuchtet. Vieles bleibt andeutungsvoll und offen.
Die Erzählstimme erscheint nüchtern und beobachtend, mit einer leisen Ironie, die weder verächtlich noch beschönigend wirkt. Thoma arbeitet mit klaren Sätzen, genauen Gesten und sorgfältig gesetzten Szenenwechseln; Dialoge tragen eine regionale Färbung, ohne unzugänglich zu werden. Der Ton bleibt meist ruhig, fast gelassen, doch unter der Oberfläche liegt stetige Spannung, gespeist aus unausgesprochenen Erwartungen und kleinen Verschiebungen im sozialen Gefüge. Der Rhythmus des Textes folgt Arbeit, Witterung und Festtagen, wodurch ein glaubwürdiges Zeitgefüge entsteht. So entwickelt der Roman Intensität aus Nähe, Wiederholung und feinen Kontrasten statt aus lauter Dramatik oder melodramatischen Zuspitzungen.
Zentrale Themen kreisen um Besitz und Begehren, um die Frage, wem Arbeit, Ertrag und Entscheidungsmacht zustehen und wie Nähe zwischen Menschen unter Bedingungen materieller Abhängigkeit verhandelt wird. Der Roman zeigt, wie Gerede zu einem unsichtbaren Instrument der Disziplinierung wird und wie Rollenbilder von Männlichkeit und Weiblichkeit Handlungsräume öffnen oder schließen. Ebenso wichtig sind Loyalität, Scham und der Wert des guten Rufs, der als soziale Währung fungiert. Die alltägliche Moral erscheint weniger als abstraktes Prinzip denn als Praxis, die im Streitfall flexibel gedehnt wird – oft zum Nutzen der Stärkeren, selten ohne Kosten für alle. Dabei bleibt Ambivalenz erkennbar.
Für heutige Leserinnen und Leser ist die Lektüre relevant, weil sie Mechanismen sozialer Kontrolle sichtbar macht, die in digitalen Öffentlichkeiten ähnliche Formen annehmen: Aufmerksamkeit, Bewertung und schnell zirkulierende Narrative prägen Verhalten. Ebenso aktuell ist das Verhältnis von Ökonomie und Intimität, wenn Partnerschaften auch als Absicherung, Arbeitsteilung und Pflegeorganisation gedacht werden müssen. Der Roman sensibilisiert für Care-Arbeit, für Verwitwung und die Frage, wie Gemeinschaft Trauer auffängt oder instrumentalisiert. Er zeigt, wie Herkunft und Eigentum Chancen verteilen, und lädt dazu ein, die eigenen Normen zu befragen, ohne die Menschen hinter den Strukturen aus dem Blick zu verlieren.
Das Leseerlebnis ist getragen von stiller Spannung und genauer Zeichnung, die ohne große Gesten auskommt und gerade dadurch lange nachhallt. Wer bereit ist, dem gemächlichen Tempo des Dorflebens zu folgen, wird mit Szenen belohnt, die in ihrer alltäglichen Präzision weit über das Lokale hinausweisen. Der Roman fordert eine aufmerksame, langsame Lektüre, bei der Zwischentöne und kleine Verschiebungen Gewicht erhalten. Er eignet sich für Leserinnen und Leser, die soziale Dynamiken erkunden wollen, und für alle, die verstehen möchten, wie aus Gewohnheit Geschichte wird. Am Ende steht kein Urteil, sondern ein erweitertes Sensorium für Nähe und Maß.
Synopsis
Der Wittiber: Ein Bauernroman von Ludwig Thoma schildert in nüchternem, beobachtendem Ton das Leben eines verwitweten Bauern in einem bayerischen Dorf. Nach dem Tod seiner Frau konzentriert sich der Hofbesitzer auf Wirtschaft und Ordnung, bemüht sich um Ansehen und Stabilität und unterdrückt seine Einsamkeit. Um ihn herum wirkt ein engmaschiges Geflecht aus Verwandtschaft, Nachbarschaft und kirchlicher Autorität, das Verhalten und Entscheidungen lenkt. Thoma führt in den bäuerlichen Jahreslauf, die Abhängigkeit von Ernte und Wetter sowie in das stetige Messen der Leute am öffentlich sichtbaren Sittlichkeitsmaßstab ein und setzt damit den Rahmen für persönliche Konflikte.
Je gefestigter der Hof scheint, desto stärker wachsen Erwartungen von außen. Heiratsvermittler und Verwandte sondieren mögliche Verbindungen, da Besitz, Arbeitskraft und Nachkommen als gemeinschaftliche Angelegenheiten gelten. Der Wittiber wehrt die Vorschläge aus Stolz und Freiheitsdrang ab und stellt stattdessen eine junge Magd ein, die Routine und Versorgung sichern soll. Zwischen nüchterner Zweckgemeinschaft und unausgesprochener Nähe entwickeln sich Spannungen. Die Dorfgemeinschaft registriert jede Veränderung, und harmlose Abläufe erhalten eine Doppeldeutung. Thoma zeigt, wie schnell private Bedürfnisse in einer Kultur der Kontrolle öffentlich werden und wie ökonomische Erwägungen heimlich die moralischen Debatten strukturieren.
Mit der Zeit verdichtet sich die Beziehung zwischen Bauern und Magd, ohne ausdrücklich benannt oder geregelt zu werden. Aus Blicken und Andeutungen wachsen Bindungen, die weder vor dem Altar noch vor der Stube bestehen. Im Wirtshaus zirkulieren Bemerkungen, bei Festtagen und Kirchenbesuchen verstärken Gesten und Sitzordnungen das Reden. Der Wittiber schwankt zwischen Begehren, Eigensinn und dem Wunsch, seinen Ruf nicht zu verlieren. Der Roman verknüpft Alltagsbilder – Stallarbeit, Felder, Brauchtum – mit psychologischer Beobachtung und formt daraus die zentrale Frage, ob individuelle Neigungen im engen Kollektivraum ertragen werden oder sich an dessen Regeln brechen.
Ein Wendepunkt entsteht, als Gerede in eine öffentlich sichtbare Verlegenheit umschlägt. Ein Vorfall, der im Haus beginnt, wird durch aufmerksame Augen und Ohren des Dorfes zur Angelegenheit des Pfarrers, der Gemeindevertretung und der Verwandten. Der moralische Appell verweist auf Sünde, Ordnung und das Beispiel für andere, während hinter den Kulissen Mitgift, Erbfolge und Besitzsicherung mitverhandelt werden. Der Wittiber wird zur Entscheidung gedrängt, die die Beziehung eindeutig ordnen oder beenden soll. Thoma entfaltet das Zusammenspiel von geistlicher Autorität und weltlichem Kalkül, das einerseits Schutz verspricht, andererseits persönliche Freiheit streng beengt. So wird Privates zur politischen Frage im Mikrokosmos des Dorfs.
Der innere Konflikt des Bauern spitzt sich zu: Er sucht Nähe, will aber Unabhängigkeit, fürchtet Bindungskosten und Statusverlust und rechnet zugleich nüchtern mit Arbeitskraft und Vermögen. Die Magd steht zwischen Zuneigung, Bedürftigkeit und der Notwendigkeit sozialer Sicherheit, die im Dorf meist nur durch die sanktionierte Ehe gewährt wird. Ihre begrenzten Handlungsspielräume kontrastieren mit den Optionen des Hofbesitzers. Im Druckraum von Scham, Stolz und ökonomischem Interesse werden Forderungen lauter, Fristen enger, Kompromisse schwieriger. Das persönliche Dilemma wird zur Stellvertreterszene für die Frage, wie viel Autonomie das Kollektiv dem Einzelnen zugesteht. Und was sie kostet.
Ausweichmanöver und Halblösungen verlieren ihre Wirksamkeit, als die Konsequenzen des Schwebezustands praktisch spürbar werden. Kontakte verebben, Hilfe bleibt aus, kirchliche Sanktionen und soziale Ächtung werden als Steuerungsmittel erkennbar. Auf dem Hof zeigen sich Risse: Arbeit gerät ins Stocken, die Atmosphäre verhärtet, und kleine Kränkungen laden sich auf. Ein weiteres Ereignis verschärft den Konflikt, bindet mehr Beteiligte ein und verlangt eine klare Entscheidung. Der Wittiber trifft einen Schritt, der seinen Besitz, seinen Ruf und seine Beziehungen dauerhaft prägen wird; die Folgen reichen über Haus und Hof hinaus, ohne dass der Roman sie vorzeitig eindeutig auflöst.
Der Roman bündelt Kritik an sozialer Heuchelei, an der Verschränkung von Sexualmoral, Macht und Eigentum und an der erzieherischen Funktion von Dorf und Kirche. Mit präziser, oft ironisch gebrochener Beobachtung zeigt Thoma Mechanismen, die Intimes öffentlich machen und Menschen auf Rollen festlegen. Der Wittiber steht exemplarisch für die Zerreißprobe zwischen Gefühl und Kalkül, Selbstbehauptung und Anpassung. Die nachhaltige Wirkung des Werks liegt in seiner Klarheit, die ohne Pathos zeigt, wie fragile Lebensentwürfe an starren Ordnungen scheitern oder sich wandeln, und Leserinnen und Leser dazu anregt, das Verhältnis von Konvention und Freiheit neu zu bedenken.
Historischer Kontext
Der Wittiber spielt in ländlichen Regionen Altbayerns und entstand im späten wilhelminischen Kaiserreich, als das Königreich Bayern unter den Wittelsbachern – bis 1912 unter der Regentschaft Luitpolds – formal eigenständig blieb und dennoch Teil des Deutschen Reichs war. Prägende Institutionen des Dorflebens waren die katholische Pfarrgemeinde, die Gemeindeverwaltung mit Bürgermeister und Rat, die Gendarmeriestationen sowie Amtsgerichte in den Märkten. Die Schulpflicht und der Religionsunterricht verankerten Konfessionalität früh. Mit dem Bürgerlichen Gesetzbuch, das 1900 reichsweit in Kraft trat, wurden zentrale Fragen von Ehe, Vormundschaft und Erbrecht vereinheitlicht, während regionale Gewohnheiten der Hofübergabe fortwirkten. Genossenschaften, Molkereien und Sparkassen strukturierten den Agrarsektor.
Die bäuerliche Ökonomie in Ober- und Niederbayern war um 1900 von klein- bis mittelbäuerlichen Betrieben, Milchviehhaltung und Holz- sowie Nebenerwerb geprägt. Der Eisenbahnanschluss und neue Verkehrswege banden Dörfer enger an Märkte wie München oder Rosenheim. Molkereigenossenschaften und Raiffeisenkassen erleichterten Absatz und Kredit, doch Preisschwankungen, Verschuldung und Arbeitskräftemangel setzten Höfe unter Druck. Übliche Übergabeverträge sollten den Betrieb geschlossen erhalten; jüngere Geschwister wurden durch Aussteuer oder Abfindungen berücksichtigt und suchten häufig Arbeit in Städten oder der Saisonarbeit. Diese ökonomische Verdichtung formte Heiratsstrategien, Nachbarschaftsnetzwerke und die rigorose Kalkulation von Arbeit, Ansehen und Besitz, wie sie zeitgenössische Bauernromane abbildeten.
In Altbayern prägte die römisch-katholische Kirche bis 1914 das soziale Gefüge stark. Pfarrer, Kirchenverwaltungen und kirchliche Vereine organisierten Feste, Prozessionen und Armenfürsorge und setzten Normen von Sittlichkeit und Geschlechterrollen durch. Verlobung, Heiratsgut, uneheliche Geburt und öffentliche Moral wurden nicht nur juristisch, sondern durch kirchliche Lehre und Dorfmeinung gerahmt. Debatten über Sitten und Zensur erreichten um 1900 eine neue Intensität: Die sogenannte Lex Heinze von 1900 richtete sich reichsweit gegen „unsittliche“ Darstellungen in Kunst und Theater und befeuerte Sittlichkeitsvereine. In diesem Klima entstanden Literatur und Satire, die kirchliche Macht und dörfliche Kontrolle kritisch beobachteten.
Die lokale Ordnung beruhte auf einem engen Zusammenspiel von Gemeinde, Kirche und wirtschaftlichen Eliten. Bürgermeister, Großbauern, Wirte und der Pfarrer bildeten informelle Netzwerke, die Arbeitsplätze, Leumund und die Zuteilung kommunaler Ressourcen beeinflussten. Rechtskonflikte wurden häufig außergerichtlich durch Vermittlung gelöst; erst bei Eskalation griffen Amtsgerichte und Gendarmerie ein. Soziale Sanktionen – vom Ausschluss aus Vereinen bis zum Druck der Nachbarschaft – regulierten Verhalten wirksam. Heirat und Knechts- oder Mägdestellen folgten einem Markt mit festen Erwartungen an Tugend, Fleiß und Vermögen. Diese dichte Kontrolle des Alltags erklärt, warum literarische Dorfgeschichten hier Autorität, Tratsch und ökonomische Vernunft so eng verknüpfen.
Rechtlich und sozial stand der Status von Witwen und Witwern im Zentrum vieler Hoffragen. Hofübergabeverträge und Ausgedinge regelten Versorgung, Wohnrecht und Arbeitsanteile der älteren Generation, während der Erbe den Betrieb führte. Das Bürgerliche Gesetzbuch brachte einheitliche Vorschriften zu Erbquoten, Vormundschaft über minderjährige Kinder und Eheschließung, doch regionale Vertragsformen blieben maßgeblich. In dieser Ordnung verband sich Trauerarbeit mit nüchterner Erwartung an erneute Heirat, Haushaltsführung und die Sicherung von Arbeitskräften. Der Begriff „Wittiber“ verweist auf den männlichen Verwitweten und markiert in der dörflichen Öffentlichkeit zugleich eine präzise soziale Rolle, die mit Besitz, Ansehen und moralischer Beobachtung verbunden war.
Ludwig Thoma (1867–1921), in Oberammergau geboren und als Jurist ausgebildet, kannte bayerische Amts- und Dorfwirklichkeit aus erster Hand. Nach Stationen als Rechtsanwalt wandte er sich dem Journalismus und der Literatur zu und veröffentlichte in München bei Albert Langen, dem Verleger der satirischen Zeitschrift Simplicissimus. Thoma verband realistische Dorfbeobachtung, Dialektnähe und eine betont antiklerikale Stoßrichtung, die ihn in die Nähe der Heimatkunst und des ländlichen Realismus à la Ludwig Anzengruber rückt. Seine Bauernromane zeigen nicht Idylle, sondern soziale Mechanik: Besitzlogik, Standesdenken, kirchliche Disziplin. Der zeitgenössische Lesermarkt für solche Stoffe war im Kaiserreich groß und überregionale Verlage machten sie weit zugänglich.
Die Veröffentlichung von Thoma’schen Bauernstoffen fiel in eine Phase massiver publizistischer Expansion: Leihbibliotheken, Familienblätter und Illustrierte erweiterten die Leserschaft, während die Feuilletons Kulturkämpfe zwischen liberalen, sozialdemokratischen und katholischen Stimmen austrugen. Werke, die kirchliche Autorität oder dörfliche Sitte kritisch zeichneten, stießen regelmäßig auf Widerspruch konfessioneller Presseorgane und fanden zugleich Anklang bei einem urbanen Publikum, das „volkstümliche“ Stoffe suchte. Die Münchner Verlagslandschaft um Langen bot Autoren rechtliche und drucktechnische Infrastruktur, auch wenn Zensur- und Sittlichkeitsdebatten an ihnen nicht spurlos vorbeigingen. Vor diesem Hintergrund gewann die realistische Darstellung ländlicher Machtbeziehungen ein besonderes Gewicht im literarischen Feld.
Vor dem Ersten Weltkrieg gelesen, lässt sich „Der Wittiber“ als Kommentar zur späten wilhelminischen Gesellschaft verstehen: Thoma macht sichtbar, wie Eigentum, kirchliche Normierung und öffentliche Meinung die intimsten Entscheidungen des Dorflebens bestimmen. Ohne auf spektakuläre Ausnahmen angewiesen zu sein, beschreibt der Bauernroman jene alltäglichen Mechanismen, die Modernisierung abfedern oder umlenken: vom Konsenszwang über Konformitätsdruck bis zu Vertragsformen der Hofsicherung. Darin liegt seine zeitdiagnostische Schärfe. Das Buch spiegelt eine Epoche, in der traditionelle Institutionen noch stark waren, aber durch Marktintegration, Rechtseinheit und neue Medien bereits herausgefordert wurden – und hält dieser Ordnung einen nüchternen Spiegel vor.
Der Wittiber: Ein Bauernroman
Erstes Kapitel
»Um d’ Kathi is schad; dös behaupt’ i, weil ‘s wahr is, und koa besserne Hauserin is weit umadum net g’wes’n«, sagte der Zwerger von Arnbach, und Männer und Weiber, die beim Leichentrunk saßen, nickten beistimmend.
»De Ehr’ muaß ihr a niada Mensch lass’n, daß ihr d’ Arbet guat von da Hand ganga is.«
»Han?«
Die Fischerbäuerin von Neuried redete undeutlich, weil sie ein tüchtiges Stück Wurst kaute; aber wie sie es hinuntergeschluckt hatte, wiederholte sie ihre Worte.
»Daß ihr d’ Arbet guat von da Hand ganga is, sag i.«
»Und halt vastanna hat sie ‘s aa«, rief einer über den Tisch hinüber.
»Freili hot sie ‘s vastanna. Und gar so viel a guate Melcherin is sie g’wesen,« sagte die Fischerbäuerin, die als Schwester der Verstorbenen heute ein Aufhebens machen durfte. »Solchene muaß it viel geb’n, und it leicht, daß a mal a Kuah nach ihr ausg’schlag’n hat, und vo drei Strich hat sie so viel Milli ausg’molka, wia’r an anderene aus vieri.«
»Und g’rath’n is ihr alssammete,« rief die Huberin von Glonn, »sie hat a niad’s Kaibi durchbracht; und bal sie oans no so g’ring herg’schaugt hat, is ihr it umg’stanna.«
»Was mög’st?« fragte der Zwerger, den die Fischerbäuerin anstieß. »Ah so! Geh, theat’s d’ Würscht no mal her!«
Und er gab der Nachbarin hinaus, die mit Messer und Gabel darüberging und wehleidig sagte: »Es is schad um sie, weil sie gar so viel a guate Melcherin war.«
Der Schormayer von Kollbach hörte die Lobreden oder hörte sie nicht; er schaute verloren an sein Bierglas hin; und wenn er den Deckel aufmachte und eines trank, geschah es auch gedankenverloren und ohne Genuß.
»Was hoscht jetzt an Sinn?« fragte ihr der Zwerger.
»Wia?«
»Was d’ an Sinn hoscht? Übergibst, oda machst alloa furt?«
»I bin do it alloa.«[1q]
»Ja no, die Tochta werd aa it ledi bleib’n mög’n; und bal sie heireth, was is nacha?«
»Dös woaß i jetzt aa it.«
»Geh, Zwerger, laß guat sei! Wer red’t denn von Übageb’n, bal ma d’ Muatta erst vor a Stund ei’grab’n hamm?«
Der Schormayer Lenz sagte es, und zeigte sich überhaupt als rechtsinnigen Menschen, der auch im Unglück seine fünf Sinne beisammen hat, indem er achtgab, daß beim Leichenmahl alles in Ordnung ging und Verwandte und Gefreundete herzhaft zugriffen.
»Ja no,« antwortete der Zwerger, »mi red’t grad; und wer woaß, wann mi wieda beinand is. Und es is guat g’moant g’wen, Schormayer; des sell derfst g’wiß glaab’n.«
»Wia?«
»I sag, daß i dir nix schlecht’s moan, und nix für unguat!«
»Na, na!«
»Bal d’ Kathi bei’n Leb’n blieb’n waar, kunnt’st freili no a fünf Jahr regier’n, aber a so werd ‘s dir hart o’kemma.«
»Ja, ja.«
»Sie is so viel a guate Melcherin g’wen, und in Stall überhaupts hat ‘s koa besserne gar it geb’n,« sagte die Fischerbäuerin, indes sie einen Löffel Rübenkraut zum Schweinefleisch nahm.
»Der Herr gebe ihr die ewige Seligkeit und lasse sie ruhen in Frieden, Amen!« rief am untern Ende eine scharfe Stimme, die zu den frommen Worten nicht recht paßte.
Und sie ging von der Asamin[1] aus, die mit einem kleinen Gütler ein armseliges und streiterfülltes Leben führte.
Sie hatte aber auch mit der Katharina Schormayer eine Schwester begraben und mußte deswegen an diesem traurigen Tage gehört werden.
»Amen!« responsierten die Verwandten und Gefreundeten, und räusperten sich dazu; denn sie gönnten der Asamin nicht, daß sie das Wort führen sollte.
Dann war es still; bloß daß man Gabeln und Messer auf den Tellern kratzen hörte, oder auch einen, der seufzte, oder einen, der sagte: »Ja no! Jetzt is scho amal a so.«
Nach einer Weile jedoch brachte der Zwerger die Unterhaltung wieder in Fluß.
»Des muaß mi sag’n, schö hat da Herr Pfarra g’redt, und g’rad fei’ hat a sei Sach’ fürbracht.«
»Er hot überhaupts a guat’s Mäuwerk«, lobte der Schneiderbauer; »da is er ganz anderst wia der inser in Arnbach. Der sell ko gar nix.«
»Dös is wahr, bei dem muaß mi einschlafa, aba an Herrn Metz lob’ i. Er hat der Schormayerin ihr Ehr geb’n, daß mi z’fried’n sei muaß.«
»Ein fleißiges Weib ist eine Krone ihres Mannes, hat a g’sagt, und dessell hat er aa g’sagt: durch ein weises Weib wird das Haus erbauet. I hon ma ‘s guat g’mirkt.«
Die Asamin ließ sich zu oft hören.
»Mirk d’ as no! Du ko’st as guat braucha!« schrie der Schneiderbauer grob und brachte viele zum Lachen.
»Bal’s aba da Herr Pfarra g’sagt hat!«
»Is ja recht, mirk da ‘s no g’rad!«
»Von a Predigt ko si a niada was hoam nehma, net grad i alloa.«
»Is ja recht.«
»Und des sell derf i do sag’n, daß mi de Predigt g’fall’n hat, und überhaupts is sie von mir so guat a Schwesta g’wen als wia vo de andern; und des is amal wahr, daß er dös g’sagt hat. Ein fleißiges Weib, hat er g’sagt, ist die Krone des Mannes.«
»Is ja recht, bal’s no du aa oane waarst!«
»Nacha krieget der Asam vielleicht gar was für di«, sagte der Zwerger; und wieder lachten Verwandte und Gefreundete.
»Schaug no, daß du was kriagst für de Dei’; und des sell muaß i dir no sag’n …«
»Sei amal staad!« mahnte der Lenz so nachdrücklich, daß die Asamin einhielt.
Und jetzt schob auch seine Schwester Ursula die Fleischplatte vor den alten Schormayer hin.
»Geh, Vata, iß dennerscht was!«
»I mog it.«
»Dös is jetzt aa nix, bal du a so da hockst; is ja des best’ Sach!«
»I mog it, sag’ i.«
»Wickel ‘s eahm ei!« sagte die Fischerbäuerin. »Dahoam mag er ‘s na scho.«
Der Wittiber trank ein ums andere Mal und schaute mit leeren Augen vor sich hin, daß es den Schneiderbauer erbarmte.
»Wie lang bist jetzt verheireth g’wen?« fragte er den stillen Mann.
»I?«
»Ja, muaß do bald dreiß‘g Jahr sei.«
»It ganz. Achtazwanzgi san mi beinand g’wen.«
»Is a lange Zeit. Da g’wohnt ma si z’samm.«
»Da g’wohnt ma si z’samm, ja, ja! Und jetz woaß i gar nix mehr, wo i hi’g’hör, und dahoam is nix, und anderstwo is aa nix.«
»Es werd scho wieder, Vata, laß no guat sei!« sagte Lenz.
»Nix werd ‘s. Dös vastehst du net. Bal mi achtazwanz’g Jahr mitanand g’arbet hat, und is oan Tag g’wen wia den andern, und auf oamal is ‘s gar, dös is dumm ganga. Dös hätt ‘s it braucht.«
»No schau, bei dir is no net allssammete aus«, tröstete der Zwerger. »Du host a Baargeld und kost zuaschaug’n, wann’s d’ heut übagibst.«
»Ja, bal i d’ Arbet nimma hab, was is denn nacha? Und alloa is d’ Arbet aa nimma luschti. Dös is amal nix mehr und werd nix mehr.«
Er schaute wieder vor sich hin und rührte nichts an von allem, was aufgetragen wurde.
Den andern aber hatte die Trauer den Appetit nicht verschlagen; sie langten herzhaft zu, und über Essen und Trinken wurde es lebhafter.
Von der seligen Schormayerin war nicht mehr so viel die Rede als von der Ernte und von den Viehpreisen; und jeder wußte etwas zu sagen, was seiner Kenntnis Ehre machte.
Und wie sich der Eifer steigerte, wollte auch der Lenz zeigen, daß er gut beschlagen war.
Die Fischerbäuerin wieder nahm sich der Ursula an und erzählte ihr von einigen Bauernsöhnen, die rundherum mit guter Aussicht fürs Leben zu heiraten waren.
Und wenn ihr die Namen ausgingen, wußte gleich eine andere noch einen besseren zu rühmen; und über ein kurzes steckten die Weiber ihre Köpfe zusammen und waren vom Sterben mitten ins Heiraten gekommen.
Die Asamin nicht.
Ihre Meinung hatte in solchen Fragen erst recht keine Geltung, und überdem hielt sie es für richtig, jetzt mit einigen Wünschen an den Schormayer zu gehen.
Ohne daß es die andern viel bemerkten, setzte sie sich hinter den Wittiber und fing erst einmal kräftig zu seufzen an. Da er nicht darauf achtete, zupfte sie ihn am Ärmel und sagte: »Dös is a wahr’s Kreuz!«
Der Schormayer wandte sich um. »Was willst?«
»A Kreuz is, sag i, daß d’ Kathi hat sterb’n müass’n.«
»Jetz laß du mi aus!«
»Ja, glaabst, mi bekümmert dös nix? Sie is vo mir aa’r a Schwesta g’wen.«
»I woaß scho.«
»Und bal i aa g’rad an arme Güatlerin bi, des sell macht da gar nix aus. Vielleicht hon i mehra Derbarma mit dir als an anderne.«
»I dank da schö. Ja, is scho recht.« Und er drehte ihr den Rücken zu.
Aber die Asamin war darüber nicht traurig, sie schaute links und rechts, ob die Gespräche noch am Fließen waren; und wie sie das mit Befriedigung sah, faßte sie wiederum den Schwager am Ellenbogen.
»Was hoscht denn?«
»Du, hat d’ Kathi gar it dergleich’n tho, daß sie ihre Verwandt’n a bissel was zuakemma laßt?«
»Na, gar nix.«
»Koan Pfennig it?«
»Na, sag i.«
»Sollt’st nacha schon du a wengl was thoa, daß mi liaba bet’ dafür.«
»Bal’s d’ net gern bet’st, laßt d’ as bleib’n.«
»Sie no net glei so gach. Mi sagt ja grad, weil ‘s a guat’s Werk waar, wann mi an arma Menschen was gab.«
»Du hoscht ihra Lebzeit’n gnua kriagt, und hoscht as do bloß vabutzt.«
»I?«
»Ja, du! Und jetz laß mi mei Ruah!«
»Jetz da muaß i lacha. Wos hon denn i kriagt von ihr?«
»I red nix mehr.«
Der Schormayer war ein weniges aus seiner allertiefsten Trübseligkeit gerissen und zeigte seiner Schwägerin die breite Seite.
»Luada!« brummte er vor sich hin und trank einmal.
Die Asamin gab viel und doch nicht alles verloren; sie wartete etliche Zeit, bis nach ihrer Meinung die Trauer wieder obenauf schwamm.
Dann kriegte sie den Wittiber noch mal am Ärmel.
»Ja Herrgott …!«
»Geh! Muaßt it a so sei! I sag nix mehr von an Geld!«
»Du kriagst schon koans.«
»Dös san mi arma Leut g’wohnt. Aba, paß auf, den brauna Rock von ihr und den Spensa kunnt’st ma do scho geb’n.«
»Wos für an brauna Spensa?« fragte mit einmal Ursula, und fragte es sehr scharf.
»I ho do mit dir it g’red’t.«
»Na, aba an Vata that’st o’bettln und schamst dir gor it.«
»Dös is it bettelt, bal mi fragt!«
»Dei Frag’n kenn i scho, und schama thuast di du gor it. Möcht sie ‘s G’wand vo da Muatta!«
»Was waar ‘s nacha, bal mi an Spensa kriagat? Hoscht du it gnua Sach? Is dös it da Brauch, daß mi an Verwandt’n was gibt? Da möcht i scho von Betteln sag’n und ‘s Mäu recht aufreiß‘n, als wenn sie koan Schwesta net g’wen waar von mi und ‘s Bet’n net aa braucha kunnt!«
Die Asamin deckte ihren Rückzug tapfer und gut, wie ein jeder sagen mußte, aber sie mußte eben doch zurückweichen und von allen Angriffen abstehen.
Sie saß wieder am untern Ende des Tisches und blieb von den flinken Augen der Ursula bewacht, so daß kein lautes Gespräch mehr für sie eine neue Gelegenheit gab.
»Und jetz geh i,« sagte der Schormayer bald darauf und stand auf.
»I geh mit dir, Vata,« rief der Lenz.
»Na, du bleibst do, und de andern aa. I find alloa’ hoam, und koan Unterhaltung brauch i net. S’ Good beinand!«
Er schwankte etwas und hatte in Kümmernis und Nachdenken mehr Bier getrunken, als mancher Fröhliche ertragen könnte; aber die Türe erreichte er doch in einer mäßigen Bogenlinie.
Die Trauerversammlung rief ihm Grüße nach und hielt wieder eine Zeitlang Betrachtungen ab über die Schormayerin und ihr schnelles Sterben und über den Tod im allgemeinen.
»Es is wirkli hart für eahm,« sagte die Fischerbäuerin, »und bal mi ‘s recht sagt, is er z’ alt zu’n no mal Heireth’n und z’ jung zu’n Aufhör’n.«
Die Schneiderin rückte näher zu ihr und wisperte leise, daß es die Mannsbilder n hören sollten: »Überhaupts sag i dös: bei dem Alter is besser, wann da Mo z’erscht stirbt, weil si inseroans leichter in d’ Ruah gibt.«
»Da hoscht amal recht, und des sell is no allemal wahr g’wen, wie ma sagt: bal unser Herrgott an Hanswurst’n hamm will, laßt er oan mit fufz’g Jahr Wittiber wer’n.«
Die Fischerin sah die Schneiderin bedeutsam an, und sie nickten mit den Köpfen und waren sich einige darüber.
Zweites Kapitel
Der Schormayer trat tiefe Löcher in die weiche Dorfgasse, wie er jetzt an dem trübseligen Herbstnachmittage heimging, aber er achtete nicht auf den glucksenden Lehm, der ihm an den Stiefeln hängenblieb.
Wenn er vom Wege abkam und beinahe knietief in den Schmutz trat, fluchte er still und lenkte in die Mitte der Straße ein, aber bald zog es ihn wieder links oder rechts an einen Zaun, und er blieb stehen und brummte vor sich hin:
»Nix mehr is, gar nix mehr.«[2q]
»Himmelherrgott!« sagte er, wenn ein Windstoß in die Obstbäume fuhr und ihm kalte Regentropfen ins Gesicht schleuderte.
Ein Hund riß an der Kette und bellte ihm heiser nach; beim Finkenzeller öffnete die alte Mariann ein Fenster und rief ihm zu: »Derfst ma ‘s it übel ham, daß i net bei da Leich’ g’wen bi; i hon an Wehdam in die Haxen und kimm it bei da Tür außi. I waar ihr so viel gern ganga, und derfst ma ‘s g’wiß glaab’n, i bi ganz vokemma, wia’n i dös g’hört hab, und weil sie gar so …«
Der Schormayer hörte sie nicht; er bog scharf um die Hausecke und war nun bald, unverständliche Worte murmelnd, an der Einfahrt seines Hofes.
Die Spuren vieler Tritte waren noch sichtbar; sie liefen mitten über den geräumigen Platz bis zur Haustüre, und bei ihrem Anblick raffte der Schormayer seine Gedanken wieder fester zusammen.
»Da hamm s’ as raustrag’n. Ah mei! Ah was!«
Er faßte zögernd nach der Türklinke, als vom Kuhstall herüber eine helle Weiberstimme klang.
»Bauer!«
»Was is?«
»Schaugst it eina? D’ Schellerin hat a Kaibi kriagt.«
»Was nacha?«
»A Stierkaibi[2].«
Die Stalldirne klapperte auf ihren Holzpantoffeln mit hoch aufgeschlagenen Röcken näher heran.
»Vor a Stund is ‘s kemma, und hat gar it viel ziahg’n braucha, und i ho mir z’erscht denkt, i schick umi zu’n Wirt, aba nacha is an Tristl sei Knecht da g’wen, und nacha …«
»Ja, ja! Is scho recht …«
Er trat ins Haus und schlug die Türe hinter sich zu.