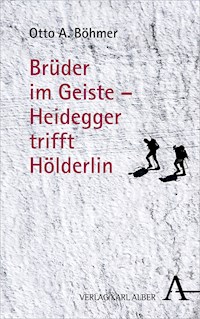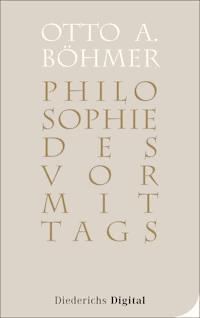3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Um die Liebe geht es in diesem Roman von Otto A. Böhmer, aber auch um die Selbstverliebtheit, um den Mut, der oft nur schwer zu haben ist, und um den treffsicheren, flügelleichten Spott. Ein Roman von hintersinnigem Witz und spielerischer Ironie. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 250
Ähnliche
Otto A. Böhmer
Der Wunsch zu bleiben
FISCHER E-Books
Inhalt
Für Christel
»Die tiefe Langeweile, in den Abgründen des Daseins wie ein schweigender Nebel hin- und herziehend, rückt alle Menschen … in eine merkwürdige Gleichgültigkeit zusammen.«
Martin Heidegger
Schwer ist der Mut
In der Geschichte, die hier erzählt werden soll, passiert nicht viel, und damit fügt sie sich ein in andere Geschichten, die in unserer Zeit erzählt werden, denn auch in diesen geschieht nicht viel. Es scheint so, als ob unsere Zeit für Geschichten nicht mehr viel hergibt; große Ereignisse finden hinter unserem Rücken statt und erscheinen dann, für uns zurechtgemacht, auf dem Bildschirm oder der Titelseite der Zeitung. Diese Nachrichten aber wirken auf uns seltsam unwirklich; wir nehmen sie zur Kenntnis, halten sie für wichtig und freuen uns dann, wenn wir den Sportteil der Zeitung lesen können oder aber ihre letzte Seite, die »Aus aller Welt« überschrieben sein mag. Hier erfahren wir dann Wissenswertes über Morde, Betrügereien, Eifersuchtsdramen, Explosionen, oder auch kurios Anmutendes wie etwa Mitteilungen über die krebserzeugende Wirkung von bayrischem Bier, ein neu entdecktes uraltes Verhütungsmittel aus der Inneren Mongolei oder die Bade- und Duschgewohnheiten des Mittelstandes.
Nun mag man einwenden, daß besonders die Mord-, Totschlags- oder Eifersuchtsmeldungen doch Geschichten sind, die vom Leben selbst geschrieben werden; das ist richtig, hat aber im Grunde mit uns, die wir behäbig die Zeitung lesen oder faul vor dem Fernseher sitzen, nicht viel zu tun, denn wir erfahren nicht alles, und so erzählt uns beispielsweise keiner die ganze Geschichte des aufsehenerregenden Mordes am Metzgermeister Paul Pressack in Oberaichach, – wir bekommen sie nur als dürre Meldung auf den Tisch und dürfen uns dann entsprechende Zutaten des Geschehens selbst ausmalen. Wir sind darüber nicht verwundert, denn von unserem eigenen Leben lassen sich auch nur in seltenen Fällen Geschichten erzählen, die andere dazu veranlassen könnten, genauer hinzuhören. Wir werden vom Alltag zugedeckt, und was wir zu berichten haben, atmet nicht den Geschmack von Freiheit und Abenteuer, sondern nur die milde, muffige Luft unserer alltäglichen Verrichtungen.
Und doch kann man nicht sagen, daß unser Alltag etwa ereignislos dahinplätschert; es passiert durchaus etwas, und was wir an täglichen Ereignissen vermelden können, hat seinen eigenen Reiz. Die Abenteuer des Alltags sind von eher zierlicher Gestalt; sie kommen weder aus der Kälte noch aus der Wärme, sondern schleichen sich unbemerkt heran, von irgendwoher, und sind dann auf einmal da und beanspruchen unsere ganze Aufmerksamkeit. In den alltäglichen Ereignissen durchqueren wir keine Wüsten, nehmen wir an keiner Verfolgungsjagd teil, kämpfen wir nicht mit einem Riesenhai vor einem Korallenriff oder werden gar zu Marshalls von Dodge City ernannt, sondern wir haben es mit kleinen Erlebnissen zu tun, die uns herausfordern und nach einer Antwort verlangen, ohne unsere alltägliche Vorstellungswelt so durcheinanderzubringen, daß wir ganz und gar verwirrt würden.
Intensivere dieser Erlebnisse allerdings können uns zuweilen aus der Bahn werfen, und der Alltag erscheint uns dann gar nicht mehr als Alltag. Wenn wir beispielsweise einen Unglücksfall erleben, kann es sein, daß alles, was bislang gegolten hat und wichtig war, auf einmal hinfällig und unbedeutend wird, und wir verlieren den Boden unter den Füßen. Auf der anderen Seite kann es auch sein, daß wir besonders glücklich sind, wenn wir Glück haben; ein Ereignis dieser Art ist für uns etwa jener Zustand, den wir als Verliebtsein oder auch als Liebe kennen. In einem solchen Glücksfall sieht der Alltag für uns plötzlich ganz anders aus, obwohl er sich an sich gar nicht verändert haben mag. Wir sind bis an den Rand unseres Kopfes voll mit Gefühl, und wir haben Spaß daran, die lächerlichsten Kleinigkeiten mit ernster Würde anzunehmen und die erhabenen Dinge in überschäumendem Lachen untergehen zu lassen. Kurzum, wir sind verliebt, und alles andere zählt für uns nicht mehr. Später wird auch unsere keineswegs ungewöhnliche Geschichte von einem solchen alltäglichen und doch einzigartigen Abenteuer wie der Liebe berichten.
Zunächst aber verfolgen wir, die wir ohnehin alles besser wissen, die seltsam, träge, ja leidenschaftslos anmutenden Bemühungen unseres Helden, mit dem erdrückenden Gleichmaß des Alltags zurechtzukommen und der schwierigen Aufgabe, nur zu leben, gerecht zu werden. Da unser Held den eigenen »kreisenden« Gedanken nachhängt wie andere Leute ihren Träumen, vollziehen sich diese Bemühungen nicht ohne gewisse hellsichtig-resignierende, spöttische Gelassenheit, die allerdings nicht darüber hinwegtäuschen kann, daß seine Weltsicht in einem selbstgezimmerten Gefühls- und Gedankenverschlag ausgebrütet wurde, in dem sie sich, oft sogar wider besseres Wissen, zu genügen scheint und immer wieder in einer trügerischen Ruhe versinkt, die näher am Schlaf ist, ja vielleicht am Tode als am Leben.
Unser Held ist auf der Suche: »Es ist, vordergründig gesehen, die Frau meines Lebens, nach der ich suche, ziellos, ruhig, verzweifelt und oft auch bewundernswert gleichgültig. Um diese Frau geht es und noch um soviel mehr, nämlich um jene warme Kraft, die mein großer Kollege Adalbert Stifter ›das sanfte Gesetz‹ genannt hat. Was ist das sanfte Gesetz? Vielleicht das Geheimnis des Lebens, das sich den Lebenden nicht, eher noch den Toten ablauschen läßt. Um dieses sanfte Gesetz, das ich noch nicht kenne, geht es, und mein einfältiger Gedanke ist, daß die Frau meines Lebens eine, und wenn auch nur die erste, Tür dorthin öffnen kann. Der dunklen Worte karger Sinn: Diese Frau muß her, auch wenn es sie wahrscheinlich gar nicht gibt … Trotzdem bin ich überzeugt davon, daß sie, die am besten zu mir paßt, schon längst irgendwo, ohne es zu wissen, wartet. Nur ist die Wahrscheinlichkeit, daß sie mir über den Weg läuft und wir uns dann ebenso zufällig auch noch kennenlernen, denkbar gering!«
Errörterungen dieser Art trägt unser Held gerne vor, und er sieht dabei nicht unglücklich aus. Die Sehnsucht nach der Frau seines Lebens hat ihn noch nicht verzehrt, und wenn er lacht, zieht sich sein rundes Gesicht um die schmalen Augen herum zusammen, die dann kaum noch zu sehen sind, so als ob ein solches Lachen für sie fast schon zuviel sei. Tatsächlich lacht er auch nicht oft, und er sagt von sich: »Im Grunde bin ich ein Kauz, ein seltsamer Vogel, tagscheu und träge, – ein Griesgram, der kaum jemals recht fröhlich sein kann.« Das aber ist zumindest übertrieben, denn unser Held ertappt sich des öfteren dabei, daß er sich wohlfühlt und sogar gute Laune hat, und diese Feststellung macht ihn dann mißmutig, denn wirkliche Fröhlichkeit paßt nicht zu dem Bild, das er mit den Jahren von sich selbst zurechtgeschnitten hat. So kommt es immer wieder vor, daß er sich zur Schwermut mahnt, denn er will nicht, daß er anders werden könnte, anders, als er nun mal glaubt sein zu müssen. Er stellt das sachlich fest, und doch kann er sich nicht so ganz ernst nehmen, wenn er von seinen Depressionen spricht, die er so nennt, weil er keine andere Bezeichnung dafür weiß, außer eben jenem schönen alten Wort Schwermut, das in sich schon soviel anklingen läßt von dem, was in einem Menschen vorgeht, der sich seiner wiederkehrenden Traurigkeit kaum erwehren kann.
»Ich neige zu Depressionen«, sagt unser Held, »denn schwer ist der Mut, der schwere Mut, nur zu leben. Und darum geht es, um das Leben, das wir leben müssen vor dem Sterben. Noch aber kann ich mich und meine Welt in Frage stellen: Die große, viel zuwenig bekannte Kategorie der ›Selbstverarschung‹, die existentiell so wichtig, so wegweisend ist, sie liegt mir am Herzen, zumal diese Kategorie – ein Kollege hat es bislang nur erkannt – gerade auch literarisch noch weitgehend ungenutzt ist«, und Hölzenbein hat seinen Spaß dabei, wenn solche »Sprüche« – so nennen seine Freunde Bemerkungen dieser Art – im Gespräch immer wieder auf freundlich-respektvolles Unverständnis stoßen. Er leidet an sich selbst, aber er bleibt dabei behutsam, spöttisch und realistisch: »Es ist alles nicht so schlimm«, sagt er, »das wirkliche Leid findet man ganz woanders … Leute wie ich haben zuviel Zeit, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Sie schauen auf ihre kleinen Wunden, die sie sich womöglich noch selbst geschlagen haben, und sehen dann nicht mehr, wo die eigentlichen Probleme dieser Welt liegen!« (»Das ist im Grunde eine Unverschämtheit den Menschen gegenüber, denen es wirklich dreckig geht«, fügt er zufrieden hinzu, und er ist dabei auf distanzierte Weise gerührt über sich selbst.)
So hat er sich im Laufe der Jahre ein Weltbild zurechtgelegt, in dem er bescheiden und mit Abstand zu den Menschen und Dingen den Mittelpunkt einnimmt. Dieses Weltbild hat sich bewährt, wenn man die Tatsache, daß er mit ihm bislang durch die Jahre gekommen ist, schon als Beweis dafür nehmen will, daß es auch tatsächlich in sich stimmig war und eine unwiderlegbare Bedeutung für ihn besaß: In einem kleinformatigen, aber dickleibigen grünen Buch hat er einmal notiert: »Distanz zu sich – Distanz zu den Dingen!« und »Selbstbewußt bis an die Grenzen der Bescheidenheit …«. Er schreibt in dieses Buch seine hauseigenen »Reflexionen«, – Sätze, die sich mit Gott und der Welt »aus der Sicht eines trotzigen Menschen« beschäftigen und die neben einer gewissen Gespreiztheit oft auch Streiflichter einer gediegenen, schwerfälligen Originalität zu erkennen geben. Allerdings ist es nicht so, daß Bernd Hölzenbein – so heißt nämlich der Held unserer Geschichte – nun tagein, tagaus an seinem Schreibtisch sitzen würde, um seine mehr oder weniger geschliffenen Sentenzen in sein Buch zu bringen, sondern er befleißigt sich hier – wie auch in den meisten anderen Dingen – einer sehr unregelmäßigen, um nicht zu sagen schleppenden Arbeitsweise, mit der er, wie er selbst sagt, »noch nie viel geschafft« hat.
Bernd Hölzenbein heißt unser Held – so war eben zu hören –, und nicht wenige unserer Leser werden nun vielleicht sagen: »Den Namen hab’ ich doch schon einmal gehört!?« Die Fußballkundigen denken sofort an einen überaus listenreichen, ehemaligen Nationalspieler der Frankfurter Eintracht, der in der Sportpresse gerne als »Schlitzohr« und »Fuchs« apostrophiert wurde, und in der Tat trägt der Held unserer Geschichte den Namen dieses Fußballspielers. Dafür kann er natürlich nichts, – genauso wie die ungezählten Zeitgenossen, die Fritz Walter heißen, nichs dafür können, daß sie den Namen des verdienstvollen Ehrenspielführers der deutschen Fußballnationalmannschaft tragen.
Unser Bernd Hölzenbein hat im übrigen vom Äußeren her keinerlei Ähnlichkeit mit seinem berühmten Namensvetter, aber da er Fußballfreund und zudem noch Anhänger der Frankfurter Eintracht ist, hat er die Spielkünste des Bernd Hölzenbein von jeher bewundert. »Seine Spielweise ist eine Freude für Auge und Gemüt«, sagt er, »gerade in einer Zeit, in der die stumpfsinnigen Balltreter und ungehobelten Kollektivbolzer immer mehr die Szene beherrschen!« Viele Spiele der Frankfurter Eintracht hat er schon besucht, seitdem er in der Stadt am Main wohnt, die von vielen als chaotisch bezeichnet wird, und er ist einer jener Anhänger dieses Vereins, die schon seit Jahren Wechselbäder der Gefühle durchmachen müssen, weil die Genialität des spielerischen Anspruchs (»Von ihren Möglichkeiten her ist die Eintracht die beste Mannschaft Deutschlands!«) sich immer wieder nur mit schmerzhaften Bauchlandungen in die spielerische Wirklichkeit umsetzen läßt. Aber daran hat er sich gewöhnt, und doch ärgert er sich immer noch, wenn »seine« Mannschaft gegen eine »Bauernmannschaft« wie Hertha BSC oder Leverkusen 04 verliert. Er ärgert sich oft sogar so sehr, daß ihm samstags ab 17.15 Uhr, wenn der Bundesligaspieltag beendet ist und die Ergebnisse feststehen, das ganze Wochenende verkorkst erscheint, weil die Eintracht einmal mehr eine absolut unnötige Niederlage eingefangen hat. Hölzenbein weiß, daß es »albern« ist, sich über die Ausrutscher seines Fußballvereins zu ärgern, er weiß es und er ärgert sich daher nur noch mehr, obwohl er sich »immer wieder zur Ordnung ruft«, das allerdings zumeist ohne Erfolg, und so setzt ihm dieser eher komische Ärger zu wie ein störrisches Haustier, und Hölzenbein nimmt ihn an, mißmutig, übellaunig und ausgestattet mit einem besseren Wissen.
An diesem Samstag, an dem wir uns unserem Helden zum ersten Mal (unbemerkt) nähern, ist es sonnig, und am Himmel tanzen ein paar helle Wolken, so als wollten sie sich über die ganze Stadt lustig machen. Die Frankfurter Eintracht spielt heute im heimischen Waldstadion gegen den 1. FC Kaiserslautern, und Hölzenbein, der schon länger nicht mehr »zum Fußball« gegangen ist, hat die Absicht, dieses Spiel zu besuchen.
Was uns zu schaffen macht
Die Wohnung ist groß, und man vermutet, daß hier mindestens zwei Menschen wohnen. Die Räume sind fast vier Meter hoch; »richtige kleine Hallen, sagen manche Leute und weisen darauf hin, daß man sich in solchen hohen Zimmern doch verloren vorkommen muß.« Hölzenbein sieht das anders, und obwohl er sich des öfteren tatsächlich verloren vorkommt, bestreitet er auf das entschiedenste, daß seine wiederkehrende Einsamkeit mit der großen hohen Wohnung zu tun haben könnte. »Natürlich haust man in so einer Hütte nicht freiwillig allein«, sagt er, »aber es dürfte ja bekannt sein, daß in dieser Wohnung bis vor einiger Zeit noch zwei Menschen gewohnt haben. Daß ich jetzt – keineswegs freiwillig – allein hier lebe, ist also ein Kapitel für sich!« In der Tat hatte Hölzenbein bis vor etwas weniger als drei Jahren »eine feste Liebesbeziehung«, und eines Tages war er mit Hannah, seiner Freundin, in diese große Wohnung gezogen. Zuvor hatten sie zwei Jahre lang in einer kleinen Atelierwohnung im Osten der Stadt gewohnt. Als sich in der kleinen »Hasenhöhle«, wie Hölzenbein und seine Freundin ihre damalige Wohnung nannten, immer mehr Bücher, Platten, Blumentöpfe und andere sperrige Gegenstände ansammelten, beschloß man, sich eine große Altbauwohnung zu suchen. In diesem Zusammenhang war auch von Heirat die Rede, denn die zärtliche Freundschaft schien sich bewährt und eher noch gefestigt zu haben. Warum also nicht heiraten, sagte sich Hölzenbein, wenn man seiner Sache sicher ist und vielleicht auch irgendwann einmal Kinder haben will.
Eine schöne Altbauwohnung wurde überraschend schnell gefunden; man zog um, lebte ein halbes Jahr in der neuen Wohnung, und an der Grundlage ihrer Liebe schien sich nichts zu ändern. Dann zog Hannah aus. Sie hatte sich, ohne daß Hölzenbein etwas merkte, in einen gemeinsamen Freund verliebt, den er eigentlich nie so recht hatte ernst nehmen können.
Der Abschied war so abrupt wie die Trennung, und Hölzenbein ging wochenlang durch die hohen, halbleeren Räume, weinte ab und zu, starrte düster vor sich hin, trank Whisky, nahm Valium, weinte danach wieder und sagte dann eines Tages: »Jetzt bin ich über’n Berg!«, was nicht stimmte.
Da ihm jede praktische Lebensbewältigung aber zutiefst zuwider war, versetzte ihn der bloße Gedanke, schon wieder umzuziehen, in Panik, und er beschloß, in der großen Wohnung, die ihm mit ihren Dämmerfarben und den winkligen Wegen schon ans Herz gewachsen war, zu bleiben. Finanziell schien das machbar, ohne daß überproportionale Einschränkungen nötig waren. Hölzenbein blieb also in seiner Wohnung, und je länger er dort wohnte, desto mehr konnte er ihre unbestreitbaren Vorzüge genießen: die Ruhe, den für Frankfurter Verhältnisse fast idyllischen Blick in einen kleinen Park, in dem die Baumkronen bei Wind sich ineinanderschoben, und die Möglichkeit, seine geliebte Rockmusik so laut zu hören, wie er wollte. Seine Vermieterin, eine ältere Dame, war diesbezüglich von ungewöhnlicher Toleranz und behauptete stets, die dröhnenden Musikwellen aus der Wohnung unter ihr kaum zu hören. So war Hölzenbein im Laufe der Zeit ein inniges Verhältnis zu seiner Wohnung eingegangen, ein Verhältnis, das sich als haltbar erwies, was man von seinen Liebesbeziehungen nicht sagen konnte.
Die Tatsache, daß Hannah ihn verlassen hatte, sang- und klanglos, ohne sich der Mühe zu unterziehen, ihm die tieferen Gründe dafür auseinanderzusetzen, machte ihm mehr zu schaffen, als er wahrhaben wollte, und manchmal dachte er, daß er nicht mehr in der Lage sein würde, eine neue, »eine langanhaltende, tiefe Liebe« zu erleben und zu »durchstehen«. Dieser Gedanke besaß in seiner unabwendbaren Kälte auch etwas lustvoll Tröstendes, und Hölzenbein war beim Nachdenken über seine auserwählte Einsamkeit oft genug gerührt über sich selbst. In letzter Zeit allerdings hatte er sich nicht mehr so sehr darauf konzentriert, »eine oder gar die Frau zu finden«. Die standhafte, eigenwillige Sehnsucht nach Zärtlichkeit, nach Wärme, nach einer Vertrautheit, die bei ihm blieb, unerschütterlich, trotzig, diese Sehnsucht war geblieben, aber – der »alte Schwung« schien dahin zu sein. »Ich bin müde und alt geworden«, sagte er und freute sich, wenn seine Zuhörer wieder einmal nicht so recht wußten, ob er eine Bemerkung wie diese ernst meinte oder nicht.
Hölzenbein ist also zur Zeit wieder mehr als früher »bei sich selbst«, und es gelingt ihm ansatzweise, so zu leben, wie es seinen matten Bedürfnissen entspricht. Im Moment sitzt er in der Küche am Frühstückstisch und liest eine Zeitung. Er leistet sich den Luxus, zwei Zeitungen abonniert zu haben, die Frankfurter Rundschau und die FAZ. Letztere liest er aus beruflichen Gründen, »wegen des Feuilletons«, aber er hat vor einiger Zeit »mit Genugtuung« festgestellt, »daß auch der Sportteil der FAZ wesentlich besser geworden ist«. Die Frankfurter Rundschau entspricht seiner »linksliberalen Grundeinstellung«, und da er sich noch als »Weggenosse der Studentenbewegung« sieht, der er Anfang der siebziger Jahre, wenn auch nicht als emsiger Akitivist, angehörte, hält er es heute, mit dem Abstand eines Jahrzehnts, für wichtig, daß »demokratische Einzelinstitutionen« wie die Frankfurter Rundschau oder auch die Büchergilde Gutenberg durch ein Abonnement bzw. die Mitgliedschaft unterstützt werden. Dabei stuft er sich im Grunde als »unpolitisch« ein, worüber später vielleicht noch mehr zu sagen sein wird; »in einer Zeit aber, in der Freiheitsrechte immer mehr bedroht werden und anonyme Apparate in die Entscheidungen der Menschen eingreifen«, erscheint es Hölzenbein unbedingt erforderlich, »daß man weiß, wo man steht«, und das ist für ihn, »in Anlehnung an ein Tucholsky-Wort«, von jeher »links, wo das Herz schlägt!«
Der Frühstückstisch in der Küche ist reichhaltig gedeckt: Auf einem großen, runden Brett liegen vier verschiedene Käsesorten, Salami, Schinken, Leberwurst, und daneben stehen noch drei Gläser, die Pflaumenmus, Erdbeer- und Aprikosenmarmelade enthalten. Hölzenbeins Frühstücksteller ist krümelübersät, und einige hängen auch in seinem Bart. Es scheint, als sei Schmalhans bei ihm nicht der Küchenmeister. Aber das Frühstück ist für ihn die wichtigste Mahlzeit, und am Wochenende hat er die Zeit dafür, die er unter der Woche nicht aufbringen kann. So ist der Frühstückstisch dann immer gut gedeckt, und es gibt diverse Brötchen, die Hölzenbein bei einem Bäcker um die Ecke holt.
Man könnte vermuten, daß unser Held zur Dicklichkeit neigt, da das gute Essen doch einiges für ihn zu bedeuten scheint, aber das ist eigentlich nicht der Fall. Er hat zwar ein rundes Gesicht, das von einem Bart umrahmt wird, und würde man nur sein Gesicht betrachten, könnte man ihn tatsächlich für rundlich halten, aber am Körper selbst ist er schlank, – bei einer Größe von knapp 1,90 m wiegt er um die achtzig Kilo, ein Gewicht, das ihm »angemessen« erscheint, auf das er allerdings ständig achten muß, da er schnell zunimmt, wenn »ich mich gehen lasse«.
Hölzenbein ist kein schöner Mann, aber er sieht insgesamt nicht uninteressant aus. Besonders sein rundes Gesicht, mit einer breiten Nase unter kleinen Augen und zackigen Augenbrauen, wirkt auf eine kuriose Weise ansehenswert, und nachdem er früher immer aussehen wollte »wie Robert Redford«, hat er sich heute mit seinem Aussehen abgefunden und investiert dabei sogar kleine Portionen an Eitelkeit. Hölzenbein ist 33 Jahre alt und somit etwa ein Jahr jünger als sein berühmter Namensvetter. Das Alter als solches ist für ihn ein Problem, wobei er nicht sein »konkretes« Alter meint, sondern »den allgemeinen und leeren Ablauf der Zeit«. »Wir werden alt«, sagt er, »und wir geben die Stunden und Tage wehrlos aus der Hand. Dabei ist die Zeit vielleicht nur das Bild der Ewigkeit, der Kollege Plotin hat das einmal gesagt, und wenn sie das wäre, dann würden wir selbst uns nicht nur die Zeit, sondern auch die Ewigkeit vertreiben, die Ewigkeit, an der wir mit jedem müden Schlag unseres Herzens teilhaben wie weitgereiste Pilger, an die man das Wort richtet.«
»Wenn wir dem Geheimnis der Zeit auf die Spur kommen«, sagt Hölzenbein pathetisch, »dann können wir das Geheimnis des Lebens entschlüsseln, dann wissen wir, warum wir leben, um zu sterben«, und natürlich kann er nur selten ganz ernst bleiben, wenn er sich so oder ähnlich »zu den wiederkehrenden Fragen unserer irdischen Befindlichkeit« äußert; – tatsächlich aber ist das Problem der Zeit und damit auch das des Alterns eine Frage, die ihn schon immer bewegt hat.
Sein eigenes Alter nimmt er inzwischen »fast gelassen« an, und obwohl ihn immer noch Bilder von Hinfälligkeit und Schmerz, von Hilflosigkeit, Verfall und vollendeter Schwäche heimsuchen, die auch durch den Anblick alter Menschen hervorgerufen werden, berührt ihn die brüchige Sicherheit, alt werden zu müssen oder frühzeitig zu sterben, nicht mehr so sehr. »Es kommt, wie es kommen muß, sagen die Leute«, und Hölzenbein kann sich dem nur anschließen, denn ein solcher Satz steht mit seiner eigenen, behäbigen Weltsicht durchaus im Einklang. »Ich glaube an Schicksalsfäden, die niemand knüpft, an folgenschwere Begegnungen, die keiner arrangiert, und an den eine geheimnisvollen Weltenlenker, den es gar nicht geben kann«, sagt er und freut sich an diesem Ausspruch, der »ebenso wahr wie belanglos« ist.
Gerade hat Hölzenbein sein viertes Brötchen verspeist, und er fühlt sich übersatt und bewegungsunfähig; Müdigkeit kriecht in ihm hoch.
Er liest die Bekanntschaftsanzeigen in der Frankfurter Rundschau, und sein Interesse hält sich dabei in Grenzen. Bis vor einem halben Jahr etwa war das Studium dieser Annoncen noch eine seiner wichtigsten Wochenendbeschäftigungen, der er mit Hoffnung und Schwung nachging. Zweimal hat er selbst eine Anzeige aufgegeben, – mit gutem Erfolg, wenn man die Tatsache, daß in beiden Fällen jeweils eine Freundschaft zustande kam, als Erfolg werten will.
Danach schrieb er nur noch auf Anzeigen, die ihm gefielen, und auch dabei kam es zu der einen oder anderen »Liebelei«, die meist »kurz und heftig« war, um dann »freundschaftlich auszuklingen«. Aus Bequemlichkeitsgründen benutzte Hölzenbein einen Standardtext, wenn er auf eine Anzeige reagierte; er fand, daß eine Zuschrift, die einmal erfolgreich gewesen war, sich bewährt hatte, und man deshalb zweckmäßigerweise auf sie zurückgreifen sollte.
Inzwischen aber hat sein Interesse für die an jedem Wochenende abgedruckten »leisen Rufe aus der Einsamkeit« nachgelassen. »Diese Art, sich kennenzulernen, ist zwar legitim, aber auch sehr anstrengend!« sagt Hölzenbein. »Da ist nichts Spielerisches mehr mit im Spiel. Bierernst geht man aufeinander zu und fährt sofort schweres Geschütz auf. Die geheimen Absichten, die man hat, sind alles andere als geheim, und selbst wenn man das Ganze locker aufzieht, weiß doch der andere, daß er jemandem gegenübersitzt, der auch auf der Suche ist.« »Diese Art des Kennenlernens hat mich zum Schluß nur noch überanstrengt«, sagt Hölzenbein, »und ich sehe mich im Moment nicht mehr in der Lage, bei den wöchentlichen Anzeigenläufen mit an den Start zu gehen!« Und er setzt hinzu: »Dabei spricht eigentlich alles dafür, daß ich auf diese Angebote, die man in der Zeitung vorfindet, angewiesen bin, denn zurückgezogen, wie ich nun mal lebe, habe ich sonst ja kaum irgendwelche anderen Möglichkeiten, die vielzitierte Frau meines Lebens kennenzulernen! Traurig aber wahr, und so halte ich mich weiter daran, daß ich mit der Einsamkeit, meiner kalten, aber treuen Freundin, ein lieblos-leidenschaftliches Verhältnis pflege, das so lange halten wird, bis ich dereinst einmal den Löffel abgeben muß.« Es mag seltsam anmuten, wie Hölzenbein redet, zugegeben, aber so redet er nun mal: »Ich bin ein Feuilletonist von Format, ein Meister der kunstvoll gedrechselten leeren Sätze«, sagt er von sich, »und ich trage mich mit der Last meiner Gedanken, die ich mit mir führe wie ein kleines handliches Reiseklavier. Hineingreifen kann ich in meine stets verfügbare, hauseigene Aphorismen-Sammlung: in ihr liegen Sentenzen bereit, die den Nerv der Weltproblematik wie beiläufig treffen, – Wahrheiten, federleicht und schwerverdaulich, kritisch, genau und auf sympathische Weise belanglos!«
Hölzenbein rülpst laut und freut sich daran, daß ein Bäuerchen in diesen hohen Räumen eindrucksvoll hallt. Schwerfällig erhebt er sich und legt die verschiedenen Teile seiner Zeitung zur Seite. Er schenkt sich noch eine Tasse Tee ein und beginnt dann, den Frühstückstisch abzuräumen. Jetzt ein Mittagsschläfchen, denkt er, Ruhe finden, hinüberdämmern in das ganz andere Land. Wenn er am Wochenende frühstückt, weitet sich diese Mahlzeit oft zu einer anstrengenden Sitzung aus. Fast ein wenig verkrampft hockt er auf seinem Stuhl, freut sich an dem reichgedeckten Tisch, blättert in seinen Zeitungen, wobei er sich auf die Sportseiten, das Feuilleton und die Bekanntschaftsanzeigen konzentriert, ißt ein Brötchen nach dem anderen und ruft »die verschüttete Schaffenskraft« in sich auf den Plan, die nicht kommen will, und er ermahnt sich, energisch sein »Tagwerk zu beginnen«.
Der Gedanke aber, energisch sein zu müssen, etwas schaffen zu wollen, macht ihn immer sehr schnell müde, und der Versuchung, dem ausgedehnten Frühstück noch »ein Mittagsschläfchen anzuhängen«, kann er nur selten widerstehen. Hölzenbein aber ist trotz seines Phlegmas ehrgeizig, er hält sich – »zum Erstaunen meiner Freunde« – für einen begabten Schriftsteller. Veröffentlicht aber hat er außer ein paar kleinen Aufsätzen und »einem schmalen, spätexpressionistisch wirkenden Gedichtband« noch nichts, und das ist, wenn man so will, sein Dauerproblem. »Meine urwüchsige Trägheit«, sagt er, »gereift mit den Jahren, läßt die Feder in meiner Hand, die so viel Bedeutendes zu Papier bringen könnte, immer wieder stocken. Welch ein Verlust für die denkenden Menschen, welch ein Verlust für uns alle, die wir guten Willens sind!«
Die Frage, ob Hölzenbein wirklich ein begabter Schriftsteller sein könnte, werden wir in unserer Geschichte nicht beantworten – es steht uns darüber auch gar kein Urteil zu, obwohl wir natürlich alles besser wissen –, aber von seinen Bemühungen und Überlegungen, etwas zu schreiben, wird im folgenden noch öfter die Rede sein.
Nachdem er den Frühstückstisch abgeräumt hat, geht er in eines seiner beiden großen Wohnzimmer, die durch eine Schiebetür voneinander getrennt sind. In dem einen Raum, der gelb gestrichen ist, stehen an den Wänden Bücherregale, die mehr als zwei Meter hoch sind. Da kaum noch Platz in den Regalen ist, hat Hölzenbein die Bücher zum Teil zweireihig untergebracht, »in vorderer Front die Titel für das staunende Publikum, in zweiter Reihe der gehobene Mist«. Andere Bücher liegen kunstvoll ungeordnet übereinander. Ein System, nach dem etwa eine geheimnisvolle Ordnung in das Lesematerial gebracht worden wäre, ist nicht zu erkennen.
In dem zweiten Raum, der dunkelbraun mit hellen Abstufungen gestrichen ist und in der Mitte der Decke eine weiße Stukkatur zeigt, befinden sich in einem etwas wacklig aussehenden Regal Hölzenbeins Schallplatten und die nicht mehr ganz moderne Stereoanlage, bestehend aus Steuergerät, Plattenspieler und zwei Boxen, von denen nur eine im Regal steht, während die andere in einer angemessenen Entfernung an der Wand hängt. Auf den beiden obersten Ablageflächen des Regals stehen etliche Flaschen, die Köstlichkeiten wie Whisky, Cognac, Rum, Calvados, Ouzo, Vermouth enthalten. »Die Flaschen habe ich so hoch hinaufgestellt, damit sie schwer erreichbar sind«, sagt Hölzenbein, »wissen meine Freunde und ich doch, daß ich latent alkoholgefährdet bin, was mich allerdings nicht prinzipiell daran hindert, zu der einen oder anderen Flasche zu greifen, wenn mir der Sinn danach steht.«
Er legt eine Platte auf, ›Watch‹ von Manfred Mann’s Earthband, die zu seinen »Lieblingsscheiben« gehört, und geht dann, während die Musik laut und vertraut an ihm vorbeizieht, in seinen Wohnräumen auf und ab. Das ist eine seiner Lieblingsbeschäftigungen; »väterliches Erbteil«, sagt er, »mein Vater ist auch immer wie ein alter kranker Tiger in seinem Käfig auf- und abgegangen! Das Auf- und Abgehen ist Ausdruck unserer existentiellen Ruhelosigkeit. Geworfen in eine Welt, in die wir nicht wollten, können wir nicht fliehen, aber wir versuchen es immer wieder und müssen dann umkehren, mitten im Leben, mitten auf unserem Weg. So gehen wir auf und ab, weil wir weder vor noch zurück können. Am Anfang und am Ende unseres Weges ist das große Dunkel«. So spricht er, aber Sätze wie diese erheitern ihn selbst, während andere Leute sie zuweilen annehmen, als seien es »Nachrichten aus dem uralten Land der Weisheit«.
Vor den Fenstern neigen sich die Bäume im Wind. Durch den kleinen Park, der ›Gemeindegarten‹ genannt wird, kommen und gehen Menschen, manche schwerbepackt mit Taschen und Tüten; Samstagmittag, da müssen die letzten Einkäufe für das Wochenende erledigt werden. Der Himmel ist hell und sonnig, Lichtstreifen tanzen durch das Blattwerk, und ein Eichhörnchen flitzt am Stamm in eine Baumkrone hinauf.
Im Spessart, im Taunus oder im Odenwald könnte heute Fernsicht sein, denkt Hölzenbein. Herbstfarben schmücken das gequälte Land, nie ist das Licht so klar und sanft, aber auch schon so todkrank wie im Herbst. Danach kommt dann die schwere Düsternis des Winters, die Kälte der Tage und Nächte. »Diese Jahreszeit mit ihrer geborgten Hoffnunglosigkeit ist wie für mich geschaffen«, sagt Hölzenbein, »naßkalte oder klirrende Frosteinsamkeit, das Element, aus dem tragische Denker wie ich schöpfen. Und außerdem kann man schön früh ins Bett, die Decke über die Ohren ziehen und sich am eigenen Mief erwärmen!«
Hölzenbein, der weiter auf- und abgeht und inzwischen eine Platte von ›Bob Marley and the Wailers‹ aufgelegt hat, denkt daran, daß er seinen Jahresurlaub noch vor sich hat. Nach der Buchmesse will er drei Wochen auf die Insel Amrum fahren, ein »Eiland, das mir ans Herz gewachsen ist«. Immerhin war er schon dreimal auf dieser kleinen nordfriesischen Insel, vor Jahren einmal mit Hannah, sonst aber immer allein, und wenn er von der Nordsee erzählt, vom Watt oder dem weiten grünen Land und den rauhen Winden, dann bezeichnet er sich gern als einen »treuen Freund des deutschen Nordens«. Schon immer wollte er nach Hamburg oder Bremen ziehen, aber beruflich gab es bislang dort keine Möglichkeiten für ihn, und so mußte er »wohl oder übel, aber inzwischen auch mit einer gewissen Identifikation« in Frankfurt bleiben.
Sein Wunschtraum war und ist es, »als geachteter und vielleicht auch belächelter Poet auf einer Nordseeinsel meine Tage zu beschließen, umgeben von der Einsamkeit meines Schaffens, dem Gleichmaß des Meeres, unberechenbaren Winden, zwei oder drei wohlgeratenen Kindern und einer ebenso wohlgeratenen Frau, die mich liebt und vielleicht noch ein bescheidenes Vermögen ihr eigen nennen sollte, an dem ich großherzig bereit wäre mitzuzehren.« Ein schöner Wunschtraum zweifelsohne, und Hölzenbein träumt ihn weiter, »gelassen, konsequent und daher auch realistisch. Mit anderen Worten: Ich glaube nicht daran, nicht ernsthaft jedenfalls, daß er Wirklichkeit wird, aber das Träumen als solches ist schon wichtig. Was wären wir ohne unsere Träume? Hang on to a dream!«
Durch den kleinen Park gehen die ersten Fans in Richtung S-Bahnstation, man sieht schwarzweiße Schals, schwarzweiße Mützen, Jeansjacken mit dem ›Eintracht-Adler‹. Gesänge ertönen, die von rhythmischem Klatschen begleitet werden.