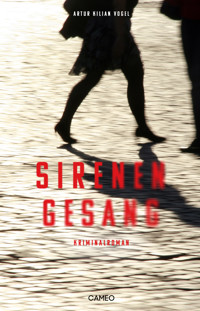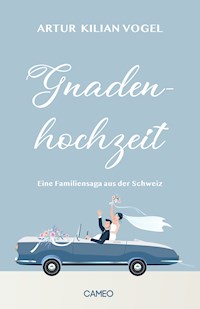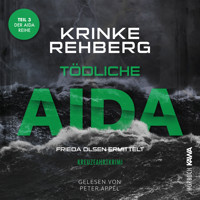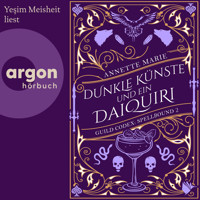24,99 €
Mehr erfahren.
Nach fünfzehn Jahren hat ihn seine Freundin Sidonie verlassen. Strittmatter sitzt an einem Novemberabend des Jahres 2013 nach Redaktionsschluss allein in den abgedunkelten Räumen der Zeitung, deren Chefredaktor er ist. Am selben Tag ist seine berufliche Existenz zerstört worden: Der Verlag wird das Blatt nach 181 Jahren einstellen, weil es nicht mehr rentiert. Strittmatter, fast 63 Jahre alt, fühlt sich wie ein Hund, den man am ersten Urlaubstag am Strassenrand ausgesetzt hat. Er lässt sein Leben an sich vorbeiziehen. Lena taucht auf: Seine erste große Liebe, die Anfang der 1970er-Jahre mit einem Knall zerbrach. Der Bürgerkrieg im Libanon. Politische Wirren und Massensterben im Sudan. Amy, 1970. Seine Erinnerungen gibt Strittmatter in der Ich-Form wieder. Wo die Erzählung in die Gegenwart schwenkt, kommt ein anonymer Erzähler aus dem Off zum Einsatz.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 280
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Artur Kilian Vogel
Der Zeitungsmann,dem die Sprache verloren ging
Roman
CAMEO
Copyright © 2021 Cameo Verlag GmbH, Bern Alle Rechte vorbehalten. Der Cameo Verlag wird vom Bundesamt für Kultur für die Jahre 2021–2024 unterstützt. Lektorat: Susanne Schulten, Duisburg Umschlaggestaltung: André De Carvalho, Cameo Verlag GmbH, Bern Layout und Satz: Rafael Schlegel, Cameo Verlag GmbH, Bern ISBN: 978-3-906287-90-4
1
«Du blutest», schreit Sidonie.
Diese Sequenz spult sich in seinem Kopf immer wieder ab. Manchmal im Zeitraffer. Manchmal in Zeitlupe. Einmal verschwommen, wie wenn sie der weiße Rauch der Tränengasgranaten vernebelt und weichgezeichnet hätte, denkt er. Dann wieder klar und tiefenscharf. Zwei Menschen liegen auf dem Asphalt, ein Paar. Er ist verletzt; sie ist außer sich.
Die Szene spielt im Oktober des Jahres 2000 in Ramallah, der provisorischen Hauptstadt des provisorischen Palästinenserstaates.
Neben ihnen schlägt ein Mann dumpf auf den Boden auf. Er trägt eine zerrissene, offene Steppjacke, darunter ein T-Shirt mit einem Bild von Michael Jackson und dem «Thriller»-Schriftzug.
Strittmatter sitzt im abgedunkelten Büro vor dem Bildschirm, auf dem sich eine Nackte räkelt. Doch er ist nicht bei der Sache. Er ist bei Sidonie. Sidonie, wieso zum Teufel hast du mich aus deinem Leben ausgeblendet?
Wieder schreit Sidonie. Lauter, um den Lärm der Waffen und das Geschrei der Verletzten zu übertönen: «Du blutest!»
Ein dumpfer Schlag gegen den Arm hat mich gefällt; Sidonie hat sich neben mich hingeworfen. Wir liegen Gesicht an Gesicht, ganz nah, aber ohne einander zu berühren. Sie auf dem Bauch, die Kamera weit von sich gestreckt, ich auf dem Rücken, zwischen uns ihre schwarze Fototasche. Ich zittere und bin wütend. Ein Scheißjob! Sein Leben aufs Spiel setzen für einen Zeitungsartikel; den Tod riskieren für eine Schlagzeile. Schwachsinnige Idee! Dass mir meine Sterblichkeit so drastisch in Erinnerung gerufen wird, macht mich fassungslos. Und Sidonie, Sidi, habe ich hineingeritten in dieses Schlamassel.
Ihre Stirn ist geschwärzt vom öligen Qualm der brennenden Autoreifen. Unter dem Ölfilm ist sie blass wie eine nachlässig grundierte Leinwand, noch blasser als sonst, eine schwärzlich transparente Maske auf weißem Grund. Und sie schwitzt. Eigentlich schwitzt Sidonie nie. Nicht in der größten Hitze. Auch nicht im Stress.
«Und du schwitzt», antworte ich und schäme mich, sobald er gesagt ist, für die schiere Idiotie dieses Satzes. Sie zieht ihre Brauen zusammen; ein lautloser Tadel: Wie kannst du eine solch erbärmliche Banalität von dir geben, während wir Todesängste ausstehen? Ebenso wortlos entschuldige ich mich damit, dass mein Hirn auf minimale Überlebensfunktionen umschaltet und der Instinkt das Kommando über den Intellekt übernimmt, sobald ich Angst habe.
Ich liege auf dem Rücken wie Gregor Samsa, auf einen Schlag in einen hilflosen, verletzten Käfer verwandelt, betrachte die Welt aus der Asphaltperspektive, starre in den grau verhangenen Himmel, durch den Geschosse sirren. Das rhythmische Stakkato einer automatischen Waffe schlägt den Takt.
«Du blutest», schreit sie nochmals, um den Krach zu übertönen. Feine Rinnsale ihres Schweißes haben weiße Spuren in den Schmutz auf ihrem Gesicht gelegt und ihre Falten nachgezeichnet. Und wieder kommt mir ein banaler Gedanke: Ich bin neunundvierzig Jahre alt, sie ist auch schon gut vierzig, und leider ist das nicht mehr zu leugnen, jetzt, wo sie im Dreck liegt und ich ihr Gesicht von Nahem betrachte. Verängstigt und verletzt liegen wir auf einer Straßenkreuzung in Ramallah, und erbarmungslos werden uns unsere Vergänglichkeit und der unvermeidliche Zerfall, der uns erwartet, vorgeführt.
Am Arm spüre ich dickflüssige Wärme. Als ich mich abtaste, da, wo die Lederjacke zerfetzt ist (die Lederjacke trage ich, um Gummigeschosse abzufedern, die von den Soldaten auf der anderen Seite der Barrikaden abgefeuert werden), färbt sich die Hand in klebrigem Rot. Ich empfinde nur Ekel. Angst und Ekel, keinen Schmerz. Der Schmerz wird später kommen, wenn sich die Erregung gelegt hat und der Adrenalinspiegel sinkt. Die Hand wische ich an meiner Jeans ab.
Mit Gummigeschossen kennt sich Strittmatter aus. Schon zwei Jahrzehnte zuvor, als er als junger Lokalreporter über die Jugendkrawalle schrieb, bekamen er und die Kollegen der anderen Zeitungen und der Radiostationen sie ab. Der Chefredakteur hatte befohlen, leuchtend orange Armbinden mit dem Aufdruck Presse zu tragen, damit man die Reporter, die selber die Haare lang trugen und unrasiert waren wie die Demonstranten, nicht mit diesen verwechselte. «Wir wollen keine Strafverfahren wegen Landfriedensbruchs riskieren», sagte der Chef, «und wir wollen jeden Anschein vermeiden, dass wir mit den Chaoten gemeinsame Sache machen.»
Aber diese Armbinden verwandelten die Reporter in Zielscheiben. Den Polizisten, etwa gleich alt wie er, aber in voller Kriegsmontur mit geschlossenem Helmvisier, hat Strittmatter nicht vergessen. Der hielt im Laufschritt plötzlich inne, fixierte die auffällig leuchtende Presse-Armbinde, legte an, zielte und feuerte aus nächster Nähe eine Ladung Gummi-schrot auf Strittmatter ab. Dieser konnte sich gerade noch umdrehen, so dass die Gummigeschosse auf seinen Hintern und den Rücken prasselten, der von der dick gefütterten Wildlederjacke einigermaßen geschützt war. Blaue Flecken setzte es trotzdem ab. Während Tagen konnte er kaum sitzen und musste bäuchlings schlafen.
Die Polizisten betrachteten die Berichterstatter als Feinde, weil sie sich in ihren Zeitungsartikeln nicht an die Verlautbarungen der Polizeisprecher hielten, sondern schrieben, was sie gesehen hatten. Das war nicht immer vorteilhaft für die Polizisten, die manchmal mit unnötiger Härte, um nicht zu sagen Brutalität, durchgriffen. Sie rächten sich, indem sie Ladungen von Gummigeschossen auf die Journalisten abfeuerten, ihnen Tränengaspetarden vor die Füße knallten oder auch mal einem Fotografen die Kamera aus der Hand knüppelten.
Hier, auf dieser Kreuzung, braucht es keine Armbinden. Hier ist jeder ein Ziel. Hier gilt es ernst. Hier wird scharf geschossen.
«Streifschuss», keuche ich. «Ist bei dir alles in Ordnung?»
Sidonie schreit weiter in den grellen Waffenlärm hinein: «Du musst ins Spital. Sofort!»
«Ist nur ein Streifschuss, beruhige dich!», wiederhole ich.
«Ich will nicht, dass du stirbst.»
«Wir können hier nicht weg. Aufstehen wäre viel zu gefährlich. Und ich sterbe nicht.»
«Spiel nicht den Helden!» Ihre Stimme klingt gestresst, fast aggressiv. So habe ich sie noch nie erlebt, Sidonie, die kühle Pariserin aus altem Adel.
Im Fallen ist das schwarz-weiß gesprenkelte Tuch verrutscht, mit dem der Mann im Michael-Jackson-T-Shirt sein Gesicht vermummt hatte. Mitten in seiner Stirn sitzt ein dunkles Loch.
Wir kennen ihn. Er heißt Taher; er ist neunzehn Jahre alt und verheiratet. Seine Frau erwartet das erste Kind. Wir haben das Paar einige Tage zuvor in einem Palästinenserlager interviewt, er ein magerer junger Mann ohne Arbeit, seine Frau Salima, fast noch ein Mädchen, mit aufgeblähtem Schwangerschaftsbauch. In ihrem kleinen Haus aus nackten grauen Backsteinen, unter dessen Wellblechdach sich dumpfe Hitze staute und in dem auch Tahers Eltern, eine Großmutter und mehrere Geschwister lebten, hatten sie uns empfangen wie Gäste, hatten uns Corned Beef aus Konservendosen vorgesetzt, Hummus, Petersiliensalat, Falafel und Fladenbrot, obwohl sie wahrscheinlich selber kaum genug zu essen hatten.
Ich will zu Taher hin robben. Sidonie hält mich zurück. Sie atmet in harten Stößen: «Wir müssen weg, jetzt, sofort.»
Eine junge Frau mit beigem, eng am Kopf anliegendem Tuch, in Jeans und Turnschuhen und einem halblangen blauen Kaftan, der hinter ihr her flattert, rennt mit langen, gazellenhaften Sprüngen über die Straße und fällt mitten auf der Kreuzung dramatisch hin. Auf ihrer Jeans breitet sich ein dunkler Fleck aus. Ihr Schreien übertönt sogar das Grollen der heranrollenden Panzer.
«Wir kommen hier nicht weg, viel zu gefährlich.»
«Wir müssen jetzt weg, jetzt», drängt Sidonie.
Aber wie sollen wir aufstehen, wie können wir weglaufen, wie kommen wir ungeschoren davon, wenn von mehreren Seiten geschossen wird?
«Willst du auch angeschossen werden?», schreie ich zurück.
«Du musst ins Spital, putain de merde!» Sidonie stößt jedes Wort einzeln aus: «Du! Musst! Ins Spital! Sofort! Ich will nicht, dass du stirbst. Bitte stirb nicht! Bitte! Stirb! Nicht!»
Und dann, mehr hingehaucht als geschrien, dieser Satz, dieser eine, seit langem ersehnte, nie gehörte Satz: «Je t’aime.»
Sidonie gab sich stets so überlegen, distanziert. Aristokratisch eben. Unsere Beziehung war ernst, beinahe sachlich; ihr fehlte das Neckische. Dass sie mich liebte, auf ihre Art liebte, nicht manifest, wie ich mir das gewünscht hätte, nicht durch die überschwängliche Bezeugung großer Gefühle, sondern implizit und irgendwie selbstverständlich, habe ich daraus ableiten müssen, wie sie mich küsste, mich anfasste, sich an mich schmiegte. Meine Freunde verwechselten Sidonies Distanziertheit mit Arroganz.
«Ich kann keine Poesie in Eurer Beziehung finden», bemerkte Affentranger an einem milden Abend. Wir hatten auf seiner Terrasse zu viel Bordeaux getrunken und ein Rinderfilet vertilgt, das er, ich gebe es gern zu, perfekt gegart hatte, medium rare, in einer Kräuterkruste. Tagsüber entwickelt Lorenz Affentranger im Verteidigungsministerium Software für den taktischen Einsatz von Kampfjets in imaginären Luftkämpfen gegen virtuelle Feinde, abends dichtet er, wenn die letzte seiner oft wechselnden Liebschaften gerade abgängig und die nächste noch nicht in Sicht ist. Alle paar Jahre bringt er im Eigenverlag unter dem Dichternamen Irenäus Pithikos eine Sammlung seiner Verse heraus.
Natürlich war mir Affentranger noch eine Bosheit schuldig. Ich hatte sein Begehr, in meiner Zeitung eine Rezension seines schmalen Versebüchleins mit dem Titel Zerbrechliches Gelächter zu publizieren, mit der Begründung abgelehnt, es sei zu esoterisch. (In Wirklichkeit fand ich es einfach miserabel, war aber zu feig, Affentranger das offen zu sagen.) Seinen Spruch über meine Beziehung zu Sidonie federte er mit einem Zitat von Ingeborg Bachmann ab, der auch für meine Beurteilung seines poetischen Werkes anwendbar gewesen wäre, wenn ich mich zur Ehrlichkeit hätte durchringen können: «Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar.»
Nein, überheblich oder arrogant war Sidonie nicht. Aber sie strahlte diese entspannte Überlegenheit aus, eine Souveränität im Umgang mit dem Gewusel, das die anderen veranstalteten. Dass sie die Welt mehrheitlich durch den Sucher ihrer Spiegelreflexkamera beobachtete, schuf zusätzlich Distanz. Das Savoir-vivre war in ihrer stinkreichen Familie über Generationen hinweg zusammen mit den angesammelten Erbstücken wie selbstverständlich weitergereicht, kultiviert und gelegentlich abgestaubt worden. Wir Gewöhnlichen hingegen müssen es uns mühsam antrainieren, ohne jemals wirklich zu reüssieren.
Als Sidonie mich zum ersten und übrigens auch einzigen Mal bei ihren Eltern zum Dîner aufbot, war ich schon vom Entrée der herrschaftlichen Wohnung am Jardin du Luxembourg eingeschüchtert, wo mir eine polnische Hausangestellte in schwarzem Rock und schwarzer Bluse mit kleiner, weißer Schürze und weißem Spitzenhäubchen den Mantel abnahm. Die Altvorderen in Öl, die in den Fluren hingen, blickten streng; impressionistische Landschaften und Stillleben an den Wänden des riesigen Salons und einige antike Tischchen und Vitrinen zwischen ausladenden, modernen Sitzmöbeln wiesen diskret auf viel altes Geld und viel alten Geschmack hin.
«So, Journalist sind Sie», wiederholte ihr Vater, ein großer, schwerer Mann mit buschigen Augenbrauen, der auch zu Hause einen dunklen Maßanzug mit weißem Hemd und goldenen Manschettenknöpfen, grauer Weste und dunkelroter Krawatte trug. «Könnten Sie mit Ihren Einkünften denn eine Familie ernähren?»
Ziemlich unverschämt. Ich hätte ihm – wäre ich nicht so paralysiert gewesen von der theatralischen Inszenierung auf dieser Großbürgerbühne, auf der ich mich wie ein herumgeschubster Komparse fühlte – gern gesagt, dass seine Tochter als ziemlich bekannte Fotografin und Mitglied einer renommierten Bildagentur durchaus in der Lage war, für sich selber zu sorgen. Ja, dass sie vermutlich viel mehr verdiente als ich, der ich als Reporter für unbedeutende Zeitungen und Magazine ein eher kümmerliches Dasein führte. Dass sie folglich nicht darauf angewiesen war, von mir durchgefüttert und ausstaffiert zu werden. Erwartete er, dass ich um die Hand seiner Tochter anhielt? Sie war damals immerhin fast vierzig. Zudem wäre das, rein technisch, gar nicht möglich gewesen, auch wenn ich es beabsichtigt hätte. Denn was ihr Vater nicht wusste und auch ich nicht, und was Sidonies Mutter beharrlich verschwieg – die Bernerin, die das R in unnachahmlich vornehmer Art rollte und neben ihrem massigen Mann ähnlich klein und zäh wirkte wie die Tochter –, was wir also alle nicht wussten außer ihrer Mutter, war, dass Sidonie bereits verheiratet war.
Sie erzählte es mir später an jenem Abend, lange, nachdem die Essenszeremonie beendet war, beiläufig, als ob sie die Ehe so locker eingegangen wäre, wie man Unterwäsche kauft oder sich für ein neues Teleobjektiv entscheidet.
Ihre zwei jüngeren Brüder, die ich auf Mitte dreißig schätzte, waren physisch eher nach dem Vater geraten und hatten französisierte Namen polnischer Vorfahren bekommen: Joseph Casimir hieß der ältere, Stanislas der jüngere. (Sidonie hatte man nach der Großmutter väterlicherseits getauft und ihr als zweiten Namen jenen der Berner Großmutter gegeben: Cathérine.)
Joseph und Stanislas kamen mir vor wie zwei Teddybären in teuren Kleidern. Natürlich übten sie angesehenere Berufe aus als ich. Joseph hatte die École normale d’administration absolviert und kraxelte auf einer Karriereleiter im Innenministerium empor; er musterte mich während des ganzen Abends feindselig. Wahrscheinlich wartete er darauf, dass ich das Messer ablecken oder mich mit einem anderen Fauxpas als Prolet erweisen würde, indem ich rülpste oder mit vollem Mund redete. Stanislas war soeben Teilhaber einer alteingesessenen Anwaltskanzlei geworden. Er hatte eine attraktive, große Frau mit wallendem, dunklem Haar, die in einem grünglitzernden, enganliegenden, fast bodenlangen Kleid steckte und Schriftstellerin war, wie sie unablässig betonte. Sie hieß Élodie und trug natürlich ein «de» vor ihrem Familiennamen. Élodie de Quelquechose redete den ganzen Abend wie eine Endlosschleife, schnell, vornehm und hohl. Ihr Gatte, Stanislas, behandelte sie behutsam wie ein exotisches Haustier.
«Wenn ich mir die Reaktion deiner Familie vor Augen halte», sagte ich zu Sidonie, als wir uns später in ihrer bescheidenen Wohnung im Quartier Château d’Eau geliebt hatten, «komme ich mir vor wie etwas, was die Katze auf der Fußmatte deponiert hat und wofür man sich Gummihandschuhe überstreift, um es zu entfernen.»
«Erzähl keinen Seich!», antwortete Sidonie.
Sie redet berndeutsch wie ihre Mutter, mit einem diskreten französischen Akzent, der dem Deutschen jede Härte nimmt. «Meine Eltern sind einfach unglaublich altmodisch. Früher, als ich im heiratsfähigen Alter stand, wie das in unseren Kreisen heißt, früher haben sie mir passende junge Männer vorgestellt, die mit ihren Eltern bei uns zum Essen eingeladen wurden und sich dann zufälligerweise, zufälligerweise in Anführungszeichen», sagte sie, malte mit den Zeige- und Ringfingern beider Hände diese Anführungsstriche in die Luft und deutete ein Lächeln an, indem sie mit den Mundwinkeln zuckte, «zufälligerweise allein mit mir auf der Terrasse wiederfanden und dort ungeschickt versuchten, mich zu küssen, während ich die Gelegenheit nutzte, heimlich eine Zigarette zu rauchen. Das war selbstverständlich bei uns ebenfalls verpönt. Oder ich wurde in ein weißes Ballkleid gesteckt und an Debütantinnenbällen wie eine teure Trophäe vorgeführt. Aber ich traf nur blasierte Langweiler, gehemmte Herrensöhnchen oder geistlose Draufgänger. Kam hinzu, dass meine Eltern sich für mich ein passendes Studium wünschten, Kunstgeschichte, Ägyptologie, Tanztherapie, irgendetwas Schönes und Unverbindliches, das einen angenehmen und reputierlichen Zeitvertreib bis zur Eheschließung ermöglichte. Als ich Fotografin wurde, was sie bis heute für einen Männerberuf halten, vor allem, wenn man in unsichere Gegenden reist, und als ich zu Hause auszog und diese Wohnung hier nahm – stell dir vor: Vater weigert sich bis heute, mich hier zu besuchen. Er würde dieses Viertel niemals betreten, sagt er und nennt es ‹Klein-Ouagadougou›. Alors: Als ich von zu Hause auszog, mit gut zwanzig, ohne mich mit einem der passenden Jünglinge verlobt zu haben, dämmerte ihnen allmählich, dass ich wohl nicht die Laufbahn einschlagen würde, die sie sich für mich ausgedacht hatten: Studium zur Überbrückung der vorehelichen Phase, in der allerlei Gefahren lauern, dann endlich eine standesgemäße Heirat, Kinder auf die Welt stellen, einen großen Haushalt führen, gesellschaftliche Anlässe ausrichten. Jetzt sind sie alt, Vater gut siebzig, Mutter fast siebzig, und ich glaube, sie haben sich damit abgefunden, dass zwar ihre Söhne Karriere machen, die Tochter aber eine unverbesserliche Bohemienne ist.»
«Ich fühlte mich unwillkommen. Ich wurde gemustert wie ein krabbelndes, ekliges Insekt. Taxiert und für zweitrangig befunden.»
«Damit musst du leben. Mein Vater ist so konservativ; der wird sich nie damit abfinden, dass ich ihm auch mit fast vierzig noch Männer präsentiere, mit denen ich zwar zusammenlebe …»
«Darf ich dich daran erinnern, dass wir nicht wirklich zusammenleben?»
«Stimmt. Also, mit denen ich verkehre … passt das jetzt?»
«Passt.»
«Und die ich nicht heiraten werde.»
«Wieso nicht heiraten? Diese Frage haben wir nie diskutiert. Wir haben nie eine gemeinsame Entscheidung getroffen. Du verkündest sie einfach so, sozusagen ex cathedra. Sidonies Fatwa. Du gibst mir keine Chance, meine Argumente vorzutragen.»
«Erstens habe ich keine Absicht, dich zu heiraten, Piment. Ich möchte auch nicht mit dir zusammenziehen. Das würde unsere Beziehung zerstören …»
«Lass uns das Thema wechseln», unterbrach ich sie. «Ich bin anderer Meinung, und du tust mir weh.»
«Hör mal, Pirmin! Unsere Beziehung ist genau deshalb so …, so …», sie suchte nach dem passenden Wort, das ihr nur auf Französisch einfiel, «… so excitant wie am ersten Tag, weil wir den Alltag nicht hineinkriechen lassen. Es ist gut, wie es ist.»
«Und zweitens?»
«Zweitens bin ich schon verheiratet.»
Ich muss ausgesehen haben wie ein Kater, dem man gerade einen Kübel Wasser über den Kopf geschüttet hat.
Sie lachte: «Das hättest du nicht erwartet, oder?»
Jetzt fleht Sidonie mich an, am Leben zu bleiben. Sie hat Angst um mich – Angst, dass ich ihr entgleiten könnte. Ich beuge mich mühsam zu ihr hinüber, versuche vorsichtig, mit dem verletzten Arm nicht den Boden zu berühren, und küsse sie auf die trockenen Lippen.
«Ist nur ein Streifschuss, mon amour», wiederhole ich und spüre, wie die Hitze vom Arm über die Schulter und den Hals in den Kopf kriecht. «Mach dir keine Sorgen! Niemand stirbt an einem Streifschuss.»
«Ich will dich nicht verlieren», fleht sie keuchend.
2
Strittmatter lehnt sich in seinem Bürostuhl zurück. Sie hat sich von hinten über ihn gebeugt und die Arme um ihn geschlungen. Durch ihre Jacke spürt er ihre festen Brüste. Ihr Haar kitzelt sein Gesicht. Sie riecht nach Gewürzen, nach Sa-fran und Thymian, nach Vanille. Strittmatter hat sich bei Paddy einst nach ihrem Parfum erkundigt. Es heiße Ange ou Démon, antwortete sie. (Danach war er sich unsicher, ob er mit dieser Frage bereits einen verbalen Übergriff begangen hatte. Und dann schalt er sich einen überangepassten, ängstlichen Spießer. Später war er einen Moment lang versucht, ihr das Parfum zu schenken, hat sich die Idee aber schnell aus dem Kopf geschlagen, weil man seinen weiblichen Angestellten kein Parfum schenkt. Punkt. Schluss.)
Paddy. Die Umarmung, mit der sie die jahrelang sorgfältig gewahrte Distanz aufhebt und die Grenzen des Professionellen durchbricht, erregt ihn. Für einen Augenblick ist er versucht, den Arm um ihre Hüfte zu legen, sie enger an sich zu ziehen, sein Gesicht zwischen ihre Brüste zu betten. Er stellt sich vor, wie es wäre, Hand in Hand oder eng umschlungen mit ihr hinauszugehen in den kühlen, windigen Abend und später in ihrem sinnlichen Duft zu baden, in ihren Armen alles zu vergessen, das Unaufschiebbare hinauszuzögern, dem Unvermeidlichen ein Schnippchen zu schlagen, wenigstens für ein paar verlorene Momente.
Sex ist der universelle Tröster, und beim Geschlechtsakt konzentriert sich alles auf den Augenblick. Die Empfindung von Raum und Zeit, der Sinn für Vergangenes und Künftiges, sogar die Grenze zwischen dem eigenen Körper und jenem, in den man gerade eindringt, mit dem man verschmilzt, sie alle sind für einen kurzen, ekstatischen Augenblick aufgehoben, bevor sie, nach flüchtiger Erfüllung, der Trauer und Erschöpfung weichen. Paddy und er, denkt Strittmatter, dreißig Jahre Altersunterschied, der Chefredakteur und seine ehemalige Praktikantin, eine unmögliche und umso reizvollere Konstellation. Und das Geschwätz, das sich ausbreiten würde wie ein übelriechender Darmwind, in der Redaktion zuerst, dann in den Journalistenzirkeln, schließlich in der Stadt:
Habt ihr gehört, Strittmatter und diese … wie heißt sie noch?
Er hat sie …
Und sie hat sich ihm dafür …
Der alte Lustmolch!
Testosterongesteuert!
In seinem Alter! In seiner Position!
Das junge Luder!
Sich hochschlafen!
Die Beine breitmachen für die Karriere!
Der alte Schmutzfink!
Dann reißt sich Strittmatter zusammen, stößt sie mit beiden Händen von sich, fast unwirsch: «Du solltest jetzt gehen, Paddy, bitte!», sagt er viel zu laut, und dann leiser: «Ich bin froh, dass du gekommen bist. Danke. Aber jetzt muss ich allein sein.»
Sie versteht mich, denkt er, sie ist die Einzige, die mich versteht, und ich bin ihr dankbar dafür. Ich werde sie vermissen. Ich werde sie unendlich vermissen.
Lange starrt er zu der Stelle hin, wo das dämmrige Halbdunkel des Großraumbüros in die Finsternis übergeht, in die sie eingetaucht ist. Einsamkeit bricht über ihn herein wie brodelndes Magma, heiß und schmerzhaft.
Du hast, sagt er sich, soeben den letzten von vielen fatalen Fehlern begangen, den allerletzten und vielleicht den größten.
Strittmatter hatte das Todesurteil seit langem erwartet. Als es verhängt wurde, traf es ihn trotzdem wie eine Abrissbirne, die auf morsches Gemäuer aufschlägt.
Er sitzt in seinem Büro, das er einst mit dem Menschenaffenhaus im Zoologischen Garten verglichen hat: auf zwei Seiten verglast, so dass, wer draußen vorbeigeht, mit einem Seitenblick feststellen kann, ob der Gorilla anwesend ist und wer gerade seinen silbernen Rücken krault. Kinder könnten die Nase an den Scheiben plattdrücken. Aber natürlich verirren sich Kinder selten in eine Zeitungsredaktion – außer am sogenannten Zukunftstag, da sie ein paar Stunden am Arbeitsplatz ihrer Mütter oder Onkel oder Patinnen schnuppern dürfen. Zukunft, denkt Strittmatter, Zukunft war gestern; heute ist Vergangenheit.
Von draußen dringt fahles Licht herein, blass dümpelt eine halbe Mondscheibe über den Dächern der Häuser auf der anderen Straßenseite, deren Firste sich schwarz vom schummrigen, weichgezeichneten Nachthimmel abheben; gelblich schimmert die Straßenbeleuchtung herauf in den vierten Stock. Der Wind entreißt den Alleebäumen die braun gewordenen Blätter und peitscht sie durch die Luft. Eine Vorahnung von Winter hat sich heimlich in die Stadt geschlichen. Als er am Mittag, vom Bahnhof kommend, über die Brücke gelaufen war, hatte er den Kaschmirschal enger um den Hals geschlungen, ein Geschenk von Sidonie, an die er jedes Mal erinnert wird, wenn er das weiche, karierte Halstuch umlegt. Wieso, fragt er sich in solchen Momenten, wieso verflüchtigt sich dieser Schmerz nie, auch nicht nach Jahren? Zeit heilt Wunden? Nein, sie schenkt einem Vergessen, aber nur, wenn man Glück hat. Und die Wunde kann jederzeit neu aufplatzen. Er hat bei anderen Frauen Trost gesucht in den vergangenen vier Jahren. Einige hat er sogar bezahlt für ein bisschen vorgespielte Zuwendung. Doch hinter jedem neuen Gesicht hat er das von Sidonie gesucht. Und kaum hatte er sich eingeredet, die Liebe zu ihr endlich abgetötet zu haben, schlich sich der Schmerz von neuem an.
Was drängt uns dazu, unser Denken auf die Trauer über Vergangenes, nicht Wiederbringliches zu richten, auf verflossene Peinlichkeiten, verpasste Chancen, Verletzungen, statt uns der Zukunft zuzuwenden?
Die Hände hatte Strittmatter in den Taschen des Mantels vergraben, nachdem er dort vergeblich nach den Handschuhen gefahndet hatte. Du wirst vergesslich, schalt er sich, du wirst alt. Einmal bleibt das Mobiltelefon zu Hause auf dem Küchentisch, worauf er es im Büro frenetisch sucht, dann lässt er die Handschuhe im Zug und den Schirm im Restaurant liegen; bald ist er zu nichts mehr zu gebrauchen, und dann wird er vom Wind verweht werden wie die verwelkten Herbstblätter.
Strittmatter schaukelt mit der Lehne seines Bürostuhls vor und zurück. Das beruhigt. Manchmal fährt ein Krankenwagen oder ein Feuerwehrauto vorbei. Er sieht sie nicht und hört sie kaum; nur ihr Blaulicht huscht rhythmisch durch den Raum wie die Installation einer Videokünstlerin.
Sein verletzter Arm. Dreizehn Jahre schon. Nur wer genau hinschaut, kann die vernarbte Kerbe noch ausmachen. «Bitte stirb nicht! Bitte bleib! Bitte!»
Hast du mich wirklich geliebt, Sidonie? Und wenn ja, wieso hast du dich plötzlich, ohne Vorwarnung, ohne Erklärung, aus meinem Leben abgemeldet – nach fünfzehn gemeinsamen Jahren? Wenn du mich besucht hättest, es mir erklärt hättest! Hör mal, Pirmin, ich finde, die Luft ist raus. Unsere Beziehung hat sich totgelaufen. Wir müssen ehrlich sein zueinander und uns eingestehen, dass wir als Paar keine Zukunft haben. Das wäre schmerzhaft gewesen. Aber wenigstens hätte ich versuchen können, deinen Entscheid zu verstehen und zu verarbeiten, auch wenn ich ihn emotional nicht begriffen hätte. Indem du dich wortlos entferntest, ohne mir die Chance einer Reflexion einzuräumen und ohne Möglichkeit, mit dir über deine Entscheidung zu diskutieren und deine Beweggründe zu erfahren, hast du mich stehenlassen wie einen vollen Müllsack am Straßenrand, und genauso kam ich mir vor: wie ein Stück Dreck, das man nicht mehr anfassen will. Wer eine Beziehung beendet, hat die aktive Rolle übernommen und das Urteil gefällt, doch der Verurteilte sollte wenigstens das Recht haben, mit Stil, Rücksicht und Respekt auf die Richtstätte geführt zu werden. Du, Sidonie, warst trotz deines adeligen Pedigrees und der langen Galerie vornehmer Ahnen stillos, respektlos und rücksichtslos, und das war die schlimmere Tortur als die Trennung selber.
Alle Lichter sind gelöscht außer seiner Tischlampe, und der Bildschirm der Online-Redakteurin draußen im Großraumbüro flimmert wie ein Fernsehgerät, das man nach Ende des Programms nicht ausgeschaltet hat. Ungezählte Male hat er befohlen, Computer herunterzufahren, wenn sie nicht gebraucht werden, um Strom zu sparen. Doch die Kollegin hört nicht auf mich, denkt er; auch das ist eine Form der Verachtung. Kaum hat er sich über den flimmernden Bildschirm geärgert, ärgert er sich über seine Kleinmütigkeit. Was ist ein vergessener, Strom fressender Bildschirm im Vergleich zu dem, was er heute hat tun müssen und was er in den nächsten Tagen noch tun muss? Mein Gott! Soll das Gerät doch flimmern.
Die Zeitung ist im Kasten. Wahrscheinlich stammt der Ausdruck aus der Zeit, als Artikel noch Zeile um Zeile in Blei gegossen und die Bleizeilen in metallenen Rahmen oder Kästen zu Zeitungsseiten arrangiert wurden. Die Metteure, so nannte man die Männer, welche die Bleizeilen zusammenbauten, die Metteure hatten schwarze Hände und waren Pragmatiker, im Gegensatz zu den Journalisten, die man insgesamt zu den Romantikern zählen darf. Ein fehlendes Komma? Kein Problem, das setzen wir noch rasch ein. Der Artikel zu lang? Verkleinern wir die Fotografie auf der Seite, oder fräsen wir einen unnötigen Halbsatz heraus.
Es war eine physische Arbeit damals, unten in der Mettage. Der Redakteur stand mit verschränkten Armen daneben, eine Gauloise im Mundwinkel. Indem man Gauloise, Gitanes oder die giftigen Roth-Händle inhalierte, signalisierte man, dass man zur Fraktion jener lockeren Typen gezählt werden wollte, die Journalismus betrieben oder, besser gesagt, sich im Journalismus austobten, als ob sie Künstler wären. Die im Spielsalon stundenlang am selben Flipperautomaten hantierten und ein Gratisspiel nach dem anderen herausholten. Die mittags in der italienischen Arbeiterkneipe Ravioli aßen, dazu Rotwein und später zum Espresso Grappa tranken und nachmittags gegen drei beschwingt auf der Redaktion auftauchten, am Pult ein Nachmittagsschläfchen einlegten und erst gegen Abend zu arbeiten begannen, dafür richtig und notfalls bis zum allerletzten Redaktionsschluss morgens um zwei. Die gestandene Politiker zur Weißglut trieben, indem sie impertinente Fragen stellten.
Die andere Fraktion, das waren die Handwerker des geschriebenen Wortes, seriös und arbeitsam, bei denen jeder Satz stimmte, aber alles ein wenig langweilig war, und die nach Redaktionsschluss nach Hause zu Frau und Kindern strebten. Sie schrieben mit zehn Fingern, weil sie das System sorgfältig erlernt hatten, während die Gauloise-Raucher ihre Texte mit zwei Fingern in die mechanische Hermes-Schreibmaschine hackten.
Doch die Erinnerung ist eine betrügerische Kurtisane, denkt Strittmatter: In der Mettage war das Rauchen schon damals verboten, im Gegensatz zur Redaktion, wo eine dicke, stinkende Wolke unter der Decke des Abschlussraumes hing.
Ein paar Pfeifenraucher gab es auch; das waren die Redaktionsphilosophen, die viel dachten, klug redeten und wenig schrieben, weil sie fast immer damit beschäftigt waren, die Pfeife zu stopfen, ein paar Züge zu paffen, sie neu anzuzünden, wenn sie erloschen war, und sie, wenn der Tabak ausgeraucht war, auszuklopfen, die verklebten Tabak- und Rußreste im Pfeifenkopf auszukratzen und den Pfeifenhals mit einem weißen Pfeifenputzer zu reinigen, der danach schmaulig auf dem Pult lag.
Und dann gab es noch die Nichtraucherinnen von der politischen Redaktion, die sich lautstark über die Umweltverschmutzung durch die männlichen Kollegen ausließen und sich bei der Chefredaktion vergeblich darüber beschwerten, dass es in den Redaktionsräumen nach kaltem Tabak stank.
Der Redakteur stand also daneben, oder die Redakteurin, während der Metteur – Metteurinnen gab es keine, das war damals eine strikt den Männern vorbehaltene Arbeit – die Bleiseite baute, die nach und nach zum spiegelverkehrten Abbild der Zeitungsseite von morgen wurde; in Metall gegossene Informationen und Meinungen, gefestigte, ausgekühlte Gedanken. Metteure waren in der Lage, Zeilen mit verkehrten Buchstaben von rechts nach links zu lesen. Oder wenn sie dazu nicht in der Lage waren, hielten sie einen Handspiegel hin, um darin zu lesen. Am Schluss wurde die bleierne Buchstabenlandschaft mit schwarzer Farbe beschmiert, und auf einem Blatt Papier von minderer Qualität in der Originalgröße der entstehenden Zeitung wurde ein Seitenabzug gedruckt, so dass der Redakteur die Zeitungsseite, die der Metteur gerade zusammengesetzt hatte, nochmals prüfen konnte, bevor daraus eine Druckplatte gegossen wurde.
Heute geschieht alles elektronisch. Einen körperlichen Kontakt zur entstehenden Zeitung gibt es nicht mehr. Zuerst werden die Inhalte ins Internet gestellt, verziert mit vielen Farbfotografien, und mit reißerischen Titeln angepriesen. Dann wird die Zeitung virtuell am Bildschirm verfertigt; Texte werden aus dem elektronischen Briefkasten übernommen oder aus dem Agenturordner, oder Journalistinnen und Journalisten schreiben sie direkt in die Druckvorlage, füllen das Zeitgeschehen in vorgezeichnete Gefäße ab. Bilder lädt man aus einem elektronischen Speicher auf die entstehende Zeitungsseite hoch und bringt sie dort in die richtige Form. Erst in der Druckerei werden die übermittelten, fertigen, aber noch virtuellen Zeitungsseiten auf Druckplatten übertragen. Und erst am nächsten Morgen, wenn man die gedruckte Zeitung in den Händen hält, gibt es eine kurze physische Verbindung zur eigenen Arbeit, bevor diese im Müll oder im Altpapier entsorgt wird.
Wie es eigentlich komme, dass die Zeitung immer genau so dick sei, dass alle Ereignisse des Tages darin Platz fänden, hatte ihn am letzten Zukunftstag ein etwa zwölfjähriges, vorwitziges Mädchen gefragt.
«Es ist genau umgekehrt», hatte Strittmatter geantwortet. «Wir stutzen die Ereignisse so lange zurecht, bis sie den Raum zwischen den Anzeigen exakt ausfüllen.»
Der Raum allerdings, den die Anzeigen beanspruchten, denkt er, ist immer schmaler geworden. Das lukrative Modell, bei dem Abonnenten ein Drittel, Anzeigenkunden hingegen zwei Drittel der Einnahmen beisteuerten und so den Verlegern satte Gewinne verschafften, die sich, ohne viele Gedanken an die Betriebswirtschaft zu verschwenden, große, kostspielige Redaktionen leisteten, funktionierte längst nicht mehr. Hinzu kam, dass die Verleger den unverständlichen Fehler begangen hatten, Inhalte, welche ihre teuren Redaktionen hergestellt hatten, im Internet kostenlos zu verscherbeln. Das wäre, hatte Strittmatter damals doziert, als wenn man den Hamburger bei McDonald’s gratis bekäme, obwohl seine Verfertigung und seine Darreichung doch Rohstoffe und Arbeitskräfte erfordert und somit Herstellungskosten verursacht hätten. Auf diese Idee müsse man erst einmal kommen.
Man wolle die Leute mit Gratisinhalten anfixen und dann, wenn sie sich an das Internet gewöhnt hätten, Geld dafür verlangen, räsonierten die Verleger. Aber das Kalkül war nicht aufgegangen. Viel zu wenige Konsumenten waren bereit, für journalistische Inhalte im Internet zu bezahlen. Dann übertrugen die Verleger das Dumpingmodell aus dem Internet auf die gedruckte Zeitung und fluteten die Städte mit billig fabrizierten Gratisblättern, welche den bezahlten Zeitungen weitere Anzeigeneinnahmen entzogen. Das Interesse an ihren Qualitätszeitungen verloren sie und reduzierten deren Gestehungskosten radikal, indem sie Redaktionen zusammenlegten, Stellen abbauten, Honorare kürzten, unrentabel gewordene Titel killten und stattdessen andere, ausgiebiger sprudelnde Geldquellen anzapften.
3
Strittmatter hat wahllos einen Aktenordner herausgegriffen aus der langen Parade von schwarzen, roten, blauen und grauen Kartonrücken, hinter denen sich seine Arbeit von mehr als vier Jahrzehnten verbirgt, säuberlich auf weiße Blätter geklebt, gelocht und abgeheftet. Er hat ihn irgendwo aufgeschlagen und einen seiner Artikel von 1990 zu lesen begonnen: Attentat in Israel löst heftige Reaktionen aus, steht darüber, Von Pirmin Strittmatter, Jerusalem, und der erste Satz lautet: Westliche Beobachter in mehreren arabischen Hauptstädten sprachen am Montag bereits von einer Verhärtung des arabischen Standpunkts in der Frage eines Nahostfriedens. Heute, denkt Strittmatter, der sich fragt, ob er sich auch zweieinhalb Jahrzehnte später noch für solche Sätze schämen müsste, heute würde ein solcher Einstieg gnadenlos eliminiert. Erstens weiß jedes Kind, was westliche Beobachter sind: Hinter ihnen versteckt sich im besseren Fall der Botschafter des eigenen Landes und im schlechteren der Journalist selber, der seine Meinung äußert, ohne das zuzugeben, weil, wenn er es zugäbe, sich niemand dafür interessieren würde. Und zweitens weichen die Leser einem solchen Satz aus wie Fußgänger einem Hundehäufchen.
Zeitungen sind professioneller geworden, denkt Strittmatter, das schon. Damals, in seinen Anfängen als Journalist, musste jeder alles machen; eine Bildredaktion, eine Zeitungsproduktion oder ein Layout gab es nicht. Grafiken wurden von einem freien Mitarbeiter angefertigt, einem alten, zittrigen Mann, der mit dem Fahrrad auf die Redaktion kam, um die Aufträge abzuholen und die fertigen Zeichnungen, auf Papier selbstverständlich und schwarz-weiß, zurück auf die Redaktion zu bringen. Manchmal hatte der Mann Zeit und manchmal nicht; wenn er keine Zeit hatte, oder wenn es zu stark regnete und er nicht mit dem Rad fahren mochte, gab es keine Grafik, so einfach war das. Die Zeitungsseite von morgen wurde vom Redakteur mit Filzstift auf eine Zeitungsseite von gestern oder vorgestern skizziert; Bilder, schwarz-weiß natürlich, suchte man im Archiv, oder man nahm sie aus dem aktuellen Angebot der Bildagentur, das Boten mehrmals am Tag in grünen Briefumschlägen anlieferten. An den Berichten von Korrespondenten, die per Telex hereinratterten, durfte prinzipiell nichts geändert werden, außer dass man hie und da ein fehlendes Komma einsetzte oder einen Tippfehler ausmerzte, während man die Meldungen der Schweizerischen Depeschenagentur, der Associated Press, der Agence France Presse, der Deutschen Presseagentur oder der United Press International als Rohmaterial verwendete und je nach Bedarf zusammenstrich, kürzte oder zerschnippelte und einzelne Abschnitte neu zusammenklebte.