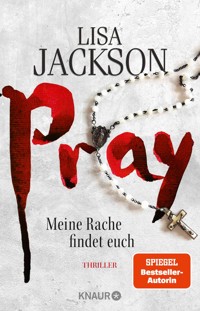9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein Fall für Alvarez und Pescoli
- Sprache: Deutsch
Detective Regan Pescoli ist in den Fängen des »Unglücksstern-Mörders«. Ein psychopathischer Killer, der seine weiblichen Opfer in einer Berghütte gefangen hält, um sie dann bei eisiger Kälte an einen Baum zu fesseln und erfrieren zu lassen. Seine kryptische Nachricht an die Polizei: »Meidet des Skorpions Zorn«. Doch wer ist der Skorpion? Fieberhaft suchen Pescolis Partnerin Selena Alvarez und ihre Kollegen in der Wildnis nach Spuren ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 574
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Lisa Jackson
Der Zorn des Skorpions
Thriller
Aus dem Amerikanischen von Elisabeth Hartmann
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Der schon aus Der Skorpion bekannte Unglücksstern-Mörder ist noch immer nicht gefasst. Er schickt der Polizei geheimnisvolle Initialen, die zusammengesetzt letztendlich den Satz Meide des Skorpions Zorn ergeben könnten. Jetzt hat er vermutlich Detective Regan Pescoli in seine Gewalt gebracht, denn die Initialen »P« und »R«, neben wenigen anderen Buchstaben, fehlen dem Täter noch. Regans Partnerin Selena Alvarez ist mehr als beunruhigt …
Inhaltsübersicht
Prolog
IN DER HÖHLE EINES MÖRDERS
1. KAPITEL
2. KAPITEL
3. KAPITEL
4. KAPITEL
5. KAPITEL
6. KAPITEL
7. KAPITEL
8. KAPITEL
9. KAPITEL
10. KAPITEL
11. KAPITEL
12. KAPITEL
13. KAPITEL
14. KAPITEL
15. KAPITEL
16. KAPITEL
17. KAPITEL
18. KAPITEL
19. KAPITEL
20. KAPITEL
21. KAPITEL
22. KAPITEL
23. KAPITEL
24. KAPITEL
25. KAPITEL
26. KAPITEL
27. KAPITEL
28. KAPITEL
29. KAPITEL
30. KAPITEL
31. KAPITEL
32. KAPITEL
EPILOG
Danksagung
Lisa Jackson bei Knaur
IN DER HÖHLE EINES MÖRDERS
Ohne zu zögern, trat Pescoli an den großen Schrank und öffnete die Doppeltüren. Dahinter befanden sich Papiere. In den Fächern standen Bücher über Astronomie und Astrologie, außerdem säuberlich gestapelte Karteikästen und Zeichnungen … Es war zu dunkel, um etwas erkennen zu können, aber …
Ihr wurde flau im Magen, als sie sah, welche Zeichnungen es waren. Es handelte sich um die Zettel, die über den Köpfen der Opfer an den Bäumen gehangen hatten, und dort lagen noch so viele mehr.
Sie wusste, dass ihr die Zeit davonlief. Zitternd vor Kälte sah sie sich in dem Raum nach einer Waffe um, nach einem Telefon, einem Computer, nach irgendetwas, um sich schützen und Kontakt nach außen herstellen zu können, doch vergebens.
Sie entdeckte lediglich eine Taschenlampe, und als sie den Lichtstrahl ein letztes Mal über den Schrankinhalt wandern ließ, fuhr ihr erneut der Schreck in die Glieder. Dort, bei den penibel beschrifteten Zetteln mit den rätselhaften Botschaften und Sternen, lagen Fotos. Von den Frauen, die er in seine Gewalt gebracht hatte. Sämtlich nackt, an einen Baum gefesselt, noch sehr lebendig, Entsetzen in den Augen.
Pescoli spürte ein Flattern im Magen.
Ihr blieb nichts anderes übrig, als das Beweismaterial einfach liegen zu lassen und einen Fluchtweg zu finden. Für sich selbst. Für Elyssa. Für die anderen, von denen er gesprochen hatte …
Wo befinden sie sich? Wo ist Elyssa? Ist sie hier irgendwo? Oder wird sie bereits durch den Wald zu einem frei stehenden Baum getrieben, wo ihr ein einsamer, grausamer Tod gewiss ist …?
1. KAPITEL
Gestern
Regan Pescoli war heiß.
Allerdings nicht in erotischem Sinne.
Sie platzte fast vor Wut. Sie kochte vor Zorn. Stinksauer war sie.
Sie umfasste das Steuer ihres Jeeps so krampfhaft, dass ihre Knöchel weiß wurden, biss die Zähne fest zusammen und sah starr auf die Straße, als könnte ihr zornfunkelnder Blick das Bild des herzlosen Schweinehunds heraufbeschwören, der sie in diesen Zustand namenloser Wut versetzt hatte.
»Mistkerl«, zischte sie. Die Reifen ihres Dienstwagens gerieten auf dem vereisten Abhang leicht ins Rutschen. Ihr Herz raste, ihre Wangen waren trotz der Minustemperaturen draußen gerötet.
Kein Mensch auf der Welt außer ihrem Ex-Mann, Luke »Lucky« Pescoli, brachte sie dazu, dermaßen rotzusehen. So wie an jenem Tag. Da hatte er schließlich die unsichtbare Grenze überschritten, die Regan gezogen und er bisher respektiert hatte. Er war doch wirklich einfach nur ein Versager. In all den Jahren ihrer Ehe hatte er ihr nichts als Unglück gebracht.
Und jetzt hatte er es sich aus heiterem Himmel in den Kopf gesetzt, ihr die Kinder wegzunehmen.
Die Melodie eines bekannten Weihnachtslieds dudelte im Radio ihres Jeeps, während Regan wie eine Verrückte durch die steilen, schneebedeckten Berge und Schluchten in dieser Gegend der Bitterroot-Bergkette raste. Der Jeep reagierte optimal. Die Fenster beschlugen vor Kälte, der Motor überwand grollend den Pass, die Reifen fraßen sich über die verschneite Landstraße durch diese Bergkette, über den Bergrücken, der ihr Haus von der Gegend trennte, in der Luke mit seiner neuen Frau lebte, einer Barbiepuppe mit Namen Michelle.
Gewöhnlich war Regan glücklich über diese Barriere. Doch heute ging sie ihr aufgrund der schlechter werdenden Wetterbedingungen gehörig auf die Nerven.
Ihr letztes Telefongespräch mit Luke spulte sich wie die schlechte Bandaufnahme einer Warteschleife immer wieder in ihrem Kopf ab. Er hatte angerufen und bestätigt, dass ihre Kinder, der Sohn und die Tochter, die sie weitestgehend allein erzogen hatte, bei ihm waren. Lucky hatte in seiner herablassenden Art gesagt: »Die Kinder, Michelle und ich haben geredet, und wir stimmen alle überein, dass Jeremy und Bianca bei uns wohnen sollten.«
An diesem Punkt war das Gespräch eskaliert, und Regans Abschiedsworte an ihren Ex-Mann, bevor sie den Hörer aufknallte, waren: »Pack die Sachen der Kinder, Luke, denn ich komme und hole sie ab. Und Cisco ebenfalls. Ich will meinen Sohn. Ich will meine Tochter, und ich will meinen Hund. Und ich komme und hole sie mir.«
Sie hatte das Haus verschlossen und war sofort losgefahren, entschlossen, die Fronten zu klären und ihre Kinder zurückzubekommen. Oder Lucky umzubringen. Oder beides.
Der Motor des Jeeps heulte empört auf, als sie auf dem verschneiten Terrain zu einem entnervenden Schneckentempo herunterschaltete. Sie suchte im Handschuhfach nach ihrem Reserve-Zigarettenpäckchen, das sie »für den äußersten Notfall« dort versteckte, nur um feststellen zu müssen, dass es leer war. »Toll.« Sie zerknüllte die nutzlose Schachtel und warf sie auf den Boden vor dem Beifahrersitz. Sie hatte das Rauchen aufgeben wollen …, ganz und gar, schon seit geraumer Zeit. Wie es aussah, war es heute so weit.
Im Radio trällerte irgendeine Countrysängerin etwas von scheußlichem Wetter, und Pescoli schaltete es aus.
»Du hast ja recht«, brummte sie grimmig und beschleunigte in einer Kurve. Die Reifen schlitterten leicht, fanden dann wieder Bodenhaftung.
Sie nahm es kaum wahr.
Ebenso wenig nahm sie die hohen Fichten, Tannen und Kiefern wahr, die sich mit von Schnee und Eis beschwerten Zweigen wie majestätische Wachtposten in die frische, kalte Luft reckten. Schnee fiel aus unsichtbaren Wolken. Die Scheibenwischer fegten die Flocken weg, die Heizung lief auf Volltouren. Trotz des Gebläses konnte die warme Luft nichts dagegen ausrichten, dass die Fenster immer mehr beschlugen.
Pescoli kniff die Augen zusammen und sehnte sich nach einem einzigen tiefen Zug aus einer Zigarette, während sie sich für die bevorstehende Konfrontation wappnete, die abenteuerlich zu werden versprach. Von wegen »Fröhliche Weihnachten« und »Friede den Menschen, die guten Willens sind«. Das galt nicht für Lucky. Hatte noch nie gegolten. All diese Plattitüden, doch um der Kinder willen Frieden zu halten und die Gefühle zu beherrschen, waren vergessen.
Er durfte ihr nicht die Kinder wegnehmen, niemals.
Sicher, sie machte häufig Überstunden im Büro des Sheriffs von Pinewood County, und in letzter Zeit war die Abteilung dank des Winterwetters mit großflächigen Stromausfällen, Straßensperrungen und Glatteis im gesamten Bezirk völlig überlastet gewesen. Außerdem befand sich der »Mörder mit dem Unglück bringenden Stern« oder kurz der »Unglücksstern-Mörder« genannt, der erste Serienmörder, der in diesem Teil von Montana sein Unwesen trieb, immer noch auf freiem Fuß.
Der Kerl war einer von der übelsten Sorte. Ein organisierter, geschickter Mörder mit langem Atem, der die Reifen seiner ahnungslosen Opfer beschoss und damit Unfälle provozierte. Die verletzten Frauen »rettete« er dann, nur um sie in irgendeinen geheimen Unterschlupf zu verschleppen, wo er sie gesund pflegte, sie vollkommen von sich abhängig machte und ihr Vertrauen erschlich. Schließlich trieb er sie nackt hinaus in die winterkalte Wildnis, fesselte sie an einen Baum und überließ sie dem eisigen, erbarmungslosen Wind und einem langsamen, qualvollen Tod.
Wie sie darauf brannte, ihn zu schnappen!
Bisher hatte der grausame Kerl fünf Frauen umgebracht. Die letzte, Donna Estes, war noch lebendig gefunden und per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden, wo sie dann doch gestorben war, ohne wieder zu Bewusstsein gekommen zu sein – ohne das perverse Schwein identifizieren zu können. Natürlich wurden an den Tatorten auch Hinweise gefunden, die Autowracks der Opfer wurden weit entfernt von den Mordschauplätzen entdeckt, an denen der Täter über den Köpfen der Toten an den Baum genagelte Botschaften hinterließ. Doch bislang führte nicht das kleinste Beweisstück auf die Spur eines Verdächtigen. Was nicht hieß, dass sie überhaupt einen im Visier hatten. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten sie keinerlei Gemeinsamkeiten bei den Opfern feststellen können, und kein potenzieller Täter war ihnen bisher ins Blickfeld geraten.
Noch nicht.
Das würde sich ändern. Musste sich ändern.
Und während Pescoli und das ganze Morddezernat Überstunden schoben, um den Perversen zu schnappen, hatte Lucky die Unverfrorenheit, die unbeschreibliche Frechheit besessen, ihre Kinder zu entführen und ihr mitzuteilen, dass er das alleinige Sorgerecht beantragen würde.
Vor knapp einer halben Stunde hatte sie das Telefongespräch mit ihm beendet und ihre Partnerin gebeten, für sie einzuspringen. In etwa einer Viertelstunde würde sie vor seiner Wohnung stehen. Sie legte eine Tim-McGraw-CD ein, erinnerte sich, dass sie Lucky gehörte, betätigte die Auswurftaste und feuerte die CD zu ihrer leeren, zerknüllten Zigarettenschachtel auf den Boden vor dem Beifahrersitz. Flüchtig dachte sie an Nate Santana, den Mann, mit dem sie eine Affäre hatte. Er konnte ihr gehörig den Kopf verdrehen, doch sie wusste, dass er nicht gut für sie war. Überhaupt nicht gut. Ein gutaussehender Cowboy, der Typ, dem sie besser aus dem Weg ging. Und an den sie jetzt nicht denken durfte. Nicht, wenn sie an bedeutend Wichtigeres zu denken hatte.
Der Jeep geriet leicht ins Schleudern, und sie lenkte behutsam dagegen. Seit Jahren fuhr sie in Schneestürmen durch diese Berge, doch sie war sehr wütend und ihr Fahrstil vielleicht ein bisschen zu aggressiv.
Pech! Empörung steuerte ihr Handeln. Ihr Gerechtigkeitssinn trieb sie an. Regan nahm eine Kurve ein wenig zu schnell und schlitterte aus der Spur, doch sie hatte den Jeep wieder in der Gewalt, bevor er über die Böschung in den Abgrund des Cougar Canyon schießen konnte.
Sie schaltete herunter. Wieder drehten die Räder durch, als wäre die Straße hier kurz vor der letzten Bergkuppe spiegelglatt. Noch ein paar Meter, und es ging bergab …
Noch einmal schleuderte das Fahrzeug.
»Du lässt nach«, schalt Pescoli sich und lenkte in eine Kurve.
Krack!
Ein Schuss aus einem leistungsstarken Gewehr hallte durch den Wald. Instinktiv duckte Pescoli sich, nahm eine Hand vom Steuer und griff nach ihrer Waffe. Der Jeep rüttelte, und sie begriff, was mit ihr geschah. Mitten im heftigen Schneesturm schoss jemand auf ihr Fahrzeug.
Nicht irgendjemand. Der Unglücksstern-Mörder! Auf diese Weise bringt er seine Opfer in seine Gewalt!
Angst ergriff ihr Herz.
Der Jeep drehte sich, die Reifen rutschten, der Sicherheitsgurt rastete ein, alles Gegenlenken war sinnlos.
Immer schneller drehte sich der Jeep und glitt über den Rand der Felsenschlucht. Verzweifelt griff Regan nach ihrem Handy, doch es rutschte ihr aus der Hand, als der Jeep zwischen Bäumen hindurchschleuderte und über Felsbrocken hinwegschoss. Metall krachte und kreischte, Glassplitter und kalte Luft brachen ins Wageninnere ein, der Airbag prallte gegen Regans Oberkörper.
Bamm! Der Jeep fiel auf die Seite. Metall knirschte, spitze Steine und Geröll bohrten sich durch die Tür. Heftiger Schmerz fuhr durch Regans Nacken und Schulter, und sie wusste sofort, dass sie verletzt war.
Warmes Blut quoll aus einer seitlichen Kopfwunde. Wie auf Schienen raste der Jeep durchs Unterholz, dann überschlug er sich.
Mit der einen Hand klammerte sie sich ans Steuer, mit der anderen hielt sie immer noch ihre Pistole umfasst. Die Welt drehte sich um sie, ihre Zähne schlugen aufeinander. Vor ihrem geistigen Auge sah sie die Opfer des Mörders. Momentaufnahmen in schneller Abfolge, von nackten Frauen, tot, mit bläulicher Haut, Eis und Schnee im Haar, so fest an Baumstämme gebunden, dass die Haut verfärbt und aufgesprungen und Blut geflossen war, bevor es gefror.
Bamm!
Der Kühler barst beim Aufprall, der Ruck ging Pescoli durch sämtliche Knochen. Ihre Schulter brannte wie Feuer, der Airbag zwängte sie ein, aufgewirbelter Staub geriet ihr in die Augen.
Unter dem Geräusch von reißendem Metall prallte der Jeep von einem Baum ab und raste den Abhang hinunter. Das Kühlerblech zerknautschte, ein Reifen platzte, immer schneller ging es bergab.
Pescoli konnte in Todesangst kaum einen klaren Gedanken fassen und kämpfte gegen die drohende Bewusstlosigkeit. Sie hielt ihre Pistole fest, tastete am Armaturenbrett nach dem Schalter, der das Magnetschloss ihrer Gewehrhalterung entriegelte, für den Fall, dass sie die Waffe überhaupt zu fassen bekam.
Aber sie musste. Denn wenn sie den Absturz überlebte und irgendein Kerl mit einer Waffe zu ihrer Rettung kam, würde sie ihn drankriegen. Ohne lange zu fragen. Flüchtig dachte sie an ihr verpfuschtes Leben: an ihre Kinder und ihren verstorbenen ersten Mann, an ihren zweiten Mann, Lucky, und schließlich an Nate Santana, den sexy Herumtreiber, mit dem sie sich nie hätte einlassen dürfen.
Es gab so vieles, was sie bereute.
So darfst du nicht denken. Bleib wach. Bleib am Leben. Halte dich bereit für diesen Wahnsinnigen und schieß ihm den Schädel weg.
Sie biss die Zähne zusammen und drückte die Taste des Magnetschlosses, doch nichts rührte sich. Das Gewehr löste sich nicht. Verzweiflung stieg auf, aber noch hatte sie ja ihre Pistole. Sie schloss die Finger um die Waffe und spürte sie tröstlich in ihrer Hand liegen.
Nicht lange fragen, gleich schießen.
Noch einmal hörte sie Knirschen und Ächzen von Metall, als das Dach unter den Überrollbügeln einbrach und auf sie zukam.
Grell blitzte die Erkenntnis auf, jetzt sah sie ganz klar. Sie wusste nun, dass sie jetzt sterben würde.
Perfekt!
Befriedigt sehe ich zu, wie der Jeep sich überschlägt und über den Rand des Abgrunds in die Schlucht stürzt. Bäume wanken, der Schnee fällt in großen Haufen von den Zweigen, und die Geräusche von reißendem Metall und splitterndem Glas werden vom Sturm gedämpft.
Aber ich darf mich nicht auf meinen Lorbeeren ausruhen oder mir auf die Schulter klopfen, denn dort wartet Arbeit auf mich. Und diese hier, Regan Elizabeth Pescoli … nein, besser: Detective Pescoli ist anders als die anderen.
Womöglich erkennt sie mich.
Sofern sie lebt.
Sofern sie bei Bewusstsein ist.
Ich muss auf der Hut sein.
Rasch rolle ich die Plastikplane zusammen, die ich dort ausgebreitet hatte, von wo ich einen so perfekten, präzisen Schuss auf die Straße abfeuern konnte. Ich schnalle sie auf meinen Rucksack und vergewissere mich, dass die Skibrille meine Augen verdeckt und mein Gesicht von Skimütze, Kappe und Kapuze verdeckt wird. In der Gewissheit, meine Identität damit geheim halten zu können, schultere ich mein Gewehr und stapfe durch den hohen Schnee, froh darüber, dass die Verwehungen meine Spuren bald verdeckt haben werden.
Mein Fahrzeug habe ich in einem verlassenen Holzfällerlager abgestellt, zwei Meilen von der Stelle entfernt, wo der Jeep aufgeschlagen ist. Zwei Meilen durch steiles, unwegsames Gelände, das zu durchqueren mich Stunden kosten wird. Pescoli ist keine zierliche Frau, und womöglich wehrt sie sich.
Doch auf all das bin ich vorbereitet.
Ich wandere an der Rückseite des Berges hinab, der die Straße überblickt, an der Straße dann krieche ich durch ein Kanalrohr, um meine Spur zu verwischen. Es ist eng und dunkel, kein Wasser plätschert, und es dauert bedeutend länger, doch die zusätzliche halbe Meile ist der Mühe wert. Nicht nur, damit ich den schwachsinnigen Cops die Spurensuche erschwere, sondern auch, weil Detective Pescoli so noch länger der eisigen Luft ausgesetzt ist, die ihr tief in die Knochen kriecht. So wird sie eher bereit sein, Hilfe anzunehmen, gleichgültig, von wem. Auch wenn sie wachsam sein wird.
Ich glaube nicht daran, dass sie den Unfall überlebt hat und aus dem Wagen entkommen oder gar geflüchtet ist, nicht, nachdem ich gesehen und gehört habe, wie schwer der Jeep bei seinem Sturz vom Felsen beschädigt wurde. Doch selbst wenn ein Wunder geschieht und ihre Verletzungen es zulassen sollten, dass sie sich befreien und aus dem Wrack kriechen konnte, bin ich vorbereitet.
Bei dem Gedanken spüre ich den Adrenalinstoß in meinem Blut. Ich jage seit jeher gern, pirsche mich an meine Beute heran, teste mein Geschick an den würdigsten Gegnern.
Ich lächle unter meiner Neopren-Skimütze und bin mir bewusst, dass Regan Pescoli ganz sicher eine würdige Gegnerin ist.
Lauf doch, denke ich, und die Finger meiner rechten behandschuhten Hand spannen sich um mein Gewehr. Lauf nur wie der Teufel, Regan Pescoli! Du wirst mir nicht entkommen.
Pescoli bekam kaum Luft. Ihre Lunge war wie zugeschnürt, so furchtbar eng. Und die Schmerzen …
Sie hatte das Gefühl, als würde das gesamte Gewicht des zerbeulten Jeeps auf ihrem Körper lasten, ihre Muskeln quetschen, ihr die Luft aus den Lungen, das Leben aus dem Körper drücken.
Werde jetzt nur nicht theatralisch, Regan! Raus hier! Auf der Stelle! Rette dich!
Du weißt, was hier vorgeht, und das bedeutet nichts Gutes. Nein, es sieht äußerst böse für dich aus.
Verzweifelt versuchte sie, den Sicherheitsgurt zu lösen und den verflixten Airbag von ihrem Gesicht zu schieben. Schmerz schnitt durch ihre Schulter, und sie schrie gequält auf.
Während ihr Körper sonst auf jeden Befehl prompt reagiert hatte, war sie nun völlig hilflos.
Los, los! Dir bleibt nicht viel Zeit!
Sie wusste, dass er in diesem Moment dort draußen war. Sie konnte seine Nähe förmlich spüren.
Begriff, dass er in unerschütterlicher tödlicher Absicht näher kam.
Grundgütiger, beweg dich, Pescoli, nichts wie raus hier!
Sie hielt den Atem an, biss gegen den Schmerz die Zähne zusammen, zwängte die Finger in den Zwischenraum zwischen den Sitzen und drückte mit aller Kraft auf die Taste, die den Gurt löste.
Klick.
Endlich! Wenn sie jetzt irgendwie die eingedrückte Tür aufstoßen oder durch die Frontscheibe kriechen könnte … Doch nichts geschah, der Gurt ließ sich nicht öffnen.
Wie bitte? Nein!
Sie versuchte es noch einmal.
Wieder hörte sie das metallische Klicken der Verriegelung, aber das Ding klemmte. Genauso wie das Schloss ihres Gewehrhalters.
In panischer Angst versuchte sie es immer und immer wieder, verzog vor Schmerzen das Gesicht, fürchtete, dass der Mörder jeden Augenblick auftauchte, was das Ende vom Lied wäre. Ihr Ende.
Nicht aufgeben! Noch ist Zeit!
Das Blut, das aus einer Schnittwunde an ihrer Schläfe rann, gefror auf ihrer Haut, und sie zitterte, ihre Zähne klapperten. Wind und Schnee stürmten durch die zersplitterte Frontscheibe, und trotzdem lief ihr vor Angst der Schweiß über den Rücken.
Regan rechnete jetzt jede Sekunde damit, dass der Perverse auftauchte.
Nein, du bist kein wehrloses Opfer! Nichts wie raus aus diesem Fahrzeug!
Wenn sie doch bloß den Polizeifunk einschalten oder ihr Handy greifen könnte oder …
Noch einmal versuchte sie, den Sicherheitsgurt zu lösen, und musste einsehen, dass es sinnlos war, die verdammte Schnalle klemmte. Zum Teufel! Sie musste den Gurt durchschneiden … aber womit? Sie tastete die Konsole ab, versuchte, den Deckel zu öffnen, doch auch der klemmte. »Ach, nein«, fauchte sie leise und zwängte einen Finger in die Öffnung … In der linken Hand hielt sie immer noch die Waffe. In ihrer Hosentasche steckte ein Taschenmesser mit gezahnter Klinge. Wenn sie es nur irgendwie greifen könnte … oder das Funkgerät … oder ihr Handy … oder ihr Notrufgerät. Doch sie war nicht im Dienst, und deshalb lag das kleine Funkgerät, das sie manchmal an der Schulter trug, irgendwo auf dem Rücksitz. Sie hatte nicht gedacht, dass sie es bei ihrer Konfrontation mit Luke brauchen würde.
Verbissen versuchte sie, ihre Finger in ihre Hosentasche zu zwängen, um das Messer herauszuziehen, das den Sicherheitsgurt durchsägen könnte.
Mühsam schob sie die Hand hinein und kämpfte vergeblich gegen ihre Panik, gegen das Gefühl, dass sie jeden Moment unter Schock geraten und dann völlig hilflos sein würde.
So darfst du nicht einmal denken. Arbeite einfach weiter. Du schaffst das schon, du schaffst das.
Sie schluckte ihre Angst herunter, ertastete das Messer mit den Fingerspitzen. Mach schon, mach schon. Noch weiter zwängte sie die Hand in die Tasche und lauschte die ganze Zeit über das Klopfen ihres Herzens und das Rauschen des Winterwinds hinweg auf Schritte, das Knacken von Zweigen oder irgendein Geräusch, das nicht in diese winterliche Wildnis passte, auf Geräusche, die sie vor dem sich anschleichenden menschlichen Raubtier warnten.
Ihre Kollegen würden sie finden, das wusste sie. Irgendwann. Wenn ihr genug Zeit blieb, würde das Büro des Sheriffs ihr Fahrzeug entdecken. Immerhin hatte man es doch mit Signalgeräten ausgestattet. Der Jeep würde gefunden werden. Von den Guten.
Aber angesichts der Überlastung im Dezernat und ihrem eigenen Wunsch nach Zeit für sich allein würde sie wohl entweder gefangen genommen oder erfrieren, bevor man überhaupt daran dachte, sie zu suchen.
Angst und Wut erfassten sie. Sie spannte die Finger um das Messer.
Endlich!
Mit äußerster Konzentration zog sie die kleine Waffe an ihrem Bein hinauf aus der Tasche, fort von den Schmerzen. Ihre Hände zitterten, als sie das Messer schließlich freibekam. Sorgfältig klappte sie die Klinge heraus, dann stach sie wie verrückt auf den Airbag ein, der zischend langsam in sich zusammenfiel. Sie schob ihn von sich und begann, den Gurt durchzusägen. Ihre Wangen waren taub, ihre Finger begannen, vor Kälte starr und gefühllos zu werden.
Wäre sie unverletzt gewesen, hätte sie den Gurt problemlos durchschneiden können. So aber musste sie alle Kraft aufbieten. Sie begann zu sägen und fühlte eher, statt es zu sehen, dass sie nicht allein war.
Aber wo war er?
Sie erstarrte. Mit der Linken umklammerte sie ihre halbautomatische Glock. Verkrampft, wie sie war, brauchte sie die handliche Pistole. Sobald sie sich aus dem Wrack befreit hatte, konnte sie das Gewehr wieder in Betracht ziehen und versuchen, das Halterungsschloss zu öffnen.
Sie hörte nichts außer dem Heulen des Windes und ihrem eigenen angsterfüllten Herzschlag. Sie sah nur Weiß auf Weiß, Millionen von rasenden Schneeflocken, die vom Himmel fielen, und ihre eigene Fantasie gaukelte ihr Bilder vor. Ihr Herz raste.
Ich weiß, dass du da bist. Zeig dich!
Nichts. Sie fuhr mit der Zunge über ihre rissigen Lippen und sagte sich, dass sie sich lediglich Dinge einbildete. Gewöhnlich gab sie nicht viel auf »Bauchgefühl« und »weibliche Intuition« oder »Polizisteninstinkt«. Doch jetzt, in dieser einsamen vereisten Schlucht …
Hatte sich da etwas bewegt? Im Dickicht dort, nur drei Meter vom Jeep entfernt? Mit hämmerndem Herzen spähte sie hinaus. Eiskristalle rieselten auf ihr Gesicht herab.
Nichts.
Aber doch, da bewegte sich eindeutig etwas … Sie ließ das Messer fallen, fasste die Pistole mit beiden Händen und zielte durch die zersplitterte Frontscheibe. Wieder ein Schatten.
Sie drückte ab, als der Schatten vorsprang.
Bamm!
Die Kugel traf den Stamm einer schneebedeckten Kiefer. Borke, Eissplitter und Schnee spritzten auf.
Ein großer Rehbock sprang zwischen den Bäumen hervor, stob den Berg hinauf und verschwand im Schneegestöber.
»Ach«, flüsterte sie und fühlte sich wie in einem Adrenalinrausch. Ein Reh. Nur ein verängstigtes Reh.
Langsam stieß sie den Atem aus, fing wieder an zu sägen und hatte sich gerade selbst überzeugt, dass sie überreagierte, als sie in den Resten ihres Rückspiegels eine Bewegung sah. Sie schaute noch einmal hin; da war nichts mehr.
Nun reiß dich zusammen.
Ein letzter Schnitt mit dem Messer, und der Sicherheitsgurt gab sie frei. Im selben Moment spürte sie ein heißes Brennen im Nacken.
Was jetzt?
Sie schlug mit der flachen Hand auf ihren Nacken und fühlte etwas Kaltes, Metallisches, ein kleines Geschoss in der Nähe ihrer Halswirbelsäule. Eine eisige Faust legte sich um ihr Herz, als sie einen Pfeil herausriss.
Sie zitterte panisch. Beinahe hätte sie das verflixte Ding fallen gelassen. Jemand hatte auf sie geschossen, aber womit? In dem schlanken silbernen Behältnis mit der kurzen Nadel und dem verborgenen Mechanismus, der die unbekannte Substanz in ihren Körper katapultierte, konnte sich Gott weiß was an Drogen oder Gift befinden. Ihr war speiübel.
Nicht! Verlier jetzt nicht den Durchblick! Das Schwein ist ganz in der Nähe …
Wieder bemerkte sie eine Bewegung in den Resten des Rückspiegels – ein vages Huschen.
Sie blinzelte verzweifelt, hob die Pistole und wandte sich dem Fenster zu, doch es war zu spät. Schon gehorchten ihre Finger nicht mehr den Befehlen ihres Gehirns, die Bilder in ihrem Kopf wurden wirr, ein Prickeln überlief ihren gesamten Körper.
Das Mittel …
Wieder etwas Bewegtes in den Spiegelscherben.
Das Gewehr. Sie brauchte das Ge… wehr …
Sie versuchte zu agieren, nach dem Angreifer Ausschau zu halten, doch sie spürte nichts mehr, war taub an Körper und Geist. Ihr Kopf sank auf die Seite, die Pistole entglitt ihren Fingern, und die Welt begann, sich in gespenstischer Zeitlupe zu drehen. Alles um sie herum verwandelte sich in trübe, verschwommene Schemen.
»Nein!«, sagte sie. Ihre Zunge fühlte sich zu groß an. Vergeblich tastete sie nach ihrer Pistole.
Und dann sah sie ihn, seine vom zersplitterten Spiegel verzerrten Züge, seine große Gestalt in Weiß, das Gesicht von einer Skimütze verdeckt, die Augen hinter einer großen dunklen Skibrille verborgen.
Ihr Bewusstsein begann zu schwinden, sie glitt in eine Ohnmacht, als er sagte: »Detective Pescoli.« Seine warme Stimme ließ darauf schließen, dass er sie kannte. Er war nur noch ein paar Schritte entfernt … Wenn sie doch nur ihre Waffe auf ihn hätte richten können … »Anscheinend hatten Sie einen Unfall.«
Unter Aufbietung all ihrer Kräfte sah sie ihm ins Gesicht und fauchte: »Geh zum Teufel!«
»Da bin ich bereits, Detective, aber immerhin bin ich nicht mehr allein dort. Sie werden mir jetzt Gesellschaft leisten.«
Nie im Leben, dachte sie plötzlich wieder ganz klar. Sie tastete nach der Pistole, hob sie mit schlaffen Händen und drückte ab.
Ein paar Schüsse hallten durch die Schlucht. Aber sie verfehlten ihr Ziel. So nahe er ihr auch war, sie hatte ihn verfehlt, hatte nur Felsen und wer weiß was getroffen.
Er seufzte und schnalzte mit der Zunge. »Das wirst du bereuen.«
Sie wollte noch einmal feuern, doch ihre Finger gehorchten ihr nicht mehr, und alles, was sie tun konnte, als er näher rückte, war, nach ihm zu schlagen. Ihre Fingernägel verhakten sich in seiner Skimütze und ritzten seine Haut. Überrumpelt schrie er auf.
»Miststück!«
Ganz recht geschieht es dir, und jetzt habe ich Gewebe und DNA unter den Fingernägeln. Falls ich je gefunden werde, bist du so gut wie tot.
Sie sah, wie Blut aus den Kratzern quoll und er in eine Art Päckchen griff und ihm etwas entnahm … eine Schürze? Gott, sie konnte nicht klar sehen … alles war so verzerrt … Doch sie erkannte das Kleidungsstück in seiner Hand …
Eine Zwangsjacke?
Eiskalte Angst erfasste sie. Ihr war bewusst, dass er sie nicht einfach oder schnell sterben lassen würde. Er würde sie am Leben erhalten, sie quälen, gesund pflegen und sie dann gnadenlos töten, genauso wie die anderen.
Aber in einer Zwangsjacke? Das hieße, gefesselt und völlig hilflos zu sein …
Es war, als würde er ihre schlimmsten, abgründigsten Ängste kennen.
Schneegestöber wirbelte vor ihren Augen herum, sein Anblick und der der Zwangsjacke verschwammen inmitten der tanzenden eisigen Flocken. Als sie das Bewusstsein verlor, empfand sie keine Angst, nur eine wilde Entschlossenheit, diesen Mistkerl, sollte sie je wieder zu sich kommen, restlos fertigzumachen. Endgültig. Ihn dahin zu schicken, wo er das Licht der Sonne niemals wiedersehen würde.
Sie konnte nur hoffen, dass sie eines Tages die Chance dazu bekam.
2. KAPITEL
Heute
Wo kann sie nur sein?
Ein heftiger Sturm pfiff durch die Schluchten der Umgebung, als Nate Santana, das Handy ans Ohr gepresst, im Stall auf und ab stapfte. Das schmale, nutzlose Gerät gab keinen Ton von sich. »Komm schon, komm schon«, drängte er, wohl wissend, dass es sinnlos war.
Regan war wieder einmal missing in action.
Der kleine Monitor zeigte an, dass das Handy keinen Empfang hatte.
Frustriert schob Santana es in die Tasche seiner verschlissenen Jeans und ermahnte sich, die Ruhe zu bewahren. Er war einfach überreizt aufgrund der Ereignisse der letzten paar Wochen in dem verschlafenen Städtchen Grizzly Falls. Sonst nichts.
Und trotzdem nagte die Sorge in seinen Eingeweiden und rief ihm ins Gedächtnis, dass alles, was in seinem Leben gut war, zu verschwinden pflegte, und dass Pescoli mit ihrem sexy Körper das Beste war, was ihm seit langer, langer Zeit passiert war … wahrscheinlich seit Santa Lucia …
Seine Gedanken verdüsterten sich, als er sich die letzte Frau in Erinnerung rief, die sein Leben verändert hatte, und er verdrängte ihr schönes Bild. Shannon Flannery war Schnee von gestern.
Im Moment musste er sich der Tatsache stellen, dass Regan seine Anrufe ignorierte.
Oder etwa nicht?
Er fuhr sich mit der Hand durchs Haar und starrte böse in die Reithalle, aus der ein besonders starrsinniges und nervöses Hengstfohlen seinen Blick herausfordernd erwiderte.
Gewöhnlich ließ Santana sich von Tieren bereitwillig ablenken. Seiner Erfahrung nach waren sie bedeutend einfacher im Umgang als Menschen. Vertrauenswürdiger. Beständiger. Doch an diesem eisigen Morgen konnte er sich nicht konzentrieren. Immer wieder schweiften seine Gedanken zu Regan ab.
Verflixt, ihn hatte es erwischt. Und es passte ihm ganz und gar nicht, dass sie ihm so unglaublich unter die Haut ging. Du hast es zugelassen. Du hast zugelassen, dass ein flüchtiges Techtelmechtel ohne Verpflichtungen sich zu einer ausgewachsenen Affäre entwickelte, die schon fast an eine Beziehung grenzt.
Bei dem Gedanken biss er die Zähne zusammen.
Sie war die letzte Frau, mit der er sich hätte einlassen sollen. Die absolut schlimmste!
Im Geiste schalt er sich, belegte sich mit einer langen Liste von Schimpfwörtern, die zunehmend abwertender wurden. Seit langer Zeit war keine Frau in sein Hirn vorgedrungen oder hatte bewirkt, dass er zu jeder Tages- und Nachtzeit überlegte, wie er sie ins Bett bekommen konnte. Und Regan war außerdem noch Polizistin im Büro des Sheriffs von Pinewood County.
Was besagte das?
Dass er sie auf jeden Fall meiden musste!
Doch sie hatte ihn angezogen wie eine Oase einen Verdurstenden in der Wüste.
Ein Blick aus dem Fenster bestätigte, dass die Mutter aller Unwetter nicht nachließ. Eisiger Wind heulte durch die tiefen Schluchten in diesem Teil von Montana. Eis überzog die Scheiben von außen, und der Schnee fiel so dicht und schnell, dass er die Lichter seiner Unterkunft in knapp drei Metern Entfernung nicht sehen konnte.
In dem riesigen Stall mit Trainingshalle war es warm. Das Heizsystem ächzte und wirbelte den Staub des vergangenen Sommers auf. Die vertrauten Gerüche von Sattelfett und Pferdedung, Gerüche, die er von jeher kannte, stiegen ihm in die Nase. Pferde scharrten in ihren Boxen mit den Hufen; eines, die nervöse Stute, wieherte leise. Lauter Geräusche und Gerüche, die sonst beruhigend auf ihn wirkten. Im Grunde fühlte sich Nate Santana Tieren viel enger verbunden als den meisten Menschen. Insbesondere Frauen.
Bis auf die verflixte Regan Pescoli.
Mit ihren zwei Kindern.
Den zwei beendeten Ehen.
Ihre Beziehung, die eigentlich nur auf Sex basierte, war in keiner Weise romantisch oder konventionell.
Keine Gelöbnisse.
Keine Versprechungen.
Keine Verpflichtungen.
Keine große Sache.
Oder?
Warum war er dann jetzt so gereizt und nervös? Warum störte es ihn, dass er sie nicht erreichen konnte? Es war auch früher schon vorgekommen, dass sie sich tagelang nicht gesprochen hatten, gelegentlich sogar eine ganze Woche nicht. Allerdings nicht in letzter Zeit. In den vergangenen paar Monaten hatten sie sich nahezu täglich gesehen. Oder allnächtlich. Und darüber hatte er sich keineswegs beklagt.
Er sagte sich, dass der Handy-Empfang hier oben bekanntermaßen schlecht war und dass es nichts Neues war, wenn das Gerät keinen Empfang meldete. Selbst Brady Long, Santanas Arbeitgeber, eine echte Nervensäge und reicher Kupfer-Erbe, der sich nicht scheute, mit Geld um sich zu werfen, schaffte es nicht, in der näheren Umgebung einen Funkturm errichten zu lassen. Was Santana normalerweise nicht störte. Von Natur aus ein Einzelgänger, weckte die Technologie in ihm weder Interesse noch Vertrauen.
Außer an diesem Morgen.
Was soll’s, wenn du sie nicht erreichen kannst? Du weißt doch, dass sie bis über beide Ohren in ihren Polizeiangelegenheiten steckt. Der Unglücksstern-Mörder ist noch auf freiem Fuß, und dieser Schneesturm verursacht vermutlich einen Notfall nach dem anderen, Stromausfall in den Häusern, von der Straße gerutschte Fahrzeuge, Erfrorene. Sie hat zu tun. Das ist alles. Kein Grund zur Panik.
Trotzdem spürte er es. Diese leise, bedrohliche Vorahnung, die ihm die Nackenhaare sträubte und es ihm sauer in die Kehle trieb, immer dann, wenn Unheil drohte. Nicht, dass er nicht selbst genug Herzen gebrochen und Kummer heraufbeschworen hatte, aber trotzdem, er konnte Böses vorausahnen, schon seit seiner Kindheit.
»Daran ist dein Indianerblut schuld«, hatte sein Vater immer gebrummt, wenn Nate von diesen Vorahnungen sprach. »Mütterlicherseits. Ihr Urgroßvater – oder war’s der Ur-Urgroßvater? – war eine Art indianischer Schamane gewesen. Konnte Leute durch Handauflegen heilen. Oder verfluchen. Behauptet deine Mutter jedenfalls. Er war Arapaho, glaube ich, oder doch Cheyenne? Auch egal. Einmal hat er im Traum eine Klapperschlange gesehen, und das reichte. Er wurde Medizinmann. Hatte wahrscheinlich die gleichen komischen Vorahnungen wie du, mein Junge.«
Nach solchen leicht getrübten Erkenntnissen biss sein Alter dann einen Klumpen Kautabak ab und kaute ihn höchst zufrieden durch, um ihn gleich wieder auszuspucken und sich mit dem Ärmel den Mund abzuwischen. »Nichts als Blödsinn, wenn du meine Meinung wissen willst.«
Santana allerdings hatte seine Bauchgefühle nicht eine Sekunde auf seine Herkunft zurückgeführt. Doch an diesem Abend spürte er etwas da draußen. Etwas Dunkles und vertraut Böses. Etwas Bedrohliches. Für Regan.
Er biss die Zähne zusammen und riet sich, es zu ignorieren. Er mochte solche Vorahnungen nicht und wollte sich keinesfalls wie Ivor Hicks wegen seiner angeblichen Entführung durch Aliens dem Gespött der Leute aussetzen, oder wie Grace Perchant, der Frau, die Wolfshunde züchtete und behauptete, mit den Toten zu kommunizieren, oder Henry Johansen, ein Bauer, der vor fünfzehn Jahren vom Traktor gestürzt war, sich den Kopf angeschlagen hatte und seitdem sagte, er könnte die Gedanken anderer »hören«. Nein, Santana hielt lieber den Mund, wenn es um seine Vorahnungen ging, statt sich vor den Leuten in der Stadt lächerlich zu machen.
Was Regan betraf, so würde er sie früher oder später schon treffen. So war es immer. Außerdem waren sie ja schließlich nicht verheiratet und eigentlich noch nicht einmal ein Paar; so und nicht anders wollten sie es beide.
Er ging in die Reithalle, wo Lucifer ihn nach wie vor böse ansah und mit den Hufen im weichen Boden scharrte. Er war ein großes schwarzes Hengstfohlen mit einer zackigen Blesse und einer weißen Socke und einem garstigen Charakterzug, den die einen als Freiheitsliebe bezeichneten, andere aber schlicht als Widerspenstigkeit. Für Nate war es dasselbe. Jetzt blähte das langgliedrige Fohlen die Nüstern, in den Augen war das Weiße sichtbar, sein glattes Fell schwitzte und wies Schaumflecke auf.
»Alles ist gut«, sagte Santana leise, obwohl er tief im Inneren vom Gegenteil überzeugt war. Und das Pferd wusste es auch. Darin bestand Santanas Begabung oder vielmehr seine »Gabe«. Er liebte Tiere nicht nur, er konnte sie auch verstehen, insbesondere Pferde und Hunde. Er respektierte sie so, wie sie waren, dichtete ihnen keine menschlichen Züge an und hatte nach Jahren der Beobachtung und des Sammelns von Erfahrungen gelernt, mit ihnen zu arbeiten.
Manche bezeichneten ihn als schrägen Vogel, andere verglichen ihn mit einem Schlangenbeschwörer oder führten es auf sein halbindianisches Erbe zurück, während er im Grunde nur Vernunft, Entschlossenheit und Freundlichkeit einsetzte. Er wusste einfach, wie er mit Tieren zu arbeiten hatte. Vielleicht lag das an dem Arapaho in ihm, aber er glaubte es eher nicht.
Nate nahm ein Seil von einem Haken an der Wand, schlüpfte durch das Tor der Reithalle, und als es hinter ihm klickend ins Schloss fiel, näherte er sich langsam dem Pferd. Wieder jaulte der Wind durch die Schluchten und rüttelte an den Fenstern, woraufhin es in der Schulter des großen Hengstfohlens zu zucken begann.
»Schschsch.« Santana kam immer näher. Stetig. Ruhig. Obwohl er tief im Inneren genau die Anspannung empfand, die das Pferd ausstrahlte, eine Angst, vergleichbar der Panik in Lucifers wild rollenden Augen. Jeden Augenblick konnte das Tier durchgehen.
Rumms! Die Tür zum Stall wurde aufgestoßen.
Santana erstarrte.
Und Lucifer schoss davon wie der geölte Blitz. Von null auf fünfzig in drei kurzen Sprüngen, mit aufblitzenden, donnernden Hufen, ließ er den Sand aufspritzen und galoppierte so dicht an Santana vorüber, dass dieser den Atem des Tieres hörte und seine Körperwärme spürte. Der eisige Wind von Montana stob heulend in den Stall.
Santanas Hund, ein großer Sibirischer Husky, jaulte so laut auf, dass es im Nachbarland hätte Tote aufwecken können, und sämtliche Pferde im Stall schnaubten, wieherten und scharrten nervös mit den Hufen.
»Nakita, still!«, befahl Santana, und der große Hund, die blauen Augen nach wie vor auf Santana gerichtet, legte sich widerwillig nieder.
Lucifer stob mit erhobenem Schweif und rollenden Augen in dem eingezäunten Rund auf und ab. Hätte er die Möglichkeit gehabt, wäre er über die oberste Latte des Gatters gesprungen und so schnell und weit galoppiert, wie seine kräftigen Beine ihn trugen, zur Tür hinaus und quer über Brady Longs zweitausend Morgen Land.
»Toll«, knurrte Santana im Wissen, dass das bisschen Zutrauen, das er dem ängstlichen Hengstfohlen abgerungen hatte, zerstört war. »Einfach … toll, verdammt noch mal.«
Er wandte sich der offenen Tür zu und hielt Ausschau nach dem Dummkopf, der die Tür zugeknallt hatte. »Hey!«, rief er, stieg auf das Gatter, das den Trainingsbereich vom restlichen Stall abtrennte, sprang über die oberste Latte und landete geschickt auf den gestiefelten Füßen.
Kein Mensch tauchte, den Schnee von den Schuhen stampfend und sich gegen die Kälte schüttelnd, an der Tür auf. Nur Nakita winselte und blickte hinaus in die dunkle Nacht.
Eiskalte Luft strömte in den Stall, doch niemand ließ sich blicken.
Nate stieß die Tür zu und prüfte das Schloss. Eine ominöse Angst kroch ihm über den Rücken. Die Tür war fest verschlossen gewesen, der Riegel vorgeschoben. Dessen war er sicher. Er hatte die Tür eigenhändig verriegelt.
Oder hatten die Gedanken an seine verschwundene Freundin ihn so abgelenkt, dass er nachlässig gewesen war? Hatte eine steife Brise die alte, nicht verriegelte Tür aufgestoßen? Das Schloss war schon lange ein Problem. Er hatte es längst reparieren wollen; allerdings stand so etwas nie ganz oben auf seiner Dringlichkeitsliste.
Wieder hatte er das unheimliche Gefühl, dass jemand in der Nähe, dass er nicht allein war. Doch er hörte nichts außer dem Hufescharren in den Boxen und dem Schnauben der Pferde, die sich in ihrem gewohnten Tagesablauf gestört fühlten. Santana richtete den Blick auf die Boxen und bemerkte, dass die Rotschimmelstute und der braune Wallach in den angrenzenden Boxen in eine Ecke bei den Futterbehältern starrten. Lucifer hatte seinen wilden Galopp aufgegeben, hielt den Kopf jedoch hoch erhoben und blähte die Nüstern. Er verlangsamte seinen Schritt; sein Fell zuckte, und er starrte Santana direkt an.
Nate schnappte sich eine Heugabel vom Haken an der Wand und machte zwei Schritte in Richtung der verschatteten Ecke bei den Haferbehältern.
Klingeling! Das Stalltelefon schrillte.
Santana fuhr heftig zusammen.
Mit einer behandschuhten Hand umklammerte er den Forkenstiel, ging zurück und hob den Hörer des neben der Tür angebrachten Telefons ab. »Santana«, bellte er, den Hörer ans Ohr gepresst, und ließ den Blick durchs Stallinnere wandern.
»Hier spricht Detective Selena Alvarez vom Büro des Sheriffs von Pinewood County.«
Jeder Muskel in seinem Körper spannte sich an. »Ja?«
»Ich bin Detective Regan Pescolis Partnerin.«
Das wusste er bereits. Allerdings wusste er nicht, ob Regan Alvarez anvertraut hatte, dass sie mit ihm, Santana, zusammen war.
»Mhm.«
»Pescoli ist heute nicht zur Arbeit gekommen. Ich dachte, Sie wüssten vielleicht, wo sie steckt.«
Also war, was ihre Affäre betraf, die Katze aus dem Sack. Schön. »Ich habe sie nicht gesehen.«
»Und gestern Abend?«
Nate knirschte mit den Zähnen. »Nein.«
»Hören Sie, ich weiß, dass Sie was miteinander haben. Sie spricht zwar nie darüber, aber ich habe eins und eins zusammengezählt. Also, falls Sie wissen, wo sie steckt …«
»Ich weiß es nicht«, fiel er ihr ins Wort. »Neulich Abend waren wir zusammen. Seitdem habe ich sie nicht gesehen«, gab er zu und biss die Zähne zusammen. »Ich habe sie auf dem Handy und dem Festnetz angerufen. Keine Antwort.«
»Das habe ich befürchtet.« Die Frau fluchte leise; ihre Stimme klang ratlos. Santana wurde innerlich kalt. »Falls Sie von ihr hören, sagen Sie ihr bitte, dass sie sich melden soll?«
»Ja.« Er spürte, dass Alvarez im Begriff war aufzulegen, und fragte rasch: »Was glauben Sie, wo ist sie?«
»Wenn wir das wüssten, würde ich Sie nicht anrufen.« Sie legte auf, und das Wörtchen wir hallte in seinem Kopf nach. Er legte den Hörer auf. Sein Magen verkrampfte sich, sein Gefühl, dass etwas nicht stimmte, hatte sich bestätigt. Wenn man noch nicht einmal bei der Polizei wusste, wo sie war, standen die Dinge schlimmer, als er befürchtet hatte.
Bumm!
Grace Perchant riss schlagartig die Augen auf.
Wenngleich sie glaubte, sie gar nicht zugemacht zu haben.
Sie blinzelte. Versuchte, einen klaren Gedanken zu fassen, als der Knall, wie ein Donnerschlag ganz in der Nähe, erneut durch ihren Kopf schoss.
Um sie herum fiel Schnee, und sie befand sich mitten auf der Straße, in Stiefeln, ihrem Flanellnachthemd und einem langen Mantel, der ihr um die Beine schlug. Ihre Haut war eisig kalt. Ihr Hund, Sheena, war in der Nähe, wachsam und treu wie immer. Mit intelligenten Augen und schwarzem Fell, das ihre Abstammung von Wölfen Lügen strafte, wartete Sheena geduldig wie immer. Sie wartete, selbst wenn Grace einen ihrer Anfälle erlitt.
»Lieber Gott«, flüsterte Grace zitternd. Ihre Finger und Zehen waren nahezu taub, ihr Atem stand wie eine Wolke vor ihrem Mund.
Bilder aus ihrem Traum schwirrten ihr durch den Kopf. Lebensecht. Erbarmungslos. Real. Wie Glasscherben bohrten sie sich in ihr Hirn. Wie in einer Momentaufnahme sah sie das grauenhafte Bild einer Frau in einem zerbeulten Jeep, von Schmerz geschüttelt. Und einen Stalker. Der Böse, der sie aufspürte.
Grace’ Puls beschleunigte sich, als das Bild einem anderen wich. Jetzt sah sie dieselbe Frau in einer Zwangsjacke, wie sie aus der winterlichen Schlucht geschleppt wurde. Von einem Mann in Weiß, einem Mann mit bösen Absichten.
Rasch veränderte sich die Szene, und das weibliche Opfer stand jetzt nackt an eine kältestarre Tanne gefesselt, das rote Haar steif von Eis und Schnee, die goldbraunen Augen groß vor Angst. Ihre Haut verfärbte sich bläulich.
Regan Pescoli. Die Polizistin.
Mit betäubender Sicherheit wusste Grace, dass der Mörder sie erwischt hatte. Sie überfallen hatte. Sie umbringen wollte. Wenn er es nicht schon getan hatte.
Es war nicht das erste Mal, dass eine Vision sie heimsuchte; schon einmal hatte sie einen Blick auf die dem Kerl eigene, erbarmungslose Grausamkeit erhascht.
Zu dem Zeitpunkt, es war erst ein paar Tage her, hatte Grace versucht, Pescoli zu warnen, wollte sie auf die drohende Gefahr hinweisen, doch die Polizistin hatte nicht auf sie gehört.
Wie alle anderen auch.
Gut, jetzt waren die Visionen plastischer. Deutlicher. Sie blickte zum dunklen Himmel auf, spürte, wie die kalten Schneeflocken auf ihrer Haut schmolzen. Ihre Zähne schlugen aufeinander. Wie lange war sie schon hier draußen? Wie lange war sie schon wie eine Schlafwandlerin diese kurvenreiche, einsame Straße entlanggetrottet?
»Komm, Sheena«, sagte sie und schlang gegen den Wind, der durch die Berge raste, die Arme um ihren Körper. »Schnell nach Hause.«
Der große Hund – er wog an die einhundertundfünfzig Pfund – trabte entschlossen los, durch die frischen Spuren, die sich bereits mit Schnee füllten, ihre eigenen Spuren und die Pfotenabdrücke des Wolfshunds, die dahin zurückführten, von wo sie gekommen waren, den Weg, an den sie sich nicht erinnerte.
War sie ein paar hundert Meilen oder nur eine Meile weit gelaufen? Bei Nacht sah die froststarre weiße Landschaft überall gleich aus. Und ihr Verstand, nach einer Vision gewöhnlich klarer denn je, erkannte keinen einzigen vertrauten Orientierungspunkt. Doch die Spuren waren frisch, und sie glaubte nicht, dass sie sich schon Erfrierungen zugezogen hatte. Doch sie stand wohl kurz davor. Sie musste beinahe rennen, um mit dem Hund Schritt zu halten.
Sie hasste ihre Visionen – anders konnte man sie nicht bezeichnen –, und sie wünschte sich, dass das einmal aufhören würde, aber vergebens. Damit ist es erst vorbei, wenn ich sterbe, dachte sie missmutig und zog den Mantel fester um sich, den sie sich nicht entsann, angezogen zu haben. Ihre Stiefel knirschten im weichen Schnee.
Die Visionen hatten eingesetzt, als sie dreizehn war und der Unfall passierte, der ihre Eltern und ihre ältere Schwester Cleo das Leben gekostet hatte. Es geschah in einer Winternacht ähnlich der jetzigen. Sie und Cleo hatten sich auf dem Rücksitz gestritten, während ihr Vater in den aufkommenden Schneesturm blinzelte. Ihr alter Volvo quälte sich bergauf, der Vier-Zylinder-Motor grollte laut, die Reifen gerieten leicht ins Rutschen, aus dem Radio ertönte statisches Knistern.
»Dieser idiotische Schnee«, knurrte Vater. »Ich schwör’s euch, nächstes Frühjahr ziehen wir nach Florida!«
»Nein!« Cleo hatte ihn gehört. »Wir können doch nicht umziehen! Alle meine Freunde sind hier!«
»Egal«, blieb er bei seinem Entschluss und schaltete das Radio aus. Er blickte verbissen drein, wie immer, wenn er einen Entschluss gefasst hatte. Das Scheinwerferlicht eines entgegenkommenden Fahrzeugs strahlte sein Gesicht an und ließ seine Züge im Profil scharf erscheinen. Grace, die hinter ihrer Mutter auf dem Rücksitz saß, fand, dass er plötzlich sonderbar aussah, so zerfurcht und hart.
Cleo schmollte und verlangte von ihrer Mutter: »Sag ihm, dass wir nicht umziehen können!«
Ihre Mutter drehte sich um, sah Cleo an und sagte ruhig: »Natürlich ziehen wir nicht um.«
»Ich meine es ernst.« Vater blinzelte; die Scheinwerfer näherten sich der geschwungenen Brücke über den Boxer Creek, der sich mehr als fünfzehn Meter tiefer durch die Schlucht gegraben hatte.
»Das kannst du nicht machen!« Cleo löste ihren Sicherheitsgurt und beugte sich vor, bettelte, strich sanft über seine verspannte Schulter. »Das darfst du nicht einmal im Scherz sagen. Ich ziehe nicht um.«
»Liebling, wir ziehen nirgendwohin. Dein Vater ist Vorarbeiter in der Mine. Komm, mach dir deswegen keine Gedanken.«
Und dann: »Was soll das?« Die Stimme ihres Vaters klang gepresst vor Schreck, als das Fahrzeug auf der Gegenspur näher kam. »Blende doch ab, du Dummkopf.« Er betätigte die Lichthupe.
»Hank«, wies ihre Mutter ihn zurecht. Zwei blendende Lichtsäulen fluteten das Wageninnere mit grellem weißem Licht. »Hank! Pass auf!«
Zu spät!
Vater riss das Steuer herum, um die drohende Kollision zu vermeiden, und der Wagen geriet ins Schleudern. Unkontrollierbar. Der überholende Lastwagen prallte gegen das Heck, und der Volvo begann, wie verrückt zu kreiseln.
Cleo schrie und wurde gegen Grace geschleudert.
Grace’ Kopf schlug gegen das Seitenfenster. Ihr Schädel schien vor Schmerzen zu explodieren.
Mutter schrie: »Pass auf, pass auf, o nein!« Der Wagen prallte gegen die Leitplanke, wurde auf den eisglatten Asphalt zurückgeworfen und rutschte immer schneller auf die andere Seite der Brücke zu.
Inmitten des grauenhaften Ächzens von reißendem Metall durchbrach der Volvo die Leitplanke. Reifen platzten, Glas zersplitterte.
Der Wagen stürzte ab!
Cleo schrie. Mutter betete. Und Vater fluchte, während Grace das Bewusstsein verlor.
Sie spürte den Aufprall nicht, der ihrer Mutter das Genick brach und gebrochene Rippen in die Lungen ihres Vaters trieb. Sie war nicht präsent, um zu bezeugen, wie Cleo aus dem Auto geschleudert, von ihm überrollt wurde und solche Quetschungen erlitt, dass sie sofort tot war.
Achtzehn Tage später erwachte Grace im Krankenhaus und musste erfahren, dass ihre gesamte Familie ausgelöscht war. Alle tot. Sie hatte überlebt, obwohl sie im Wasser des Bachs halb erfroren und ihre Körpertemperatur beängstigend niedrig gewesen war. Nur ein paar blaue Flecke vom Sicherheitsgurt und eine Gehirnerschütterung zeugten von ihrer Anwesenheit in dem Todesfahrzeug. Ein beteiligter Fahrer oder ein beschädigtes Fahrzeug wurde nie aufgespürt, und als sie erfuhr, dass ihre Familie tot war, hatte sie schlicht »Nein« gesagt.
Weil sie sie doch alle noch sehen konnte. Mit ihnen redete.
Mit allen: mit Vater, Mutter und Cleo. Auch jetzt noch. Nach mehr als vierzig Jahren.
Das Pflegepersonal war natürlich überzeugt davon, dass sie verrückt war, halluzinierte, Bilder heraufbeschwor.
Wenn es nur so wäre, dachte sie jetzt, als der Hund um eine Kurve bog und sie ihr Häuschen sah, eingefasst von Schneewehen und dunkel wie die Sünde auf einem kleinen Hügel am Straßenrand. Grace rieb sich die Arme, beschleunigte ihren Schritt und sagte sich, dass man ohnehin nicht auf sie hören würde, wenn sie jemandem von ihrer letzten Vision erzählte. Dass man wieder über sie lachen würde.
Vor dem Unfall, als Kind, hatte sie sich manchmal in Tagträumen verloren. War allein auf dem Schulhof zurückgeblieben, ohne den Schulgong oder das Johlen und Lachen der anderen Kinder zu hören.
Dann hatten sie sie gehänselt, und oft war sie weinend nach Hause gelaufen, um von ihrer Mutter tröstend gesagt zu bekommen, sie sei eben »besonders«, während Cleo vor »der Verrückten«, wie sie ihre Schwester nannte, zurückschreckte. Zu dieser Zeit wurden ihre Träume lediglich als Fantasien eines »begabten« Kindes abgetan. Medizinische Ursachen für ihre zeitweiligen Absenzen ließen sich nicht feststellen. Und wenngleich IQ-Tests und Prüfungen sie als völlig normal auswiesen, hatte ihre Mutter ihr immer eingeflüstert, sie wäre klüger als die anderen, die sie grausam verspotteten, dass sie, die anderen, die sie »Blöde« nannten, zu bedauern wären.
Doch die Sticheleien auf dem Schulhof trafen sie tief. Nach dem Unfall sprach Grace immer noch regelmäßig mit ihren verstorbenen Eltern und ihrer toten Schwester, was ihre Tante Barbara sehr ängstigte, und nachdem sie die ersten Welpen aufgenommen hatte – zwei Wölfe, deren Mutter einem Wilderer zum Opfer gefallen war –, häuften sich ihre Visionen. Wurden realer, deutlicher.
Diese Schulhofrüpel hatten recht. Ihr Zustand war absonderlich.
Jetzt folgte sie dem Weg bis zu ihrer Haustür und sah, dass sie halb offen stand. Im Haus war es kalt, denn die uralte Heizung war den arktischen Temperaturen nicht gewachsen, die der heulende Wind ins Haus trieb. Sie schloss die Tür hinter sich, schaltete das Licht an und schlüpfte aus ihren Stiefeln.
Sie war überreizt. Kribbelig. Übernervös.
Sie hängte ihren Mantel in den Garderobenschrank, warf ihren Morgenrock über und zog den Gürtel straff. Mit Kleinholz, das sie neben dem Kamin gestapelt hatte, zündete sie ein Feuer an, hockte sich auf ihre Fersen und sah zu, wie die Flammen Papier und trockenes Holz verzehrten. Als das Feuer aufzüngelte und knisternd und zischend Wärme versprach, rollte Sheena sich auf einem dicken Polster zusammen, das Grace genäht hatte.
»Braves Mädchen«, sagte Grace und wärmte sich die Hände. Ihr Blick fiel auf die Uhr auf dem Kaminsims neben dem verblassenden, gerahmten Foto ihrer Familie. Es war Morgen, wenige Stunden vor Sonnenaufgang, und die Bilder von Regan Pescoli bedrängten sie immer noch.
Das Feuer brannte hell. Goldene Schatten huschten durch den kleinen Wohnbereich des Hauses, in dem sie ihr ganzes Leben zugebracht hatte.
»Eine Bürde«, vertraute sie Sheena an, die, den Kopf auf die Pfoten gelegt, Grace unverwandt ansah. Kein Wunder, dass sie so viel einstecken musste.
Rod Larimer, der Eigentümer des »Bull and Bear«, einer Art Gasthof in der Stadt, hatte sie als »unsere dorfeigene Verrückte« bezeichnet. Und Bob Simms, der Jäger, der vor zwanzig Jahren die Wölfin erschossen hatte, sollte gesagt haben: »Ein total verrücktes Huhn. Absolut gaga. Gehört eingesperrt, wenn ihr mich fragt.« Manny Douglas, der für den Mountain Reporter schrieb, hatte sie einmal als »Teil des Lokalkolorits von Grizzly Falls« beschrieben. Manny hatte sie freundlicherweise mit Ivor Hicks in einen Topf geworfen, der glaubte, in den Siebzigern von Aliens entführt worden zu sein, und mit Henry Johansen, einem Bauern, der bei einem Sturz vom Traktor auf den Kopf gefallen war und seitdem behauptete, er könne Gedanken lesen.
Wie du?, fragte sie sich und starrte ins Feuer.
Nicht alle in der Stadt hielten sie für verrückt. Einige Leute fanden sogar Gefallen an der Hellseherei, fanden sie und Grace faszinierend. Sandi Aldridge, die Eigentümerin des »Wild Will’s«, war immer freundlich, und Tante Barbara war zwar verärgert, weil sie hierher umziehen musste, um das einzige noch lebende Kind ihres Bruders zu versorgen, hatte ihr jedoch stets geraten, die Gabe als Gottesgeschenk anzunehmen.
Ha. Grace griff nach dem Schürhaken und stocherte im Feuer, so dass die Funken flogen und die rote Glut noch heller aufleuchtete. Der Gang zum Büro des Sheriffs von Pinewood County würde kein Vergnügen für sie sein. Ganz und gar nicht. Sheriff Dan Grayson mochte sie nicht, und Pescolis Partnerin, Selena Alvarez, wirkte kalt und distanziert. Allerdings hatte diese Frau auch Geheimnisse, die sie streng hütete. Dessen war sich Grace sicher. Und die Vorstellung, Grayson oder Alvarez oder sonst jemanden von der Polizei von ihrer Vision überzeugen zu müssen, behagte ihr gar nicht. Ihr graute vor dem Hohn, mit dem man sie überschütten würde.
»Was soll ich tun?«, fragte sie den Hund, und in diesem Moment hörte Grace die Stimme ihres Vaters, glockenklar. »Sei klug«, empfahl er ihr mürrisch. »Halte doch einfach den Mund.«
Doch wie im Leben, so auch jetzt, war ihre Mutter anderer Meinung. »Hör nicht auf das, was andere über dich reden. Das Leben einer Frau steht auf dem Spiel. Du bist es ihr schuldig zu sagen, was du weißt.«
»Ich weiß überhaupt nichts«, wandte Grace ein. Ihre Zehen wurden langsam wieder warm.
»Nein?« Ihre Mutter schien ihr zum Greifen nah, aber natürlich sah Grace niemanden, nicht einmal einen durchscheinenden geisterhaften Umriss. Sie hörte nur Stimmen. Wie immer.
Sie richtete sich auf und nahm das Foto vom Kaminsims. Der Anblick ihrer auf der vorderen Veranda zusammengedrängten Familie zerriss ihr das Herz. Doch rasch drängte sie die sehnsüchtige Rührseligkeit und das Selbstmitleid beiseite.
Wieder tauchten Bilder von Regan Pescolis gequältem Gesicht vor ihr auf, und Grace holte tief Luft, um sich wieder zu beruhigen. Es war nur eine Frage der Zeit, wann sie sich zusammenriss und sich der Lächerlichkeit preisgab, indem sie ihre Vision der Polizei offenbarte.
»Weißt du«, sagte sie zu dem inzwischen schlafenden Hund, »manchmal ist ›Gabe‹ ein anderes Wort für Fluch.«
Schlag drei Uhr.
Selena Alvarez saß an ihrem Schreibtisch im Büro, putzte sich die Nase und blickte ärgerlich auf den Monitor ihres Computers. Sie hatte Pescoli auf dem Handy angerufen, keine Antwort erhalten und daraufhin versucht, den Ex-Mann ihrer Partnerin, Luke »Lucky« Pescoli zu erreichen, doch der meldete sich einfach nicht. Schließlich hatte sie noch einmal Nate Santana angewählt, aber vergeblich. Zwar hatte Pescoli ihr den Namen des letzten in der Reihe ihrer Taugenichts-Lover nicht verraten, doch Alvarez war überzeugt davon, dass sie sich mit Santana traf. Der Kerl entsprach genau Pescolis Typ: ein gutaussehender Herumtreiber, der vor ein paar Jahren in die Stadt eingefallen und Selenas Partnerin erst kürzlich ins Auge gesprungen war.
In Bezug auf Männer lernte Pescoli einfach nichts dazu.
Ihr erster Mann, Joe Strand, war Polizist gewesen und im Dienst erschossen worden, doch seine Moralvorstellungen galten als fragwürdig. Pescoli hatte Alvarez gestanden, dass sie Strand, ihre College-Liebe, geheiratet hatte, als sie wusste, dass sie schwanger war. Ihre Ehe sei zerrüttet gewesen, es habe während einer vorübergehenden Trennung jede Menge Affären gegeben. Luke Pescoli, ihr Ex-Mann, verteufelt sexy, aber nutzlos, schuldete ihr inzwischen ein paar Tausender an Unterhalt.
Das war Pescolis Problem: Sie suchte sich ihre Männer lieber nach dem Aussehen aus, statt auf Verstand oder guten Charakter zu achten. Nate Santana war der beste Beweis dafür: ein ruhiger Typ mit scharfen Zügen und stechenden dunklen Augen, die nie verrieten, was er dachte. Er war ein athletischer Cowboy mit durchtrainiertem Körper und beißendem Humor, offenbar stets bereit, ein halbwildes Pferd ohne Sattel zuzureiten wie auch eine ganze Nacht mit Sex zu verbringen.
Vielleicht war er gut im Bett. Aber ganz sicher nicht tauglich zum Ehemann, den Pescoli sowieso nicht wollte, wie sie behauptete.
Alvarez putzte sich die Nase und schüttelte die Sorgen ab. Immerhin hatte Pescoli angerufen. Noch einmal spulte Alvarez die Nachricht ab:
Ich bin’s. Hey, ich muss eine Privatangelegenheit klären. Lucky und die Kinder. Es kann eine Weile dauern. Springst du bitte für mich ein? Pescolis Stimme klang fest. Entschlossen. Beinahe wütend. Aber war das etwas Neues? Allerdings stammte dieser Anruf von gestern. Heute hatte sie sich noch nicht gemeldet.
Da war etwas faul. Ganz eindeutig. Pescoli war in erster Linie mit Leib und Seele Polizistin. Ganz sicher hätte sie noch einmal angerufen, zumal sie im Fall des Unglücksstern-Mörders jetzt endlich jemanden verhaftet hatten. Dieses Ereignis hätte sich Detective Regan Pescoli unter gar keinen Umständen entgehen lassen, nicht, nachdem sie monatelang versucht hatte, den Perversen zu stellen.
Schniefend warf Alvarez das Papiertaschentuch in den überquellenden Papierkorb unter ihrem Schreibtisch. Diese Erkältung – oder Grippe –, die sie sich eingefangen hatte, ging ihr langsam gehörig auf die Nerven.
Sie bezweifelte, dass sie überreagierte. Auch wenn Pescoli angedeutet hatte, dass die Regelung ihrer Privatangelegenheiten ein wenig Zeit in Anspruch nehmen könnte, stimmte hier etwas nicht.
Alvarez warf einen Blick auf die Uhr hoch oben an der Wand. Pescolis Nachricht war gestern am späten Nachmittag eingegangen, und seit diesem Zeitpunkt glaubte die Polizei von Spokane in Washington, den Mörder gestellt zu haben.
Alvarez war sich da nicht so sicher.
Heute schien irgendwie überhaupt nichts zu stimmen. Doch bald schon würde Sheriff Grayson sich auf den Weg machen, um festzustellen, ob die Person, die die Polizei von Spokane als Serienmörder verhaftet hatte, wirklich ihr perverser Täter war.
Alvarez allerdings bezweifelte, dass die verhaftete Verdächtige sich wirklich als der Unglücksstern-Mörder herausstellte. Die verhaftete Person war eindeutig eines Mordes fähig, aber bisher hatte Alvarez sie noch nicht zu einem der früheren Verbrechen in Bezug setzen können. Sie warf einen Blick auf die Fotos der Opfer auf ihrem Schreibtisch. Fünf Frauen. Unterschiedlicher Rasse und unterschiedlichen Alters, ohne Verbindung untereinander. Sie nagte an ihrer Unterlippe und trommelte mit den Fingern und dachte daran, wie intensiv Regan Pescoli an diesem Fall gearbeitet hatte.
Regan hätte Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um bei der Verhaftung der Verdächtigen mitwirken zu können, ohne Rücksicht auf ihre privaten Probleme. Und sie hätte davon gewusst. Die verfahrene Situation und dann die Verhaftung gingen durch alle Medien. Zwar waren die meisten Presseleute in Spokane eingefallen, doch ein paar Reporter lungerten noch in Grizzly Falls und in den Straßen der Umgebung herum, in der Hoffnung auf einen neuen Aspekt in der tollsten Story in Grizzly Falls seit Ivor Hicks’ Behauptung, von Aliens in ihr Mutterschiff verschleppt worden zu sein.
Noch einmal sah sie auf die Uhr an der Wand. Fast siebzehn Uhr … Ausgeschlossen, dass Pescoli diese Sache ohne Grund verpasste. Hier war ganz eindeutig etwas faul.
Alvarez rollte auf ihrem Stuhl zurück und versuchte, nicht an die Warnung zu denken, die niemand Geringeres als Grace Perchant Pescoli hatte zuteilwerden lassen. Grace war eine komische Alte, gestraft mit einer Art übersinnlicher Fähigkeit, wenn man ihr glauben wollte. Alvarez glaubte ihr nicht. Das Einzige, was sie über die seltsame Frau wusste, war, dass sie Wolfshunde züchtete, mit Geistern kommunizierte und ansonsten kaum irgendwelche Schwierigkeiten machte. Doch kürzlich, als Pescoli und Alvarez im »Wild Will’s« zu Mittag aßen, war Grace mit besorgtem Blick an ihren Tisch gekommen. Mit leiser Stimme hatte sie Pescoli angesprochen.
»Er weiß von Ihnen«, hatte Grace zu Pescoli gesagt. Ihr Blick fixierte irgendetwas in der Ferne, was nur sie selbst sah.
»Wer?«, fragte Pescoli und ging auf das Spielchen ein.
»Das Raubtier.«
Da hatte Alvarez ihn gespürt, diesen Temperatursturz, der die Angst begleitet.
»Der, den du suchst«, erklärte Grace. »Den Bösen. Er ist erbarmungslos. Ein Jäger.«
Pescoli war ärgerlich geworden und hatte ihre Wut an der Hellseherin ausgelassen, aber auch sie, Alvarez, hatte Angst gehabt. Sie wussten beide, dass Grace über den Wahnsinnigen sprach, der in den Medien der »Unglücksstern-Mörder« genannt wurde.
Er ist erbarmungslos. Ein Jäger.
Das traf zu. Und er war ein guter Schütze.
Er, hatte Grace eindeutig gesagt. Nicht sie. Nicht die Frau in Spokane, die ihren Anwalt zu sprechen verlangte, die Frau, die alle mit den Morden belasten wollten.
Schon wieder schniefend, lehnte Alvarez sich auf ihrem Stuhl zurück. Man jagte ihr nicht so leicht Angst ein, doch heute empfand sie eine Furcht, die sie von Herzen gern verleugnet hätte.
Das Grauen lag vor ihr, in Form der farbigen Hochglanzfotos von den Opfern. Insgesamt fünf. Beziehungsweise fünf, von denen wir schon wissen, dachte sie und griff nach dem Foto von Theresa Kelper, dem ersten Opfer. Womöglich gab es noch weitere. Arglose Frauen, in der Wildnis nackt an Bäume gefesselt, in den eisigen Temperaturen der verschneiten Landschaft einem langsamen, qualvollen Tod überlassen.
»Perverses Schwein.« Selenas Kinn spannte sich an. Sie blickte hinaus in den trüben Tag, der noch trüber schien, weil das mit Eiskristallen überzogene Fenster nur wenig Licht hindurchfallen ließ. Stahlgraue Wolken hingen über den Bergen. Es schneite, ein Schneesturm drohte – wieder einmal. In weiten Teilen des Landes war es bereits zu umgestürzten Masten und Stromausfällen gekommen. Die Temperaturen lagen seit Wochen tief unter dem Gefrierpunkt.
»Fröhliche Weihnachten«, sagte sie zu sich selbst, denn die Feiertage rückten immer näher.
Sie warf das Foto des Opfers zu den übrigen Bildern auf den Schreibtisch und betrachtete sie alle zusammen. Alvarez hatte mittlerweile das Gefühl, sämtliche Opfer persönlich zu kennen: