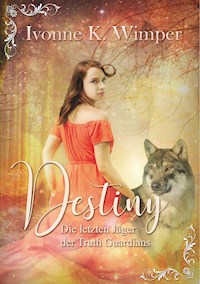
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Eine Ausreißerin im Wald, nur ein Wolf leistet ihr Gesellschaft, rätselhafte Albträume, die sich als die Wahrheit entpuppen und ein unglaubliches Gerücht... Ihr Name ist Breanna und sie dachte, sie wäre ein normaler Teenager mit normalen Problemen. Noch nie zuvor lag sie mit einer Einschätzung so daneben. Von einem Vampir vor dem sicheren Tod gerettet, wächst sie unter dessen Schutz zur jungen Frau heran. Viele Geheimnisse aus ihrer Vergangenheit kommen ans Licht und ziehen sie immer tiefer hinein in die Welt der Vampire. Eine Welt, die bedroht wird von Vampirjägern. Sie nennen sich selbst Circle of Truth Guardians und haben es sich zum Ziel gesetzt, alle Vampire um jeden Preis zu vernichten. Breanna verliert ihr Herz ausgerechnet an den Sohn eines Vampirjägers. Gefangen zwischen zwei Welten versucht sie, eine Lösung zu finden, doch das letzte Gefecht steht unmittelbar bevor. Für wen soll sie sich entscheiden, für den Vampir, der ihr das Leben rettete oder den Mann, den sie glaubt zu lieben? Oder gibt es doch noch eine Möglichkeit diese Schlacht zu verhindern?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 289
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1: Ein Mädchen allein im Wald
Kapitel 2: Zwei Wölfe
Kapitel 3: Ein Vampir in Nöten
Kapitel 4: Ein Engel auf Erden?
Kapitel 5: Was weißt du über Vampire?
Kapitel 6: Ein neues Leben
Kapitel 7: Entdeckung und Entscheidungen
Kapitel 8: Beim Ältestenrat
Kapitel 9: Das Gerücht
Kapitel 10: Der erste normale Tag im Leben
Kapitel 11: Ausflug und noch mehr Entdeckungen
Kapitel 12: Die Erinnerungen eines Fremden
Kapitel 13: Ein Junge gegen den Rest der Welt
Kapitel 14: Überraschungsbesuch
Kapitel 15: Seelenverwandt
Kapitel 16: Ein unerwartetes Geständnis
Kapitel 17: Himmel und Hölle
Kapitel 18: Schockstarre
Kapitel 19: Entscheidungen und eine überraschende Erkenntnis
Kapitel 20: Gefunden
Kapitel 21: Zurück in der Zivilisation
Kapitel 22: Schießübungen
Kapitel 23: Jäger und Models
Kapitel 24: Ein Job und neue Freunde
Kapitel 25: Mädelsabend
Kapitel 26: Verliebt?
Kapitel 27: Geheimnisse aus der Vergangenheit
Kapitel 28: Partynacht
Kapitel 29: Gegenverkehr
Kapitel 30: Breanna in Gefahr
Kapitel 31: Unfall oder Absicht?
Kapitel 32: Konsequenzen
Kapitel 33: Vampirsensoren und Albträume
Kapitel 34: Was ein Vampir kann, kann ich schon lange
Kapitel 35: Gedankenchaos
Kapitel 36: Blutiger Filmabend
Kapitel 37: Schreckensbotschaften
Kapitel 38: Verliebt in den Feind?
Kapitel 39: Vorahnungen
Kapitel 40: Günstige Gelegenheit
Kapitel 41: Helenas Warnung
Kapitel 42: Luke ist doch nicht so übel, oder?
Kapitel 43: Blutrausch
Kapitel 44: Ein Streit mit Folgen
Kapitel 45: Goodbye, Riverside
Kapitel 46: Erwachsen
Kapitel 47: Rachepläne
Kapitel 48: Das Erwachen der Sinne
Kapitel 49: Auf und davon
Kapitel 50: Verlassen
Kapitel 51: Dorians Rückkehr
Kapitel 52: Verwandlung
Kapitel 53: Böses Erwachen
Kapitel 54: Die Villa der Vampire
Kapitel 55: Zuhause
Kapitel 56: Vampirnachhilfe
Kapitel 57: Rückschläge
Kapitel 58: Ablenkung
Kapitel 59: Verzweiflung, Streit und Liebe
Kapitel 60: Falsche Fährten
Kapitel 61: Kriegsrat
Kapitel 62: Sorge um Nick
Kapitel 63 Die letzte Schlacht
Kapitel 64 Das Ende der Truth Guardians
Epilog
Danksagungen
Kapitel 1
Breanna
Ein Mädchen allein im Wald
Ich blieb stehen und drehte mich im Kreis. Egal in welche Richtung ich schaute, der Wald wollte einfach kein Ende nehmen.
Durch und durch ein Stadtkind besaß ich keine Erfahrung mit der Natur. Ich hatte Angst und fühlte mich hilflos. Das machte mich wütend denn ich hasste dieses Gefühl. Bei jedem Geräusch zuckte ich zusammen. Meine Kleidung war zerrissen, ich war schmutzig, von Moskitos zerstochen und meine Knie waren aufgeschlagen, da ich ständig an Ästen hängenblieb oder über Wurzeln stolperte. Fast schien es als hätte sich die Wildnis gegen mich verschworen. Ich besaß nur noch das, was ich am Leib trug. Meinen Rucksack hatte man mir eines Nachts auf einem Rastplatz gestohlen, als ich für einige Minuten auf einer Bank eingenickt war.
Seufzend ließ ich mich auf einem Baumstumpf am Wegrand nieder. »Wie lange laufe ich jetzt schon durch diesen verdammten Wald?«, fragte ich mich. Ich wusste es nicht genau. Es könnten drei oder aber auch schon vier Tage sein. Das letzte Haus hatte ich vor Ewigkeiten gesehen und die asphaltierte Straße war längst einem schmalen Trampelpfad gewichen.
»Ich muss irgendwo falsch abgebogen sein«, überlegte ich. »Wenn es doch wenigstens aufhören würde zu regnen.« Ich war nass bis auf die Knochen und fror erbärmlich, aber noch schlimmer als die Kälte war der Hunger.
Als ich den Kopf hob und mich umschaute, entdeckte ich ein paar Meter neben mir einen Brombeerstrauch. Schnell lief ich hin und begann die Beeren in mich hineinzustopfen. In meiner Gier ritzte ich mir an den Stacheln des Busches die Haut auf.
Mir wurde schwummerig, als ich die Blutstropfen auf meiner Haut entdeckte. Auf wackligen Beinen taumelte ich zurück zum Baumstumpf und setzte mich. In diesem Augenblick fielen mir die merkwürdigen Träume der letzten Nächte ein und ich musste kichern.
Seit ich die Zivilisation verlassen hatte, träumte ich jede Nacht denselben Traum:
Eine körperlose Stimme ruft immer wieder: »Destiny! Destiny, komm nach Hause! Du bist auf dem richtigen Weg, meine Kleine! Komm Heim!«
Wie ferngesteuert folge ich dieser Stimme bis ich eine Lichtung erreiche. Dort steht ein junger Mann. Sein Gesicht ist unter einer Kapuze verborgen, weswegen ich es leider nicht erkennen kann.
»Endlich hast du nach Hause gefunden, Destiny!«, ruft er mir zu und breitet die Arme aus, um mich zu umarmen.
»Aber mein Name ist nicht Destiny«, will ich erwidern, doch kein Laut kommt über meine Lippen.
Der Mann achtet nicht mehr auf mich. Er schaut sich gehetzt um, dann ruft er: »Lauf! Lauf um dein Leben! Sie sind gekommen, um alle Vampire zu vernichten!« ...
An dieser Stelle erwachte ich stets schweißgebadet. »Ich bin ein Vampir, der kein Blut sehen kann!«, kicherte ich. Das Kichern ging in einen Lachanfall über und ich konnte gar nicht wieder aufhören.
»Die Einsamkeit macht mich langsam verrückt!«, japste ich, sobald ich mich endlich wieder unter Kontrolle hatte.
Für einen Moment saß ich still auf meinem Baumstamm und hielt mir die vom Lachen schmerzenden Seiten. »Es ist wohl besser, ich gehe weiter. Irgendwann muss dieser Wald doch ein Ende haben.«
»Hast du dich verlaufen?«, fragte in diesem Moment eine Stimme hinter mir.
Mit vor Angst aufgerissenen Augen sprang ich auf, fuhr herum und erblickte ein Mädchen. Sie schien etwa in meinem Alter zu sein. Ihre blonden Locken hatte sie zu einem Pferdeschwanz gebunden und ihre wunderschönen tiefblauen Augen blickten genau in meine.
Sie lächelte freundlich. »Entschuldige bitte. Ich wollte dich nicht erschrecken, aber ich hab dich lachen gehört und war neugierig.«
Ich starrte sie immer noch wortlos an. »Bist du wirklich da oder bilde ich mir das ein?«, stammelte ich schließlich, denn in ihrer grünen Kleidung verschmolz sie fast mit dem Hintergrund.
Sie beachtete meine Frage nicht. »Was machst du hier? So ganz allein?«, wollte sie wissen.
»Wandern?«, erklärte ich zögernd, sogar in meinen Ohren klang es eher wie eine Frage.
»Wandern? Im Regen? Ganz allein und ohne Proviant?«, fragte sie mit skeptisch hochgezogenen Augenbrauen.
»Ja, was dagegen? Du bist doch auch allein hier«, gab ich trotzig zurück und setzte meinen Weg fort.
»Hey warte! Ich wollte dich nicht ausfragen. Es wird bald dunkel! Weißt du schon, wo du die Nacht verbringen wirst?«, rief sie mir nach.
Ich blieb stehen und drehte mich zu ihr um. »Nein, ehrlich gesagt nicht.« Bei dem Gedanken eine weitere Nacht allein im Wald zu verbringen schnürte sich mir vor Angst die Kehle zu.
»Ich weiß genau, was du meinst«, sagte sie lachend und nahm meine Hand. »Komm mit«, forderte sie mich auf.
Ich folgte ihr verwirrt. »Ich hab doch gar nichts gesagt, oder?«, fragte ich mich unterwegs stumm.
Wir verließen den Trampelpfad und gingen ein paar Meter in den Wald hinein. Vor einem hohen Baum blieben wir stehen.
»Warte hier, ich lass dir die Leiter hinunter«, sagte sie und begann geschmeidig wie eine Katze am Stamm hinaufzuklettern. Erst jetzt entdeckte ich ein Baumhaus weit oben in der Baumkrone.
Sie warf mir eine Strickleiter zu und ich kletterte langsam nach oben. Ich hatte einen kargen, winzigen Raum erwartet, doch das Gegenteil war der Fall. Alles war gemütlich und liebevoll eingerichtet, so dass ich mir gleich noch schmutziger vorkam. Ich sehnte mich nach einer Dusche.
Als hätte sie wieder meine Gedanken gelesen, sagte das Mädchen: »Ein Badezimmer haben wir hier zwar nicht, aber dort drüben, hinter dem Vorhang steht ein Eimer mit frischem Wasser aus dem Bach. Trockene Kleidung hab ich dir auch hingelegt. Wir haben ja ungefähr dieselbe Größe.«
Mit einem skeptischen Blick auf ihre zierliche Figur dachte ich: »Im Leben passe ich nicht in diese Klamotten.«
Ich verschwand hinter dem Vorhang, wusch mich und zog mich um. Überrascht stellte ich fest, dass mir die Kleidung tatsächlich passte.
Als ich kurze Zeit später hinter dem Vorhang hervortrat, rief das Mädchen erfreut: »Grün steht dir. Du siehst toll aus.« Ich schnitt eine Grimasse. »Ich? Ich bin doch ein hässliches Entlein.«
»Unsinn! Du bist wunderschön! Du siehst aus wie Schneewittchen! Hier schau selbst!« Sie nahm meine Hand und führte mich vor einen Spiegel. Ich trat näher und betrachtete mich. Lange Locken umrahmten mein blasses Gesicht und im krassen Gegensatz zu meinen dunkelbraunen Haaren standen stahlblaue Augen. Es war, als würde ich mich zum ersten Mal wirklich sehen. »Schneewittchen!«, dachte ich und musste lächeln.
»Siehst du? Du bist schön«, flüsterte sie.
Wir gingen gemeinsam zum Sofa. Auf dem Tisch stand ein Teller mit frischem Obst. »Komm, setz dich und iss. Leider hab ich nichts anderes hier«, meinte sie entschuldigend.
»Danke, das ist schon in Ordnung«, murmelte ich und machte mich hungrig darüber her.
Sie saß neben mir und schaute mir dabei zu. »Isst du nicht?«, fragte ich nach einer Weile irritiert.
»Nein, ich hab schon gegessen«, erklärte sie.
»Ach so! Sag mal, wie heißt du eigentlich?«
»Mein Name ist Sonya. Und wer bist du?«
»Ich bin Bree. Wohnst du hier?«
Sonya lachte. »Nein, natürlich nicht. Ich wohne mit meiner Familie in der Nähe von Orick. Aber wenn ich allein sein möchte, komme ich manchmal hier her.«
»Wie weit ist es bis Orick?«, wollte ich wissen. Ich hoffte, die Wildnis endlich hinter mir lassen zu können.
»Von hier? Ich würde schätzen ein Dreitagesmarsch ungefähr. Wo genau willst du denn hin?«
Ich zuckte mit den Schultern. »Mal sehen, wo es mir gefällt«, erklärte ich ausweichend und versuchte mir die Enttäuschung nicht anmerken zu lassen.
»Wenn du magst, kannst du gern ein paar Tage hierbleiben und dich ausruhen«, schlug sie vor.
»Vielleicht mache ich das«, meinte ich gähnend.
Sie sprang auf. »Jetzt richte ich dir erstmal einen Schlafplatz her. Möchtest du in der Hängematte schlafen oder reicht dir das Sofa?«, fragte sie und deutete bei ihren Worten nach oben.
Ich folgte ihrem Blick. Unter der Decke des Raumes, an einem Ast, hing eine Hängematte.
»Das Sofa ist okay«, erwiderte ich und fragte mich insgeheim, wie man in die Hängematte gelangen sollte ohne sich den Hals zu brechen.
Sonya reichte mir eine Decke. »Hier, mach es dir bequem und fühl dich wie Zuhause. Ich gehe nochmal raus. Gute Nacht Bree. Wir sehen uns Morgen, dann kannst du mir alles erzählen, was dich bedrückt, okay? Vielleicht kann ich dir helfen.«
Nachdem Sonya gegangen war, kuschelte ich mich in die weiche Decke. »Sobald es hell wird, gehe ich weiter«, nahm ich mir vor und war kurz darauf auch schon eingeschlafen.
Ich schlief wie ein Stein in dieser Nacht. Als ich erwachte, war es schon fast Mittag und von Sonya keine Spur zu sehen. Seit Tagen hatte ich das erste Mal wieder tief und fest durchgeschlafen.
Mit einem Blick aus dem Fenster stellte ich fest, dass es noch immer regnete. »War ja klar«, seufzte ich und kletterte nach unten um mich in den Büschen zu erleichtern.
Auf dem Weg zurück ins Baumhaus traf ich auf Sonya. »Du bist ja endlich aufgewacht! Ich dachte schon, du würdest den ganzen Tag verschlafen!«, rief sie mir lachend zu.
»Ich hab in den letzten Nächten nicht viel Schlaf bekommen«, entschuldigte ich mich.
»Schon okay, ich mach doch nur Spaß. Ich hab inzwischen versucht, ein Kaninchen oder Ähnliches zu jagen. Leider konnte ich keines finden. Dann ist mir eingefallen, dass ich bei dem Regen eh kein Feuer entzünden könnte und roh willst du es ja bestimmt nicht, oder?«
»Nein! Auf keinen Fall. Ich mach mir aber auch so nicht viel aus Fleisch«, erwiderte ich und schüttelte mich bei dem Gedanken, ein rohes Kaninchen zu essen.
»Das dachte ich mir. Darum hab ich ein paar Beeren und essbare Wurzeln mitgebracht.«
Gemeinsam stiegen wir hinauf ins Baumhaus. Wieder machte ich mich allein über das Essen her. Als ich Sonya darauf ansprach, meinte sie nur, sie habe schon unterwegs gegessen.
Sonya wartete, bis ich meine Mahlzeit beendet hatte. Dann schaute sie mir tief in die Augen und lächelte. »Jetzt erzähl mir, wer du bist und was dich bedrückt! Ich verspreche dir, anschließend wird es dir besser gehen.«
Ich wollte nicht über mich sprechen, doch ihr Blick hielt mich gefangen. Ich konnte nicht anders und musste ihr die Wahrheit über mich erzählen: »Mein Name ist Breanna Meyers. Ich komme aus Camden in New Jersey. Bis zu meinem fünften Lebensjahr bin ich in einem Kinderheim aufgewachsen. Niemand weiß wer meine Mutter ist, ich war ein Findelkind.«
»Kurz nach meinem fünften Geburtstag kam ich zu Pflegeeltern. Ihre Namen sind Peter und Molly Summer. Zuerst waren sie total lieb zu mir. Einen Sommer lang hatte ich eine wunderschöne Kindheit. Dann wurde Molly schwanger und als ihr Sohn geboren wurde, hatten sie und Peter plötzlich keine Liebe mehr für mich übrig. Von dem Moment, als Peter jun. auf der Welt war, wurde ich zum Dienstmädchen degradiert. Ich musste putzen, kochen, Unkraut jäten und das alles neben der Schule. Weigerte ich mich, wurde ich verprügelt oder im dunklen Keller eingesperrt. Es wurde immer schlimmer. Vor ein paar Wochen habe ich es nicht länger ausgehalten und bin abgehauen.«
»Und was hast du jetzt vor?«, fragte Sonya, die mir bisher schweigend zugehört hatte.
»Weglaufen! So lange bis ich das Gefühl habe, angekommen zu sein«, murmelte ich.
Sie lächelte. »Das klingt doch nach einem Plan. Wenn du möchtest, kannst du gern hierbleiben. Das sagte ich ja schon.«
Den Rest des Tages redeten wir nicht mehr von mir. Wir verbrachten die Zeit im Baumhaus, alberten herum und unterhielten uns stundenlang über alles Mögliche. Es fühlte sich für mich an als seien Sonya und ich schon ein Leben lang befreundet.
Am späten Nachmittag hörte es endlich auf zu regnen. »Lass uns noch ein wenig rausgehen«, schlug Sonya vor.
»Ja, gerne! Vom vielen Rumsitzen tut mir schon der Hintern weh!«
Wir liefen eine Weile schweigend durch den Wald. Wie angewurzelt blieb Sonya stehen und hob das Gesicht in den Wind. Es wirkte fast so, als würde sie etwas wittern. »Warte hier!«, sagte sie plötzlich und rannte los.
Einige Minuten später kam sie zurück. Sie sah wütend aus.
»Ist alles okay?«, fragte ich.
»Nein, nichts ist okay! Irgendein Idiot hat eine Wölfin erschossen. Sie liegt da hinten. Wie es aussieht, ist sie schon länger als vierundzwanzig Stunden tot. Wir müssen ihre Welpen finden, vielleicht können wir sie retten.«
Sie rannte so schnell los, dass ich ihr kaum folgen konnte. Als ich sie endlich einholte, kniete sie vor einer kleinen Höhle.
»Drei sind noch am Leben. Ich schätze, sie sind ungefähr zehn oder elf Wochen alt. Vielleicht kann ich sie durchbringen! Hilf mir, wir tragen sie zum Baumhaus!«
Die ganze Nacht und den nächsten Tag umsorgten wir die Welpen. Der Schwächste von ihnen schaffte es nicht, aber die anderen waren schließlich über den Berg.
Kapitel 2
Breanna
Zwei Wölfe
Über zwei Wochen lebten die beiden mit uns im Baumhaus. Tagsüber streifte Sonya mit ihnen durch den Wald und lehrte sie das Jagen, nachts brachte sie die Wölfe jedoch immer mit zurück.
Ich freundete mich besonders mit der jungen Wölfin an. Heimlich gab ich ihr den Namen Tala. Die indianische Bezeichnung für Wolf.
»Heute Nacht lasse ich die kleinen Wölfe im Wald. Ich denke sie sind nun stark genug, um allein klar zu kommen. Für alle Fälle werde ich sie aber weiter beobachten«, erklärte Sonya mir eines Abends.
»Du hast bestimmt Recht«, murmelte ich traurig.
»Es sind Wildtiere, Bree. Sie gehören in den Wald. Sie werden überleben, da bin ich mir sicher. Hier gibt es ein großes Wolfsrudel. Ich werde sie dort in der Nähe aussetzen. Vielleicht haben wir Glück und sie werden dort aufgenommen.«
Schweren Herzens verabschiedete ich mich von Tala und ihrem Bruder.
»Morgen bin ich zurück und erzähle dir, ob es geklappt hat«, versprach Sonya und verschwand mit den Wölfen im Wald.
Ich hatte mich hier im Wald wohlgefühlt. Trotz allem spürte ich, dass meine Reise noch nicht beendet war.
Als ich mich am Abend schlafen legte, fasste ich den Entschluss, Sonya noch in dieser Nacht zu verlassen und weiterzugehen.
Diesmal setzte ich meinen Plan in die Tat um. Noch vor Morgengrauen kletterte ich aus dem Baumhaus und ging fort, ohne mich zu verabschieden.
Den ganzen Tag lief ich und gönnte mir keine Rast. Das Wetter passte sich meiner miesen Stimmung an, es begann wieder zu regnen und hörte nicht auf.
Ich vermisste Sonya und das Baumhaus. Ein paar Mal war ich kurz davor umzudrehen und zu ihr zurückzugehen. Doch irgendetwas trieb mich immer weiter vorwärts.
Am frühen Abend des dritten Tages verließen mich meine Kräfte. Mit jedem Schritt wurde ich mutloser. Der starke Dauerregen war einem leichten Nieselregen gewichen und noch immer hatte ich kein Haus gesehen.
»Das hier muss das Ende der Welt sein. Hier lebt keine Menschenseele«, sagte ich und erschrak, als ich meine eigene Stimme hörte. Mir war nicht bewusst gewesen, dass ich laut sprach.
Als ich in einiger Entfernung eine Bewegung erspähte, blieb ich wie angewurzelt stehen. Ich konzentrierte mich darauf und glaubte, zwei Männer in irrsinnigem Tempo rennen zu sehen. So schnell wie es eigentlich nicht möglich war. Ich schüttelte den Kopf und schaute noch einmal hin. Es war niemand da.
»Jetzt ist es amtlich, du bist verrückt«, sagte ich und plötzlich kamen mir die Tränen.
Jeder Knochen schmerzte und ich war müde. Ich konnte einfach nicht weiterlaufen. Abseits des Weges entdeckte ich einen Felsvorsprung, in dem sich eine Höhle befand.
»Ob es hier Bären gibt?«, fragte ich mich. »Und wenn schon, du stirbst so oder so«, dachte ich dann.
Mit letzter Kraft schleppte ich mich die Böschung hinauf zu der Höhle und schlüpfte hinein. Endlich war ich dem Regen entkommen.
»Wenn ich doch nur etwas hätte, um ein Feuer zu machen«, seufzte ich. So gut es ging, rollte ich mich auf dem Boden der Höhle zusammen und fiel bald in einen leichten Dämmerschlaf.
Plötzlich hörte ich ein Schnüffeln, gefolgt von einem Rascheln. Irgendetwas kroch in die Felsspalte. Ich wollte aufschreien, als ich etwas Pelziges an meinem Bein spürte. Im nächsten Augenblick sprang Tala an mir hoch und leckte mein Gesicht.
»Tala! Was machst du denn hier?«, fragte ich und kraulte die junge Wölfin. Sie war ein wenig abgemagert und sah zerzaust aus. Sie musste mir die ganze Zeit gefolgt sein.
Dankbar drückte ich mein Gesicht an ihr Fell. »Schön das du hier bist meine Hübsche«, murmelte ich.
Nach einer Weile rollte sich die Wölfin neben mir zusammen, um zu schlafen. Meine Angst war jetzt verflogen. Ich kuschelte mich an sie und war fast augenblicklich eingeschlafen.
Kapitel 3
Dorian
Ein Vampir in Nöten
Weit nach Mitternacht rannte ich mit meinem Zwillingsbruder James durch den Wald nach Hause. Plötzlich erstarrte ich in meiner Bewegung. »Stopp mal, James. Hörst du das auch?«
»Ist sicher nur ein verwundetes Tier«, meinte er achselzuckend und lief weiter.
Ich ging dem Stöhnen nach. In einer Felsspalte erblickte ich ein schlafendes Mädchen sowie eine junge Wölfin. Vorsichtig kroch ich in die Höhle um nach dem Kind zu sehen. Die zuvor neben ihr ruhende Wölfin stellte sich mir in den Weg und fletschte die Zähne.
»Schön ruhig! Ich werde ihr nichts tun«, sagte ich mit fester Stimme und schob das Tier bestimmt zur Seite. Knurrend zog der Wolf sich zurück, ließ mich aber nicht aus den Augen. Angespannt beobachtete sie jede meiner Bewegungen, bereit sich sofort auf mich zu stürzen, sollte ich dem Mädchen etwas antun.
Vorsichtig untersuchte ich das schlafende Kind. Fieber wütete durch ihren Körper. Ohne darüber nachzudenken, hob ich sie auf und rannte zurück in die Stadt, aus der ich gekommen war.
Einige Tage später versammelte Laura die Familie um den großen Konferenztisch im Arbeitszimmer. Ich hatte sie um dieses Gespräch gebeten.
Als Familienoberhaupt nahm sie am Kopf des Tisches Platz, ihr Gefährte Henry an ihrer Seite.
Sie schwieg und schaute jeden Einzelnen von uns an. Zuerst Henry, ihren treuen Begleiter. Er hatte das lange braune Haar lose im Nacken zusammengebunden. Seine grünen Augen erwiderten ihren Blick ruhig und er lächelte.
Er spürte Lauras Traurigkeit und konnte sie gut verstehen, denn wie ich selbst konnte er ihre Gedanken hören. Ihr Zirkel war im Begriff sich aufzulösen und es gab nichts, was er tun konnte, um dies zu verhindern. »Ich werde immer bei dir sein, Liebste«, sagte er leise.
»Ich danke dir, Liebster«, erwiderte sie.
Ihr Blick wanderte weiter zu James und mir. Äußerlich glichen wir uns wie ein Ei dem anderen und doch waren wir grundverschieden. Wir hatten dunkles Haar, grüne Augen und waren von großer und muskulöser Statur.
Sie schaute zuerst James an. Er war der aufbrausendere und temperamentvollere von uns. Er war dafür bekannt erst zu handeln und dann zu denken. Ohne ein Lächeln erwiderte er ihren Blick. Neben ihm saß Mira, seine Gefährtin.
Bei ihrer Verwandlung war die dunkelhaarige Schönheit kaum älter als 18 Jahre gewesen. Genau wie James und ich gehörte sie zu den Kämpfern der Vampire. Sie hatten sich bei einer Schlacht kennengelernt. Später war sie ihm von ihrem Zirkel aus Italien in die USA gefolgt.
James, Mira und auch ich hatten vor ein paar Tagen vom Ältestenrat den Auftrag erhalten, beim Schutz der letzten Vampirsiedlung in England zu helfen. Vampire wurden dort seit Monaten immer wieder grundlos von Jägern des Circle of Truth Guardians angegriffen. Es hatte schon viele Tote gegeben.
Sonya, meine Gefährtin, wollte uns nach Europa begleiten. Sie war optisch wie charakterlich das totale Gegenteil von Mira. Ihr Haar war blond und sie hatte blaue Augen. Sie war ein Feingeist, liebte die Natur und alle darin befindlichen Lebewesen. Sie hasste es zu töten. Oft verbrachte sie Wochen oder Monate in der Wildnis, um verletzte Tiere aufzupäppeln.
Als Letztes richtete Laura ihre Aufmerksamkeit auf mich. »Erzähl uns bitte, worüber du mit uns sprechen möchtest«, erteilte sie mir das Wort.
Ich erhob mich. »Es ist dieses Kind. Es geht mir einfach nicht mehr aus dem Kopf. Wie ist es möglich, dass es so eine Macht über mich hat? Ich muss immer wieder zu ihm gehen und mich davon überzeugen, dass es ihm gut geht. Es hat mich an sich gebunden. Sie muss eine Hexe sein. Kennst du dieses Gefühl?« Fragend schaute ich Laura an.
Sie lächelte kurz. »Ich kenne es sehr gut. Mir ist es auch so ergangen, damals als ich dich und deinen Bruder fand. Der Unterschied ist, dass es für mich nur eine Möglichkeit gab euch zu retten.«
»Was kann ich dagegen tun?«, fragte ich verzweifelt.
»Nichts, Dorian. Das Gefühl wird bleiben, solange dieses Kind lebt.«
»Es muss doch etwas geben! Es macht mich sonst wahnsinnig! Was wird passieren wenn ich fortgehe? Kann ich James nach England begleiten und mich dort mit der Jagd ablenken?«, rief ich aufgebracht.
Laura schaute mir in die Augen. »Du kannst jederzeit gehen, aber das Gefühl wird bleiben«, erklärte sie. »Du wirst lernen müssen damit zu leben, Dorian.«
Ich schüttelte den Kopf. »Nein, so kann ich mich auf gar keinen Fall auf eine Schlacht konzentrieren. Es tut mir Leid, James. Ich werde dich nicht begleiten.«
»Du und deine besonnene Art werden uns fehlen, Bruder«, warf James ein.
»Unter normalen Umständen würde ich dir zustimmen, aber so wie es jetzt ist, wäre ich eine Belastung für euch.«
»Wieso das?«, wollte Mira wissen.
»Meine Gedanken kreisen nur um sie. In diesem Moment entfernt sie sich von hier und es kostet mich meine ganze Kraft, hierzubleiben. Alles in mir schreit danach ihr zu folgen. Ich kann spüren, dass es ihr sehr schlecht geht. Was kann ich nur tun?«, fragte ich der Verzweiflung nahe.
»Wir könnten sie zu uns holen«, schlug Henry nach einem Moment des Schweigens vor.
»Nein! Sie ist noch ein Kind! Wir dürfen kein Kind ... oder doch?«, unterbrach ich mich selbst.
Kapitel 4
Breanna
Ein Engel auf Erden?
Ich schlug die Augen auf und war mir ziemlich sicher, dass ich gestorben sein musste. »Ich bin im Himmel«, dachte ich, denn ich lag in einem warmen, weichen Bett und am Fußende stand ein Mann. Er war so schön, er konnte nur ein Engel sein.
Noch hatte er mein Erwachen nicht bemerkt, daher konnte ich ihn ungeniert betrachten. Er war sehr groß und muskulös, hatte dunkles Haar und sanfte grüne Augen. Im krassen Gegensatz dazu eine makellose sehr weiße Haut. Er stand völlig unbeweglich da, fast wie eine Statue.
Um den Rest des Raumes sehen zu können drehte ich den Kopf. Als ich wieder zum Fußende schaute, war der Engel verschwunden. Ich blinzelte verwirrt. Hatte ich ihn mir vielleicht nur eingebildet? In diesem Moment öffnete sich die Tür und eine ältere Krankenschwester kam herein.
»Du bist ja endlich aufgewacht, Liebes«, sagte sie erfreut. »Ich werde gleich Dr. Hanson Bescheid geben.« Mit diesen Worten verließ sie mich wieder.
»Dann bin ich wohl doch nicht tot«, murmelte ich.
Kurze Zeit später betrat ein junger Arzt das Zimmer. Er untersuchte mich und lächelte dann aufmunternd. »Das Fieber ist überstanden, aber du bist immer noch ein wenig unterernährt. Wie ist dein Name?«
Ohne zu überlegen, nannte ich den ersten Namen, der mir in den Sinn kam. »Ich heiße Destiny.«
Er streckte mir die Hand hin. »Schön dich kennenzulernen Destiny. Ich bin Dr. Hanson. Wir werden dich noch ein paar Tage hierbehalten um dich aufzupäppeln und ...«
»Wo bin ich hier denn bitte? Wie bin ich hierher gekommen? Und wo ist mein W... Hund?«, unterbrach ich ihn.
»Du bist in Orick in Kalifornien. Dies ist das Memorial Hospital. Leider kann niemand sagen, wie du hergekommen bist. Keiner hat etwas beobachtet. Vor vier Tagen lagst du plötzlich nachts vor unserer Tür, aber ein Hund war nicht bei dir. Bisher haben wir vermutet, du bist allein hergekommen und vor der Tür zusammengebrochen. Wo kommst du her? Und wo sind deine Eltern? Laut der örtlichen Polizeistation gibt es scheinbar niemanden, der nach dir sucht.«
Ich drehte den Kopf zur Wand und kämpfte einen Moment mit den Tränen. Verzweifelt überlegte ich, ob ich wegen meines Alters lügen sollte. Ich ahnte jedoch, dass es nicht viel Sinn haben würde. Ich sah einfach nicht älter aus, als ich tatsächlich war.
»Meine leiblichen Eltern kenne ich nicht. Ich bin bei Pflegeeltern aufgewachsen. Sie haben mich behandelt wie eine Sklavin. Darum hab ich es nicht mehr ausgehalten und bin weggelaufen. Unterwegs wurde ich krank und versteckte mich im Wald ...«, ich machte eine kurze Pause.
»Als Nächstes bin ich hier aufgewacht. Jemand muss mich gefunden und hergebracht haben«, überlegte ich.
»Wie heißen deine Eltern?«, wollte der Arzt wissen.
»Bitte, schicken sie mich nicht zurück! Sie würden mich umbringen«, flehte ich erschrocken.
»Ich werde sehen, was ich für dich tun kann, Destiny. Wie alt bist du?«, fragte Dr. Hanson.
»Ich bin sechzehn Jahre alt, aber bald werde ich siebzehn.«
In diesem Moment steckte eine Schwester den Kopf zur Tür herein. »Doktor! Kommen sie schnell! Wir haben einen Notfall in Zimmer dreiundzwanzig!«
Er sprang sofort auf. »Wir unterhalten uns später, Destiny!« Mit diesen Worten rannte er aus dem Zimmer.
Das Reden hatte mich erschöpft, ich ließ mich ins Kissen zurücksinken. Nur Sekunden später war ich eingeschlafen.
Wieder glaubte ich beim Erwachen den Engel an meinem Bett zu sehen. Und wieder war niemand dort, als ich genauer hinschaute.
»Verrückt!«, dachte ich. Ich grübelte vor mich hin. »Wie bin ich nur hierher gekommen?« Krampfhaft versuchte ich mich zu erinnern.
Das Letzte was mir in den Sinn kam, war die Höhle, in die ich kroch, um zu schlafen. Tala war bei mir gewesen. Der Rest der Erinnerung blieb im Dunkeln, egal wie sehr ich mich auch anstrengte. Ich glaubte mich an das Gefühl zu erinnern von kalten Händen untersucht und davon getragen zu werden. Auch glaubte ich, ein Gesicht zu sehen. Es blickte besorgt auf mich herab und flehte mich an durchzuhalten. »Den Teil habe ich mir bestimmt nur eingebildet«, seufzte ich.
Eine Schwester betrat in diesem Augenblick mein Zimmer und hörte das Seufzen. »Geht es dir gut?«, fragte sie besorgt.
»Ja, schon. Ich frage mich nur, was jetzt aus mir wird.«
Schwester Lorie lächelte. »Mach dir keine Sorgen. Zunächst bleibst du ja ein paar Tage bei uns.«
Plötzlich fiel mir Sonya wieder ein. Sie hatte mir doch erzählt, dass sie mit ihrer Familie in Orick lebte. Vielleicht konnte sie mir helfen. Nachdenklich schaute ich die junge Krankenschwester an. »Ist noch was?«, wollte sie wissen, als sie meinen durchdringenden Blick bemerkte.
»Kommen Sie hier aus dem Ort?«, erkundigte ich mich.
»Geboren bin ich hier nicht, wenn du das meinst. Aber ich wohne jetzt seit ein paar Jahren hier.«
»Dann kennen Sie bestimmt viele Einheimische?«, löcherte ich sie weiter.
»Einige sicherlich. Worauf willst du hinaus? Ich hab noch viel zu tun.«
»Ich suche meine Freundin Sonya. Sie wohnt hier in Orick. Sie ist ungefähr so groß wie ich, hat blonde lange Haare und ...«
»Wie heißt sie denn mit Nachnamen?«, unterbrach mich die Schwester.
Ich überlegte fieberhaft, aber es wollte mir nicht einfallen. Schließlich kam ich zu dem Schluss, dass Sonya mir ihren vollen Namen nie verraten hatte. Ich zuckte mit den Schultern. »Weiß nicht«, gestand ich.
»Tut mir leid, Destiny. Der Name Sonya sagt mir leider nichts und die Beschreibung passt auf hunderte Mädchen hier aus dem Ort. Ich kann dir nicht helfen.«
»Danke trotzdem«, murmelte ich und fasste den Entschluss, sobald ich aufstehen durfte, das Krankenhaus zu verlassen um Sonya auf eigene Faust zu suchen.
Einige Stunden später betraten zwei Polizisten das Zimmer. Sie waren beide noch sehr jung und mir auf Anhieb sympathisch. Sie begrüßten mich herzlich, so als würden sie mich schon lange kennen.
»Dr. Hanson hat uns benachrichtig. Da du nicht volljährig bist, müssen wir dich zu deinen Pflegeeltern zurückschicken. Daran führt leider kein Weg vorbei. Zur Zeit gibt es allerdings keine Vermisstenanzeige, die auf deine Beschreibung passt. Aus diesem Grund wird es etwas dauern, deine Eltern zu finden.«
»Was heißt das für mich?«, wollte ich wissen.
»Nun, es bedeutet wir werden dich im örtlichen Waisenhaus unterbringen müssen, sobald du aus dem Krankenhaus entlassen wirst. So lange bis wir deine Eltern gefunden haben.«
»Und was geschieht, wenn ihr meine Eltern nicht findet? Kann ich dann im Heim bleiben?«, fragte ich vorsichtig. Ein winziger Hoffnungsschimmer flackerte in mir auf.
»Als Pflegekind sind deine Daten im System gespeichert. Es wird ein paar Tage dauern, vielleicht auch Wochen, aber wir werden bald wissen woher du gekommen bist. Früher oder später können wir dich wieder in die Obhut deiner Pflegeeltern geben«, erklärte der zweite Polizist, ich glaubte, ein Bedauern in seinem Blick zu sehen.
»Auch wenn meine Pflegeeltern mich brutal misshandeln?«, wollte ich wissen.
Der jüngere der beiden machte ein wütendes Gesicht und setzte zu einer Erwiderung an. Der andere legte ihm beschwichtigend die Hand auf den Arm. »Erstmal müsstest du zurück. Du könntest aber bei der für dich zuständigen Pflegestelle eine Beschwerde einlegen. Die kümmern sich dann darum, dass du eine neue Pflegefamilie bekommst.«
»Genau! Als ob ich das noch nicht versucht hätte«, dachte ich. Tränen traten mir in die Augen. Sollten die ganzen Strapazen der letzten Wochen denn wirklich vergebens gewesen sein?
»Du siehst also, du hast überhaupt keine andere Wahl. Früher oder später finden wir deine Eltern. Du kannst uns ihren Namen also auch gleich verraten.«
Ich gab auf. »Mein Name ist Breanna Meyers. Ich komme aus Camden in New Jersey. Meine Pflegeeltern sind Peter und Molly Summer. Aber ich will auf gar keinen Fall wieder dorthin zurück. Lieber gehe ich ins Waisenhaus«, schluchzte ich.
Am Abend kurz vor seinem Feierabend betrat Dr. Hanson noch einmal mein Zimmer. »Wir haben endlich deine Eltern erreicht. Ich soll dir ausrichten, sie haben sich schreckliche Sorgen um dich gemacht. Übermorgen werden sie herkommen und dich abholen«, berichtete er.
»Ja, sie waren so sehr in Sorge kein Geld mehr für mich zu bekommen, dass sie noch nicht mal eine Vermisstenanzeige aufgegeben haben«, meinte ich sarkastisch. Ich wollte mich nicht länger unterhalten und drehte den Kopf zur Wand.
»Gute Nacht Breanna. Wir sehen uns morgen«, hörte ich den Doktor sagen, doch ich antwortete ihm nicht. In Gedanken ging ich die vergangenen Tage durch. Ganz oft hatte ich beim Aufwachen den Engel an meinem Bett stehen sehen. Doch bevor ich ihn ansprechen konnte, war er stets verschwunden. »Würde er doch nur einmal so lange bleiben, dass ich mit ihm reden kann. Ich bin sicher, dass er mich zum Krankenhaus gebracht hat.« Mit diesem Gedanken schlief ich schließlich ein.
... Ich stand am Ufer eines Sees. Mit kräftigen Zügen kam ein Fremder ans Ufer geschwommen und stieg aus dem Wasser. Der Vollmond zauberte einen silbernen Schimmer auf seine nackte Haut. Sein Anblick nahm mir den Atem. Ich wusste, ich sollte mich verstecken, doch ich konnte nicht aufhören seinen perfekten Körper anzustarren.
Mit den geschmeidigen Bewegungen eines Raubtieres kam er auf mich zu. Ich versuchte meine Beine dazu zu bringen zu fliehen, doch der Blick seiner wunderschönen blauen Augen hielt mich gefangen.
»Endlich hab ich dich gefunden. Ich habe schon auf der ganzen Welt nach dir gesucht«, flüsterte er mir ins Ohr. Er hob mich hoch und trug mich zu der kleinen Hütte, die am Ufer des Sees stand.
Drinnen angekommen legte er mich auf das Bett. Ich wurde starr vor Furcht. »Keine Angst, ich werde dir nicht weh tun«, raunte er mir ins Ohr, bevor er mich küsste ...
Mit rasendem Herzen schreckte ich aus dem Schlaf hoch. Ich hatte diesen Traum schon oft gehabt, doch noch nie war er so real gewesen wie heute. Noch immer spürte ich die Berührungen des Fremden auf der Haut. Ich setzte mich auf und schaute mich im Zimmer um. Es war niemand zu sehen. Schon wollte ich wieder die Augen schließen, da entdeckte ich den Engel in einer Zimmerecke. »Wer bist du?«, fragte ich leise.
Er zuckte zusammen, als hätte ich ihn bei etwas Verbotenem erwischt.
»Bitte bleib hier. Ich möchte dir danken«, wisperte ich.
Unsere Blicke trafen sich und mein Herz setzte einen Schlag aus. Er war überirdisch schön.
»Du brauchst mir nicht zu danken«, sagte er und seine Stimme klang in meinen Ohren wie Musik.
Tausende Fragen stürmten auf mich ein und ich wusste nicht, welche ich als erstes stellen sollte. Als ich endlich die richtigen Worte gefunden hatte, war er verschwunden. Traurig blieb ich zurück.
Kapitel 5
Breanna
Was weißt du über Vampire?
Zwei Tage darauf trafen die Summers ein, um mich nach Hause zu holen. In der Nacht zuvor hatte ich versucht, aus dem Krankenhaus zu fliehen. Ich hatte es nicht mal von der Station geschafft. Die Nachtschwester war in ihrem vorherigen Leben sicherlich ein Bluthund gewesen. Sie hatte mich erwischt, noch bevor ich den Fahrstuhl erreichen konnte. Kurzerhand hatte sie mir ein Schlafmittel verpasst, um jeden weiteren Fluchtversuch im Keim zu ersticken. Aus diesem Grund fühlte ich mich noch benommen, als ich abgeholt wurde.
Vor den Ärzten und Schwestern spielten die Summers noch die besorgten Eltern, doch kaum war ich mit ihnen allein, verpasste mir Molly eine schallende Ohrfeige. Ich zuckte nicht mal mit der Wimper.
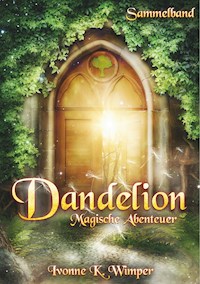
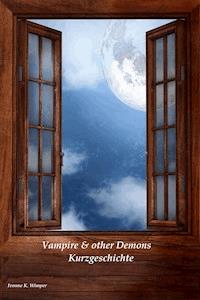
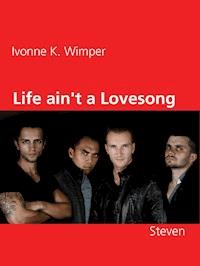











![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)














