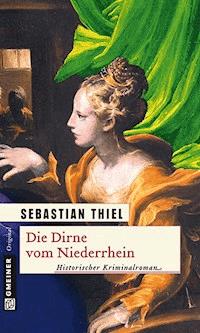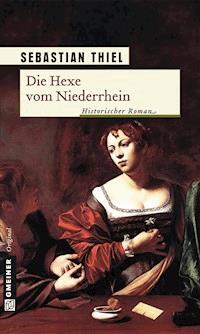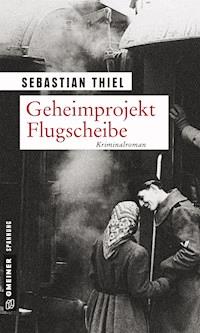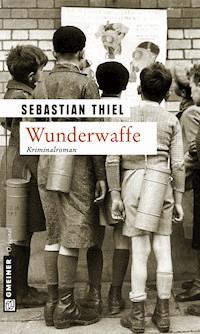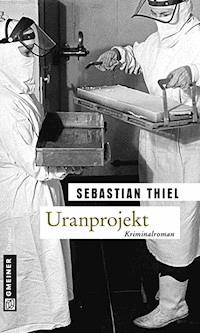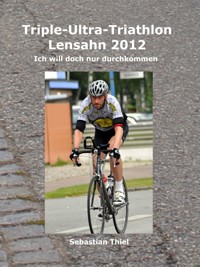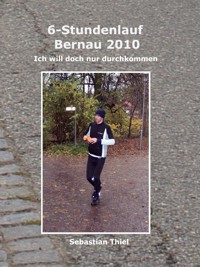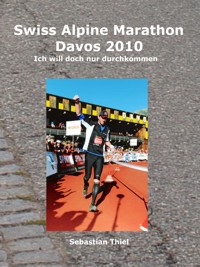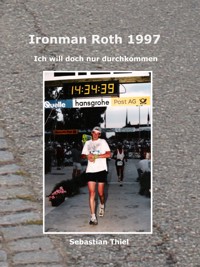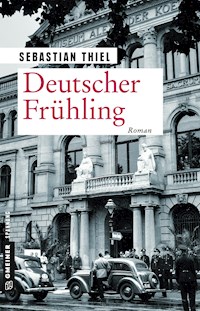
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Zeitgeschichtliche Kriminalromane im GMEINER-Verlag
- Sprache: Deutsch
Schutt und Asche bedecken Deutschlands Städte. Hunger und die ständige Angst vor dem Tod vereinen Hardy Schmittgen und Luisa Porovnik. Als das ungleiche Duo zufällig Reginald Taylor, Verbindungsoffizier des britischen Militärgouverneurs, das Leben rettet, nimmt dieser sie in seine Dienste. Und auf einmal liegt das Schicksal Deutschlands in den Händen eines grobschlächtigen Wachtmeisters und einer jungen Schmugglerin, die im Rahmen ihrer Aufträge erleben, wie ein ganzes Land zum Spielball der Mächtigen wird.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 253
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sebastian Thiel
Deutscher Frühling
Roman
Impressum
Bisherige Veröffentlichungen im Gmeiner-Verlag:
Das Adenauer-Komplott (2017); Geheimprojekt Flugscheibe (2015); Sei ganz still (2015); Uranprojekt (2014)
Die Dirne vom Niederrhein (2013); Wunderwaffe (2012); Die Hexe vom Niederrhein (2010)
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2019 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2019
Lektorat: Sven Lang
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © ullstein bild – HDG Bonn
Druck: GGP Media GmbH, Pößneck
Printed in Germany
ISBN 978-3-8392-6010-4
Widmung
Für alle, die an die Hexe geglaubt haben.
Und für meine eigene Hexe.
Haftungsausschluss
Diese Geschichte ist, wenn auch mit realen Elementen und Gegebenheiten hinterlegt, rein fiktiv und entstammt der Fantasie des Autors.
Prolog - Verbrannte Erde -
06. März 1945
Der Krieg verlangte Eile.
Obwohl, war das noch Krieg?
Hastig zog Schmittgen Luft in die Lungen, während sein Hauptmann ihnen einen Moment Ruhe gönnte. Durch die Einschusslöcher der Ruinen legte sich das warme Sonnenlicht des Nachmittags wie Balsam über die geschundene Haut der Stadt. Verdammt, er war jetzt über 50 und musste durch die zerbombte Kölner Innenstadt hetzen, als wäre er wieder ein junger Bengel. Schmittgen spuckte auf den Boden, schüttelte mit dem Kopf und ließ seinen Blick über die ausgezehrten Männer und milchgesichtigen Knaben streifen. Das sollte Hitlers Elite sein? Die Feuersbrunst, die jeden Invasor in Asche verwandelte? Zäh wie Leder, hart wie Kruppstahl und flink wie Windhunde, stets bereit, den Feind zurückzuschlagen, wenn er auch nur eine Elle auf deutschen Boden setzte?
Schmittgen seufzte erschöpft. Der Tod musste Humor haben. Einen tiefschwarzen, ekelhaften, bitterbösen Humor.
Seine Finger umschlossen den Griff der Pistole fester. Die Walther hatte ihm im jahrelangen Polizeidienst als Wachtmeister gute Dienste geleistet, und nun sollte er mit einer Handvoll Bullen gegen amerikanische Sherman-Panzer vorgehen – am besten noch die ganze Army über den Atlantikwall zurückwerfen.
Die Kugeln würden auf den Stahlkolossen abprallen wie Gummibälle. Er hätte genauso gut gegen das Metall wichsen können.
Nein, das war kein Krieg mehr. Sie wurden zur Schlachtbank geführt wie blökende Lämmer in Uniformen. Das zertrümmerte Köln war ihr Schlachthaus, Donnerschläge der Feinde die kalte Schärfe, welche sich in ihre Leiber bohrte. Nur der Dom, beinahe unversehrt und trotzig in den Himmel ragend, war der einzige Zeuge des unvermeidlichen Massakers.
»Bei Gott, Otto, lass uns gehen«, flüsterte Schmittgen atemlos in Richtung des Polizeihauptmanns, die Hände noch auf den Knien abgestützt. »Guck dir die Knaben doch an. Keine Haare am Sack, aber sollen das Reich retten. Das ist Wahnsinn!«
Schmittgens Stimme besaß eine eindringliche Intensität, geschult von unzähligen Zeugenbefragungen. Er wusste, dass sein alter Kollege Otto Grohe kein schlechter Kerl war. Leider sagte man ihm auch krankhaften Ehrgeiz nach, der aus dem dicklichen Mann einen hervorragenden Polizisten, aber einen grottenschlechten Militär machte.
»Was denkst, Spatzenhirn, was dann passiert?« Grohes Gesichtszüge wurden starr, als würde der eisige Hauch des vergangenen Winters sein Antlitz umwehen. »Hadrian, Sie werden uns abknallen wie räudige Köter, die ihre Herren gebissen haben.«
»Wer soll uns denn noch abknallen?« Schmittgen baute sich vor seinem Chef auf, breitete die Arme aus und fuchtelte mit seiner Walther. »Wir sind die letzten Idioten, die Schutt, Asche und verbrannte Erde verteidigen sollen. Alles andere, was noch laufen kann, hat sich über die Hohenzollernbrücke nach Westen gerettet. Sieh dich um, verdammt! Wir kämpfen auf einem Friedhof. Das Einzige, was wir dem Ami zufügen, sind dreckige Stiefel, wenn sie über unsere Leichen trampeln.«
Wütender Donner grollte in der Ferne in Form von amerikanischen Geschossen. Von der unsichtbaren Gefahr erschüttert, ging die zerlumpte Gruppe in Deckung. Der Blick gen Himmel war zu einer angstvollen Routine geworden. Pupillen rasten von links nach rechts und suchten in der Ferne nach den todbringenden schwarzen Punkten, die allzu schnell zu Jagdbombern wurden und den flammenden Tod vom Himmel regnen ließen. Jeder Blinde konnte sehen, jeder Taube hören, dass dieser Krieg verloren war. Nur ein paar Gestalten in Berlin klammerten sich an ein Wunder, welches niemals eintreten würde.
»Weiter!«, spie ihnen Polizeihauptmann Grohe entgegen und trabte geduckt davon. »Das gilt auch für dich, Hardy.«
Er musste verrückt geworden sein, ja gar völlig von Sinnen, wenn er immer noch glaubte, die stetig rieselnde Sanduhr des Schicksals aufhalten zu können. Nein, dies war kein Krieg mehr – nur eine Abkürzung zum Tod.
Kapitel 1 - Stadt in Trümmern -
»Los, alter Mann! Du hast den Befehl gehört.«
Tief in seinen Gedanken vergraben spürte Schmittgen einen dumpfen Schmerz an seiner Schulter. Seine Knöchel rissen auf, als er sich an der Wand abstützte, um nicht zu fallen.
»Was zum …« Die Worte verloren sich im aufkommenden Wind. Vor ihm stand ein Halbstarker, kein Kind mehr, aber noch lange kein Mann. Schmittgen musterte den Jungen. Seine dunklen Augen lagen tief in den Höhlen, der Krieg war unbarmherzig mit seinem Antlitz gewesen und hatte Brandnarben in sein Gesicht geschlagen. Dieser Knabe sollte eigentlich Mädchen hinterhergucken oder die Biervorräte seines Vaters stibitzen. Stattdessen trug er die blaue Uniform eines Rottwachtmeisters der Feuerschutzpolizei mit stolzem Trotz, während in seinen Armen eine geladene Panzerfaust bedrohlich zitterte.
»Geh weiter, Bulle«, wiederholte der Junge mit zusammengekniffenen Zähnen.
Im ersten Moment meinte Schmittgen, sich verhört zu haben. Unter anderen Umständen hätte er diesen Rotzlöffel ungespitzt in den Boden gerammt, doch Kälte und Nahrungsmangel ließen seine Kraft langsam versiegen.
»Wie ist dein Name, Rottwachtmeister?«
»Hans Pfeiffer«, zischte der Junge und kam so nah an ihn heran, dass er den heißen Atem auf seiner Haut spüren konnte.
Schmittgen lächelte traurig. Dieser Junge kannte nichts anderes als den glorreichen Reichskanzler Hitler, süße Siege und verführerische Versprechungen. Sie hatten ihnen Sand in die Augen gestreut, ihre Träume befeuert und einer gesamten Generation eingebläut, dass die germanische Herrenrasse schlussendlich obsiegen würde. Doch nicht nur die Jugend war geblendet worden, auch er hatte die Partei gewählt und den Arm gehoben, bis die Maschinerie des Todes nicht mehr aufzuhalten war.
»Geh nach Hause, Pfeiffer, und verbrenn die Uniform. Wenn der Ami an deine Tür klopft, sagst du, dass du Student bist.« Schmittgens Stimme war nur ein Flüstern im Wind, allerdings so eindringlich, als würde sich jedes Wort in den Verstand des Jungen brennen.
Für einen Herzschlag schien der Brandbekämpfer zu wanken, sorgsam die Überlegungen zu sortieren, bis seine Miene noch härter wurde. »Und wer verteidigt unsere Mütter und Schwestern vor dem Ivan? Wer bekämpft den Bolschewismus? Und wer schützt uns vor der Willkür des Tommys und der Cowboys?«
Schmittgen riss der Geduldsfaden. »Niemand mehr.« Er packte den Jungen am Kragen und drückte ihn gegen die löchrige Mauer. Sie knirschte unter dem Druck, als würde auf den zusammengeschossenen Häuserwänden die Last der Welt ruhen. Staub wirbelte auf und legte sich sanft auf ihre bleiche Haut. »Es wird niemand kommen, um deiner Mutter oder Schwester zu helfen. Nur du wirst da sein, wenn dich nicht die Ketten eines Sherman-Panzers zermalmen. Überlege dir deinen nächsten Schritt gut, es könnte dein letzter sein.«
Schutz war ein kostbares Gut, das sie nicht mehr ihr Eigen nennen konnten. Sie waren auf die Gnade Gottes angewiesen, obwohl Schmittgen sich sicher war, dass er schon lange diesen Todesacker im Schatten des Doms verlassen hatte.
»Hadrian! Pfeiffer! Bewegt euch!« Polizeihauptmann Grohes Finger zitterte am Abzug seiner Walther. Die Pistole war auf sie gerichtet. Seine Augen traten nervös aus den Höhlen hervor, seine Nerven lagen blank. Grohe würde schießen, das war Schmittgen klar. Sein alter Freund und Chef würde ihn hier, am Fuße des Andreasklosters, einfach umnieten, wenn er nicht folgte. Noch einmal spuckte Schmittgen verächtlich auf den Boden, dann lief er dem Mann hinterher und musste tatenlos dabei zusehen, wie der Junge breit grinsend an ihnen vorbeipreschte.
Er hatte Mühe mitzuhalten, als die Rotte von der Marzellenstraße auf das aufgerissene Pflaster der Komödienstraße einbog. Zum Teufel, hier sah alles gleich aus. Grauer Schutt, notdürftig zur Seite geräumt und aufgetürmt, als würde die ganze Stadt nur noch aus Ruinen und dem süßen Geruch des Todes bestehen. Der Hauptbahnhof lag in Trümmern, Pferdekadaver waren auf offener Straße zerlegt und liegen gelassen worden, hier und da ragte ein Arm aus den Steinbergen hervor. Die Front war nicht mehr auf musikuntermalten Fernsehbildern in Lichtspielhäusern zu sehen – sie war hier. Brutaler und düsterer als jeder Albtraum. Schmittgen sehnte sich danach, einfach aufzuwachen und den Krieg zu vergessen. Doch das würde nicht passieren.
Niemals.
Die Bomben hatten sein Leben in Scherben gesprengt und nichts mehr übrig gelassen, außer einer vernarbten Hülle ohne Inhalt.
»Hörst du das?« In einer Bewegung stoppte Schmittgen und griff mit seiner riesigen Pranke in die Uniform seines Chefs.
»Bist du wieder besoffen?«, wollte Grohe wissen und spähte zum Domplatz.
»Nein, da ist …« Weiter kam er nicht.
Die Ketten der Panzer zermahlten den Schutt auf dem Asphalt und verwandelten ihn in kleine weiße Staubwolken. Unaufhaltsam führte sie ihr Weg in das Herz von Köln, während Schmittgen und seine Truppe Schutz in den Ruinen suchten. Er zählte zwei Sherman-Panzer und Dutzende gut bewaffnete Soldaten. Wie eine grüne, nicht enden wollende Schlange schob sich die Division in die Stadt, ohne dass ein einziger Schuss fiel. Schmittgens Atem stockte, er nahm seine Polizeimütze ab und fuhr sich durch die fettigen blonden Haare. Dann fiel sein Blick auf den halbstarken Feuerwehrmann. Er erkannte das Blitzen in seinen Augen. Früher, als junger Anwärter, konnte man dasselbe Glitzern bei ihm sehen, wenn er zum ersten Mal eine Verhaftung allein durchführen durfte oder tief ins Dekolleté einer Frau sah. Es war ein untrügerisches Zeichen von Gefahr und alles auffressender Dummheit. Als der junge Pfeiffer das Panzerrohr zu streicheln begann und sich allein zurückzog, wusste Schmittgen, dass er recht behalten würde.
Er sah dem Bengel noch hinterher, als ein gewaltiger Donner seinen Körper zum Beben brachte. Instinktiv warf er sich auf den Boden und spähte mit der Waffe im Anschlag in alle Richtungen. Er hatte noch nie jemanden Englisch sprechen hören und nun schrien die Soldaten alle wild durcheinander. Beißender Rauch legte sich in Schmittgens Lungen. Trotzdem hielt er sich an, nicht zu husten. Jedes Geräusch könnte sein Todesurteil bedeuten. Erst jetzt erkannte er, dass der Rauch von einem der Sherman-Panzer herüberwehte. Von blanker Panik ergriffen, gelang den Männern die Flucht über den Turm des Tanks, dann zogen sich die Amerikaner zurück. Überall krachten nun Schüsse. Nervöse Finger an Abzügen sorgten dafür, dass die Luft wie elektrisiert war. Schmittgen fiel das Atmen schwer. Er hatte schon Menschen erschossen, totgeprügelt und sogar einen im Rhein ertränkt, aber Krieg, das war eine andere Nummer. Plötzlich war es ganz still, als hätte der Allmächtige die Stadt unter einer Glocke begraben.
»Hörst du das?« Die Stimme von Grohe war so leise, dass er Mühe hatte, sie zu verstehen, bis sie schließlich versiegte.
Schmittgen musste nicht hinsehen, um zu wissen, was sein Vorgesetzter meinte. Das aufdringliche Krächzen des Metalls, in Verbindung mit dem dröhnenden Motor, sprach eine deutliche Sprache. »Ein Panther.« Er hätte nie gedacht, dass diesseits des Rheins noch solche Ungetüme der Wehrmacht zu finden seien. Langsam und bedächtig rückte der Stahlkoloss auf Ketten vor. Solange der starke Panzerkampfwagen V noch die Straßen blockierte und sein Inferno auf die Amis prasseln ließ, würden sie sich an ihm die Zähne ausbeißen.
Gerade als Schmittgen seine Mütze aufsetzen wollte, spürte er leichte Vibrationen der Erde. Nach unzähligen Jahren im Polizeidienst hatte er für solche Gefahren einen siebten Sinn entwickelt. Seine große, unförmige Nase juckte, der Mund glich einer Wüste. Irgendetwas stimmte hier ganz gewaltig nicht. Er musste seinen Kopf so weit nach links drehen, bis sein Nacken knackte, um den Ursprung seines Unbehagens auszumachen.
»Herr, steh uns bei …« Die Worte von Otto Grohe hätte er blindlings unterschreiben können.
Mehrmals musste Schmittgen die Augen zusammenkneifen, um das Monstrum zu erfassen. Hinter dem flüchtenden Sherman-Panzer tauchte im Nebel eine neue Monstrosität des Krieges auf.
»Ein M26 Pershing.« Schmittgen hatte gehofft, dass er diesen Riesen auf Ketten nie mit eigenen Augen sehen würde. So eine Kriegsmaschine wollte er den Bildern der Wochenschau überlassen. Er wünschte sich, dass es dabei geblieben wäre. Sein Blick fiel auf den Panther. Ein Panzer gegen eine ganze Division. Manchmal ähnelten Mut und Wahn einander so sehr, dass man sie nicht mehr voneinander unterscheiden konnte. »Meinst du immer noch, dass wir hierbleiben sollten?«
Grohe verharrte einen Moment in innerer Stille. Die Zeit dehnte sich zu einer Unendlichkeit aus, während er sich umsah. Sie waren allein an der Front. Alle anderen waren geflüchtet. Nur sie, der Panther und die amerikanische Armee.
»Wir sollten uns zurückziehen«, resignierte er schließlich und warf seine Pistole weg. »Getrennt.« Grohe reichte ihm die Hand und nickte. »War mir eine Ehre, Hardy.«
»Mir auch, Otto. Mach et jot.«
Auf den ersten Metern duckte sich Schmittgen noch, doch als er den Mantel und die Uniformjacke achtlos in den Staub warf, vernahm er eine Leichtigkeit, wie er sie selten zuvor gespürt hatte. Als hätte eine unsichtbare Hand die tonnenschwere Last von seinen Schultern gerissen, welche ihn seit Jahren kaum atmen ließ. Seine Freude währte nur einen Herzschlag, dann fanden die Erinnerungen den Weg zurück in seinen Verstand.
Er war allein. Völlig allein.
Nun ja … fast. Schmittgen stoppte in der Bewegung. Sein Blick erfasste einen von ihnen. Sie waren schuld – nur sie –, die gut genährten Invasoren. Gott, dieser junge Amerikaner war keine zehn Meter entfernt, pinkelte im hohen Bogen an eine Mauer und betrachtete dabei selig den Dom und seine Schönheit. Sogar seine Knarre hatte er gegen die Wand gelehnt. Es schien, als hätte der Jüngling die viel zu große Uniform seines Vaters angezogen. Dass er überhaupt allein auf Reisen gehen durfte, grenzte an ein Wunder. Schmittgen sah sich um. Niemand war weit und breit zu sehen. Freudig trällerte der Amerikaner ein Lied, seine Hose hing ihm dabei in den Kniekehlen, während Schüsse in weiter Ferne hallten.
War es nicht sein Land gewesen, das Bomben auf sie regnen ließ, sodass Angst und Zerstörung ständige Begleiter ihres Alltags wurden? Waren es nicht seine Kameraden, die Feuersbrünste schürten, in der schließlich jene starben, für die er gemordet hatte?
Wie von Seilen gezogen hob er seine Waffe. Der Lauf zielte auf den Kopf des jungen Mannes. Ein Schuss wäre nur ein Zischen im Sturm, niemand würde es bemerken. Schmittgen würde seine Rache bekommen. Zumindest den Hauch von Trost in dieser dunklen Welt. Es würde jene, die er verlor, nicht zurückbringen, aber das war in dieser Hölle auf Erden gleichgültig.
Es wäre so einfach, jetzt abzudrücken. Nur warum zitterte das Schießeisen in seinen Händen? Schmittgen biss die Zähne so sehr zusammen, dass es schmerzte. Er hatte schon Mörder erschossen, auch Vergewaltiger. Danach war er mit anderen Wachtmeistern in die Pinte gegangen, hatte sich einen Glimmstängel angesteckt und sich von einer Nutte verwöhnen lassen. Alles kein Problem. Gevatter Tod war ihm nicht fremd. Sie waren alte Freunde, die sich bis zu ihrer unweigerlich letzten Begegnung beizeiten über den Weg liefen.
Doch das hier war falsch. Dieser Kerl aus Texas oder New York oder wo er auch immer herkam, konnte nichts dafür, dass die Eliten ihre Kompanien über die Lagekarte schoben. Der Junge war auch nur eine Figur, die nicht hier sein wollte, in einem Krieg, der nie nobel oder gütig war, sondern grausam und tödlich.
Langsam sank die Waffe, bis Schmittgen sie wieder in den Holster schob und davontrottete. Der junge Ami hatte den Tod genauso wenig verdient wie Margot oder Theresa und trotzdem würde er niemals mehr das viel zu helle Lachen seiner Frau oder die weinerliche Stimme seiner Tochter hören. Sie waren tot. Nichts würde sie zurückbringen. So einfach war das.
Noch einmal sah Schmittgen über die Schulter zum jungen Soldaten und huschte hinter eine Häuserwand. Innerhalb weniger Sekunden gesellten sich seine Kameraden zu dem Jungen. Ein Jeep hielt an der Stelle, wo Schmittgen eben noch mit gezückter Waffe gestanden hatte. Sie scherzten, rauchten und beäugten ein frivoles Magazin. Es war ein kurzer Moment des Glücks in einer grausamen Welt. So schnell konnte es gehen. Eben noch beinahe tot, jetzt schon Titten gucken.
»Du verdeckst das Ziel, alter Mann!«
Zum wiederholten Male an diesem Tag zuckte Schmittgen zusammen. Früher hatte ihn nichts aus der Ruhe bringen können und jetzt erschrak er bei jedem Fliegenschiss.
»Pfeiffer!« Schmittgen näherte sich langsam dem jungen Feuerschutzpolizisten. »Du sollst nach Hause gehen.«
»Ich hab sie im Visier«, flüsterte er leise.
Der Knabe hatte die Panzerfaust 30 auf den Jeep und die Gruppe gerichtet. Ein Auge war zugekniffen, eine Schweißperle suchte sich windend den Weg seine glänzende Schläfe hinab.
Schmittgens Blick wanderte über die Soldaten zu dem Jungen. »Bei Gott, schmeiß den Ääpelsquetsch weg! Es ist aus. Vorbei. Ende. Du kannst hier nur sterben.«
»Jeder tote Feind ist ein guter …«
Schmittgen unterbrach die Worte des Jungen mit einem Schlag gegen seine Schläfe. Dabei knackten seine Finger so laut, dass es in seinem Kopf widerhallte. Der Schmerz zog seinen Arm hoch. Früher hatte er täglich Leuten ein paar Schellen auf die Fressluke gegeben, doch die Zeiten waren lange vorbei. Der Junge klappte zusammen wie eine Marionette, der man die Fäden durchgetrennt hatte. Das würde ’ne Menge Kopping geben. Die Panzerfaust brach er über das Knie und warf sie achtlos auf einen Schutthaufen, erst dann packte er sich den Jungen, zog seine Uniformjacke aus und legte ihn in den Eingang eines Luftschutzbunkers. Hoffentlich hatte er die Scheiße aus dem Schädel des Jungen nun herausgeprügelt, sodass er keinen weiteren Anlauf unternehmen würde, die 34. Division im Alleingang zu besiegen. Wahre Helden starben meistens sehr jung und einsam. Dieses Schicksal wollte er dem Knaben ersparen.
Als Schmittgen sich vom Luftschutzbunker entfernte, fiel ihm auf, dass er gar nicht wusste, in welche Richtung oder wohin er ging. Es gab niemanden, der auf ihn wartete, auf sein Überleben hoffte oder dem er etwas schuldig war. Hier war nichts mehr, was ihn hielt. Seine Frau und sein Kind hatte er vor zwei Jahren auf dem Zentralfriedhof begraben, Polizei und Feuerwehr waren nicht mehr existent, seine Wohnung nur noch ein Haufen Asche. Selbst der Schreibtisch in seiner Dienststelle war den Flammen anheimgefallen.
Mit tief in den Hosentaschen vergrabenen Händen ließ er sich vom warmen Frühlingswind leiten. Er genoss das kaum hörbare Pfeifen an seinen Ohren und wie die Böen zärtlich über seine Haut strichen. Schmittgen schloss die Augen.
Dies war ohne Zweifel ein guter Tag zum Sterben.
Wie ein Besucher schlenderte er durch die Kölner Innenstadt, während nicht weit entfernt Schüsse fielen. Er pfiff ein Lied aus seiner Jugend, trat einen Stein vor sich her und stoppte erst, als dieser gegen eine zerbrochene Scheibe schlug. Schmittgen blickte auf und befand sich vor einer Kneipe.
»Zum Schwarzen Pferd«, las er vom zerschossenen Schild unter seinen Füßen. Der gesamte Block schien vom Feuer verschont, lediglich die Einschusskrater kündeten von der Katastrophe, die über die Stadt hereingebrochen war. Noch immer lagen seine Hände in den Taschen, während er in die Gaststätte eintrat. Wie vermutet waren alle Vorräte geplündert worden. Sogar das feine Holz der Theke hatte man mit scharfen Äxten herausgetrennt. Schmittgens Weg führte ihn auf einer schmalen Treppe nach oben, bis er im dritten Stock in einer winzigen Wohnung stand. Eigentlich war es Wahnsinn, was er gerade machte. Die wenigen Blocks, in denen man noch Schutz fand, gaben einerseits ein gutes Ziel für Artilleriebeschuss oder die Bomber ab. Andererseits, die Amis würden schon nicht ihre eigenen Leute in Flammen aufgehen lassen, nur um ein paar versprengte Einheiten des Volkssturms zu erledigen. Bomben waren teuer, und Geld entschied oftmals Kriege.
Schmittgen drehte sich auf dem Absatz und sah sich um. Der kleine Wohnraum war beinahe noch intakt. Zumindest kam die Einrichtung seiner Vorstellung von einer behaglichen Unterkunft recht nahe. Selbst wenn das ganze Haus knarrte und quietschte, als könnte es jeden Herzschlag einstürzen. Sogar der Ofen schien funktionstüchtig. Hier hatte jemand Hals über Kopf die Wohnung verlassen. Den Bewohnern war es nicht einmal gelungen, den Koffer nach unten zu schleppen. Kleidung, Decken und Schriftstücke lagen arglos auf dem Holzboden verteilt – beinahe, als hätte jemand etwas gesucht.
»Erna und Heinz Porovnik«, murmelte er, als er einen Brief vom Boden auflas. »Was soll das denn für ein Name sein?«
Als sich Schmittgen hinunterbeugte, knackte die Diele unter seinen Füßen. Argwöhnisch vollführte er einen Schritt zur Seite. Überall lag Staub, nur auf den Hölzern vor dem Bett waren hastige Spuren zu erkennen. Selbst einem altersschwachen Wachtmeister war klar, dass hier etwas nicht stimmte. Obwohl er wusste, dass die meisten Bewohner Kölns auf der Flucht waren, an der Front kämpften oder schlicht dem Sensenmann anheimgefallen waren, sah er sich argwöhnisch um. Irgendetwas stimmte hier nicht.
Stille senkte sich über die Innenstadt. Anscheinend hatten die beiden Kettenmonster ihre Schlacht geschlagen.
Als Schmittgen die erste Diele öffnete, verschlug es ihm fast den Atem. Soweit er sehen konnte, hatte jemand den Zwischenboden mit Schnapsflaschen gefüllt. Es gab kein Etikett, keinen Schriftzug, nur klare Flaschen mit Fusel. Verdammt, er stand auf einem Vermögen. Vorsichtig, als könnte dieser Traum mit jeder hastigen Bewegung zerplatzen, nahm er eine Flasche an sich und entfernte den Verschluss. Bitter und beißend stieg ihm der Alkohol in die Nase. Schmittgen lief das Wasser im Mund zusammen. Jemand musste die Vorräte der Kneipe geplündert und hier versteckt haben. Vielleicht waren es sogar die Besitzer selbst gewesen.
Er drehte sich zum Bett vor ihm. Kissen waren wohl unter die Decke gelegt worden, wahrscheinlich wollte die Dame des Hauses ihre gute Wäsche vor Staub und rieselndem Schmutz schützen. Doch etwas machte ihn stutzig. Schmittgen verschärfte seinen Blick. Das tiefe Rot auf den Bettlaken, welches beinahe ins Schwarz abglitt, hatte er bereits zu oft gesehen. In einer Bewegung riss er die Decke beiseite. Im nächsten Moment wünschte er sich, dass er es nicht getan hätte. Das ältere Paar war mit unzähligen Messerstichen malträtiert worden. Die Münder waren aufgerissen, Hände und Füße gefesselt, ihre Gliedmaßen seltsam verrenkt. Noch einmal fiel sein Blick auf den Alkoholvorrat. Es brauchte keine Ausbildung bei der Polizei, um zu wissen, dass die beiden gefoltert wurden, damit sie das Versteck ihres kleinen Schatzes preisgeben sollten. Dass die Mörder die ganze Zeit über den Alkoholvorräten ihr dunkles Werk verrichteten, war eine schreckliche Ironie des Schicksals. Wahrscheinlich standen sie unter Zeitdruck und waren rasend vor Panik, als die Amerikaner die Stadtgrenze erreichten.
»Arme Hunde«, flüsterte Schmittgen, roch noch einmal an der Flasche und schritt zum Fenster.
Am Horizont suchten sich unzählige Rauchwolken den Weg hoch zur Sonne und verschmolzen schließlich mit dem strahlend blauen Himmel. Unter anderen Umständen wäre dies ein wunderschöner Tag gewesen. Vielleicht wäre er mit Theresa in den Park gegangen oder hätte ihr gezeigt, wie man angelt. Bestimmt wäre sie eine gute Anglerin geworden. Sie wäre jetzt fast 14 Jahre alt. Ihren Fang hätte Margot mit viel Schmalz und Kräutern eingerieben und über offener Flamme saftig gegart. Es wäre ein Schmaus gewesen für die ganze Familie.
Ein trauriges Lächeln huschte über Schmittgens Gesicht, als er herabsah und auf den Fenstersims stieg. Es wäre nur ein kurzer Schritt. Schnell, schmerzlos, erleichternd. Dann wäre er wieder bei ihnen, könnte ihre Hand halten, über ihr Haar streicheln …
Schmittgen blickte über die Schulter. Es wäre so einfach, wären da nicht die Leichen hinter ihm. Nur ein Scheusal hätte ein älteres Ehepaar auf solch eine bestialische Weise zugerichtet. Schmittgen kletterte wieder in die Wohnung.
Mehrere laute Explosionen ließen seinen Blick in die Ferne schweifen. Er kniff die Augen zusammen und konnte nicht glauben, was er da sah. Die wunderschöne, alte Hohenzollernbrücke lag geknickt wie ein Streichholz im Rhein. Etliche Rauchsäulen stiegen stetig in den Himmel auf und kündeten davon, dass die Wehrmacht sich nicht mehr anders zu helfen gewusst hatte. Nun waren sie endgültig von der Außenwelt abgeschnitten. Die Front lag jetzt hinter ihnen.
Gemächlich, beinahe etwas genervt, sah Hadrian Schmittgen zu den Leichen und entfernte sich vom Fenstersims. Umbringen konnte er sich immer noch. Vorher galt, es den Schnaps zu saufen, und, wenn er nicht in Kriegsgefangenschaft geriet oder sofort hingerichtet wurde, könnte er bei der Gelegenheit ein paar alte Bekannte in der Unterwelt aufsuchen – sich nur ein wenig umhören und gucken, was passierte.
Aber dafür sollte er die Knarre verstecken. Und er musste das Ehepaar unter die Erde bringen, bevor die Amerikaner ihre Hausdurchsuchungen starteten. Das Letzte, was er wollte, war, dass man ihm den Doppelmord in die Schuhe schob. Er hatte eigentlich gar nichts dagegen, am Galgen zu baumeln, während die Frühlingssonne sein Gesicht streichelte, aber jetzt, wo er sich auch totsaufen konnte, wäre es doch Verschwendung, wenn der schöne Fusel in die Hände der Amerikaner oder sogar in die des Mörders fallen würde. Nein, das gönnte Schmittgen diesen Arschlöchern nicht und hob die Flasche in Richtung des Bettes.
»Ruhet in Frieden.« Er trank in großen Schlucken. »Ihr Glücklichen habt es hinter euch.«
Kapitel 2 - Germania -
23. April 1945
Das war es also.
Berlin war eingeschlossen.
Luisa hielt den Atem an und lauschte den gedämpften Stimmen, die aus dem Hinterhof drangen. Dabei umklammerte sie das blutige Fleisch der zwei Karnickel so fest, als wären sie noch am Leben und könnten sich freistrampeln. Eigentlich hatte der Tag gut begonnen. Seit zwei Nächten waren die Luftangriffe ausgeblieben. Sie konnte in der Zeit drei Kippen gegen ein wenig Käse eintauschen, diesen zur alten Frau Huber bringen, woraufhin sie einen kleinen Sack Steckrüben bekam. Darauf war der dümmliche Schmitze aus Charlottenburg besonders scharf, weshalb er ihr seine Schmerzmittel und Süßigkeiten überließ. Diese wiederum brachte sie in den Moabiter Hinterhof, wo an diesem dämmrigen Tag das Leben noch den Hauch eines Pulses hatte. In den zerbombten und notdürftig freigeräumten Höfen konnte man alles tauschen, was noch irgendeinen Wert hatte. Kalle, ein schlaksiger Kerl mit schlechten Zähnen und guten Kontakten, war hier so was wie der Chef des Blocks. Man munkelte, dass er Fotografien von allen großen Tieren der Ordnungspolizei und Verwaltung geschossen hatte. So ein Bordell im Hinterhof zahlte sich offensichtlich aus. Einen großen Teil des Eudokal brauchte er selbst – wahrscheinlich wegen der eitrigen schwarzen Stümpfe in seiner Hackfresse, die er tatsächlich Zähne nannte. Mit Pervitin machte er die Mädchen gefügig und schenkte ihnen noch Süßigkeiten, wenn sie mal wieder einen ganz besonders perversen Wunsch zu erfüllen hatten.
Dabei waren die Frauen kaum älter als sie, Luisa. Doch wo Vater und Mutter fehlten, vom Krieg fortgerissen, hatte solcher Abschaum wie Kalle es nicht schwer. Niemand kannte seinen richtigen Namen und vielleicht war das auch gut so. Allerdings war er immer sehr gut informiert und seine geflüsterten Worte weckten bei Luisa höchste Aufmerksamkeit.
»Ist es wahr?« Langsam trat sie aus dem Schatten. Sie wusste, dass ihre hellblonden, beinahe weißen Haare sie verrieten, weshalb sie ein dunkelrotes Tuch um ihren Kopf gebunden hatte.
Nachdem der erste Schock überwunden war, grinste Kalle breit. Augenblicklich wurde Luisa speiübel. Worte waren zeitweise gefährlicher als Taten. Nicht wenige hatte die Schutzstaffel aufgeknüpft und mit warnenden Schildern versehen.
»Was soll wahr sein, Porovnik?« Kalle erhob sich vom kleinen Kohleofen, ebenso seine Mannen. Nervös blickte die Gruppe umher. Jetzt, wo das Reich zusammenbrach, zog sich auch die schützende Hand der Funktionäre langsam zurück. Jedermann spürte den eisigen Hauch des Todes über der Stadt wehen und erkannte die Veränderung, die er mit sich brachte.
Nachdem Kalle sich vergewissert hatte, dass niemand sonst ihr Gespräch belauschte und seine Mädels immer noch brav am anderen Ende des Hinterhofs ihren Körper feilboten, vollführte er einen Schritt auf Luisa zu. Behutsam, als wäre ihr Gesicht aus Porzellan, streichelte er ihr eine blonde Strähne aus dem Gesicht.
»Wie alt bist du jetzt, Porovnik?«
»Stimmt es, was du gerade gesagt hast?«, entgegnete sie trotzig. Sie ließ die Hand auf ihren Rücken gleiten und umfasste den Griff ihres Lieblingsmessers. Er wäre nicht die erste Type gewesen, die meinte, dass ihre blauen Augen und die zierliche Figur dazu einluden, sie zu betatschen.
Kalle kam nah an sie heran. Sein stinkender Atem legte sich beißend in ihre Nase. »Beantworte mir meine Frage und ich beantworte deine.«
»Ich bin 14.« Sie zog die Nase hoch und fixierte ihn. »Und jetzt bist du dran?«
»14? Was für ein wundervolles Alter.« Seine Männer lachten leise. »Wie wäre es, wenn du bei mir anfängst? Ich kann dich beschützen. Kein Schweinkram, nur leichte Sachen am Anfang. Ein wenig tanzen, vielleicht mal ein Rohr reinigen?«
Kurz blickte Luisa zu den Mädchen. Ihre Gesichter waren nur notdürftig gereinigt, wandelnden Leichen gleich hatten ihre Augen sämtlichen Glanz verloren. Blutergüsse zierten die jungen Gesichter, einer war sogar der Arm gebrochen worden. Das Mädchen zitterte am ganzen Leib, während sie zerschnittene Bettlaken notdürftig um ihren Arm wickelte.
Beileibe war Luisa nicht fremd, wie es sich anfühlte, wenn die Faust eines Mannes gegen das Jochbein hämmerte, und wie laut es knackte, wenn dünne Mädchenfinger brachen. Ihr Vater war ein Säufer, dem nur allzu oft die Hand ausrutschte, wenn er mal wieder kein Geld hatte, um sich neuen Stoff zu kaufen, oder erneut seine Arbeit im Schlachthof verlor. Als sie die Mädchen sah, war da wieder das Pochen in ihrem Gesicht, wenn die Farbe des Blutergusses langsam ins Violette wechselte. Ohne Frage, mit Kalle und seinen Spießgesellen war nicht zu spaßen.
Luisa rang sich ein Lächeln ab und legte den Hauch von Verführung in ihre Stimme. Das mochten die Männer. Mutter machte dies manchmal, wenn sie nichts auf den Tellern hatten und sie mit dem Bäcker in ein Hinterzimmer ging. »Ich versuche, daran zu denken«, antwortete sie zuckersüß und holte tief Luft. »Stimmt es nun?«
»Scheint so.« Kalle nickte langsam und musterte sie von oben bis unten. »Der Freund eines Freundes hat ein Radio und hört BBC. Weißt du, was das ist?«
Luisa nickte. Natürlich wusste sie das. Beim Bund Deutscher Mädel gab es sogar Unterrichtsstunden, die sich mit dem Thema der Feindpropaganda befassten. Die British Broadcasting Corporation war eines der schlimmsten Sprachrohre der Tommys. Hinter vorgehaltener Hand wurde allerdings darüber berichtet, dass die Aussagen allzu oft zutrafen.
»Gut«, flüsterte Kalle und streichelte über ihre Wange. »Hübsch und klug, schau mal einer an. Davon haben wir hier nicht allzu viele. Angeblich sollen die Amis schon an den Elbwiesen stehen, der Ivan ein paar Kilometer davor. Du weißt, was passiert, wenn der Bolschewik hier ist?«
Jeder wusste es. Plakate kündeten von nichts anderem, aus Lautsprecherwagen hallte immer dieselbe Platte. Nur der Volkssturm, in Verbindung mit des Führers Genialität, konnte die rote Pest noch aufhalten. Luisas Magen krampfte, doch sie ließ sich nichts anmerken. Wenn es auch nur im Ansatz stimmte, was die Männer flüsterten, stand ihr die Hölle auf Erden bevor.