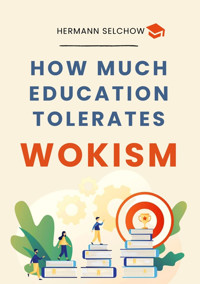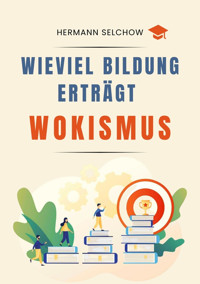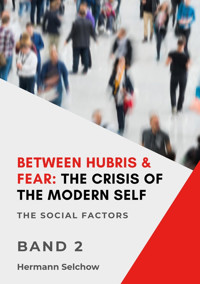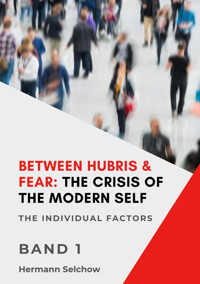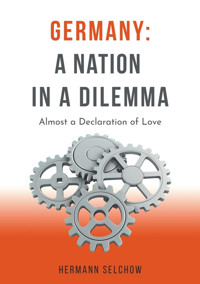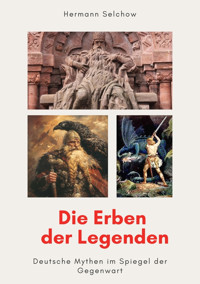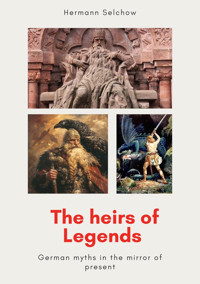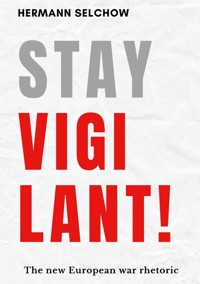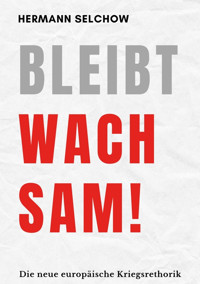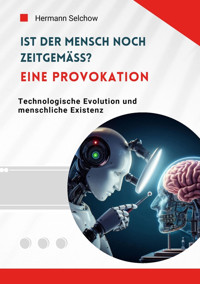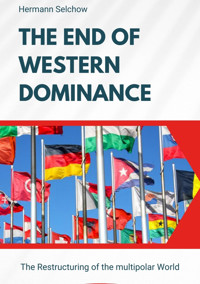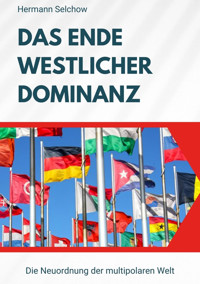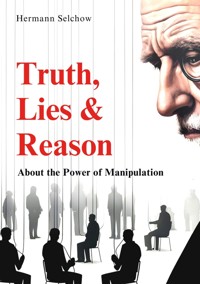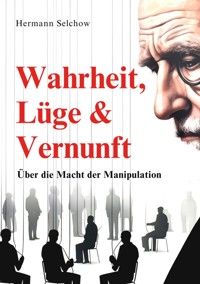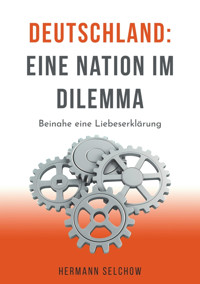
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Deutschland - Eine Nation im Dilemma - Beinahe eine Liebeserklärung Die Deutschen lieben anscheinend ihre Niederlagen wie andere Völker ihre Siege. Warum nur? Diese Nation, die ihre Geschichte wie eine Wunde leckt und dabei Gefallen daran findet, ist das Subjekt eines Buches, welches das Dilemma einer ganzen Kultur seziert: "Deutschland - Eine Nation im Dilemma - Beinahe eine Liebeserklärung". Deutschland – ein Land, das aus dem Scheitern eine Kunstform gemacht hat. Der Autor dieses provokanten Werks, Hermann Selchow, seziert die deutsche Seele mit der Präzision eines Pathologen und der Zärtlichkeit eines Liebhabers. Das Ergebnis: ein literarisches Röntgenbild einer Nation, manchmal überspitzt, aber immer nahe an der Wahrheit. Die berühmte deutsche Gründlichkeit entpuppt sich als systematische Selbstdemontage, der Perfektionsdrang als Lähmung durch Analyse. Aus Vergangenheitsbewältigung wird Gegenwartsverweigerung. Ein Volk, das seine Neurosen wie Orden trägt und dabei vergisst zu leben. Doch dieses Buch ist kein billiger Voyeurismus deutscher Defekte. Es ist Diagnostik mit Herz, Kritik ohne Verachtung. Der Autor, selbst Teil dieses Volkes, entlarvt nicht nur die Mechanismen deutscher Selbstsabotage, sondern zeigt auch deren produktive Kraft. Denn wer sich so virtuos selbst zerstört, beherrscht auch die Kunst der Erneuerung. Deutsche Leser werden sich ertappt fühlen – und vielleicht zum ersten Mal über ihre eigenen Abgründe schmunzeln können. Fremde erhalten Einblick in die Seelenlandschaft eines Volkes, das seine Traumata wie Reliquien hütet. Soziologen und Psychologen finden womöglich Material für Jahre der Analyse. Geschrieben ist das Buch im Stil der liebevollen Obduktion: scharfsinnig ohne Kälte, ironisch ohne Zynismus. Eine seltene Balance zwischen Wissenschaft und Menschlichkeit. Die Zukunftsfrage bleibt: Können die Deutschen ihre Selbstzerstörung überwinden? Oder ist sie vielleicht ihr kostbarstes Gut? Der Autor liefert keine einfachen Antworten, aber die richtigen Fragen. "Deutschland - Eine Nation im Dilemma" ist Therapie als Literatur, Gesellschaftskritik als Liebesakt. Ein Buch für alle, die Deutschland verstehen wollen – und für Deutsche, die sich endlich selbst ertragen möchten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 291
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Deutschland – Eine Nation im Dilemma
Beinahe eine Liebeserklärung
© 2025 Hermann Selchow
Druck und Distribution im Auftrag des Autors:
tredition GmbH, Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Germany
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung "Impressumservice", Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Deutschland
Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung: [email protected]
Deutschland – Eine Nation im Dilemma
Beinahe eine Liebeserklärung
Essays
Inhaltsverzeichnis
Das deutsche Dilemma unterm Mikroskop
Die Wurzeln in der Geschichte: Selbstzerstörung als deutsches Thema
Die deutsche Abneigung gegen Erfolg: Ablehnung und Selbstkasteiung
Große Denker und Kleinbürgertum - ein deutscher Widerspruch?
Deutsche Bildung - von Lehrinstituten und Bildungskasernen
Wirtschaft & Forschung - Ein Nachruf auf "Made in Germany"
Die Arbeitswelt der Deutschen – Zwischen Burn-Out und Sozialamt
Denunziantentum - Keine deutsche Erfindung, aber ...
Das deutsche Verhältnis zur Macht: Bürger oder Untertan?
Die Fragmentierung traditioneller gesellschaftlicher Strukturen
Das neue deutsche Spießbürgertum im Gewand des Wokismus
Selbstbetrachtung: Von Fischkopp und Bergler, Ossie und Wessie
Ein Blick von außen auf die Deutschen
Eine deutsche Vision: Ein Sommermärchen?
Das deutsche Dilemma unterm Mikroskop
Es gibt Völker, die ihre Geschichte wie einen Mantel tragen, würdevoll und selbstverständlich. Und es gibt solche, die sie wie einen Mühlstein um den Hals schleppen, stöhnend unter dem Gewicht vergangener Epochen. Die Deutschen gehören zweifellos zur zweiten Kategorie, wobei sie die bemerkenswerte Eigenschaft entwickelt haben, aus diesem Mühlstein noch zusätzliche Steine zu meißeln, um sich das Leben noch schwerer zu machen. Man könnte dies als eine besondere Form der Kreativität betrachten, wäre es nicht so tragisch produktiv in seiner Destruktivität.
Die vorliegende Untersuchung unternimmt den Versuch, diesem eigentümlichen Phänomen auf den Grund zu gehen, wobei der Autor, selbst ein Teil dieses Volkes ist, sich bewusst ist, dass er damit ein Terrain betritt, das von Minenfeldern ideologischer und persönlicher Befindlichkeiten durchzogen ist. Doch was wäre die deutsche Seele ohne ihre Abgründe, was wäre der deutsche Geist ohne seine Selbstquälerei? Es ist, als hätte Goethe seinen Faust nicht als Warnung, sondern als Gebrauchsanweisung für ein ganzes Volk geschrieben. Der Pakt mit dem Bösen wurde längst geschlossen, nur dass Mephistopheles inzwischen die Gestalt des kollektiven Über-Ichs angenommen hat, das unermüdlich flüstert: Du bist nicht gut genug, du warst nie gut genug, du wirst nie gut genug sein.
In der Tat scheint es, als hätten die Deutschen eine Art nationale Neurose entwickelt, die sich in periodischen Anfällen von Selbsthass und Selbstzerstörung äußert. Dabei ist bemerkenswert, mit welcher Gründlichkeit und Systematik dieses Volk an seiner eigenen Demontage arbeitet. Andere Nationen mögen ihre dunklen Kapitel haben, aber sie verstehen es, diese in den Kellergewölben der Erinnerung zu verwahren und darüber ein neues Stockwerk zu errichten. Die Deutschen hingegen haben aus ihren Kellern einen Schrein gemacht, vor dem sie täglich niederknien und Buße tun für Sünden, die längst zu Staub zerfallen sind, während sie gleichzeitig neue Sünden begehen im Namen der Läuterung.
Es ist ein Paradox von geradezu dialektischer Schönheit: Ein Volk, das sich selbst als das der Dichter und Denker versteht, hat es fertiggebracht, das Denken zu einem Instrument der Selbstkasteiung zu pervertieren. Wo einst Kant das sapere aude proklamierte, herrscht heute ein sapere nolo - ein entschiedenes Nichtwissenwollen, wenn es um die eigenen Stärken geht, kombiniert mit einer obsessiven Fixierung auf die eigenen Schwächen. Es ist, als hätte man Nietzsches Übermenschen durch seinen Gegenentwurf ersetzt: den deutschen Untermenschen, der in der Selbstverachtung seine höchste Vollendung findet.
Diese Selbstzerstörung vollzieht sich nicht in den großen Gesten des heroischen Untergangs, wie sie die Romantik einst verherrlichte. Sie ist subtiler, perfider, bürokratischer. Sie geschieht in Kommissionen und Arbeitsgruppen, in Studien und Expertisen, in einer endlosen Kette von Selbstbezichtigungen und Selbstverbesserungsversprechen. Die Deutschen haben das industrielle Verfahren auf die Seelenmassage angewendet und dabei eine Effizienz entwickelt, die ihre berühmten Ingenieure vor Neid erblassen ließe. Wenn Selbstzerstörung eine Olympische Disziplin wäre, hätten die Deutschen alle Medaillen abgeräumt und würden anschließend eine Kommission einsetzen, um zu untersuchen, ob ihr Sieg nicht vielleicht unfair war.
Dabei ist es nicht so, als mangelte es diesem Volk an Grund zum Selbstbewusstsein. In den vergangenen Jahrzehnten haben die Deutschen eine der stabilsten Demokratien der Welt aufgebaut, eine Wirtschaftsmacht geschaffen, die ihresgleichen sucht, eine Kultur hervorgebracht, die von Bach bis Beuys reicht. Aber all das wird überlagert von einem seltsamen Bedürfnis, das Erreichte kleinzureden, zu relativieren, in Frage zu stellen. Es ist, als würde ein Tennisstar nach jedem Sieg sofort eine Pressekonferenz abhalten, um zu erklären, warum er eigentlich hätte verlieren müssen.
Dieses Phänomen ist nicht auf eine bestimmte politische Richtung beschränkt. Es durchzieht alle Schichten der Gesellschaft, alle Parteien, alle Institutionen. Rechts wie links, oben wie unten, überall findet man diese eigentümliche Mischung aus Größenwahn und Selbsthass, die so typisch deutsch ist. Die Rechten träumen von einem Zurück-wohin-auch-immer. Die Linken wollen die Welt retten und glauben nicht daran, dass Deutschland dazu in der Lage wäre. Die Mitte schwankt zwischen beiden Extremen und nennt das ausgewogene Politik.
Man könnte vermuten, dass dieses Verhalten eine Folge der historischen Traumata des 20. Jahrhunderts ist, und zweifellos spielen diese eine Rolle. Aber das erklärt nicht, warum andere Nationen mit ähnlich belasteten Geschichten einen anderen Weg gefunden haben. Die Japaner haben Hiroshima und Nagasaki hinter sich gelassen und sind zu einer Kulturnation geworden. Die Spanier haben Franco überwunden und sich zu einer modernen Demokratie entwickelt. Die Deutschen hingegen scheinen ihre Vergangenheit wie eine chronische Krankheit zu kultivieren, die zwar nicht tödlich ist, aber das Leben zur Qual macht.
Vielleicht liegt das Problem tiefer, in der deutschen Seele selbst, die seit Jahrhunderten zwischen Extremen hin- und herpendelt. Entweder Heiliges Römisches Reich oder Kleinstaaterei, entweder Sturm und Drang oder Biedermeier, entweder Größenwahn oder Selbstverachtung. Es scheint, als hätten die Deutschen nie gelernt, die Mitte zu finden, das Maß zu halten. Sie sind ein Volk der Superlative, auch im Negativen. Wenn sie sich schon selbst zerstören, dann wenigstens gründlich.
Diese Gründlichkeit zeigt sich besonders in der Art, wie die Deutschen mit ihrer eigenen Identität umgehen. Andere Völker haben eine Identität, die Deutschen haben ein Identitätsproblem. Sie sezieren ihre Nationalität mit der gleichen Intensität, mit der sie ihre Autos konstruieren, und kommen dabei zu dem Schluss, dass sie eigentlich keine Nation sein dürften. Es ist ein Teufelskreis: Je mehr sie über sich nachdenken, desto weniger gefällt ihnen, was sie sehen. Je weniger ihnen gefällt, desto mehr denken sie nach. Am Ende steht ein Volk, das sich selbst zum Objekt seiner eigenen Forschung gemacht hat und dabei vergessen hat zu leben.
Betrachten wir etwa die deutsche Sprache, diese herrliche, komplexe, präzise Sprache, die Goethe und Schiller, Heine und Brecht hervorgebracht hat. Was machen die Deutschen daraus? Sie verunstalten sie mit Anglizismen, verstümmeln sie mit Gendersternchen, verwässern sie mit politischer Korrektheit. Es ist, als würde man eine Stradivari nehmen und sie als Brennholz verwenden. Die Sprache, die einst die Sprache der Philosophie und der Dichtung war, wird zu einem Instrument der Selbstunterwerfung.
Oder nehmen wir die deutsche Industrie, einst der Stolz der Nation, Symbol für Qualität und Innovation. Was geschieht mit ihr? Sie wird demontiert im Namen des moralischen Fortschritts, verlagert im Namen der Globalisierung, reguliert im Namen des Umweltschutzes. Natürlich sind Umweltschutz und Globalisierung wichtige Themen, aber nur die Deutschen schaffen es, aus jeder Herausforderung eine Gelegenheit zur Selbstaufgabe zu machen. Andere Nationen nutzen den Wandel als Chance, die Deutschen als Buße.
Diese Tendenz zur Selbstkasteiung zeigt sich auch in der deutschen Außenpolitik. Während andere Länder ihre Interessen verfolgen und das auch offen sagen, sprechen deutsche Politiker von "Verantwortung" und meinen damit meist Verzicht. Deutschland soll zahlen, Deutschland soll helfen, Deutschland soll sich zurücknehmen. Immer sind es die anderen, die Rechte haben, Deutschland hat nur Pflichten. Es ist eine merkwürdige Form des Imperialismus: der Imperialismus der Selbstverleugnung.
Man fragt sich, ob dieser Masochismus nicht auch eine Form von Narzissmus ist. Wer sich so intensiv mit seiner eigenen Schlechtigkeit beschäftigt, macht sich immer noch zum Mittelpunkt des Universums. Die deutsche Schuld wird zu einer neuen Form der deutschen Größe: Wir sind die Schlechtesten, also sind wir auch die Wichtigsten. Es ist eine perverse Logik, aber eine, die funktioniert. Deutschland mag seine Wirtschaftsmacht verlieren, seine kulturelle Ausstrahlung, seinen politischen Einfluss - seine moralische Selbstgeißelung macht es immer noch einzigartig.
Dabei übersehen die Deutschen, dass ihre permanente Selbstkritik längst zu einer neuen Form der Arroganz geworden ist. Wer ständig betont, wie schlecht er ist, erwartet Bewunderung für seine Ehrlichkeit. Wer sich permanent entschuldigt, macht deutlich, dass er sich für wichtig genug hält, um entschuldigt zu werden. Die deutsche Demut ist eine Tarnung für deutschen Hochmut, die deutsche Bescheidenheit eine Maske für deutsche Überheblichkeit.
Es ist bezeichnend, dass diese Selbstzerstörung immer im Namen höherer Werte geschieht. Die Deutschen zerstören sich nicht aus Lust an der Zerstörung, sondern aus Liebe zur Moral. Sie opfern ihre Interessen nicht dem Egoismus, sondern dem Altruismus. Sie schwächen sich nicht aus Schwäche, sondern aus Stärke. Es ist die reinste Form der Perversion: das Böse im Namen des Guten zu tun.
Betrachten wir die deutsche Geschichtspolitik. Kein anderes Volk beschäftigt sich so intensiv mit seiner Vergangenheit, kein anderes hat so viele Gedenkstätten, Denkmäler, Erinnerungsrituale. Das ist an sich ehrenwert, aber die Deutschen haben daraus eine Industrie gemacht, einen Kult, eine Religion. Die Vergangenheit wird nicht bewältigt, sondern zelebriert. Nicht im Sinne einer Verherrlichung, sondern im Sinne einer ewigen Selbstanklage. Es ist, als hätten die Deutschen beschlossen, ihre Geschichte nicht zu überwinden, sondern sie zu ihrem Schicksal zu machen.
Diese obsessive Beschäftigung mit der Vergangenheit hat zur Folge, dass die Gegenwart aus dem Blick gerät. Während die Deutschen die Verbrechen von vor achtzig Jahren erforschen, übersehen sie die Probleme von heute. Während sie sich für die Sünden ihrer Großväter entschuldigen, ignorieren sie die Herausforderungen ihrer Kinder. Es ist eine Form der historischen Flucht: Man beschäftigt sich mit der Vergangenheit, um nicht über die Zukunft nachdenken zu müssen.
Dabei ist es paradox: Je mehr sich die Deutschen mit ihrer Geschichte beschäftigen, desto weniger lernen sie aus ihr. Die Lehre aus der Vergangenheit sollte sein, dass Extremismus gefährlich ist. Stattdessen haben die Deutschen den Extremismus nur verlagert: vom politischen ins moralische. Sie sind nicht mehr extrem nationalistisch, sondern extrem selbstkritisch. Sie sind nicht mehr extrem stolz auf ihr Land, sondern extrem beschämt über es. Das Pendel schlägt in die andere Richtung aus, aber es bleibt ein Extremismus.
Diese Extreme zeigen sich auch in der deutschen Mentalität des Alles-oder-Nichts. Die Deutschen können nicht einfach nur ein bisschen umweltbewusst sein, sie müssen die Welt retten. Sie können nicht einfach nur tolerant sein, sie müssen die Toleranz erfinden. Sie können nicht einfach nur demokratisch sein, sie müssen die beste Demokratie der Welt haben. Und wenn sie merken, dass sie nicht perfekt sind, dann sind sie sofort die Schlechtesten. Es gibt keine Zwischentöne, keine Grautöne, nur Schwarz oder Weiß.
Diese Schwarz-Weiß-Mentalität durchzieht alle Bereiche des deutschen Lebens. In der Wirtschaft gibt es nur Wachstum oder Krise, in der Politik nur Fortschritt oder Reaktion, in der Kultur nur Avantgarde oder Spießertum. Die Deutschen haben verlernt, dass das Leben hauptsächlich aus Grautönen besteht, aus Kompromissen, aus unvollkommenen Lösungen für komplizierte Probleme. Sie wollen immer das Absolute, das Reine, das Vollkommene. Und da es das nicht gibt, zerbrechen sie daran.
Vielleicht ist das der Kern des deutschen Problems: die Unfähigkeit zur Ironie. Andere Völker können über sich selbst lachen, können ihre eigenen Schwächen mit Humor betrachten, können Widersprüche aushalten, ohne daran zu zerbrechen. Die Deutschen nehmen sich und alles andere bittererst. Sie können nicht lachen über ihre eigenen Marotten, ihre eigenen Eigenarten, ihre eigenen Widersprüche. Alles muss Bedeutung haben, alles muss wichtig sein, alles muss ernst genommen werden.
Diese Humorlosigkeit ist vielleicht die verheerendste Form der deutschen Selbstzerstörung. Wer jeden Fehler als Katastrophe betrachtet, wird handlungsunfähig. Wer jede Kritik als vernichtend empfindet, wird zum Neurotiker. Die Deutschen haben aus ihrer Geschichte den falschen Schluss gezogen: Nicht dass man Fehler vermeiden muss, sondern dass man keine machen darf. Und da Fehler menschlich sind, bedeutet das letztendlich, dass man nicht menschlich sein darf.
Betrachten wir die deutsche Bürokratie, diese perfekte Metapher für den deutschen Geist. Ursprünglich geschaffen, um Ordnung zu schaffen, hat sie sich zu einem Selbstzweck entwickelt. Regeln werden nicht mehr erlassen, um Probleme zu lösen, sondern um Regeln zu haben. Verfahren werden nicht mehr angewendet, um Ziele zu erreichen, sondern um Verfahren anzuwenden. Die Form hat den Inhalt verschlungen, die Mittel sind zum Zweck geworden. Es ist die Bürokratisierung des Lebens, die Verrechtlichung der Existenz, die Regulierung der Seele.
Und überall in dieser Bürokratie findet man das gleiche Muster: die Lust an der Selbstbeschränkung, die Freude am Verzicht, das Vergnügen am Verbot. Es ist, als hätten die Deutschen entdeckt, dass man Macht auch dadurch ausüben kann, dass man sie nicht ausübt. Wer sich selbst die strengsten Regeln auferlegt, kann sich moralisch überlegen fühlen. Wer am meisten verzichtet, gewinnt. Es ist eine perverse Form des Wettbewerbs: Wer kann sich am meisten selbst schaden?
Diese Logik durchzieht auch die deutsche Wirtschaftspolitik. Während andere Länder versuchen, ihre Wirtschaft zu stärken, versucht Deutschland, seine Wirtschaft zu zivilisieren. Gewinn ist verdächtig, Erfolg ist peinlich, Wettbewerb ist unfair. Stattdessen soll die Wirtschaft dienen: der Umwelt, der Gesellschaft, der Moral. Das ist an sich nicht verkehrt, aber die Deutschen übertreiben auch hier. Sie wollen nicht nur eine erfolgreiche Wirtschaft, sondern eine moralische Wirtschaft. Und da Moral und Erfolg oft in Konflikt stehen, wählen sie die Moral und wundern sich über den ausbleibenden Erfolg.
Es ist bezeichnend, dass Deutschland in vielen Zukunftstechnologien den Anschluss verloren hat. Nicht weil es an technischen Fähigkeiten mangelte, sondern weil man sich zu viele Gedanken über die moralischen Implikationen gemacht hat. Während andere Länder Atomkraft genutzt haben, hat Deutschland sie verteufelt. Während andere Gentechnik entwickelt haben, hat Deutschland sie reguliert. Während andere künstliche Intelligenz vorangetrieben haben, hat Deutschland über die Ethik diskutiert. Am Ende haben die anderen die Technologie und Deutschland die Ethik. Aber Ethik ohne Macht ist folgenlos, Moral ohne Mittel ist wirkungslos.
Dieses Muster zeigt sich auch in der deutschen Außenpolitik. Deutschland will eine moralische Macht sein, aber keine reale Macht. Es will Einfluss ohne Verantwortung, Ansehen ohne Risiko, Führung ohne Führungsanspruch. Andere Länder definieren ihre Interessen und verfolgen sie. Deutschland definiert seine Werte und opfert sie. Es ist eine Politik der guten Absichten und schlechten Ergebnisse, eine Diplomatie der Prinzipien und der Erfolglosigkeit.
Besonders deutlich wird diese Haltung in der Europapolitik. Deutschland ist das größte und wirtschaftlich stärkste Land der EU, aber es verhält sich wie der kleinste und schwächste Partner. Es zahlt am meisten, bestimmt am wenigsten. Es trägt die größte Verantwortung, hat aber den geringsten Einfluss. Andere Länder nutzen die EU für ihre Zwecke, Deutschland dient der EU als Zweck an sich. Es ist eine Politik der Selbstaufopferung, die niemand dankt und nichts erreicht.
Vielleicht ist das das eigentliche Problem: Deutschland hat aufgehört, ein normales Land zu sein. Es will entweder ein außergewöhnlich gutes Land sein oder ein außergewöhnlich schlechtes. Es kann nicht einfach nur ein Land unter anderen sein, mit Stärken und Schwächen, mit Interessen und Werten, mit Erfolgen und Fehlern. Es muss immer besonders sein, immer extrem, immer absolut. Und da Perfektion unmöglich ist, bleibt nur die Selbstzerstörung.
Diese Haltung hat auch Auswirkungen auf die deutsche Gesellschaft. Das Streben nach moralischer Perfektion hat zu einer Atmosphäre der permanenten Anspannung geführt. Jedes Wort wird auf die Waagschale gelegt, jede Geste interpretiert, jeder Scherz analysiert. Die Deutschen haben verlernt, entspannt zu sein, natürlich zu sein, menschlich zu sein. Sie sind zu Schauspielern in ihrem eigenen Leben geworden, die ständig darauf achten müssen, ihre Rolle richtig zu spielen.
Diese Verkrampfung zeigt sich auch in der deutschen Sprache der Gegenwart. Sie ist gespickt mit Euphemismen, Vermeidungsformeln, präventiven Entschuldigungen. Man sagt nicht mehr, was man denkt, sondern was man denken sollte. Man formuliert nicht mehr spontan, sondern politisch korrekt. Die Sprache, die einst das Werkzeug der Dichter und Denker war, ist zum Instrument der Angepassten und Ängstlichen geworden. Es ist eine Sprache des Verzichts, der Selbstzensur, der freiwilligen Unterwerfung.
Und überall findet man die gleiche Logik: Statt Probleme zu lösen, schafft man sie ab, indem man sie umbenennt. Statt Schwierigkeiten anzugehen, erklärt man sie weg. Statt Konflikte auszutragen, vermeidet man sie. Es ist eine Politik der Realitätsverweigerung, die sich als Realitätsbewältigung tarnt. Man flüchtet sich in die Sprache, um der Wirklichkeit zu entgehen.
Besonders absurd wird diese Haltung, wenn man betrachtet, wie die Deutschen mit ihren eigenen Erfolgen umgehen. Jeder Erfolg wird sofort relativiert, jede Leistung kleingemacht, jeder Fortschritt in Frage gestellt. Es ist, als hätten die Deutschen Angst vor dem eigenen Erfolg, als würden sie sich vor ihrer eigenen Tüchtigkeit fürchten. Sie haben das Scheitern zu ihrer Komfortzone gemacht und den Erfolg zu ihrer Bedrohung.
Man könnte diese Haltung als Bescheidenheit interpretieren, aber es ist keine echte Bescheidenheit. Echte Bescheidenheit kennt ihre Grenzen, aber auch ihre Fähigkeiten. Deutsche "Bescheidenheit" kennt nur ihre Grenzen und leugnet ihre Fähigkeiten. Es ist eine falsche Bescheidenheit, eine neurotische Bescheidenheit, eine destruktive Bescheidenheit. Sie dient nicht der Selbsterkenntnis, sondern der Selbstverachtung.
Diese falsche Bescheidenheit hat auch eine soziale Funktion: Sie ist ein Mittel der Abgrenzung. Wer sich permanent selbst kritisiert, zeigt, dass er zu den Guten gehört. Wer seine eigenen Erfolge kleinredet, demonstriert seine moralische Überlegenheit über die, die stolz auf ihre Leistungen sind. Es ist eine Form des Klassenkampfs mit umgekehrten Vorzeichen: Die Guten erkennt man daran, dass sie schlecht über sich reden.
Aber diese Strategie hat einen Haken: Sie funktioniert nur, solange alle mitmachen. Sobald jemand die Regeln des Spiels durchschaut und sich weigert mitzuspielen, bricht das ganze System zusammen. Und genau das geschieht gerade. Andere Länder, andere Kulturen lassen sich nicht mehr von der deutschen Selbstgeißelung beeindrucken. Sie sehen darin nicht Moral, sondern Schwäche. Sie interpretieren deutsche Zurückhaltung nicht als Bescheidenheit, sondern als Mangel an Selbstbewusstsein.
Das führt zu einer paradoxen Situation: Je mehr sich Deutschland zurücknimmt, desto weniger wird es respektiert. Je mehr es auf seine Interessen verzichtet, desto mehr werden seine Interessen ignoriert. Je moralischer es sich gebärdet, desto unmoralischer wird es behandelt. Es ist ein Teufelskreis der Selbstschwächung, der nur durch eine radikale Umkehr gestoppt werden kann.
Aber eine solche Umkehr ist unwahrscheinlich, denn sie würde eine fundamentale Änderung der deutschen Mentalität erfordern. Die Deutschen müssten lernen, dass Stärke nicht automatisch böse ist, dass Erfolg nicht automatisch verdächtig ist, dass nationale Interessen nicht automatisch verwerflich sind. Sie müssten lernen, dass man ein guter Mensch sein kann, ohne ein schwacher Mensch zu sein, dass man moralisch sein kann, ohne masochistisch zu sein.
Vor allem aber müssten die Deutschen lernen, über sich selbst zu lachen. Sie müssten erkennen, dass ihre Selbstquälerei nicht ehrenwert ist, sondern lächerlich. Sie müssten verstehen, dass ihre permanente Selbstkritik nicht Ausdruck von Tiefe ist, sondern von Oberflächlichkeit. Sie müssten begreifen, dass ihre Unfähigkeit, stolz auf sich zu sein, nicht Bescheidenheit ist, sondern Dummheit.
Und dabei übersehen die Deutschen das Wichtigste: Ihre Selbstzerstörung zerstört nicht nur sie selbst, sondern auch das, wofür sie einst standen. Die deutsche Kultur, die deutsche Wissenschaft, die deutsche Technik - all das wird mit untergehen, wenn Deutschland sich weiter auf seinem Weg der Selbstaufgabe bewegt. Es ist nicht nur ein nationaler Suizid, sondern ein kultureller, ein geistiger, ein menschlicher.
Vielleicht ist das der Preis, den die Deutschen für ihre Vergangenheit zu zahlen bereit sind. Vielleicht glauben sie, dass sie ihre historischen Verbrechen nur durch kulturellen Suizid sühnen können. Vielleicht ist ihre Selbstzerstörung ihr letzter Beitrag zur Weltgeschichte: die Demonstration, wie man sich aus schlechtem Gewissen zu Tode quält.
Aber das wäre eine Verschwendung enormer Potentiale. Deutschland hat so viel zu bieten: seine Wissenschaft, seine Technik, seine Kultur, seine Erfahrungen. All das könnte der Welt helfen, die Zukunft zu gestalten. Stattdessen beschäftigt sich Deutschland mit seiner Vergangenheit und überlässt die Zukunft anderen. Es ist ein Rückzug aus der Geschichte im Namen der Geschichte, eine Flucht aus der Verantwortung im Namen der Verantwortung.
Die Frage ist, ob es noch Hoffnung gibt. Ob die Deutschen noch einmal den Mut fassen können, sich selbst zu mögen. Ob sie noch einmal lernen können, dass Selbstkritik gut ist, aber Selbsthass destruktiv. Ob sie einmal verstehen werden, dass man seine Vergangenheit bewältigen muss, um seine Zukunft gestalten zu können. Ob sie begreifen können, dass Stärke und Moral sich nicht ausschließen, sondern ergänzen.
Vor allem aber erfordert sie Mut. Den Mut, die eigene Stärke anzuerkennen. Den Mut, die eigenen Interessen zu vertreten. Den Mut, die eigenen Werte zu verteidigen. Den Mut, ein normales Land zu sein mit normalen Ambitionen und normalen Fehlern. Den Mut, menschlich zu sein statt übermenschlich oder untermenschlich.
Es ist paradox: Ausgerechnet die Deutschen, die einst für ihren Mut berühmt und berüchtigt waren, müssen heute Mut lernen. Nicht den Mut zur Zerstörung, sondern den Mut zum Leben. Nicht den Mut zur Eroberung, sondern den Mut zur Selbstbehauptung. Nicht den Mut zur Unterdrückung, sondern den Mut zur Befreiung - zur Befreiung von den eigenen Komplexen, von der eigenen Vergangenheitsfixierung, von der eigenen Selbstverachtung.
Ob sie diesen Mut aufbringen werden, ist fraglich. Die Verführung der Selbstzerstörung ist zu groß, die Bequemlichkeit der Selbstverachtung zu verlockend, die Süße der Selbstgeißelung zu intensiv. Es ist einfacher, sich schlecht zu fühlen, als gut zu werden. Es ist bequemer, sich zu beklagen, als sich zu ändern. Es ist angenehmer, Opfer zu sein, als Verantwortung zu übernehmen.
Aber vielleicht - und das ist die schwache Hoffnung, die am Ende bleibt - vielleicht werden die Deutschen irgendwann erkennen, dass ihre Selbstzerstörung nicht nur sie selbst betrifft, sondern auch ihre Kinder und Kindeskinder. Vielleicht werden sie verstehen, dass sie nicht nur für ihre Vergangenheit verantwortlich sind, sondern auch für ihre Zukunft.
Vielleicht werden sie wieder lernen, dass es keine Schande ist, ein Volk zu sein. Dass es keine Sünde ist, Traditionen zu haben. Dass es kein Verbrechen ist, stolz zu sein - nicht auf das Schlechte, aber auf das Gute. Vielleicht werden sie wieder entdecken, dass Patriotismus nicht Chauvinismus sein muss, dass Selbstbewusstsein nicht Arroganz bedeutet, dass nationale Identität nicht nationalen Größenwahn impliziert.
Es liegt nicht an mangelnder Intelligenz. Die deutsche Geisteswissenschaft hat Kant und Hegel hervorgebracht, die deutsche Naturwissenschaft Einstein und Heisenberg. Es liegt nicht an fehlender Kreativität. Die deutsche Kultur hat Bach und Beethoven geschaffen, Goethe und Mann. Es liegt auch nicht an mangelnder Tüchtigkeit. Die deutsche Wirtschaft hat Mercedes und BMW, Siemens und SAP hervorgebracht.
Das Problem liegt tiefer: in einer kollektiven Neurose, die aus der Unfähigkeit entstanden ist, mit Ambivalenzen umzugehen. Die Deutschen können nicht ertragen, dass sie sowohl Täter als auch Opfer der Geschichte waren, sowohl Zerstörer als auch Schöpfer, sowohl Barbaren als auch Kulturträger. Sie wollen Eindeutigkeit in einer Welt der Mehrdeutigkeit, Klarheit in einer Realität der Widersprüche. Dabei hätten sie allen Grund zur Zuversicht.
Das Buch, zu dem dieses Vorwort gehört, ist ein Versuch der Aufklärung in doppeltem Sinne: der intellektuellen Aufklärung über die Mechanismen der Selbstzerstörung und der emotionalen Aufklärung über die Möglichkeiten der Selbstbefreiung. Es ist weder eine Anklage noch eine Entschuldigung, weder eine Verherrlichung noch eine Verdammung. Es ist ein Versuch, die Wahrheit über ein Volk zu erzählen, das sich selbst nicht mehr erkennt.
Vielleicht wird diese Wahrheit schmerzhaft sein. Wahrheit ist oft schmerzhaft. Aber sie ist auch befreiend. Und Befreiung ist das, was Deutschland am dringendsten braucht: Befreiung von seinen Komplexen, von seiner Vergangenheit, von sich selbst. Nur ein befreites Deutschland kann wieder ein beitragendes Mitglied der Völkergemeinschaft werden, kann wieder Teil der Lösung statt Teil des Problems sein.
Die Diagnose ist gestellt: Deutschland leidet an chronischer Selbstzerstörung. Die Symptome sind beschrieben: Selbsthass, Vergangenheitsfixierung, moralischer Größenwahn, Erfolgsphobie und Zukunftsangst. Was fehlt, ist die Therapie. Diese kann nicht von außen kommen, sie muss von innen wachsen. Sie muss von den Deutschen selbst ausgehen, von ihrem Willen zur Gesundung, von ihrem Mut zur Selbstachtung, von ihrer Bereitschaft zur Normalität.
Ob sie diesen Mut aufbringen werden, bleibt abzuwarten. Die Zeichen sind gegenwärtig nicht ermutigend. Aber die Geschichte lehrt, dass auch die unwahrscheinlichsten Wendungen möglich sind. Vielleicht erleben wir noch die deutsche Wiedergeburt - nicht als neues Reich, sondern als normale Nation neben anderen Nationen. Einfach als Volk unter Völkern, mit Rechten und Pflichten, mit Stärken und Schwächen, mit Vergangenheit und Zukunft.
Die Liebe, von der im Titel die Rede ist, ist eine schwierige Liebe. Es ist die Liebe zu einem Land, das sich selbst nicht liebt. Es ist die Hoffnung auf ein Volk, das die Hoffnung aufgegeben hat. Es ist der Glaube an eine Nation, die nicht an sich glaubt. Es ist eine Liebeserklärung im Konjunktiv, ein Bekenntnis im Irrealismus, eine Zuneigung im Modus der Möglichkeit.
Aber vielleicht ist das der einzige Weg, wie man Deutschland heute noch lieben kann: nicht wie es ist, sondern wie es sein könnte. Nicht in seiner gegenwärtigen Selbstzerstörung, sondern in seiner möglichen Selbstfindung. Nicht als das Land der ewigen Buße, sondern als das Land der neuen Hoffnung.
Deutschland verdient diese Liebe. Seine Menschen verdienen sie, seine Kultur verdient sie, seine Zukunft verdient sie. Was nicht verdient ist, ist der Verzicht auf die eigenen Möglichkeiten.
In diesem Sinne ist die folgende Untersuchung nicht nur eine Analyse, sondern auch ein Appell. Ein Appell an die Deutschen, endlich aufzuhören mit ihrer Selbstquälerei und anzufangen mit ihrem Leben. Ein Appell, die Vergangenheit ruhen zu lassen und die Zukunft zu gestalten. Ein Appell, sich selbst so zu nehmen, wie sie sind: nicht perfekt, aber wertvoll, nicht makellos, aber liebenswert, nicht übermenschlich, aber menschlich.
Es ist Zeit für eine neue deutsche Normalität. Zeit für eine neue deutsche Selbstachtung.
Die Wurzeln in der Geschichte: Selbstzerstörung als deutsches Thema
Die deutsche Seele, wenn es sie denn gibt, trägt einen Todeskeim in sich, der ihr zur zweiten Natur geworden ist. Nicht die banale Selbstzerstörung des Säufers oder des Spielsüchtigen, sondern jene raffinierte Variante, die sich als höhere Moral tarnt und dabei das eigene Fundament untergräbt. Es ist, als hätte die Geschichte diesem Volk einen besonderen Auftrag erteilt: die Kunst der Selbstdemontage zur Perfektion zu bringen.
Man könnte mit den Germanen beginnen, diesen pelzgewandeten Waldläufern, die Rom das Fürchten lehrten und sich dann untereinander zerfleischten, sobald der äußere Feind besiegt war. Bereits Tacitus bemerkte mit römischer Präzision diese eigentümliche Neigung zur Selbstauslöschung, die er freilich als Tapferkeit missdeutete. Doch war es wirklich Mut, was die Cherusker, Markomannen und Sueben antrieb, oder bereits jene fatale Lust am eigenen Untergang, die später Nietzsche als spezifisch deutsch identifizieren sollte?
Die Antwort liegt vielleicht in der Struktur dieser frühen Gesellschaften verborgen, in ihrer Unfähigkeit, dauerhafte Institutionen zu schaffen. Während Rom seine Macht durch Verwaltung und Recht stabilisierte, blieben die germanischen Stämme in einem Zustand permanenter Auflösung gefangen. Ihre Könige waren Kriegsherren auf Zeit, ihre Bündnisse kurzlebig, ihre Loyalitäten käuflich. Sie verstanden die Kunst der Zerstörung, aber nicht die der Erhaltung.
Diese Disposition zur Instabilität färbte auf alles ab, was später als deutsch gelten sollte. Das Heilige Römische Reich, dieser tausendjährige Anachronismus, war bereits bei seiner Gründung ein Widerspruch in sich: weder heilig noch römisch und am Ende auch kein Reich. Otto der Große, der sich die Kaiserkrone aufs Haupt setzte, glaubte vielleicht wirklich, er erneuere die Herrlichkeit Karls des Großen. Stattdessen schuf er ein Monster aus konkurrierenden Gewalten, das seine Energie in endlosen Bürgerkriegen verbrauchte.
Man stelle sich vor: ein Reich, das sich über neunhundert Jahre lang methodisch selbst zerlegte, dabei aber nie den Anspruch aufgab, die erste Macht der Christenheit zu sein. Die deutschen Könige und Kaiser zogen regelmäßig nach Italien, um ihre Herrschaft zu legitimieren, und kehrten geschwächt zurück, während ihre Fürsten zu Hause die Macht unter sich aufteilten. Es war, als hätten sie einen Vertrag mit dem Selbstmord geschlossen und ihn über Jahrhunderte in Raten abgetragen.
Heinrich IV., der im Büßergewand nach Canossa pilgerte, verkörpert diese masochistische Grundhaltung in ihrer reinsten Form. Nicht genug, dass er sich dem Papst unterwarf – er inszenierte diese Demütigung auch noch als Triumph der Frömmigkeit. Die Deutschen haben daraus eine Tugend gemacht: die Niederlage als moralischen Sieg zu feiern. Canossa wurde zum Prototyp aller späteren deutschen Selbstdemütigungen, von der Dolchstoßlegende bis zur bedingungslosen Kapitulation.
Aber die wahre Meisterschaft in der Selbstzerstörung entwickelten die Deutschen erst mit der Reformation. Martin Luther, dieser geniale Spalter, zertrümmerte nicht nur die Einheit der Christenheit, sondern auch die Einheit seiner eigenen Nation. Mit jedem Thesenanschlag, mit jeder Streitschrift trieb er den Keil tiefer in das ohnehin brüchige Gefüge des Reiches. Die Folgen waren vorhersehbar: dreißig Jahre Krieg, der Deutschland in eine Wüste verwandelte.
Luther selbst mag geglaubt haben, er befreie die Seelen vom römischen Joch. Tatsächlich eröffnete er die deutsche Spielart des Bürgerkriegs, der sich fortan als Glaubenskrieg tarnte. Jeder Fürst konnte nun seine Machtgelüste mit theologischen Argumenten verbrämen, jeder Bauer seinen Aufstand als göttlichen Auftrag deuten. Das Ergebnis war eine Orgie der Vernichtung, die Europa ein Jahrhundert lang in Atem hielt.
Der Dreißigjährige Krieg war mehr als ein Glaubenskrieg; er war die erste große Selbstvernichtungsaktion der deutschen Nation. Katholiken und Protestanten massakrierten einander mit einer Gründlichkeit, die selbst die Zeitgenossen erschreckte. Ganze Landstriche wurden entvölkert, Städte ausgelöscht, Kulturen vernichtet. Als der Westfälische Friede 1648 endlich dem Gemetzel ein Ende setzte, war Deutschland um Jahrhunderte zurückgeworfen.
Und was lernten die Deutschen aus dieser Katastrophe? Sie institutionalisierten die Spaltung. Das Reich zerfiel in hunderte kleiner Herrschaften, jede mit ihrer eigenen Armee, ihrer eigenen Währung, ihren eigenen Zöllen. Deutschland wurde zu einem Flickenteppich aus Kleinstaaten, die sich gegenseitig lähmten. Die Kleinstaaterei, die romantische Gemüter später als Vielfalt priesen, war in Wahrheit die Fortsetzung des Bürgerkriegs mit anderen Mitteln.
Friedrich der Große versuchte, diesem Zustand mit preußischer Effizienz zu begegnen. Er schuf einen Staat, der funktionierte, aber nur, weil er seine Untertanen wie Maschinen behandelte. Preußen wurde zur Kaserne Europas, ein Land, in dem Ordnung um jeden Preis herrschte. Doch auch Friedrich konnte die deutsche Neigung zur Selbstzerfleischung nur kanalisieren, nicht überwinden. Seine Schlesischen Kriege waren bereits der Anfang jener fatalen Tradition, die Deutschland immer wieder in Kriege gegen die halbe Welt trieb.
Die Aufklärung, die in anderen Ländern zur Befreiung des Geistes führte, verkam in Deutschland zur Gehirnakrobatik weltfremder Gelehrter. Während die Franzosen eine Revolution machten und die Engländer ihr Empire begründeten, saßen deutsche Professoren in ihren Stuben und erfanden Systeme, die niemand verstand. Kant, der Königsberger Philosoph, lief täglich zur selben Zeit dieselbe Strecke und entwickelte dabei Gedankengebäude von solcher Kompliziertheit, dass sie nur noch von anderen deutschen Professoren verstanden wurden.
Diese Weltfremdheit hatte System. Die deutsche Intelligenz flüchtete sich in die Abstraktion, weil die Realität unerträglich war. Wie sollte man auch stolz auf ein Land sein, das aus dreihundert Zwergstaaten bestand und dessen größte kulturelle Leistung darin bestand, die komplizierteste Philosophie der Welt zu erfinden? Also träumte man von der Kulturnation, von jenem Deutschland der Dichter und Denker, das in der Realität nirgends existierte.
Napoleon beendete diesen Traum mit preußischer Gründlichkeit französischer Prägung. Seine Armeen fegten durch Deutschland wie ein Sturm durch ein Kartenhaus. Das Heilige Römische Reich, dieser tausendjährige Anachronismus, löste sich auf, ohne dass jemand eine Träne vergoss. Franz II., der letzte Kaiser, legte seine Krone nieder wie einen abgenutzten Hut. Es war das Ende einer Illusion, aber auch der Beginn einer neuen.
Die Befreiungskriege gegen Napoleon weckten zum ersten Mal seit Jahrhunderten ein deutsches Nationalgefühl. Junge Männer strömten zu den Fahnen, nicht für irgendeinen Fürsten, sondern für das Vaterland. Ernst Moritz Arndt und Johann Gottlieb Fichte predigten den Deutschen, sie seien das auserwählte Volk Europas. Turnvater Jahn ließ sie Leibesübungen machen, damit sie würdig würden ihrer großen Bestimmung.
Doch kaum war Napoleon besiegt, zerfiel die nationale Einigkeit wieder. Der Wiener Kongress restaurierte die alte Ordnung in verschärfter Form. Deutschland blieb ein Flickenteppich, nur dass es nun statt dreihundert nur noch neunundreißig Herren gab. Die nationale Bewegung wurde in den Untergrund gedrängt, wo sie sich radikalisierte. Aus patriotischen Jünglingen wurden Demagogen, aus Turnvereinen Geheimbünde.
Karl Ludwig Sand, der Kotzebue erstach, war das erste Opfer dieser fatalen Entwicklung. Er glaubte, mit einem Dolchstoß die deutsche Einheit herbeizwingen zu können. Stattdessen lieferte er Metternich den Vorwand für die Karlsbader Beschlüsse, die jeden Ansatz demokratischer Entwicklung erstickten. Sand wurde hingerichtet, aber sein Geist lebte weiter in den Köpfen einer Generation, die gelernt hatte, dass nur die Tat zählt, auch wenn sie zum Verderben führt.
Die Revolution von 1848 war der nächste Akt in diesem Drama deutscher Selbstzerstörung. In der Frankfurter Paulskirche versammelten sich die besten Köpfe des Landes, um endlich jene Einheit zu schaffen, die seit Jahrhunderten ersehnt wurde. Sie redeten und diskutierten, entwarfen Verfassungen und Grundrechtskataloge, während draußen die Reaktion ihre Kräfte sammelte.
Diese Männer, fast alle Professoren, Pastoren oder Advokaten, glaubten tatsächlich, man könne eine Nation durch Paragraphen schaffen. Sie übersahen dabei, dass Macht nicht aus dem Geist kommt, sondern aus Gewehren. Als Friedrich Wilhelm IV. die ihm angebotene Kaiserkrone ablehnte, war das Schicksal der Revolution besiegelt. Die Paulskirche löste sich auf wie ein Debattierklub nach Geschäftsschluss.
Doch das eigentliche Drama begann erst jetzt. Die gescheiterten Revolutionäre gingen ins Exil oder passten sich an. Die einen wurden Amerikaner, die anderen preußische Beamte. Deutschland blieb gespalten, aber nun mit dem zusätzlichen Trauma einer gescheiterten demokratischen Revolution. Das Bürgertum hatte versagt, die Fürsten triumphierten, das Volk blieb stumm.
Otto von Bismarck erkannte diese Konstellation mit der Kaltblütigkeit eines Chirurgen. Er verstand, dass die deutsche Einheit nicht durch Reden, sondern nur durch Blut und Eisen zu erreichen war. Seine drei Kriege zwischen 1864 und 1871 waren Meisterstücke der Machtpolitik, aber auch der Beginn einer Hybris, die Deutschland ins Verderben führen sollte.
Das Deutsche Reich, das 1871 in Versailles proklamiert wurde, war ein preußisches Machtkonstrukt mit föderalistischem Anstrich. Bismarck hatte Deutschland geeint, aber zu welchem Preis? Die süddeutschen Staaten wurden gleichgeschaltet, die Katholiken diskriminiert, die Sozialisten verfolgt. Das Reich war von Anfang an ein Zwangsbau, der nur durch die Autorität des Eisernen Kanzlers zusammengehalten wurde.
Bismarck selbst erkannte die Fragilität seiner Schöpfung. Seine Außenpolitik nach 1871 war ein permanenter Eiertanz, um zu verhindern, dass sich die europäischen Mächte gegen Deutschland verbündeten. Er wusste, dass das Reich in seiner exponierten Lage Europas nur überleben konnte, wenn es sich zurückhielt. Deutschland war saturiert, wie er immer wieder betonte, es hatte genug.
Doch Bismarck hatte die Rechnung ohne die deutsche Seele gemacht. Das Reich, das er geschaffen hatte, entwickelte sehr schnell einen Appetit, der über seine Verdauungskraft hinausging. Die Deutschen, jahrhundertelang das Aschenputtel Europas, konnten sich nicht damit abfinden, nur eine Macht unter anderen zu sein. Sie wollten mehr, sie wollten alles.
Kaiser Wilhelm II., dieser kronengeschmückte Dilettant, verkörperte diese neue deutsche Maßlosigkeit in Reinkultur. Er entließ Bismarck, weil er sich von niemand bevormunden lassen wollte, und steuerte das Reich mit der Umsicht eines Geisterfahrers. Seine Weltpolitik war ein einziger Fehler, seine Flottenrüstung eine Provokation Englands, seine Bündnispolitik ein Desaster.
Der Kaiser war nicht allein schuld an diesem Kurs. Hinter ihm stand eine ganze Generation von Deutschen, die glaubten, ihr Land sei dazu berufen, die Welt zu beherrschen. Professoren lehrten von der deutschen Sendung, Industrielle träumten vom Weltmarkt, Generäle planten den großen Krieg. Deutschland hatte sich in einen kollektiven Rausch hineinmanövriert, aus dem es nur ein böses Erwachen geben konnte.