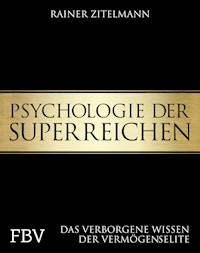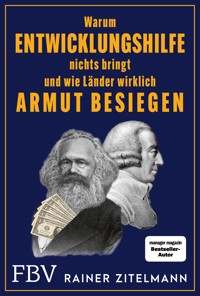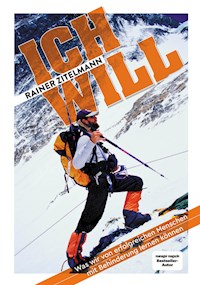21,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 21,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FinanzBuch Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
An diesem Buch werden sich Kapitalismuskritiker die Zähne ausbeißen. Zitelmann prüft die zehn häufigsten Einwände gegen den Kapitalismus: Kapitalismus führe zu Hunger und Armut, zu steigender Ungleichheit, zu überflüssigem Konsum, zu Umweltzerstörung und Klimawandel. Im Kapitalismus zähle nur der Profit zu Lasten der Menschlichkeit, im Kapitalismus dominierten Monopole, und die Demokratie werde ausgehöhlt. Zitelmann setzt sich mit jedem dieser Argumente ausführlich auseinander und zeigt: Nicht der Kapitalismus hat versagt, sondern alle antikapitalistischen Experimente der vergangenen 100 Jahre. Dabei argumentiert er nicht theoretisch, sondern wartet mit einer Fülle überraschender Fakten und historischer Tatsachen auf. Der zweite Teil des Buches handelt davon, wie die Menschen in Europa, den USA und Asien zum Kapitalismus stehen. Um das zu erkunden, hat Zitelmann bei dem renommierten Umfrageinstitut Ipsos MORI eine Umfrage in 14 Ländern in Auftrag gegeben, deren Ergebnisse hier erstmals vorgestellt werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 565
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
RAINER ZITELMANN
DIE 10 IRRTÜMER DER ANTI-KAPITALISTEN
Zur Kritik der Kapitalismuskritik
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen
Originalausgabe, 3. Auflage 2025
© 2022 by FinanzBuch Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH
Türkenstraße 89
80799 München
Tel.: 089 651285-0
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.
Redaktion: Ansgar Graw
Korrektorat: Anja Hilgarth
Satz: Carsten Klein, Torgau
eBook: ePUBoo.com
ISBN Print 978-3-95972-546-0
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-98609-037-1
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.finanzbuchverlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de
Inhalt
Vorwort zur 3. Auflage 2025
Vorwort
Teil A: Die 10 Irrtümer der Antikapitalisten
1. »Kapitalismus ist verantwortlich für Hunger und Armut«
2. »Kapitalismus führt zu steigender Ungleichheit«
3. »Kapitalismus ist schuld an Umweltzerstörung und Klimawandel«
4. »Kapitalismus führt zu immer neuen Wirtschaftskrisen«
5. »Kapitalismus ist undemokratisch – die Reichen bestimmen die Politik«
6. »Kapitalismus führt zu Monopolen«
7. »Kapitalismus fördert Egoismus und Profitgier – Menschlichkeit geht verloren«
8. »Kapitalismus erzeugt künstliche Bedürfnisse durch Werbung und fördert unnötigen Konsum«
9. »Kapitalismus führt zum Krieg«
10. »Kapitalismus führt zum Faschismus«
Teil B: Antikapitalistische Alternativen
11. Sozialismus sieht auf dem Papier immer gut aus (außer, wenn es ein Geschichtsbuch ist)
Teil C: So sehen die Menschen den Kapitalismus
12. Wie stehen die Deutschen zum Kapitalismus?
13. Wie Schweizer und Österreicher zum Kapitalismus stehen
14. So sehen die Menschen in Asien, Europa und den USA den Kapitalismus
Schluss: Antikapitalismus als politische Religion
Weiying Zhang: Marktwirtschaft und allgemeiner Wohlstand
Der Fragebogen
Der Autor
Anmerkungen
Literaturverzeichnis
Vorwort zur 3. Auflage 2025
Ich habe dieses Buch nicht geschrieben, um Antikapitalisten zu überzeugen. Ich weiß, dass nur sehr wenige Anhänger der antikapitalistischen Religion Bücher von Andersdenkenden lesen – es könnte sie ja in ihrem Glauben verunsichern. Ich habe das Buch geschrieben, um Menschen, die für die Marktwirtschaft sind, Fakten und Argumente an die Hand zu geben.
Inzwischen ist dieses Buch in 30 Sprachen erschienen. Nur im Herzland des Antikapitalismus, in Frankreich, gibt es bis heute keine Übersetzung. Und natürlich nicht in einem Land wie in China, wo zwar meine Bücher über Reichtum sehr erfolgreich sind, aber ein Buch wie dieses aus politischen Gründen nicht erscheinen darf.
Für die 1. Auflage, die 2022 erschien, hatte ich eine Umfrage in 14 Ländern in Auftrag gegeben. Den Fragebogen finden Sie auf Seite 399 bis 402 und mehr zur Methode der Umfrage im Kapitel 14 ab Seite 328. Inzwischen habe ich die Umfrage aber in 35 Ländern durchgeführt. Eine ausführliche Darstellung können Sie in der Fachzeitschrift Economic Affairs (Oktober 2023) finden – geben Sie bei Google einfach den Titel ein: »Attitudes towards capitalism in 34 countries on five continents«.
Einige wichtige Ergebnisse möchte ich nun in diesem Vorwort darstellen, als Ergänzung und Aktualisierung von Kapitel 14.
Wir hatten zuerst sechs Fragen gestellt, ohne das Wort »Kapitalismus« dabei zu verwenden, das für viele Menschen einen schlechten Klang hat. Doch auch wenn man das Wort nicht verwendet, stehen die Menschen in den meisten Ländern der Marktwirtschaft skeptisch gegenüber und fordern massive Interventionen des Staates.
Die meisten Anhänger der Marktwirtschaft gibt es in Polen. Das ist kein Wunder. Einst war Polen eines der ärmsten Länder Europas, aber durch die kapitalistischen Reformen ab 1990 hat sich der Lebensstandard erheblich erhöht und Polen war über Jahrzehnte eines der am stärksten wachsenden Länder. Ich empfehle Ihnen dazu mein Buch »Der Aufstieg des Drachen und des Weißen Adlers«, der von Vietnam und Polen handelt, oder meinen Film »Poland. From Socialism to Prosperity«, den Sie auf Youtube finden.
An zweiter Stelle folgen die USA und dann Tschechien, ebenfalls eine marktwirtschaftliche Erfolgsstory. Auch die Zustimmung zur Marktwirtschaft in Südkorea dürfte niemanden wundern, der das Land kennt: In den 60er-Jahren war es so arm wie heute die ärmsten afrikanischen Länder, aber heute ist es eines der wirtschaftlich erfolgreichsten Länder der Welt und der Lebensstandard stieg immens.
Gewundert hatten sich manche bei Veröffentlichung der Umfrage, dass es in Argentinien so viele Marktwirtschaft-Fans gibt – nur in fünf Ländern, wo wir die Befragung durchführten, war die Zustimmung größer, dagegen in 29 Ländern geringer. Manche Kritiker zweifelten an den Ergebnissen: »Argentinien ist doch ein peronistisches Land, das weiß doch jeder«, hieß es. Nun, unsere Ergebnisse zeigten einen Stimmungswandel in dem Land, der sich später dann tatsächlich in der Wahl des Anarchokapitalisten Javier Milei zum Präsidenten manifestierte.
Umgekehrt zeigte unsere Befragung, dass die Menschen im kapitalistischen Musterland Chile Marktwirtschaft und Kapitalismus skeptisch gegenüberstehen. Ein weiterer Irrtum? Nein, wenige Monate nach unserer Erhebung wählten die Chilenen einen Sozialisten als Präsident. Unsere Befragung ermöglicht es also manchmal, einen Blick in die Zukunft zu werfen. Das gilt auch für Länder wie die Schweiz, eines der kapitalistischsten Länder Welt, in dem sich aber auch zunehmend eine antikapitalistische Stimmung breit macht, wie unsere Befragung zeigte. Die Ergebnisse für alle Länder sehen Sie in der Grafik auf Seite 5.
Die zweite Grafik auf Seite 6 zeigt die Einstellung der Menschen zum Kapitalismus, wenn man alle 34 Fragen berücksichtigt, die wir gestellt haben. Die Grafik ähnelt der ersten, ist aber nicht identisch. Nur in sechs Ländern überwiegt die Zustimmung zum Kapitalismus: Polen, USA, Südkorea, Japan, Nigeria und Tschechien. Darüber hinaus sehen wir auch in Vietnam und Argentinien starke Zustimmungswerte zum Kapitalismus. Dass in Nigeria die Menschen den Begriff »Kapitalismus« sehr positiv sehen, mag manche wundern. Aber die Nigerianer sind in einer Hinsicht klüger als wir Deutsche: Während viele Deutsche glauben, Kapitalismus führe zu Hunger und Armut, glaubt das in Nigeria kaum jemand, wie unsere Umfrage zeigte. Kapitalismus ist für viele Nigerianer ein Hoffnungswort – das Versprechen eines Lebens wie in Europa oder den USA.
Auch in Vietnam hat das Wort »Kapitalismus« einen sehr positiven Klang für viele Menschen. Zwar nennt sich das Land offiziell eine »sozialistische Marktwirtschaft«, doch tatsächlich hat die wirtschaftliche Freiheit in diesem Land seit Einleitung der sogenannten »Doi Moi«-Reformen Ende der 80er-Jahre riesige Fortschritte gemacht und Unternehmertum wird dort bewundert.
Ich war in den meisten Ländern, wo die Befragung durchgeführt wurde, und mehr über diese Länder und die Umfrageergebnisse erfahren Sie in meinem Buch »Weltreise eines Kapitalisten«, das 2024 erschienen ist.
Ein Ergebnis der Befragung war besonders interessant: Neben all den Fragen zum Kapitalismus stellten wir auch zwei Fragen, die als Indikator für die Unterstützung von Verschwörungstheorien dienen (siehe Seite 399, Frage 5 und 6). Das Ergebnis war eindeutig: In 34 von 35 Ländern (Albanien war die einzige Ausnahme) neigen Antikapitalisten stärker zum Verschwörungsdenken als Prokapitalisten. Tatsächlich ist Antikapitalismus eine besondere Form von Verschwörungsdenken: Reiche und Lobbyisten kontrollieren die Welt und sind Sündenböcke für alle negativen Entwicklungen, so der Glaube der Antikapitalisten.
Es ist nicht überraschend, dass der Antikapitalismus am stärksten unter denjenigen ausgeprägt ist, die sich links im politischen Spektrum befinden, und die stärksten Befürworter des Kapitalismus rechts der Mitte sich finden. Doch während in einigen Ländern die Formel lautet: »Je rechtsgerichteter, desto kapitalismusfreundlicher«, gibt es mehr Länder, in denen gemäßigte Rechte den Kapitalismus etwas mehr unterstützen als diejenigen, die sich am äußersten rechten Rand des politischen Spektrums befinden.
Unsere Befragung zeigte auch, welche Kritikpunkte am Kapitalismus am weitesten verbreitet sind. Und zwar, dass:
der Kapitalismus von Reichen dominiert wird, die die politische Agenda bestimmen;
der Kapitalismus zu wachsender Ungleichheit führt;
der Kapitalismus Egoismus und Gier fördert und
der Kapitalismus zu Monopolen führt.
Mit diesen Meinungen über den Kapitalismus setze ich mich in diesem Buch intensiv auseinander.
Meine Bitte: Helfen Sie mit, diese Fakten über den Kapitalismus weiter zu verbreiten. Schenken Sie dieses Buch Ihren Freunden und helfen Sie damit, die Wahrheit über ein großartiges Wirtschaftssystem zu verbreiten, durch das der Anteil der Menschen, die in extremer Armut leben, weltweit in 200 Jahren von 90 auf weniger als 9 Prozent sank.
Dr. Dr. Rainer Zitelmann, Dezember 2024
Einstellung zur wirtschaftlichen Freiheit in 35 Ländern
Durchschnitt der Aussagen zugunsten eines freiheitlichen Wirtschaftssystems geteilt durch den Durchschnitt der Aussagen zugunsten eines staatlich gesteuerten Wirtschaftssystems (ohne Verwendung des Begriffs »Kapitalismus«)
Lesehilfe: Je größer die Zahl ist, desto positiver die Einstellung zur Marktwirtschaft
Quellen: Allensbacher Archiv, IfD-Umfrage Nr. 12038, Ipsos MORI, Umfragen Nr. 20–091774–30, 21–087515–07, 22–014242–04–03, 22–087515–44 und 22–087220–42, Indochina Research, Sant Maral Foundation, FACTS Research & Analytics Pvt. Ltd. und Research World International Ltd.
Gesamtkoeffizient über die Einstellung zum Kapitalismus in 35 Ländern
Lesehilfe: Je kleiner die Zahl, desto ausgeprägter die antikapitalistische Einstellung
Quellen: Allensbacher Archiv, IfD-Umfrage Nr. 12038, Ipsos MORI, Umfragen Nr. 20–091774–30, 21–087515–07, 22–014242–04–03, 22–087515–44 und 22–087220–42, Indochina Research, Sant Maral Foundation, FACTS Research & Analytics Pvt. Ltd. und Research World International Ltd.
Vorwort
Kapitalismus wird heute mit allen schlimmen Dingen auf der Welt in Verbindung gebracht. Der Begriff ist zum Synonym für das Böse schlechthin geworden. Und zwar nicht nur in der politischen Religion des Antikapitalismus, sondern auch im Bewusstsein vieler Menschen. Der Kapitalismus hat nicht viele Freunde auf der Welt – und dies, obwohl er so erfolgreich war wie kein anderes Wirtschaftssystem der Menschheitsgeschichte.
Der Trick der Antikapitalisten: Sie vergleichen das reale System, in dem wir leben, mit dem Ideal einer perfekten Welt, die sie sich ausgedacht haben, die es jedoch nirgendwo gibt oder gab. Sie setzen zudem darauf, dass die Menschen wenig über Geschichte wissen und darüber, in welch ärmlichen und menschenunwürdigen Verhältnissen unsere Vorfahren lebten, bevor der Kapitalismus entstand. Und sie setzen darauf, dass die meisten Zeitgenossen in der Schulzeit fast nichts über die menschenunwürdigen Verhältnisse im Sozialismus erfahren haben.
Schließlich zeichnen sie die Zukunft in den schwärzesten Farben, wobei sie alle negativen Entwicklungen nicht etwa dem möglichen Staatsversagen, sondern immer nur einem angeblichen Marktversagen zuschreiben. Wenn man darauf hinweist, dass alle antikapitalistischen Systementwürfe ausnahmslos gescheitert sind, dann lassen die Antikapitalisten das nicht gelten: Das sei ja gar kein »wahrer« Sozialismus gewesen! Und sie insinuieren damit selbstgewiss, sie hätten nun nach über 100 Jahren das richtige Rezept gefunden, wie es das nächste Mal funktionieren kann.
Das Wirtschaftssystem des Kapitalismus beruht auf Privateigentum und Wettbewerb – die Unternehmen entscheiden, was und wie viel produziert wird. Bei dieser Entscheidung helfen ihnen die Preise, die sich am Markt bilden. Die zentrale Rolle im Kapitalismus spielen die Unternehmer, die neue Produkte entwickeln und neue Marktchancen entdecken, sowie die Konsumenten, die mit ihren individuellen Käufen letztlich über Erfolg oder Misserfolg des Unternehmers entscheiden.1 Kapitalismus ist Unternehmerwirtschaft – eigentlich wäre dies sogar das treffendere Wort.
Im Sozialismus dagegen dominiert das Staatseigentum und es gibt weder einen wirklichen Wettbewerb noch wirkliche Preise. Vor allem gibt es im Sozialismus kein Unternehmertum. Welche Produkte in welcher Menge produziert werden, entscheiden zentrale staatliche Planbehörden und nicht private Unternehmer.
Freilich, in dieser reinen Form existiert keines dieser Systeme irgendwo auf der Welt. Alle Systeme sind tatsächlich Mischsysteme. In sozialistischen Systemen gab und gibt es begrenztes Privateigentum und Reste von Marktwirtschaft (andernfalls wären sie viel früher zusammengebrochen). Und in kapitalistischen Ländern gibt es heute eine Menge sozialistischer und planwirtschaftlicher Bestandteile (die das Funktionieren der Marktwirtschaft oft behindern und ihre Ergebnisse entsprechend verzerren).
In meinem Buch »Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung« habe ich eine »Theorie« entwickelt, die ich heute die »Reagenzglas-Theorie« nenne – obwohl es eigentlich keine Theorie ist, sondern eher ein Bild, mit dem man historische Entwicklungen besser verstehen kann: Stellen Sie sich ein Reagenzglas vor, in dem sich die Elemente Staat und Markt, Sozialismus und Kapitalismus befinden. Und dann geben Sie in dieses Reagenzglas mehr Markt ein, so wie es die Chinesen seit den 1980er-Jahren getan haben: Das Ergebnis ist eine Abnahme der Armut und eine Zunahme des Wohlstandes. Oder Sie geben in das Reagenzglas mehr Staat ein, so wie es die Sozialisten in Venezuela seit 1999 getan haben. Das Ergebnis ist mehr Armut und weniger Wohlstand.
Überall auf der Welt herrscht dieser Kampf der Gegensätze: Markt versus Staat, Kapitalismus versus Sozialismus. Es handelt sich hier um einen dialektischen Widerspruch, und die Entwicklung eines Landes – ob nun in Richtung mehr Wohlstand oder weniger Wohlstand – hängt davon ab, wie sich das Kräfteverhältnis zwischen Markt und Staat entwickelt. Während in den 1980er- und 1990er-Jahren in vielen Ländern eine Stärkung der Marktkräfte zu beobachten war (Deng Xiaoping in China, Margaret Thatcher und Ronald Reagan in Großbritannien und den USA, Reformen in Schweden und Anfang der 2000er-Jahre in Deutschland), können wir heute in vielen Ländern beobachten, wie die andere Seite – der Staat – in diesem Kampf der Gegensätze zunehmend an Stärke gewonnen hat. Auf der Ebene der Ideen heißt dies: Antikapitalismus ist wieder verstärkt in Mode und prägt das Denken vieler Journalisten und Politiker.
In den Diskussionen, die ich in vielen Ländern zu diesem Thema geführt habe, wurden mir oft Fragen gestellt, die in dem Buch »Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung« nicht beantwortet worden waren, so etwa: Wie steht es mit der Umweltzerstörung? Oder: Gehen nicht menschliche Werte im Kapitalismus verloren, wird nicht am Ende alles dem Profitdenken geopfert? Und wie verhalten sich Demokratie und Kapitalismus? Zeigt nicht das Beispiel der USA, dass nicht die Mehrheit der Wähler, sondern das große Geld die Politik bestimmt? Und was ist mit der Schere zwischen Arm und Reich, die, wie man in Medien lesen kann, ständig weiter auseinandergeht? Und was sagen Sie zu den großen Monopolen wie Google oder Facebook, die immer mächtiger werden? Schließlich: Ist nicht der Kapitalismus für die Kriege auf dieser Welt verantwortlich und hat er nicht schlimme Diktaturen – wie etwa die Hitler-Diktatur – hervorgebracht? Die Menschen, die am Kapitalismus zweifeln oder verzweifeln, fragen schließlich: Sollte man nicht Alternativen zum Kapitalismus ausprobieren? Diesen Fragen widme ich mich in diesem Buch.
Ich argumentiere in den folgenden Kapiteln nicht theoretisch. Gegner des Kapitalismus lieben es, über Theorien zu diskutieren, weil bei solchen Diskussionen nicht so einfach zu entscheiden ist, wer recht und wer unrecht hat, und weil sie Freude daran haben, sich in die Höhen der Abstraktion aufzuschwingen. Theorien bzw. ökonomische Modelle sind für die meisten Menschen jedoch zu abstrakt und schwer verständlich. Das ist der erste Nachteil. Der zweite Nachteil, der noch schwerer wiegt: Manche Theorien sind verführerisch, weil sie mit dem übereinstimmen, was wir zu wissen glauben, mit unseren Vorurteilen über die Welt. Wenn sie in sich stimmig sind, eingängig formuliert und gut präsentiert werden und vor allem dem entsprechen, was wir sowieso zu wissen glauben, üben sie eine große Anziehungskraft aus. Ich finde es wichtiger, sich zunächst einmal darüber zu vergewissern, ob die Fakten, auf denen eine Theorie basiert, wirklich zutreffend sind. Und das ist der wunde Punkt bei den Theorien der Antikapitalisten: Sie stimmen einfach nicht mit den historischen Fakten überein, sondern nur mit unseren Vorurteilen über die Welt.
Auch manche Anhänger des Kapitalismus diskutieren gerne über ökonomische Modelle. Ich habe nichts dagegen, und solche Modelle haben ihre Berechtigung. Ich finde es jedoch zielführender, statt über Modelle über historische Fakten zu diskutieren und dann zu entscheiden, wer recht hat.
In diesem Buch gehe ich wie folgt vor: Im Teil A widme ich mich detailliert den immer wieder gegen den Kapitalismus vorgetragenen Argumenten. Im mittleren Teil B befasse ich mich mit der Frage nach Alternativen zum Kapitalismus. Dabei begründe ich, warum ich nicht viel davon halte, mich mit irgendwelchen Ideen auseinanderzusetzen, die es nur auf dem Papier gibt. Auf dem Papier sieht Sozialismus immer gut aus – außer, wenn es ein Geschichtsbuch ist.
Im dritten Teil des Buches (C) geht es darum, wie die Menschen den Kapitalismus sehen. Vielleicht haben Sie die Bücher von Steven Pinker, »Aufklärung jetzt!«, oder von Hans Rosling, »Factfulness«, gelesen. Mich haben diese Bücher fasziniert: Sie zeigen, wie sehr sich die meisten Menschen irren, wenn sie glauben, früher sei alles besser gewesen und die ganze Welt werde immer schlechter. Der Widerspruch zwischen den in Umfragen ermittelten Daten darüber, wie die meisten Menschen die Welt sehen, und den Fakten, wie die Welt wirklich aussieht, ist frappierend. Das gilt auch für das Thema Kapitalismus, bei dem die historischen und ökonomischen Fakten einerseits und die Meinungen der Menschen andererseits stark auseinanderfallen. In einem großen internationalen Projekt habe ich Menschen in 14 Ländern dazu befragen lassen, was sie über den Kapitalismus denken.
Dieses Buch dient nicht in erster Linie der Auseinandersetzung mit anderen Wissenschaftlern, sondern es geht mir vor allem um die Kritik an populären Meinungen über den Kapitalismus. Gleichwohl setze ich mich in manchen Kapiteln mit den Argumenten einiger prominenter antikapitalistischer Intellektueller – wie etwa Thomas Piketty, Naomi Klein und Noam Chomsky – oder mit Büchern und Argumenten von kapitalismuskritischen Wissenschaftlern auseinander. Ich tue das vor allem dann, wenn ich glaube, dass deren Thesen inzwischen in breiteren Bevölkerungsschichten Akzeptanz gefunden haben. Dabei haben natürlich die meisten Menschen, die antikapitalistische Meinungen teilen, weder Marx noch einen der modernen Kapitalismuskritiker gelesen. Aber viele ihrer Thesen haben – vermittelt durch Medien, Universitäten und Schulen – Eingang in das allgemeine Bewusstsein gefunden und gelten sogar teilweise als gesicherte Erkenntnisse, obwohl sie zahlreiche Irrtümer enthalten.
Sie werden zudem sehen, dass manche Thesen, die scheinbar ganz neu und aktuell daherkommen (z. B. die Kritik am Konsum), tatsächlich sehr viel älter sind: Die Begründungen der Konsumkritik wechselten – mal war es die Zerstörung der Kultur, dann die angebliche »Entfremdung«, heute ist es der Klimawandel –, doch die Zielrichtung blieb stets gleich, der Kapitalismus. Die ständig wechselnden Begründungen der gleichen Thesen legen den Verdacht nahe, dass die Begründungen nicht so wichtig sind wie das eigentliche Ziel. Manche Antikapitalisten, so etwa Naomi Klein, geben sogar offen zu, dass sie sich für Themen wie den Klimawandel erst in dem Augenblick interessierten, als sie entdeckten, dass dieses Thema eine neue, wirksame Waffe im Kampf gegen den schon vorher verhassten Kapitalismus sei.
Kritiker werden mir »Einseitigkeit« vorwerfen. Das liegt einerseits daran, dass viele Fakten und Argumente in diesem Buch im Widerspruch zu allem stehen, was die meisten Menschen glauben und was in vielen Medien vermittelt wird (zum »andererseits« komme ich gleich). Daher werden Sie oft überrascht sein. Voraussetzung für die Lektüre des Buches ist eine gewisse Offenheit für Fakten, die Ihren bisherigen Meinungen möglicherweise widersprechen. Bei unserer Umfrage in Deutschland bekam von 18 Aussagen zum Kapitalismus keine so wenig Zustimmung (15 Prozent) wie die, dass der Kapitalismus in vielen Ländern die Lage der einfachen Leute verbessert hat. Dreimal so viele Befragte (45 Prozent) sind sicher, der Kapitalismus sei für Hunger und Armut auf der Welt verantwortlich. Die Zahlen, die ich im ersten Kapitel präsentiere, belegen eindeutig, dass die 15 Prozent recht und die 45 Prozent unrecht haben.
Bei Themen wie Hunger oder Armut ist jedoch eine auf Fakten basierte Diskussion sehr schwierig. Je stärker ein Thema emotional besetzt ist, umso weniger sind Menschen überhaupt bereit, Fakten zur Kenntnis zu nehmen, die ihren eigenen Meinungen widersprechen. Wissenschaftler haben das in Experimenten und Untersuchungen herausgefunden.
In zahlreichen repräsentativen Erhebungen, die Wissenschaftler in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder in ähnlicher Weise durchführten, wurde den Befragten ein Blatt mit einem Bild und einer Sprechblase vorgelegt und folgende Frage gestellt: »Ich möchte Ihnen jetzt einen Vorfall erzählen, der sich neulich bei einer Podiumsdiskussion über [dann folgten unterschiedliche Themen wie Gentechnik, Klimawandel, Kernenergie, Luftverschmutzung usw., die emotional polarisieren] ereignet hat. Experten sprachen über die Risiken und den Stand der Forschung. Plötzlich springt ein Zuhörer auf und ruft etwas in den Saal: Wenn Sie das mal bitte lesen.« Auf dem Blatt war ein Sprecher mit einer Sprechblase abgebildet, in der stand: »Was interessieren mich Zahlen und Statistiken in diesem Zusammenhang? Wie kann man überhaupt so kalt über ein Thema reden, bei dem es um das Überleben von Mensch und Natur geht?« Die Frage darunter lautete: »Würden Sie sagen, der hat recht oder nicht recht?« Diese Frage wurde über 27 Jahre in 15 repräsentativen Befragungen zu unterschiedlichen Themen, über die in der Öffentlichkeit kontrovers und emotionalisiert diskutiert wird, gestellt. Stets gab die Mehrheit dem Zwischenrufer recht, der sich nicht für Fakten interessierte. Im Durchschnitt sagten 54,8 Prozent, der faktenresistente Zwischenrufer habe recht, nur 23,4 Prozent sahen dies anders.2
Hier bin ich beim »andererseits«: Ich versuche in diesem Buch nicht, künstlich eine »mittlere« Position einzunehmen oder den irrigen Meinungen vieler Menschen entgegenzukommen, wenn die Fakten eindeutig sind. Abgesehen davon: Angesichts von Hunderten Büchern, die den Kapitalismus anklagen, wäre es kein Fehler, wenn ein Buch den Kapitalismus verteidigt. In jedem Gerichtsverfahren wird dem Angeklagten ein Verteidiger zugestanden. Der Richter – und der sind in diesem Fall Sie, lieber Leser – kann sich ein Urteil bilden, wenn alle Fakten auf dem Tisch liegen, auch jene, die für den Kapitalismus sprechen. Ein Verfahren, in dem es keinen Verteidiger gibt und Ankläger und Richter unter einer Decke stecken, nennt man Schauprozess. Die Auseinandersetzung mit dem Kapitalismus erinnert häufiger an einen Schauprozess als an ein faires Verfahren.
Sehr beeindruckt hat mich die klare und in einfachen Worten gehaltene Verteidigung der Marktwirtschaft von meinem Freund Professor Weiying Zhang, einem renommierten Ökonom der Peking-Universität. Ich habe seinen Beitrag auf den Seiten 375–398 angefügt. Lesern, die sich bislang noch nicht intensiv mit dem Thema »Kapitalismus« befasst haben, empfehle ich, dieses Kapitel vielleicht nicht am Ende, sondern am Anfang – also gleich nach diesem Vorwort – zu lesen.
Abschließend möchte ich den Wissenschaftlern und Freunden danken, die mir mit Zuspruch oder kritischen Hinweisen zu diesem Buch geholfen haben. Manche haben einzelne Kapitel gelesen, andere das ganze Manuskript. Mein Dank gebührt Prof. Jörg Baberowski, Dr. Daniel Bultmann, Prof. Jürgen W. Falter, Prof. Thomas Hecken, Dr. Christian Hiller von Gaertringen, Dr. Helmut Knepel, Prof. Eckhard Jesse, Prof. Hans Mathias Kepplinger, Prof. Wolfgang König, Dr. Gerd Kommer, Prof. Stefan Kooths, Prof. Wolfgang Michalka, Reinhard Mohr, Dr. Kristian Niemietz, Prof. Werner Plumpe, Prof. Martin Rhonheimer, Prof. Walter Scheidel, Prof. Hermann Simon, Prof. Frank Trentmann, Prof. Bernd-Jürgen Wendt, Prof. Erich Weede.
Mein besonderer Dank gilt Dr. Thomas Petersen vom Allensbach-Institut, der das Projekt über viele Monate mit großem Engagement begleitet, und meinem Freund Ansgar Graw, der das Buch wieder mit hoher Kompetenz lektoriert hat.
Teil A: Die 10 Irrtümer der Antikapitalisten
1. »Kapitalismus ist verantwortlich für Hunger und Armut«
Der Kapitalismus wird oft für Hunger und Armut in der Welt verantwortlich gemacht. Was glauben Sie? Ist die Armut in den vergangenen Jahrzehnten eher gesunken, eher gestiegen oder eher gleichgeblieben?
2016 wurden 26.000 Menschen in 24 Ländern nach ihrer Einschätzung der Entwicklung absoluter Armut über die letzten 20 Jahre befragt. Nur 13 Prozent der Befragten gaben an, die Armutsquote sei gesunken. 70 Prozent glaubten hingegen, die Armutsquote habe zugenommen. Besonders stark fiel die Fehlwahrnehmung in Industrieländern aus. In Deutschland etwa gaben nur 8 Prozent an, dass der Anteil absolut Armer an der Weltbevölkerung gesunken sei. Eine 2017 durch Ipsos MORI durchgeführte Studie kam zu ähnlichen Ergebnissen. Demnach waren in Deutschland lediglich 11 Prozent der Befragten überzeugt, die absolute Armut habe weltweit abgenommen, während in China 49 Prozent eine Abnahme sahen.3 Die absolute Armutsgrenze ist eine Armutsgrenze, die einen gleichen Warenbedarf von Menschen weltweit zugrunde legt. Wer diesen Warenkorb nicht erwerben kann, gilt als »absolut« gesehen arm.4
Bevor der Kapitalismus entstand, lebten die meisten Menschen auf der Welt in extremer Armut – 1820 betrug die Quote noch 90 Prozent. Heute ist sie unter 10 Prozent gesunken. Das Bemerkenswerte: In den letzten Jahrzehnten, seit dem Ende der sozialistischen Planwirtschaft in China und anderen Ländern, hat sich der Rückgang der Armut so stark beschleunigt wie in keiner Phase der Menschheitsgeschichte zuvor. 1981 lag die Quote noch bei 42,7 Prozent, im Jahr 2000 war sie bereits auf 27,8 Prozent gesunken und 2021 lag sie unter 10 Prozent.5
Diese Haupttendenz, die über Jahrzehnte anhält, ist entscheidend. Zwar ist die Armut – entgegen den ursprünglichen Erwartungen der Weltbank, die diese Daten erhebt – zuletzt wieder gestiegen. Aber das hat vor allem mit der Covid-Pandemie zu tun, die in Ländern mit ohnehin großer Armut zu einer erneuten Verschlechterung der Situation geführt hat.6
Hat man die längere Tendenz im Blick, dann sind auch andere Entwicklungen erfreulich. Die Kinderarbeit nahm in den letzten Jahrzehnten deutlich ab. Im Jahr 2000 arbeiteten weltweit 246 Millionen Kinder, 20 Jahre später, im Jahr 2020, waren es nur noch 160 Millionen.7 Und dies, obwohl die Weltbevölkerung im gleichen Zeitraum von 6,1 auf 7,8 Milliarden Menschen zunahm.
Um das Thema Armut zu verstehen, müssen wir einen Blick in die Geschichte werfen. Viele Menschen glauben, der Kapitalismus habe zu Hunger und Armut in der Welt geführt. Sie stellen sich die vorkapitalistische Zeit völlig unrealistisch vor. Johan Norberg, der Verfasser des Buches »Fortschritt«, war in seiner Jugend selbst ein Antikapitalist. Er räumt jedoch ein, er habe nie darüber nachgedacht, wie die Leute wohl vor der industriellen Revolution gelebt hätten. »Ich stellte mir diese Epoche der Menschheit im Grunde genommen vor wie einen Ausflug aufs Land.«8 Sahra Wagenknecht schreibt in ihrem Buch »Die Selbstgerechten«, vor dem Kapitalismus hätten die Menschen zwar in »sicherlich entbehrungsreichen« Verhältnissen gelebt, aber sie verklärt diese als das »viel ruhigere, naturverbundene, in verlässliche Gemeinschaften integrierte Leben«, das im Vergleich zum Kapitalismus »geradezu eine Idylle« gewesen sei.9
In seinem berühmten Werk über die Lage der arbeitenden Klasse in England, in dem Friedrich Engels in drastischer Weise die Arbeitsbedingungen im Frühkapitalismus anprangerte, vermittelte er ebenfalls ein idyllisches Bild der Lage der Heimarbeiter, bevor die Maschinenarbeit und der Kapitalismus kamen und dieses schöne Leben zerstörten: »Auf diese Weise vegetierten die Arbeiter in einer ganz behaglichen Existenz und führten ein rechtschaffenes und ruhiges Leben in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit, ihre materielle Stellung war bei weitem besser als die ihrer Nachfolger; sie brauchten sich nicht zu überarbeiten, sie machten nicht mehr, als sie Lust hatten, und verdienten doch, was sie brauchten, sie hatten Muße für gesunde Arbeit in ihrem Garten oder Felde, eine Arbeit, die ihnen selbst schon Erholung war, und konnten außerdem noch an den Erholungen und Spielen ihrer Nachbarn teilnehmen; und alle diese Spiele, Kegel, Ballspiel usw., trugen zur Erhaltung der Gesundheit und zur Kräftigung ihres Körpers bei. Sie waren meist starke, wohlgebaute Leute, in deren Körperbildung wenig oder gar kein Unterschied von ihren bäurischen Nachbarn zu entdecken war. Ihre Kinder wuchsen in der freien Landluft auf, und wenn sie ihren Eltern bei der Arbeit helfen konnten, so kam dies doch nur dann und wann vor, und von einer acht- oder zwölfstündigen täglichen Arbeitszeit war keine Rede.«10
Engels fährt fort: »Sie waren ›respektable‹ Leute und gute Familienväter, lebten moralisch, weil sie keine Veranlassung hatten, unmoralisch zu sein, da keine Schenken und liederlichen Häuser in ihrer Nähe waren, und weil der Wirt, bei dem sie dann und wann ihren Durst löschten, auch ein respektabler Mann und meist ein großer Pächter war, der auf gutes Bier, gute Ordnung und frühen Feierabend hielt. Sie hatten ihre Kinder den Tag über im Hause bei sich und erzogen sie in Gehorsam und der Gottesfurcht.« Die jungen Leute, so Engels, »wuchsen in idyllischer Einfalt und Vertraulichkeit mit ihren Gespielen heran, bis sie heirateten«. Negatives klingt nur an, wenn er fortfährt: »Dafür aber waren sie auch geistig tot, lebten nur für ihre kleinlichen Privatinteressen, für ihren Webstuhl und ihr Gärtchen und wussten nichts von der gewaltigen Bewegung, die draußen durch die Menschheit ging. Sie fühlten sich behaglich in ihrem stillen Pflanzenleben und wären ohne die industrielle Revolution nie herausgetreten aus dieser allerdings sehr romantisch-gemütlichen, aber doch eines Menschen unwürdigen Existenz.«11
Das Bild vieler Menschen über das Leben in vorkapitalistischen Verhältnissen ist durch diese und ähnliche romantisierenden Darstellungen bis zur Unkenntlichkeit verklärt. Schauen wir zurück in die vorkapitalistische Zeit, also in die Zeit vor 1820.
Die Armut entstand keineswegs durch den Kapitalismus, sondern sie war längst da und bestimmte das Leben der Menschen seit Jahrtausenden. Armut hat keine Ursachen – Wohlstand hat Ursachen. Fernand Braudel, der berühmte französische Historiker, hat ein Standardwerk über die Sozialgeschichte des 15. bis 18. Jahrhunderts verfasst. Er schreibt dort, selbst im relativ gut situierten Europa seien ständig Teuerungen und Hungersnöte aufgetreten. Die Getreideerträge waren so dürftig, dass zwei schlechte Ernten nacheinander bereits eine Katastrophe bedeuteten.12 In Frankreich, das noch am besten abschneidet, gab es im 17. Jahrhundert 11 und im 18. Jahrhundert 16 Hungersnöte – und diese Zahl sei wahrscheinlich noch viel zu niedrig gegriffen. Sämtliche Länder Europas befanden sich in der gleichen Lage. In Deutschland, wo Stadt und Land hartnäckig vom Hunger heimgesucht wurden, folgte eine Hungersnot auf die nächste.
Viele Menschen glauben, erst die Industrialisierung und die Verstädterung hätten zu Hunger und Armut geführt. Doch Braudel schreibt, das flache Land habe bisweilen sogar noch mehr gelitten. »Da der von Kaufleuten, Städten und Grundherren abhängige Bauer kaum über Reserven verfügt, bleibt ihm in Notzeiten keine andere Wahl, als in die drangvolle Enge der Stadt zu ziehen, um auf der Straße zu betteln … Die Städte mussten sich gegen diese regelmäßigen Invasionen, bei denen nicht nur die Bedürftigen des Umlandes, sondern regelrechte Armenheere oft von weit her herbeiströmten, schon bald zur Wehr setzen.«13
Wäre die Situation in den Städten generell schlimmer gewesen als auf dem Land, dann wären nicht Millionen Menschen in die Städte geströmt. Der Wirtschaftshistoriker Werner Plumpe schreibt: »Die neuen Gewerbe und Industrien schufen kein Proletariat; sie waren vielmehr möglich, weil es eine breite, meist ländliche Unterbeschäftigung gab … Die Industrie half vielmehr einer großen Zahl von Menschen, der strukturellen Unterbeschäftigung und Armut zu entkommen und als Industriearbeiterschaft zu überleben … Der Kapitalismus, wenn man so will, traf auf eine arme Bevölkerung, die im Wortsinne nichts zu verlieren hatte, aber viel gewinnen konnte.«14
Freilich traf dies nur für Menschen zu, die in den Städten auch Arbeit fanden und in der Lage waren zu arbeiten. Für die anderen war das Schicksal grausam. In Paris wurden Kranke und Invalide in die Spitäler gesteckt und die Arbeitsfähigen, zu zweien aneinandergekettet, mit der schweren und ekelerregenden, endlosen Säuberung der Stadtgräben beschäftigt.15
Hunger war eines der größten Probleme in vielen Ländern. In Finnland kam es 1696/97 zu einer großen Hungersnot – laut Schätzungen starb dabei ein Viertel bis ein Drittel der Bevölkerung. Doch auch in Westeuropa lebten die Menschen oft in menschenunwürdigen Bedingungen. 1662 berichteten die burgundischen Abgeordneten dem König, dass »die Hungersnot in diesem Jahr mehr als zehntausend Familien Eurer Provinz dahingerafft und ein Drittel der Bewohner selbst guter Städte gezwungen hat, Gras zu essen«, und ein Chronist fügt hinzu: »Einige dort verzehrten Menschenfleisch.«16
Die Volksnahrung bestand aus Brei, Suppe oder Brot aus minderen Mehlen, das nur in ein- bis zweimonatigem Abstand gebacken wurde und fast immer schimmelig und so hart war, dass es mancherorts mit der Axt zerteilt werden musste.17 Die meisten Menschen, auch in den Städten, mussten mit 2.000 Kalorien am Tag zurechtkommen, wobei der Anteil der Kohlenhydrate weit über 60 Prozent der Gesamtkalorienmenge ausmachte.18 Oft war Essen gleichbedeutend mit dem lebenslangen Verzehr von Brot und nochmals Brot oder von Mus und Brei.19 Besonders hoch lag der Brotkonsum bei der Landbevölkerung und den untersten Schichten der Arbeiterschaft. Nach Angaben von Le Grand d’Aussy nahm ein Handlanger oder Bauer 1782 in Frankreich täglich zwei bis drei Pfund Brot zu sich, »wer aber anderes zu speisen hat, verzehrt nicht diese Menge«.20
Die Menschen damals waren mager und kleinwüchsig – die gesamte Geschichte hindurch hat sich der menschliche Körper an unzureichende Kalorienzufuhr angepasst. »Die kleinwüchsigen Arbeiter des 18. Jahrhunderts«, so schreibt Angus Deaton in seinem Buch »Der große Aufbruch«, »waren faktisch in einer Ernährungsfalle gefangen. Sie konnten nicht viel verdienen, weil sie körperlich so schwach waren, und sie konnten nicht genug essen, weil sie ohne Arbeit nicht das Geld hatten, um sich mit Lebensmitteln zu versorgen.«21 Manche Menschen schwärmen von den harmonischen vorkapitalistischen Zuständen, als alles so schön »entschleunigt« war, aber diese Langsamkeit war meist ein Ergebnis physischer Schwäche infolge von dauerhafter Mangelernährung.22 Man schätzt, dass vor 200 Jahren ungefähr 20 Prozent der Einwohner von England und Frankreich gar nicht arbeitsfähig waren. »Sie hatten höchstens genug Kraft, um jeden Tag ein paar Stunden langsam zu gehen, wodurch sie Zeit ihres Lebens zum Betteln verurteilt waren.«23
1754 berichtete ein Autor: »Die Bauern Frankreichs, weit entfernt von Wohlstand, besitzen nicht einmal das Lebensnotwendige; dieser Menschenschlag siecht mangels Erholung von seiner Schwerarbeit schon vor dem 40. Lebensjahr dahin … Schon das Äußere der französischen Bauern kündet von körperlichem Verfall.«24 Ähnlich war es in anderen europäischen Ländern. Braudel konstatiert: »Diese Gesamtsituation mit ihrem ungefähren Gleichstand von Sterbefällen und Geburten, der auffallend hohen Kindersterblichkeit, den Hungersnöten, der chronischen Unterernährung und den schweren Epidemien ist für die frühere Lebensordnung kennzeichnend.« In manchen Jahrzehnten starben sogar mehr Menschen als Säuglinge geboren wurden.25 Der »Besitz« der Menschen beschränkte sich auf einige wenige Dinge, so wie man sie auf zeitgenössischen Bildern sieht: ein paar Hocker, eine Bank und als Tisch ein Fass.26
Und die Menschen starben so, wie sie lebten. In einem Bericht aus Paris heißt es, die Toten wurden in Sackleinen eingenäht und in Clamart, vor den Toren der Hauptstadt, in ein Massengrab geworfen, das man mit ungelöschtem Kalk bestreute. »Ein zerlumpter Priester, ein Glöckchen, ein Kreuz«, so wird der Leichenzug der Armen beschrieben. Ihm gingen unbeschreibliche Zustände im Spital voraus: Für 5.000 bis 6.000 Kranke standen nur 1.200 Betten zur Verfügung, und so legte »man den Neuankömmling zwischen einen Sterbenden und eine Leiche«.27
Ich habe das so ausführlich beschrieben, um zu zeigen, was konkret damit gemeint ist, wenn es heißt, dass damals 90 Prozent der Weltbevölkerung in extremer Armut lebten. Denn in anderen Erdteilen war es noch viel schlimmer als in Westeuropa. Der britische Ökonom Angus Maddison hat sich auf die Berechnung von historischen Wirtschaftsdaten spezialisiert. In komplizierten Verfahren hat er das Bruttosozialprodukt pro Kopf der Bevölkerung geschätzt. Im Jahre 1820 betrug dieses in Westeuropa, von dem bisher die Rede war, 1.202 Internationale Dollar (eine Maßeinheit, die auf dem Jahr 1990 beruht). Ähnlich hoch war es in anderen westlichen Ländern, also Nordamerika, Australien und Neuseeland. Im Rest der Welt betrug das Bruttosozialprodukt pro Kopf jedoch zum gleichen Zeitpunkt nur 580 Internationale Dollar, also etwa die Hälfte.28
Was der Kapitalismus bewirkt hat, sieht man im längeren historischen Vergleich. Im Jahr 1 unserer Zeitrechnung betrug das Bruttosozialprodukt pro Einwohner in Westeuropa 576 Internationale Dollar, im globalen Durchschnitt waren es 467. Das heißt: In Europa hatte es sich in der vorkapitalistischen Zeit, vom Jahr 1 bis zum Jahr 1820, gerade mal verdoppelt. Und in der kurzen Zeit von 1820 bis 2003 stieg es dann in Westeuropa von 1.202 auf 19.912 Internationale Dollar und in den anderen kapitalistischen Ländern des Westens sogar auf 23.710 Internationale Dollar.29
In Asien hingegen stieg das Bruttosozialprodukt pro Einwohner in den 153 Jahren von 1820 bis 1973 lediglich von 581 auf 1.718 Dollar. Und dann, in nur 30 Jahren, stieg es von 1.718 auf 4.434 Internationale Dollar im Jahr 2003.30
Was war geschehen? Die Entwicklung in Asien ist vor allem darauf zurückzuführen, dass nach dem Tode Mao Zedongs im Jahr 1976 Stück für Stück der Kapitalismus in China eingeführt wurde. Da die Reduktion der weltweiten Armut vor allem ein Ergebnis dieser Entwicklung in China ist, soll sie hier etwas ausführlicher dargestellt werden.
Noch im Jahr 1981 betrug die Zahl der Chinesen, die in extremer Armut lebten, 88 Prozent der Bevölkerung, heute sind es weniger als ein Prozent. Niemals in der Weltgeschichte stiegen in so kurzer Zeit so viele Hunderte Millionen Menschen aus bitterer Armut in die Mittelschicht auf. Daher können wir viel daraus lernen, wie Armut überwunden wird – nicht in der Theorie, sondern in der geschichtlichen Wirklichkeit.
Ein Rückblick: Ende der 1950er-Jahre starben 45 Millionen Chinesen als Folge des von Mao initiierten sogenannten »Großen Sprungs nach vorne«. Es ist erschütternd, dass die meisten Menschen, die in der Schule viel über die wirklichen oder vermeintlichen Probleme des Kapitalismus lernen, niemals von diesem größten sozialistischen Experiment der Geschichte gehört haben.
Ich habe darüber ausführlicher in meinem Buch »Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung« geschrieben und dort den chinesischen Journalisten Yang Jisheng mit diesem Bericht zitiert: »Der Hunger war gegen Ende schrecklicher als der Tod selbst. Die Maiskolben waren gefressen, das wilde Gemüse war gefressen, die Baumrinde war gefressen, Vogelmist, Mäuse und Ratten, Baumwolle, alles hatte man sich in den Bauch gestopft. Wo man Guanyin-Erde, eine Art fetten Lehm, fand, schob man sich bereits beim Graben dicke Klumpen in den Mund.«31 Es kam immer wieder zu Kannibalismus. Zuerst wurden die Kadaver toter Tiere gegessen, doch später begannen die Dorfbewohner in ihrer Verzweiflung, Tote auszugraben, zu kochen und zu essen. Menschenfleisch wurde sogar, wie anderes Fleisch, auf dem Schwarzmarkt gehandelt.32 Eine nach Maos Tod entstandene (und prompt verbotene) Studie über den Bezirk Fengyang in der Provinz Anhui verzeichnete allein für den Frühling 1960 63 Fälle von Kannibalismus, darunter ein Ehepaar, das seinen achtjährigen Sohn erwürgte und aufaß.33
Die Lebenserwartung hatte 1958, vor Maos »Großem Sprung nach vorne«, bei fast 50 Jahren gelegen, 1960 war sie auf unter 30 (!) Jahre gefallen. Fünf Jahre später, nachdem der Hunger und das Morden aufgehört hatten, stieg sie auf fast 55 Jahre. Fast ein Drittel der Chinesen, die während dieser dunklen Phase des größten sozialistischen Experimentes der Menschheitsgeschichte geboren wurden, hat dessen Ende nicht erlebt.34
Nach dem menschlichen und ökonomischen Desaster der Mao-Ära erkundeten die Chinesen in anderen Ländern, wie es dort aussah und was sie von ihnen lernen könnten. 1978 begann eine rege Reisetätigkeit führender chinesischer Politiker und Wirtschaftler. Sie unternahmen 20 Reisen in mehr als 50 Länder, um herauszufinden, was sie wirtschaftlich von ihnen lernen könnten. Den Politikern und Wirtschaftsleuten, die sahen, wie es beispielsweise den Arbeitern in Japan ging, fiel es wie Schuppen von den Augen und sie merkten, dass sie jahrelang von der kommunistischen Propaganda belogen worden waren, als diese die Errungenschaften des Sozialismus in China mit dem Elend in den kapitalistischen Ländern verglich. In Wahrheit verhielt es sich genau umgekehrt, wie jeder Teilnehmer dieser Reisen sehen konnte. »Je mehr wir von der Außenwelt sehen, desto klarer wird uns, wie rückständig wir sind«, wiederholte Deng Xiaoping, der die kapitalistischen Reformen einleitete, immer wieder.35
Doch es wäre falsch zu glauben, man sei nun über Nacht zum Kapitalismus »bekehrt« gewesen und habe sofort begonnen, in China die Planwirtschaft abzuschaffen und die Marktwirtschaft einzuführen. Man begann langsam, tastend, und gab den Staatsbetrieben nur schrittweise mehr Eigenständigkeit. Der Übergang von der sozialistischen Staatswirtschaft zur Marktwirtschaft vollzog sich nicht schlagartig, sondern in einem über Jahre und Jahrzehnte andauernden Prozess, der noch lange nicht abgeschlossen ist. Und mindestens ebenso wichtig wie die Initiativen von oben, also von der Partei, waren Bewegungen von unten, so etwa von den Bauern.
Nach den Erfahrungen mit dem »Großen Sprung nach vorn« gingen die Bauern in immer mehr Dörfern dazu über, auf eigene Initiative den Privatbesitz an Ackerland wieder einzuführen, obwohl dies offiziell verboten war. Aber es zeigte sich rasch, dass die Erträge der privaten Landwirtschaft sehr viel höher waren, und so ließen die Parteifunktionäre die Menschen gewähren. Zunächst wurde in besonders armen »Bettler-Dörfern« experimentiert – nach dem Motto: Wenn es hier schiefgeht, ist das nicht so schlimm, denn vom Boden kann man nicht fallen. In einem dieser kleinen Dörfer erlaubte die Parteiführung den Bauern, die besonders ertragsarmen Felder privatwirtschaftlich zu bestellen. Kaum hatte man dies gestattet, fiel der Ertrag dreimal so hoch aus wie bei den kollektiv bewirtschafteten Böden.
Schon lange bevor das offizielle Verbot von privater Landwirtschaft 1982 aufgehoben wurde, gab es überall in China spontane Initiativen von Bauern, die das private Eigentum entgegen dem sozialistischen Glaubensbekenntnis wieder einführten. Das Ergebnis war sehr positiv: Die Menschen mussten nicht mehr hungern, die landwirtschaftliche Produktion stieg rapide an.
Aber nicht nur auf dem Land kam es zu Veränderungen. Jenseits der großen staatlichen Unternehmen gab es zahlreiche kommunale Unternehmen, die zwar formal den Städten und Gemeinden gehörten, aber zunehmend wie private Unternehmen gemanagt wurden. Diese Unternehmen erwiesen sich oft den schwerfälligen Staatsunternehmen als überlegen, weil sie nicht den engen Vorgaben einer Planwirtschaft unterlagen. In den 1980er-Jahren etablierten sich zunehmend de facto privatwirtschaftlich geführte Unternehmen. Das sozialistische System, laut dem es ausschließlich Staatseigentum geben dürfe, von einer staatlichen Planbehörde geleitet, wurde von unten mehr und mehr ausgehöhlt.
Von großer Bedeutung war die Schaffung sogenannter Sonderwirtschaftszonen. Das waren Gebiete, in denen das sozialistische Wirtschaftssystem außer Kraft gesetzt war und in denen mit kapitalistischen Wirtschaftsformen experimentiert werden durfte. Die erste Sonderwirtschaftszone war Shenzhen, die nahe dem damals politisch und wirtschaftlich eigenständigen kapitalistischen Hongkong lag. Shenzhen war das Gebiet, von dem Chinesen illegal in die britische Kronkolonie emigrierten. So wie vor dem Mauerbau immer mehr Menschen aus Ost- nach Westdeutschland flohen, so versuchten auch immer mehr Menschen aus dem sozialistischen China über das damals kleine Fischerstädtchen Shenzhen in das kapitalistische Hongkong zu fliehen.
Deng Xiaoping war so klug zu erkennen, dass sich die Flucht nicht allein mit der Armee und schärferen Grenzkontrollen verhindern ließ, sondern dass man die Fluchtursachen analysieren und beseitigen müsse. Die Parteiführung der Provinz Guangdong, zu der Shenzhen gehört, stellte eine Untersuchung über die illegale Emigration an. Sie musste lernen, dass sich die Geflohenen auf der anderen Seite des Shenzhen-Flusses auf dem Territorium von Hongkong ansiedelten, ein eigenes Dorf gründeten und dort 100-mal mehr verdienten als die Menschen auf der sozialistischen Seite des Flusses.
Deng argumentierte, China müsse dafür sorgen, dass der Lebensstandard auf der chinesischen Seite steige, dann hätten die Menschen keinen Grund mehr zu fliehen. Shenzhen, das damals weniger als 30.000 Einwohner zählte, wurde zum ersten kapitalistischen Experimentierfeld in China. Die Parteifunktionäre, die in Hongkong und Singapur gesehen hatten, dass der Kapitalismus sehr viel besser funktioniert als der Sozialismus, gestatteten ein marktwirtschaftliches Experiment in dieser Sonderwirtschaftszone.
Das ehemalige Fischerstädtchen, aus dem die Menschen einst unter Lebensgefahr flohen, ist heute neben Hongkong und Macau die Stadt mit dem höchsten Pro-Kopf-Einkommen in China. Fast 12 Millionen Menschen leben dort, tragende Säulen der lokalen Wirtschaft sind die Elektronik- und die Telekommunikationsindustrie. Das Modell der Sonderwirtschaftszonen wurde rasch auf andere Regionen übertragen. Für ausländische Investoren waren diese Sonderwirtschaftszonen sehr attraktiv. Sie profitierten von niedrigen Steuersätzen, einer geringen Bodenpacht und zurückhaltenden bürokratischen Verwaltungsauflagen. Hier herrschte eine freiere Marktwirtschaft, als wir sie heute in vielen europäischen Ländern kennen.
Ich besuchte diese Region ein erstes Mal im August 2018 und ein zweites Mal im Dezember 2019. Bei meiner zweiten Reise dorthin sprach ich mit Vertretern eines privaten Thinktanks. Der Leiter ist Professor und gehört weder der Kommunistischen Partei noch einer anderen der acht »Parteien« in China an. »Vielleicht werden wir die letzten Verteidiger des Kapitalismus sein«, meinte er. Dass in Europa und den USA sozialistische Ideen eine Renaissance erfahren, ist für ihn unverständlich: »Hier in China glaubt kaum noch einer an die Ideen von Karl Marx.«
Ein entscheidender Schritt war, dass der 14. Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas im Oktober 1992 erstmals offiziell die Marktwirtschaft als Ziel der Reformen verkündete. Das wäre einige Jahre davor noch völlig undenkbar gewesen. Die Reformen gewannen immer mehr an Dynamik. Zwar wurde die Planwirtschaft nicht abgeschafft, aber der Anteil der Preise für Rohstoffe, Transportdienstleistungen und Kapitalgüter, die staatlich festgelegt waren, sank drastisch.
Zudem begann eine Reform der Staatsbetriebe. Privatpersonen und ausländische Investoren durften von nun an in den Kreis der Gesellschafter aufgenommen werden. Der Prozess der Privatisierung gewann bald an Fahrt, manche Unternehmen wurden an die Börse gebracht. Es kam zu zahlreichen spontanen bzw. von den lokalen Regierungen initiierten Privatisierungen. Viele staatliche Betriebe waren unter Wettbewerbsbedingungen nicht überlebensfähig.
Die Entwicklung Chinas zeigt, dass steigendes Wirtschaftswachstum – auch bei gleichzeitig steigender Ungleichheit – den meisten Menschen zugutekommt. Heute gibt es so viele Milliardäre in China wie in keinem anderen Land der Welt, auch nicht in den USA. Das zeigt, wie unsinnig das »Nullsummendenken« der Antikapitalisten ist, die glauben, Reiche seien nur reich, weil sie den Armen etwas weggenommen hätten. Nein, Hunderten Millionen Menschen in China geht es heute sehr viel besser, und zwar nicht, obwohl es so viele Millionäre und Milliardäre gibt, sondern gerade weil Deng zu Beginn der Reformen die Parole ausgegeben hatte: »Lasst einige erst reich werden.«
Deng hatte recht, dass der wirtschaftlichen Entwicklung die Hauptpriorität eingeräumt werden müsse, was sich an folgenden Tatsachen zeigt: Untersucht man, in welchen Provinzen die Armut in China in den vergangenen Jahrzehnten am stärksten zurückgegangen ist, dann sind es jene mit dem höchsten Wirtschaftswachstum. Weiying Zhang, der sicherlich der klügste Analytiker der chinesischen Wirtschaft ist und persönlich einiges zu ihrer Entwicklung beigetragen hat, wendet sich gegen die Vorstellung, dass Chinas außergewöhnlicher Erfolg ein Ergebnis der großen Rolle des Staates sei. Diese Fehldeutung ist im Westen verbreitet, aber es gibt sie auch zunehmend in China, wo manche Politiker und Wissenschaftler der Meinung sind, die Erklärung für den Erfolg des Landes liege in einem besonderen chinesischen Modell. »Die Verfechter der Theorie des ›China model‹ liegen falsch, denn sie verwechseln ›trotz‹ mit ›wegen‹. China ist nicht wegen, sondern trotz der unbegrenzten Staatsmacht und des großen ineffizienten staatlichen Sektors schnell gewachsen.«36 Tatsächlich seien »marketization« und »privatization« die treibenden Kräfte für Chinas enormes Wirtschaftswachstum. Zhang hat die Daten unterschiedlicher Regionen in China analysiert. Er kam zu dem Resultat: »Je mehr marktorientierte Reformen eine Provinz durchgeführt hatte, desto höher war das von ihr erzielte Wirtschaftswachstum. Und wer bei den Marktreformen hinterherhinkte, der hinkte auch beim Wirtschaftswachstum hinterher.«37 Die Gebiete, in denen am konsequentesten marktwirtschaftliche Reformen durchgeführt wurden, also Guangdong, Zhejiang, Fujian und Jiangsu, waren zugleich jene, die wirtschaftlich am stärksten gewachsen seien.
Dabei, und dies ist eine sehr wichtige Einsicht, gilt: »Das beste Maß für Reformfortschritte sind die Veränderungen der marktwirtschaftlichen Durchdringung in den betreffenden Zeiträumen und nicht so sehr die absoluten Werte, die innerhalb eines bestimmten Jahres erzielt wurden.«38 Die Wachstumsrate ist dort am größten, wo private Unternehmen die entscheidende Rolle spielen. Die Daten belegen: »Die Provinzen, deren Wirtschaft stärker ›privatisiert‹ ist, werden wahrscheinlich schneller wachsen. Treiber des hohen Wachstums sind die nicht-staatlichen Sektoren, nicht aber der staatliche Sektor.«39 Der Reformprozess in China verlief in den vergangenen Jahrzehnten niemals gleichmäßig, niemals nur in eine Richtung. Es gab Phasen, in denen die Marktkräfte schnell stärker wurden, aber es gab auch Phasen, in denen sich die Rolle des Staates wieder verstärkte. Auch wenn über längere Sicht die Haupttendenz »state out and private in« (guo tui min jin) war, so gab es stets auch Perioden und Regionen, in denen eine rückläufige Entwicklung stattfand, also »state in and private out« (guo jin min tui). Zhang untersuchte die unterschiedlichen Wachstumsraten in den »state out and private in«-Regionen sowie in den »state in and private out«-Regionen. Auch hier ist das Ergebnis eindeutig: Die Wirtschaftsleistung wuchs deutlich stärker in den »state out and private in«-Regionen. Das belegt, »dass Chinas schnelles Wachstum der letzten vier Jahrzehnte durch die Kräfte des Marktes und der nicht-staatlichen Sektoren angekurbelt wurde, und nicht durch die Macht der Regierung und des staatlichen Sektors, wie es die Theoretiker des ›China Models‹ behaupten«.40 Entscheidend für die weitere Entwicklung der chinesischen Wirtschaft ist der Grad der Innovation. Analysiert man die Forschungs- und Entwicklungsintensität in der Industrie, die pro Kopf erteilten Patente und den prozentualen Anteil des Neuproduktumsatzes am Gesamtumsatz der Industrie, dann wird deutlich, dass all diese Kennzahlen für Innovation statistisch eindeutig positiv mit dem Grad der marketization korreliert sind.41
Ich habe Weiying Zhang in Beijing getroffen. In unserem Gespräch unterstrich er, dass er das Missverständnis über die Gründe für Chinas Wachstum für eine große Gefahr hält. Das gilt nicht nur für China, sondern auch für den Westen. Wenn man im Westen der Fehldeutung aufsitzt, die Basis des chinesischen Erfolges sei ein besonderer »dritter Weg« zwischen Kapitalismus und Sozialismus oder ein »Staatskapitalismus«, dann werde das auch im Westen zu völlig falschen Schlussfolgerungen führen. In seinem 2020 erschienenen Buch »Ideas for China’s Future« gebraucht Zhang ein drastisches Bild: »Stellen Sie sich vor, Sie sehen einen Menschen, dem ein Arm fehlt und der sehr schnell läuft. Wenn Sie zu dem Schluss kommen, dass seine Geschwindigkeit vom Fehlen eines Arms herrührt, dann werden Sie natürlich andere dazu aufrufen, einen Arm abzusägen. Das wäre eine Katastrophe … Ökonomen dürfen nicht ›trotz‹ mit ›wegen‹ verwechseln.«42 Die Vertreter einer starken Rolle des Staates in Europa und den USA wollen uns einreden, Chinas ökonomischer Erfolg bestätige, wie entscheidend ein starker Staat für das Wirtschaftswachstum sei. Die Analysen von Weiying Zhang belegen das genaue Gegenteil.
In vielerlei Hinsicht ist der chinesische Weg nicht so außergewöhnlich, betont der Ökonom: »Tatsächlich ist Chinas ökonomische Entwicklung grundsätzlich identisch mit der in einigen westlichen Ländern, so wie in Großbritannien während der industriellen Revolution, in den Vereinigten Staaten im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert und in einigen asiatischen Ländern wie Japan und Südkorea nach dem Zweiten Weltkrieg. Sobald Marktmechanismen eingeführt und die richtigen Anreize gesetzt sind, damit Menschen nach Reichtum streben, folgt das Wunder des Wachstums früher oder später.«43
In der Tat kann man viele Parallelen zur Entwicklung des Frühkapitalismus in Europa und den USA sehen. »Frühkapitalismus« gilt bei Antikapitalisten als ein Schreckenswort, doch tatsächlich war es eine Zeit, in der sich die Lebensbedingungen der Arbeiterschaft dramatisch verbesserten. Der amerikanische Ökonom Thomas J. DiLorenzo verdeutlicht dies an folgenden Zahlen für die USA: »Zwischen 1820 bis 1860 stiegen die Löhne mit einer jährlichen Rate von etwa 1,6 Prozent. Gleichzeitig erhöhte sich die Kaufkraft eines durchschnittlichen Arbeiterlohnes zwischen 60 und 90 Prozent, abhängig von der Landesregion. Zwischen 1860 und 1890, in der Zeit, die von Wirtschaftswissenschaftlern als die ›zweite industrielle Revolution‹ bezeichnet wird, stiegen die Reallöhne (d. h. die inflationsbereinigten Löhne) in Amerika um 50 Prozent. Gleichzeitig verkürzte sich die durchschnittliche Arbeitswoche, was bedeutet, dass die Reallöhne des durchschnittlichen Amerikaners in dieser Zeit wahrscheinlich eher um 60 Prozent gestiegen sind.«44 Im nächsten Kapitel werde ich zeigen, dass Ähnliches auch für den Frühkapitalismus in England gilt, der häufig als besonders schlimmes Beispiel für menschenunwürdige und erniedrigende Zustände angeführt wird.
Der Kapitalismus hat mehr zur Überwindung von Hunger und Armut beigetragen als jedes andere System in der Weltgeschichte. Die größten von Menschen gemachten Hungerkatastrophen ereigneten sich in den vergangenen 100 Jahren im Sozialismus. Bei der Hungersnot, die in Russland nach der bolschewistischen Revolution in den Jahren 1921/22 stattfand, starben nach offiziellen Angaben der »Großen Sowjet Enzyklopädie« von 1927 5 Millionen Menschen. Die höchsten Schätzungen gehen sogar von 10 bis 14 Millionen Hungertoten aus. Nur ein Jahrzehnt später löste Josef Stalin durch die sozialistische Kollektivierung der Landwirtschaft und die »Liquidierung der Kulaken« (mehr dazu in Kapitel 11) die nächste große Hungersnot aus, der 6 bis 8 Millionen Menschen zum Opfer fielen. Besonders hart traf es Kasachstan, wo 1,5 Millionen Menschen starben – ein Drittel der Bevölkerung.45
»Beim Begriff ›Hungersnöte‹«, schreibt der Sinologe Felix Wemheuer in seinem Buch »Der große Hunger«, »denken die meisten als Erstes an Afrika. Im 20. Jahrhundert starben jedoch 80 Prozent aller Opfer von Hungersnöten in China und der Sowjetunion.«46 Gemeint sind damit nicht die Millionen Opfer von täglicher Unterernährung und mangelnder Gesundheitsvorsorge, sondern Hungersnot wird definiert als Ereignis, wenn sich die Sterblichkeitsraten gegenüber dem in dem jeweiligen Land »normalen« Maß sprunghaft erhöhen.47 Eine andere Zahl: Das Ende des Kommunismus in China und der Sowjetunion war ein Faktor, der maßgeblich dazu beitrug, dass der Hunger von 1990 bis 2017 um 42 Prozent zurückging.48
Es ist typisch für die Fehlwahrnehmung, dass die Menschen bei »Hunger und Armut« eher an den Kapitalismus denken als an den Sozialismus, der für die größten Hungersnöte im 20. Jahrhundert verantwortlich war.
In Nordkorea, einem der wenigen verbliebenen sozialistischen Länder, starben noch in den Jahren 1994 bis 1998 mehrere Hunderttausend Menschen bei Hungersnöten. Jang Jing-sung, ein Angehöriger der nordkoreanischen Elite, beschreibt, was er dort in den späten 90er-Jahren erlebte, ehe er in den Westen floh. Die Verhungernden wurden in Parks geschickt, um dort zu betteln, ehe sie starben. Es gab eine eigene »Leicheneinheit«, deren Mitglieder mit Stöcken Körper anstießen, um zu sehen, ob sie bereits tot waren. Er sah, wie sie die Leichen auf Rikschas legten; die nackten Füße, die nur aus Haut und Knochen bestanden, ragten in alle Richtungen. Eine Frau, deren Mann bereits verhungert war, bot auf einem Marktplatz ihre Tochter für 100 Won (keine 10 Cent) zum Verkauf an.49
Zurück zu den Zahlen: Der »Index of Economic Freedom«, den die Heritage Foundation erstellt, zeigt, dass die am meisten kapitalistischen Länder im Durchschnitt ein Bruttosozialprodukt pro Kopf von 71.576 Dollar haben. Bei den überwiegend freien Ländern sind es noch 47.706 Dollar. Am anderen Ende rangieren die überwiegend unfreien und die gänzlich unfreien Länder, wo das Bruttosozialprodukt pro Kopf nur 6.834 oder 7.163 Dollar beträgt.50
Der Global Multidimensional Poverty Index der Vereinten Nationen51 misst verschiedene Formen der Armut (Gesundheit, Lebensstandard, Bildung) in 80 Entwicklungsländern. Vergleicht man diesen Index mit dem Index der wirtschaftlichen Freiheit, dann sieht man, dass 35,3 Prozent der Menschen in wirtschaftlich unfreien Entwicklungsländern in »multidimensional poverty« leben, aber nur 7,9 Prozent der Menschen in überwiegend wirtschaftlich freien Entwicklungsländern.52 Der Glaube, man müsste das Geld nur von den reichen in die armen Länder »umverteilen«, ist naiv. Die Wirtschaft ist eben kein Nullsummenspiel, in dem man einem Individuum, einer Bevölkerungsgruppe oder einem Land lediglich etwas wegnehmen muss, um die Gesamtheit reicher zu machen. Was wirklich gegen Armut hilft, dies hat die Entwicklung in Westeuropa seit 1820 sowie die Entwicklung in asiatischen Ländern wie China, Südkorea oder Vietnam in den vergangenen 40 Jahren gezeigt, ist mehr wirtschaftliche Freiheit.
Zahlreiche Studien belegen und viele Ökonomen betonen, dass Entwicklungshilfe den Ländern Afrikas mehr geschadet als genutzt hat.53 Ich habe darüber ausführlich im 2. Kapitel meines Buches »Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung« geschrieben. Zwischen 1970 und 1998, der Zeit der höchsten Entwicklungshilfeleistungen an Afrika, stieg die Armut auf dem Kontinent von 11 auf 66 Prozent.54 Ausländische Hilfszahlungen finanzierten großzügig korrupte Regierungen, die sich in keiner Weise dem Wohl ihrer Bevölkerung verantwortlich fühlten. Die ausländischen Zahlungen führten auch dazu, dass diese Machthaber nicht von der Zustimmung ihrer Bevölkerung abhingen. So konnten sie ungeniert Rechtsstaatlichkeit blockieren, die Schaffung transparenter politischer und zivilgesellschaftlicher Institutionen und den Schutz bürgerlicher Grundrechte verhindern. Dadurch waren sie zugleich dafür verantwortlich, dass weder einheimische noch ausländische Investoren in diesen armen Ländern aktiv werden wollten. So hat die westliche Entwicklungshilfe dazu beigetragen, viele afrikanische Länder in ihrer Entwicklung weit zurückzuwerfen.
Ein funktionierender Kapitalismus konnte sich dort nicht entwickeln, denn ein Umfeld hochgradiger Korruption und Unsicherheit schreckte Investoren ab.55 Das führte zur Stagnation und würgte letztlich das Wachstum ab. Die korrupten Staatsangestellten entschieden nicht im Interesse des Allgemeinwohls, sondern nach Maßgabe möglicher Selbstbereicherung. Große Summen an Hilfsgeldern und eine Kultur der Abhängigkeit von Entwicklungshilfe ermutigten afrikanische Regierungen zudem, unproduktive öffentliche Sektoren weiter aufzublähen – was auch nur eine Art ist, Günstlinge zu belohnen.56
Natürlich sollten Reiche den Armen in unmittelbarer Not helfen: beispielsweise bei Naturkatastrophen oder bei Pandemien. Hier sollte es selbstverständlich sein, dass ein Land einem anderen hilft, beispielsweise mit Hilfslieferungen, Medikamenten usw. Gleiches gilt für Menschen, die innerhalb eines wohlhabenden Landes unverschuldet in Armut geraten sind, z. B. durch Krankheit oder andere Schicksalsschläge. Hier sollte großzügige Hilfe selbstverständlich sein, von Privatpersonen oder auch vom Staat. Aber solche Hilfe hilft eben nicht gegen strukturell bedingte Armut.
In Europa oder den USA dominieren naive Vorstellungen vom Kampf gegen Armut, Hunger, Kinderarbeit und andere Probleme. Manche fühlen sich gut, wenn sie keine Produkte kaufen, bei deren Herstellung Kinderarbeit eine Rolle spielte. Aber nicht selten verschlimmern Erfolge sogenannter »Aktivisten« die Situation der Menschen in armen Ländern sogar. Johan Norberg berichtet von folgendem Beispiel: 1992 stellte sich heraus, dass die amerikanische Kaufhauskette Wal-Mart in Kinderarbeit hergestellte Kleidungsstücke gekauft hatte. Der US-Kongress drohte, Importe aus Ländern mit Kinderarbeit zu verbieten. Daraufhin wurden sofort Tausende von Kindern in Bangladesh aus der Textilindustrie entlassen. Als internationale Organisationen anschließend nachforschten, was aus diesen Kindern geworden war, zeigte sich, dass viele von ihnen Beschäftigungen nachgingen, die gefährlicher und schlechter bezahlt waren als die vorigen und einige in der Prostitution gelandet waren. Ein ähnlicher Boykott gegen die Teppichindustrie in Nepal endete laut UNICEF damit, dass über 5.000 Mädchen zur Prostitution gezwungen wurden.57
Im Sommer 2014 sorgte ein neues Gesetz zur Kinderarbeit in Bolivien für weltweite Schlagzeilen und Diskussionen. Das Gesetz erlaubt in Ausnahmefällen schon Zehnjährigen zu arbeiten – und wurde unter anderem von arbeitenden Kindern selbst gefordert. Ein Skandal? Die UNICEF sagte dazu: »Grundsätzlich müssen wir feststellen, dass Kinderarbeit in vielen Ländern mit geringem und mittlerem Einkommen eine Realität ist. In Bolivien hatten viele Mädchen und Jungen gesagt, dass sie ihren Arbeitslohn zum Überleben brauchen. Befürworter des Gesetzes sind der Meinung, dass die Kinder sonst illegal arbeiten und dann viel mehr in Gefahr sind, ausgebeutet zu werden. Kritiker befürchten hingegen, dass der Kinderschutz durch das Gesetz aufgeweicht wird.«58
Die Sachlage ist also nicht so eindeutig, wie sie auf den ersten Blick erscheint. Wie bereits erwähnt, ist die Kinderarbeit weltweit massiv zurückgegangen, aber nicht vor allem als Folge von Verboten oder von Boykottaktionen, sondern deshalb, weil sich die Lebenssituation der Menschen in vielen (ehemaligen) Entwicklungsländern entscheidend verbessert hat. Die Eltern, die zuvor wirtschaftlich darauf angewiesen waren, dass ihre Kinder mitarbeiteten, verdienten jetzt besser und konnten ihren Kindern eine Ausbildung finanzieren. Nicht weniger, sondern mehr Kapitalismus hat im Kampf gegen die Kinderarbeit geholfen.
Aber wie verhält es sich mit den Armen in den entwickelten, reichen Ländern? Hier muss man zunächst zwischen der sogenannten relativen und der absoluten Armut unterscheiden. Wenn von Armut in Ländern wie Deutschland oder Schweden gesprochen wird, dann ist meist von »relativer Armut« die Rede. Wir kommen darauf im nächsten Kapitel zurück. Gemeint sind damit Menschen, die z. B. weniger als 60 Prozent des Medianeinkommens haben. Diese Armut kann niemals beseitigt werden, denn unabhängig vom Anstieg des Medianeinkommens wird es immer Menschen geben, die nur 60 Prozent oder weniger davon haben. Das ergibt sich zwangsläufig aus der statistischen Konstruktion des Medianeinkommens, das eben kein Durchschnittseinkommen ist, sondern jenes, das die Bevölkerung exakt teilt in eine Hälfte, die ein höheres Einkommen erzielt, und die andere Hälfte mit geringerem Verdienst.
Antikapitalisten argumentieren stets so, als seien alle (relativ) Armen, die in einem reichen Land leben, ohne eigenes Zutun arm geworden. Sie empören sich geradezu, wenn jemand darauf hinweist, dass es in Ländern wie Deutschland, Großbritannien, Schweden oder den USA auch Arme gibt, die selbst schuld an ihrer Situation sind oder zumindest eine Mitschuld daran tragen. Tatsächlich lässt sich jedoch nicht bestreiten, dass es neben Menschen, die unverschuldet in Not geraten sind, auch Fälle gibt, in denen Menschen lieber Leistungen des Wohlfahrtsstaates in Anspruch nehmen als selbst zu arbeiten. In gewisser Hinsicht kann man diese Menschen sogar verstehen: Wenn wegen hohen Steuern und Sozialabgaben vom Brutto zu wenig übrigbleibt und andererseits, etwa in Deutschland, vergleichsweise großzügig Leistungen des Wohlfahrtsstaates gewährt werden, dann wird es immer Menschen geben, die lieber diese Leistungen beziehen und vielleicht nebenher schwarzarbeiten, weil sie dann mit viel weniger Arbeitseinsatz am Schluss genauso viel oder sogar mehr haben als jemand, der 40 Stunden arbeitet. Man sollte nicht in erster Linie diese Menschen verurteilen, sondern ein System, das ein solches Verhalten als ökonomisch rational erscheinen lässt.
Antikapitalisten sehen alle Armen als Opfer – als Opfer des Kapitalismus, Opfer sozialer Ungerechtigkeit usw. Aber ist den Menschen damit geholfen, wenn man sie als Opfer sieht? Ist es wirklich menschlich, den Armen zu sagen: »Du bist ein Opfer des Kapitalismus, lass dir nicht einreden, du könntest an deinem Los in diesem System etwas ändern, denn deine Situation wird sich erst dann ändern, wenn der Kapitalismus beseitigt ist«? Solche Botschaften sind erstens falsch und zweitens entmutigen sie Menschen.
Liberale ermutigen die Menschen, ihr Schicksal in die eigene Hand zu nehmen und sich nicht darauf zu verlassen, dass irgendwann andere für sie etwas tun werden oder die Gesellschaft sich ändert. Zumal sie wissen, dass das, was die Antikapitalisten versprechen, nämlich eine Linderung von Armut und Not durch die Abschaffung des Kapitalismus, noch niemals in der Geschichte eingetreten ist, sondern stets das Gegenteil: Die Armut wurde größer, wo der Kapitalismus abgeschafft wurde – wie wir in Kapitel 11 sehen werden.