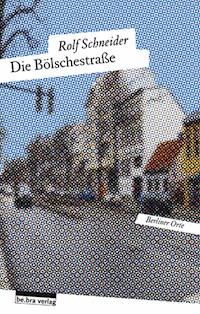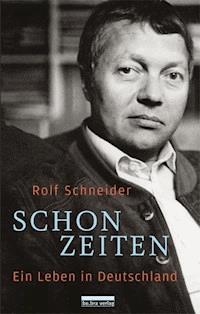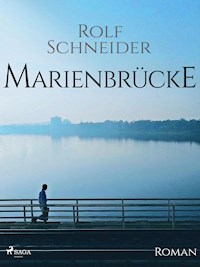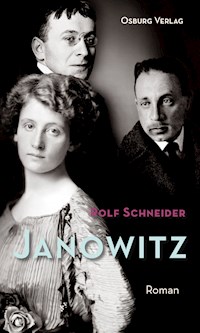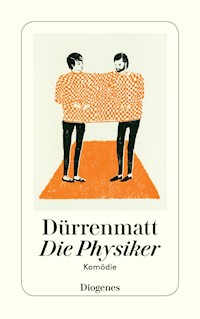3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Eng am Stoff der griechischen Sagen entlang und mit spürbarer Freude am ironischen Fabulieren erzählt Rolf Schneider die Geschichte des Zeus-Sohnes Herakles, der – halb Mensch und halb Gott – so gern ein ganzer Gott werden wollte, und rechnet dabei, quasi augenzwinkernd, mit den Heldenmythen der Vergangenheit ab. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 255
Ähnliche
Rolf Schneider
Die Abenteuer des Herakles
Nach alten Sagen neu erzählt
FISCHER Digital
Inhalt
I
Also, wir wollen von Herakles erzählen. Herakles war halb Mensch und halb Gott. Zu fragen ist sofort, von welcher Art Mensch hier die Rede ist und von welcher Art Gott, sofern wir überhaupt bereit sind, an Götter zu glauben. Götter, so viel wissen wir alle, sind übermächtige Wesen; sie vermögen allerlei zaubrische Dinge zu tun, sind meistens unsichtbar, meistens auch unsterblich, und meistens wohnen sie zu unseren Köpfen, irgendwo über den Wolken, im Blau des irdischen Himmels oder in der Schwärze des Weltraums, zwischen einer Galaxis und der nächsten.
Es gibt zahllose Götter. Sie heißen Wotan, Jahwe, Amon, Zeus, zum Beispiel. In allen vier genannten Fällen handelt es sich um einen männlichen Gott; er ist immer ein wenig mächtiger als die anderen bekannten Götter, vorausgesetzt, er duldet überhaupt noch andere Götter neben sich, denn Jahwe duldet die ausdrücklich nicht. Derart dürfte es, wenn es Jahwe gibt, weder Zeus noch Wotan geben. Aber dort, wo es Amon gibt, dürfte es wiederum nicht Wotan und Zeus geben, denn sowohl Amon als auch Wotan behaupten von sich, der höchste aller Götter zu sein. Es ist ein ermüdendes, dabei eigentlich unentwirrbares Spiel, dem sich allenfalls dadurch beikommen läßt, daß dort, wo Jahwe herrscht, für Zeus kein Platz ist, wie auch umgekehrt, wie es jeweils auch zutrifft für jeden der beiden restlichen Götter.
Zeus und Jahwe, Amon und Wotan behaupten nun jeder von sich, Herr der Welt zu sein, und vielleicht führt dies uns weiter? Unter Welt verstehen wir, sozusagen, das Insgesamt alles Vorhandenen, Erde und Weltraum und alles im Weltraum Enthaltene, das wir gerne mit dem Wort Kosmos umschreiben. Ist aber nun einer unserer vier Götter Herr dieser Welt? Ist er es, kann es nicht gut der andere auch sein. Es wäre denn, wir teilten die Welt unter ihnen auf, womit es aber dann nicht mehr die Welt unseres ursprünglichen Verständnisses wäre, denn ein Weltenteil ist keine Welt, und sein Herr dürfte nicht von sich behaupten, daß er Herr sei der gesamten Welt. Wie aber, wenn er es dennoch behauptet?
Unser Fragespiel führt uns, wie zu sehen, nicht weiter, und so sollten wir wohl besser zunächst nicht nach dem Gotte, sondern nach dem Menschen fragen. Sofort entwirrt sich alles. Denn der Mensch, der an Jahwe glaubt, ist ein anderer als jener, der an Wotan glaubt, und unbestritten ist Zeus Herr der ganzen und ungeteilten und unteilbaren Welt, wenn wir nur hinzufügen: für jenen Menschen, der an Zeus glaubt. Unsere eingangs gestellte Frage läßt sich nunmehr beantworten: Herakles ist halb Gott und halb Mensch, wobei Gott von der Art ist, wie ihm jener Mensch als Gläubiger anhängt, aus welchem Herakles zur anderen Hälfte ist. Der Gott trägt übrigens einen Namen, den wir bereits kennen: Zeus. Von welcher Beschaffenheit aber der Mensch ist, der an Zeus glaubt, sei im folgenden beschrieben.
II
Wir bleiben zu diesem Zwecke auf unserem Erdteil. Wir wenden unsere Aufmerksamkeit, vielleicht unter Zuhilfenahme einer atlantischen Karte, dem östlichen Teil Europas zu, genauer: dem südlichen Osten. Wir erkennen jene Halbinsel, die nach ihrem mächtigen Gebirge Balkan heißt; es befinden sich auf ihr die Länder Jugoslawien, Albanien, Rumänien und Bulgarien, das südlichste Land aber heißt Griechenland. Wir erkennen, immer noch auf der atlantischen Karte, daß Griechenland über eine gewissermaßen ausgefranste, in zahllosen Buchten verlaufende Küste verfügt sowie über ein Heer von Inseln der verschiedensten Größen.
Griechenland ist ein Land von Fischern, Seeleuten, Bauern und Hirten. Griechenland ist kein reiches Land. Griechenland stöhnt in den Sommern unter einer erbarmungslosen Sonne, die von den kahlen Steinen der Gebirge reflektiert wird. Das kahle Gestein ist zu guten Teilen das Ergebnis von Erosionen und Verkarstungen, was besagt: früher wuchsen Wälder hier; sie wurden ausgeplündert und abgeholzt, die Stämme wurden zum Schiffbau verwendet in Zeiten, da man Schiffe noch aus Holz verfertigte. Wir starren die kahlen Steine an. Wir blinzeln vorm grellen Licht. Wir atmen den Geruch von Thymian und Anis, den die Hitze aus den Sträuchern dorrt. Wir haben uns unmerklich von der Küste entfernt, wo das Meerwasser über die Kiesel rinnt und Salz, Muschelschalen, Tang zurückläßt. Wir bewegen uns längst auf schmalen Bergpfaden. Wir sehen Gebirgsziegen, struppige Schafe, magere Rinder. Die Hirten hocken im Schatten, überlassen die Aufsicht ihren Hunden; die Hirten essen Brot und Käse, sie trinken Rotwein dazu. Die Hirten sind Nachfahren von nicht mehr zählbar vielen Generationen, die alle dies auch waren: Hirten, die alle so im Schatten auf der Erde saßen, um Brot, Wein, Käse zu sich zu nehmen. Wir entfernen uns von der Küste. Wir entfernen uns aus der Gegenwart. Der Weg geht nach Norden. Die Wärme treibt davon unter kälteren Winden. Die Landschaft, die wir sehen, heißt Thessalien. Das Gebirge, das wir sehen, heißt Olympos. Seine Gipfel sind von Wolken umhüllt, und dort, an dieser Stelle, hinter diesem Einstieg durchs Gewölk, den der Berghang bezeichnet, wohnte Zeus, der oberste der Götter.
Zeus, so dürfen wir hiermit festhalten, ist ein griechischer Gott, wohnend in Thessalien und verehrt von Leuten, welche Griechen sind.
Und es handelt sich bei diesen Griechen um die Vorfahren jener Hirten, Bauern, Fischer und Seefahrer, welche heute das Land bewohnen. Und diese Vorfahren waren gleichfalls Hirten, Fischer, Seefahrer, Bauern, und daneben waren sie Soldaten, Handwerker, Gelehrte, Künstler, die es, natürlich, im heutigen Griechenland auch wieder gibt.
An dieser Stelle sollten wir genauer die Zeit bezeichnen, von der wir reden. Sie liegt runde drei Jahrtausende zurück. Die Schiffe damals, das wissen wir bereits, waren aus Holz gefertigt; sie bewegten sich mit Hilfe von Rudern und von Segeln. Griechenland, anders als heute, war kein einheitlicher Staat, sondern zerfallen in zahlreiche voneinander unabhängige Gemeinwesen. Was sie vereinte, waren die gemeinsame Sprache, die gemeinsame Religion und alle vier Jahre die Olympischen Spiele, also der Sport; so gering wogen solche Gemeinsamkeiten, daß man sich untereinander blutige Kriege lieferte. Das Meer, in welches das Land wie mit vielen Fingern hineingriff, war das Mittelmeer; seine Wasser boten den wichtigsten Verkehrsweg und, im Kriegsfalle, die wichtigste Aufmarschstraße; die hölzernen Schiffe beförderten Soldaten mit Helm, Schild, Lanze und außerdem Kaufleute mit Tonkrügen voller Wein, Olivenöl und Getreide; griechische Flotten fuhren nach Kleinasien, zu den Küsten am Fuße des Libanon, nach Nordafrika, Kreta, Sizilien, Italien; die vorstellbare Welt der Griechen war gerahmt durch die mittelmeerischen Küsten; was jenseits davon lag, im Atlantik, in den Tiefen Afrikas oder Asiens, verdämmerte in ihrem Bewußtsein, war keine Welt mehr, war Nebel, Einöde, die Barbarei, das Nichts.
Über dies also herrschte Zeus mit seiner Götterfamilie. Ihr wurden die Tempel mit den flachen Dächern und den verzierten Säulen errichtet, die, abgewaschen vom Regen, manchmal zerfallen, Leben und Traum jenes Griechenlands bezeugen bis jetzt, zwei- und dreitausend Jahre danach.
Erster Teil Von einem gierigen Gott, von Kühen, Kriegen und der Herstellung eines künftigen Helden
III
Beginnen wir mit einer Stadt, die Tiryns hieß. In ihr regierte ein König namens Alkaios, der seinerseits Bruder eines Mannes namens Elektryon war. Elektryon herrschte über ein Gebiet namens Mykenä; es war berühmt für seine blühende Hauptstadt und seinen Königspalast, dessen Eingang von steinernen Löwen flankiert wurde.
König Alkaios von Tiryns hatte einen Sohn, Amphitryon, einen wohlgewachsenen, kräftigen, streitlustigen Burschen. Amphitryon neigte zum Jähzorn, und unübersehbar war sein Hang zu allen Gegenständen, mit denen man Krieg führen konnte: Helmen und Brustpanzern, Steinschleudern, Pfeilen, Rammböcken, Bögen, Lanzen, Beinschienen, Schilden. Sagen wir es rundheraus: Amphitryon war ein Raufbold, ein Streithammel, eine angehende Schlachthyäne – in einem Zeitalter freilich, da die fahrenden Sänger auf den Märkten und die blinden Sagenerzähler an den Tafeln der Fürstenhöfe kein besseres Thema kannten als blutige Kriegstaten und Heldentum. Derart waren Amphitryons Anlagen die denkbar günstigsten, und er durfte sich für die Zeit, in der er lebte, aufs allerbeste gerüstet fühlen.
Auch des Alkaios Bruder, König Elektryon von Mykenä, hatte ein Kind, ein Mädchen indessen, und ihr Name lautete Alkmene.
Sie war sehr schön, und das sagt man so leichthin. Von Mädchen wird gerne behauptet, sie seien schön, dabei ist nur ihre Jugend gemeint, wenn auch zuzugestehen ist, daß Jugend einen wichtigen Aspekt der Schönheit stellt. Von Fürstentöchtern nun zumal wird gerne behauptet, sie seien schön; es handelt sich hierbei um eine der üblichen Schmeicheleien, die eigentlich den fürstlichen Vätern gelten.
Alkmene wäre auch schön genannt worden, hätte ihr Vater nicht die Königswürde besessen, und sie war noch schön selbst zu Zeiten, da sie nicht mehr jung war. Alkmenes Schönheit war derart, daß, ging sie durch die Straßen ihrer Heimatstadt Mykenä, die Leute in ihren Gesprächen innehielten, da Alkmenes Anblick ihnen die Münder verschloß; den jungen Burschen schoß das Blut in die Stirnen, ihre Gliedmaßen verhedderten sich; den Greisen juckten und tränten die Augen; selbst den Fischweibern auf dem Markte, die bekannt waren für ihre Unerschütterlichkeit und ihren Redefluß, wurden beim Auftritt Alkmenes die Lippen alsbald starr vor Erstaunen und Bewunderung.
Oder wie ein Dichter eher zurückhaltend dichtete:
Wie überragte sie doch der blühenden Frauen Geschlechter
An Gestalt und Größe, an Geist auch glich ihr nicht eine
Von den sterblichen Frauen, die Sterblichen Kinder geboren.
Auch von ihrem Haupte und dunkelbeschatteten Wimpern
Wehte ein Hauch, als käm er von Aphrodite, der goldenen …
Genug: Alkmene war schön, und welche Wirkung sie mit ihrer Schönheit erzielte, wird im folgenden sehr ausführlich zu bedenken sein.
König Elektryon hatte außer Alkmene noch Söhne gehabt, insgesamt acht. Wir sparen uns hier eine Aufzählung der Namen, die zum Beispiel Perilaos oder Eurybios lauteten, denn alle acht hatten sehr rasch und etwas schmerzlich aus unserer Geschichte ausscheiden müssen, noch ehe die eigentlich begann.
Zu den Umständen muß man wissen, daß Mykenä eine bekannte Rinderzucht besaß. Mykenische Kühe waren in ganz Griechenland berühmt für ihre Stärke, ihr Feuer, ihr Fleisch, für die Güte und Menge der Milch in ihren Eutern. Mykenäs Kühe waren der Grund für Mykenäs Reichtum, und Mykenäs Reichtum erregte den Neid der Nachbarn. Zu denen gehörten die Traphier, ein Volk, das sich besonders auf den Umgang mit Schiffen verstand. Auf dem Seewege begaben sich Traphier nach Mykenä, um mykenische Rinder zu rauben.
Ihr Vorhaben blieb nicht unbemerkt, Mykenä wehrte sich. Zwar blieb der übergroße Teil der Rinder Mykenä erhalten, aber der Preis war, daß sämtliche acht Söhne des Königs Elektryon im Gemetzel umkamen. Von neun Kindern besaßen König Elektryon und Königin Lysidikes nur noch eines; das war ein großer, ein tragischer Verlust, und er hatte erbracht werden müssen, weil Mykenä so wundervolles Rindvieh besaß.
In seinem väterlichen Schmerz wandte sich König Elektryon an seinen Bruder Alkaios von Tiryns um Unterstützung und Zuspruch. König Alkaios schickte seinen Sohn Amphitryon nach Mykenä. Dies war ein sehr weiser Entschluß; dem von Söhnen entblößten Hofe des Elektryon wurde ein junger Mann aus allernächster Verwandtschaft gestellt, dem von Viehdieben bedrohten Mykenä ein erstklassiger Kämpe.
Amphitryon war in Mykenä. Zu mittäglicher Stunde schlenderte er über den Hof des Palastes mit dem berühmten Löwentor. Sein Schritt war träge, dabei kraftvoll. Seine Muskeln spielten und vibrierten unter der gebräunten Haut seines breiten Rückens. Er setzte sich auf eine Mauer. Er ließ sich von der prallen Sonne bescheinen. Er rieb sich langsam und genußvoll die starken Gliedmaßen mit Zedernöl, und seine Zähne, weiß, stark, wölfisch, blitzten das Sonnenlicht zurück. Manch eine der Mägde von Königin Lysidikes blickte sehnsüchtig seufzend auf dieses prachtvolle Mannsbild. Nicht nur die Mägde der Königin Lysidikes blickten so, auch der Königin Lysidikes einzige Tochter, die schöne, knöchelschlanke Alkmene, wurde von solchem Anblick ihres starken Cousins bis zur Atemlosigkeit verwirrt.
Wir überspringen hier einige Wochen. Wir verschweigen die Spaziergänge, die nächtlich-heimlichen, von Base und Vetter in den königlichen Gärten. Wir wissen nicht, welche Worte sie wechselten unter Pinien und Lorbeerbäumen und was sie noch wechselten außer Worten. Wir vermögen nicht zu entscheiden, welche Haltungen sie einnahmen, als das Licht des silbernen altgriechischen Vollmondes sie berührte; wie ihre Umrisse zum Himmel standen, wenn das Lied der Nachtigallen in den Ölbäumen erscholl.
Wir sagen nur, daß, nach einigen Wochen, Amphitryon und Alkmene Hand in Hand vor König Elektryon von Mykenä erschienen und zu heiraten begehrten, wozu sie königliche Erlaubnis und väterlichen Segen erbaten. Beides wurde ihnen gewährt.
Solche Heiraten zwischen allernächsten Verwandten waren zu jener Zeit nicht unüblich und nicht selten, zumal wenn es sich um vermögende Verwandte handelte. Die möglichen biologischen Schäden für die Nachkommenschaft wurden völlig ausgeglichen durch den Vorteil, daß auf diese Weise familiäre Macht und familiärer Reichtum in einer Familie konzentriert blieben, statt sich durch Aussteuern, Brautgelder und Morgengaben in die verschiedensten Richtungen zu zerstreuen. Im Fall des Königs Elektryon von Mykenä war mit dem Neffen, der Schwiegersohn wurde, auch gleich die Frage nach der Fortsetzung der Königswürde in Mykenä entschieden. Alles würde in der Familie bleiben; und da eine Mitgift auszusetzen war, da sich außerdem König Elektryon, der früher einmal den Beinamen eines Feindeszerstreuers getragen hatte, inzwischen gealtert und geschwächt fühlte durch den Verlust von acht blühenden Söhnen, gab er als Mitgift seine Königswürde davon. Nach der Hochzeitsnacht sollte Amphitryon König von Mykenä werden. Es war eine überaus hochherzige Gabe, wie es jedermann schien.
Die Hochzeit fand statt und war glanzvoll. König Alkaios eilte von Tiryns herbei, die schöne Nichte an sein schwiegerväterliches Herz zu drücken; auch Sthenelos eilte herbei, Bruder des Alkaios wie des Elektryon, ein bewährter Haudegen und finsterer Krieger. Man stand, saß und lag in den Gemächern des königlichen Palastes und schüttete sich goldgelben Wein aus Korinth in die geöffneten Münder; zarte mykenische Kälber hingen am Spieß überm offenen Feuer; Tänzerinnen bewegten sich anmutig zu den Weisen von Doppelflöte und Lyra; Liedersänger traten auf, sie priesen Alkmenes Schönheit, Amphitryons Stärke, und sie sangen die beliebten alten Gesänge vom göttlichen Liebeslager des Kronos mit der Rhea.
Am Abend war Amphitryon so übervoll der gehörten Lieder und Musiken, des genossenen Fleisches mykenischer Kälber und des goldgelben Weins aus Korinth, daß er wie ein gefällter Eichenstamm aufs hochzeitliche Lager fiel und fest, traumlos, ununterbrochen schlief bis in den nächsten Mittag. Seine schöne Gattin Alkmene aber lag neben ihm, hörte auf seinen Atem, der mit sanften Schnarchtönen versetzt war; aus großen, schönen Augen blickte sie ins Dunkel und dachte an die Lieder, welche die Sänger gesungen hatten, jene vom göttlichen Beilager des Kronos mit der Rhea.
Nachdem sich anderntags Amphitryon von seinem Lager erhoben hatte, mit schwerem Kopf und trägen Gliedern, wurde er zum König von Mykenä ausgerufen. Das geschah in aller Öffentlichkeit. Das Volk von Mykenä drängte sich vor dem Palast mit dem Löwentor, es jubelte dem neuen Herrscher zu, es pries dessen Jugend und Stärke. Man darf solchen Jubel nicht zu ernst nehmen. Er gehörte zum Ritual. Für besonders guten Jubel wurden die Leute mit Geldstücken entlohnt, während bei Verweigerung von Jubel die königlichen Aufseher mit Peitschen drohten.
Nachdem er derart also König war, befahl Amphitryon, aus Anlaß seiner Krönung ein gewaltiges Fest zu feiern. Wieder bewegten sich Tänzerinnen anmutig zur Musik von Doppelflöte und Leier, rösteten Kälber überm offenen Herd, floß in Strömen goldgelber Wein aus Korinth, und die Liedersänger, noch etwas heiser von der Arbeit am Tag zuvor, priesen die Stärke und die Macht des jungen Königs Amphitryon von Mykenä, und sie sangen vom Beilager des mächtigen Zeus mit der Europa, nachdem Zeus sie entführt hatte in der Gestalt eines Stieres. Abends dann sank Amphitryon übervoll all des Genossenen, auf sein Lager, er sank wie ein geborstenes Schiff ins Meer; traumlos und ohne Unterbrechung schlief er bis in den folgenden Morgen, während seine Gattin Alkmene, die schöne, die knöchelschlanke, neben ihm lag und an Zeus dachte, der sich in einen Stier verwandelt hatte, um sich mit Europa zu vermählen.
Am nächsten Tag stand Amphitryon auf den Zinnen des Palastes von Mykenä. Hinter seiner Stirn nistete ein dumpfer mittelpunktloser Schmerz, und seine Augen tränten, wegen des Rauches der offenen Feuer, in die er zwei halbe Tage und zwei halbe Nächte geatmet hatte. Aus tränenden Augen blickte Amphitryon von der Zinne des Palastes über die Stadt. Er sah die Häuser, die Tempel, und er sah, jenseits der Stadtmauer, die saftigen grünen Weiden mit ihren Kuhherden, die bewacht wurden von Hirten und Hunden. Lange starrte Amphitryon aus tränenden Augen in schmerzendem Kopf auf die Kühe. Er sah ihre Bewegungen. Er sah sie grasen. Er hörte die Rufe der Hirten und das Gebell der Hunde. Wolken gingen tief und machten die Farben von Tieren und Wiesen dunkel. Da spie Amphitryon neben sich. Er stapfte die Zinne entlang, ging polternden Schrittes die Stufen hinab, ging durch mehrere Gänge des Palastes und riß zuletzt den Vorhang beiseite, der zum Gemach des Elektryon gehörte, des ehemaligen Königs von Mykenä.
Elektryon hockte auf dem Boden und hielt ein zierliches Stierkalb auf seinen Knien. Elektryon war dabei, dem Stierkalb Milch einzuflößen, um es derart zu kräftigen und am Leben zu erhalten. In seiner Tätigkeit gestört durch die polternden Geräusche, welche ausgingen von Amphitryon, hob Elektryon, Mykenäs ehemaliger König, den Kopf und sagte:
Amphitryon, mein Sohn, ich sehe deine Stirn umwölkt, deine Augen leuchten trübe, und deine Haltung verrät insgesamt wenig Fröhlichkeit.
Ich habe, sagte Amphitryon heiser, keine Kühe.
Mein Sohn, sagte Elektryon, wobei er dem gierig blökenden Stierkalb erwärmte Milch einlöffelte, was willst du, mein Sohn, mit Kühen? Hast du nicht seit gestern ein Königreich? Bist du nicht Herrscher über ganz Mykenä?
Amphitryon erwiderte: Mykenä ist, was es ist, durch seine Kühe. Ich bin König von Mykenä und habe keine Kühe. Ich will welche.
Ei, fragte Elektryon, und woher?
Von dir, sagte Amphitryon, denn du hast genug.
Mehr als eintausend, sagte Elektryon stolz, mehr als irgendwer sonst in Mykenä.
Also, sagte Amphitryon. Was spricht dagegen, wenn du mir welche abgibst?
Meine Unlust, sagte Elektryon. Kühe sind in Mykenä bares Geld und bare Macht. Was ist ein König? Ein männlicher Kopf mit einem Stück Metall darauf. Der wahre König von Mykenä ist der Mann mit den meisten Kühen und ist es auch dann, wenn er nicht König von Mykenä heißt.
Ich will Kühe, sagte Amphitryon.
Elektryon zuckte die Schultern. Er löffelte erst einmal etwas Milch in das blökende Maul des hungrigen Stierkalbs, dann sagte er:
Meine Tochter hast du bekommen, Amphitryon, meine Krone hast du bekommen, meine Kühe behalte ich selber.
Ich will Kühe! sagte Amphitryon und stampfte drohend mit einem Fuß.
Was willst du mit Kühen, sagte Elektryon. Du hast den Umgang mit ihnen nicht erlernt. Du verstehst nicht die Sprache ihrer Bewegungen. Du stammst nicht aus Mykenä. Du hast den Umgang mit Schwert, Lanze und Bogen erlernt. Du taugst ausgezeichnet zur Verteidigung unserer Kühe, nicht zu ihrem Besitz.
Ich will Kühe! sagte Amphitryon und stampfte drohend mit beiden Füßen.
Sei nicht kindisch, sagte Elektryon, das Stierkalb im Arm. Willst du, sagte er, den Stier zur Kuh führen, die Kuh zum Stiere? Was verstehst du von dem Zeitpunkt, da man sie zueinandertreiben muß? Nichts verstehst du, Amphitryon, mein Sohn. Kümmere dich lieber, damit du es verstehen lernst, um Alkmene, meine schöne, knöchelschlanke Tochter, die ich seit zwei Nächten traurig seufzen hören muß.
Ich will Kühe! schrie Amphitryon, packte zu und versuchte dem Elektryon das Stierkalb zu entreißen. Das Stierkalb blökte herzzerreißend laut, und der alte Elektryon entwickelte überraschende Kräfte: genügend jedenfalls, daß er das blökende Stierkalb nicht freiließ, und so geschah es, daß Amphitryon das Stierkalb und Elektryon umherzerrte und eine Lösung nicht abzusehen war. Zorn loderte in Amphitryon; unentwegt schrie er, daß er Kühe wolle, und als er aus dem Munde des alten Elektryon auch noch ein höhnisches Gekicher zu vernehmen meinte, übermannte es ihn derart, daß er Stierkalb nebst daran befindlichem Elektryon hochhob und gegen die granitene Wand des Palastes von Mykenä schlug.
Es gab Geräusche von splitternden Knochen und plätscherndes Blut. Dem Stierkalb war das Rückgrat gebrochen; nie mehr würde es blöken. Dem alten Elektryon aber war der Schädel zertrümmert, die Kopfhaut geplatzt, und aus diesen Wunden plätscherte es.
Mörder! schrie es gellend von der Tür, wo Lysidikes stand, die frühere Königin, des Elektryon Frau, die nach acht blühenden Söhnen nun auch noch ihren Mann verloren hatte: alle männlichen Glieder ihrer Familie, und das alles wegen der Rinder.
Lysidikes lief schreiend durch den Palast von Mykenä, jenen mit dem Löwentor; furchtbar hallten ihre Schreie an den Mauern, wurden gehört und aufgenommen und weitergetragen, eilten so durch die Straßen der Stadt Mykenä und durch die Tore in den Stadtmauern, bis dorthin, wo Sthenelos, des Elektryon Bruder und Amphitryons Oheim, bereits wieder auf dem Rückweg war von Hochzeitsfeier und Krönungsfest. Kaum vernahm Sthenelos, was sich an Blutigem ereignet hatte im Palast mit dem Löwentor, wendete er sein Pferd, und seine Männer, alles finstere Haudegen wie er, taten desgleichen.
Des Sthenelos Gefolge ritt wieder ein durchs Stadttor in Mykenä. Des Sthenelos finstere Haudegen rannten zähnebleckend durch die Straßen von Mykenä und verkündeten, wie sie den Mörder Amphitryon zurichten würden, an welchen Gliedmaßen, mit welchen Instrumenten. Amphitryon, seinerseits ein begeisterter Haudegen, stand unterdessen vorm Löwentor des Palastes von Mykenä, er hielt sein Schwert gezogen und forderte mit lauter Stimme sein Volk zur militärischen Unterstützung auf gegen den Angreifer Sthenelos. Niemand hörte ihn. Niemand folgte ihm. Allein stand Amphitryon unterm Löwentor mit gezücktem Schwert, während die Leute von Mykenä, die gestern noch ihm zugejubelt hatten als ihrem König, nunmehr dem Sthenelos zujubelten, des toten Elektryon Bruder.
Da erkannte Amphitryon, daß er verloren hatte. Er rannte, zerrte die träumende und seufzende Alkmene von ihrer Ruhestatt; er setzte Alkmene auf ein Pferd und bestieg selber ein anderes. Durch eine geheime Pforte verließ er den Palast und die Stadt, ritt mit Alkmene über sanfte Weiden, an mykenischen Rinderherden vorbei, ritt und ritt, bis Mykenä weit hinter ihm lag, ritt nach Theben, das eine mächtige Stadt war mit sieben Toren. Dort machte er halt. Theben hatte gute Verwendung für alle Arten von Kriegern.
IV
Dies ist der Zeitpunkt, ausführlicher von Zeus zu sprechen, dem obersten aller Götter.
Er lagerte, während Amphitryon mit seiner schönen Gattin Alkmene in die Stadt Theben einritt, im Kreise der anderen Götter. Er nahm die Götterspeise zu sich, die Ambrosia heißt und Unsterblichkeit verleiht; mithin das, was (neben anderem) Götter überhaupt erst zu Göttern macht. Er lagerte, nahm Ambrosia zu sich und trank Nektar. Es handelt sich bei letzterem um jenen Saft, welchen die Blüten entwickeln, auf daß sie Insekten anlocken; den Bienen dient er als Rohstoff für Honig. Nektar kommt bei jeder Blüte nur in winzigsten Tröpfchen vor; Zeus und die anderen Götter tranken ihn aber gleich literweise, woraus erhellt, daß der Nektar der Götter aus geradezu gigantischen Blüten gewonnen wurde: Götterblumen, zaubrischen, unirdischen. Die den Nektar in die Trinkschalen der Götter goß, war übrigens Hebe, eine Tochter des Zeus, ein gelocktes und anmutiges Wesen, nebenher noch die Göttin der Jugend; mit einem Krug in der Hand ging Hebe von einem Gotte zum anderen und schenkte aus.
Zeus lagerte im Kreise der Götter, aß Ambrosia, trank Nektar und dachte nach. Worüber dachte er nach? Dachte er vielleicht über Amphitryon nach, den jähzornigen, den habgierigen Töter des Elektryon, oder dachte er nach über Alkmene, die schöne, die knöchelschlanke Gattin jenes Amphitryon und darum wie dieser ruhelos und auf der Flucht von Mykenä nach Theben? Wir nehmen an, daß er über die beiden nachdachte; und wiewohl dies alles sein Werk war, Amphitryon und Alkmene samt deren gemeinsamem Schicksal, fühlte er doch ausgesprochenes Wohlgefallen an Alkmene, der Schönen, weniger an Amphitryon, dem Elektryon-Töter; aber Amphitryon ließ sich nicht vergessen, wenn jemand an Alkmene dachte, da Amphitryon ihr Gatte war.
Zeus lag und blickte hinab vom Olymp auf Alkmene. Sie hatte während vergangener Nächte so nachhaltig gedacht an Flucht und Beilager des stiergestaltigen Zeus mit Europa, daß Zeus gar nichts anderes übriggeblieben war, als auf Alkmene aufmerksam zu werden, sofern Zeus überhaupt noch dieses Anlasses bedurfte, aufmerksam zu werden auf die schöne Gattin des rauflustigen Amphitryon. Das Wohlgefallen und Wohlbefinden ging als sanftes Gekräusel über das mächtige Götterantlitz des Zeus. Es erregte, wie sanft es auch war, oder gerade weil es so sanft war, die Aufmerksamkeit der anderen Götter. Die süße Musik der Sphären wurde süßer darunter. Eine warme Woge von Zärtlichkeit ging durch die Hallen des Olymps. Jeder unter den Göttern empfand dies als ausgesprochen angenehm. Besonders Hebe, die Göttin der Jugend mit dem Nektarkrug, dehnte und rekelte sich wie in einer unklaren, gleichwohl süßen Vorahnung. Lediglich Hera befiel das allertiefste Mißtrauen; sie war die Gattin des Zeus und verantwortlich für Ehe, Familie, familiäre Ordnung auf Erden, gleichermaßen im Olymp, mithin auch bei Zeus und Hera.
Sie war nicht die erste Gattin des Zeus, und wenn Gattin bedeutete, die Mutter zu sein von jemandes Kindern, war sie auch nicht die letzte. Überhaupt waren des Zeus und der anderen Götter Familienbeziehungen von der verzwicktesten Art. Da nun jedes Wesen, selbst ein Gott, selbst ein Gottvater, in Geist und Wesen das Produkt ist jener, die vor ihm waren und ihn erschufen, müssen wir den Vorfahren des Zeus einige Aufmerksamkeit widmen. Geist und Wesen des Zeus sind für den Fortgang unserer Geschichte nämlich von beträchtlicher Wichtigkeit.
Gehen wir also zurück. Begeben wir uns zum Anfang von allen Anfängen. In ihm war das Nichts, aber es war kein nichtendes, sondern ein erfülltes Nichts, ein Noch-Nichts, in welchem Kräfte, Partikel, Energie beieinander waren wie in einem Strudel, dem Chaos. Allmählich klärte es sich und schied es sich und schied sich in Himmel und Erde. Und der Himmel war Uranos, der war der Gott des Himmels und der Himmel selbst, wie auch Gaia die Erde war und die Göttin der Erde, und beide, aus einem geboren, aus dem Strudel, der Chaos hieß, und geschieden, um Himmel und Erde zu werden und Uranos und Gaia, sie strebten auch wieder zusammen und vermählten sich, wurden eins, doch es war dies das Einssein der Vermählung, das kurz ist und immer wieder Trennung bedeutet und immer wieder auch Drang zu neuerlicher Vermählung und deren Vollzug.
Aus der Ehe des Uranos und der Gaia entstand Nachkommenschaft. Es gehörte dazu Okeanos, der Urstrom, gleichsam das Urgewässer, umgebend alles, was die Erde Gaia war, seine Mutter. Aber Uranos befand, daß seine Nachkommenschaft ihm Platz streitig machte; und da er immer wieder sich vermählte mit Gaia, der Erde, war die Nachkommenschaft zahlreich, und er meinte Angst haben zu müssen vor den Nachkommen, die, da sie sein Teil waren, auch seine Macht besaßen und mit ihrer Macht der seinen gefährlich werden konnten. Was also tun? Uranos entschloß sich zu einem drastischen Verfahren. Er vergrub die meisten seiner Nachkommen wieder in der Erde, woher sie gekommen, und das hieß: er stopfte sie Gaia, ihrer Mutter, zurück in den Bauch.
Die Erdmutter Gaia nun wollte, wie alle Mütter, ihre Kinder nicht auf ewig im Leibe behalten, sondern auf die Welt bringen, auf der Welt behalten, zum ersten oder andern Mal, sie wollte sie springen und wachsen sehen und war unzufrieden mit Uranos’, ihres Mannes, Tun und Ängsten. Unter ihren und des Uranos Sprossen war der jüngste Kronos, ein kleiner Finsterling. Diesem ließ sie eine gezahnte Sichel zukommen. In der Erde lagert in Mengen Metall für Sicheln. Kronos sollte sich der seinen bedienen, was auch geschah.
Wir gelangen nunmehr zu einem Ereignis, das überaus blutig und alles in allem äußerst heikel ist.
Kronos besaß die gezahnte Sichel. Er hatte sie von Gaia, seiner Mutter. Sicheln sind Schneidegeräte, und tatsächlich würde Kronos schneiden. Was aber würde er schneiden und bei welchem Anlaß?
Ach, es war ärgerlich. Es war über alle Maßen peinlich und skandalös und eigentlich unaussprechlich. Wir werden es dennoch aussprechen, damit unsere Geschichte fortgehen kann, und so erteilen wir, da uns nichts anderes einfällt, einem Dichter das Wort, einem griechischen, alten, Angehörigen jener Religion, zu deren Inhalten Uranos und Gaia und Kronos gehören.
Unser Dichter also dichtete:
An kam mit der Nacht der gewaltige Uranos, sehnend
Schlang er sich voller Liebe um Gaia und dehnte sich endlos
Weit. Da streckte der Sohn aus seinem Verstecke die linke
Hand und griff mit der rechten die ungeheuerlich große,
Schneidende, zahnige Sichel und mähte dem eigenen Vater
Eilig ab die Scham und warf im Fluge sie wieder
Hinter sich …
Und der solcherart amputierte Körperteil taumelte ein wenig durchs All, bis er in den Ozean fiel und dort mächtigen Schaum erregte. Aus diesem aber stieg dann eine Göttin auf: Aphrodite, die Göttin der Liebe.
Zugleich aber krochen Kronos und seine Geschwister aus Gaias Bauch ans Licht der Welt. Kronos, der Vater-Schänder und Sichel-Schnitter, wurde ihr Fürst, und das war ganz natürlich, denn ihm und seiner Tat verdankten sie ihre Freiheit. Kronos nahm sich seine Schwester Rhea zur Frau; andere Frauen denn Schwestern waren nicht vorhanden. Kronos war finster, aber friedlich. Eigentlich war es kein unangenehmes Zeitalter. Später entdeckte man, daß es sogar ein überaus angenehmes Zeitalter gewesen war, und nannte es rückblickend das Goldene.
Dann aber begann infolge des Beilagers von Kronos und Rhea (das sehr viel später die Liedersänger besangen bei der Hochzeit von Amphitryon und Alkmene), es begann Rhea Kinder zu bekommen. Kronos wußte aus einer Weissagung, das letzte seiner Kinder werde ihn um seine Herrschaft bringen. Kronos war, wie wir wissen, ein Finsterling. Kronos war außerdem des Uranos Sohn und hatte von Uranos das Bedürfnis geerbt, seine Nachkommenschaft verschwinden zu lassen. Da er aber nun auch wußte und besser als andere, wie Uranos just dadurch entmannt und entmachtet worden war, daß er seine Kinder bei Gaia verschwinden ließ, mußte eine andere Methode überlegt werden. Was tat Kronos? Er selbst verschlang seine Kinder. Kaum war Rhea eines Säuglings genesen, eilte Kronos herbei, riß den Rachen auf und ließ das Kind darin verschwinden. Kind um Kind gebar Rhea, und Kronos verschlang sie allesamt.
Rhea war bekümmert darüber, ebenso wie einst des Kronos Mutter Gaia bekümmert gewesen war, und wie diese sann Rhea auf Abhilfe. Als sie zu neuerlichem Male schwanger wurde und ihre Niederkunft nahe sah, ging sie heimlich davon. Sie versteckte sich auf der Mittelmeerinsel Kreta. Sie genas eines Sohnes, den sie Zeus nannte. Sie verbarg Zeus in einer Grotte und schob ihn einer Ziege zu, von deren Milch er sich nähren konnte. Als dann Kronos nahte, sein nächstes Kind zu verspeisen, reichte sie ihm einen Windelpack, darin sich statt des lebendigen Zeus bloß ein großer Stein befand. Kronos verschlang den Pack mit dem vermeintlichen Säugling.