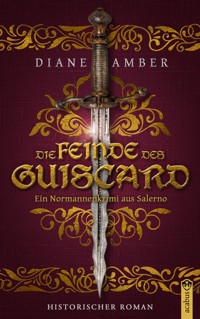Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Als Psychiaterin und aus leidvoller Erfahrung weiß Dr. Carola Adler, dass das Leben nicht berechenbar ist, aber eine Leiche im Garten kommt selbst für sie überraschend. Carola und ihre Mitbewohnerin Linda ahnen, dass der Tote und alles, was auf dessen Auffinden folgt, ihr Leben durcheinander wirbeln wird. Zuerst stehen sie dem Trubel gelassen gegenüber. Doch nach und nach offenbart sich, dass in den Mord immer mehr Personen aus Carolas Vergangenheit verstrickt sind. Als Hagen, ihre einstige große Liebe aus Studentenzeiten auftaucht, ist es mit ihrer Fassung dahin.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 273
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
*
Es ist nicht so, dass man als Psychologin Menschen lieben muss. Es wäre zwar wünschenswert, aber oftmals sorgt die praktizierende Arbeit für das Gegenteil.
Selbst wenn man anderen Leuten im Alltag unvoreingenommen begegnet, stößt man aus den idiotischsten Gründen auf miese Laune. Derzeit wegen der Hitze. Gestern herrschten 34 Grad und für den heutigen Tag kündigte der Wetterdienst 38 Grad an, was für die meisten schon Ursache genug ist, den Tag mies gelaunt zu beginnen. Anscheinend wissen alle im Vorhinein, dass sie es nicht ertragen werden. Tun sie dann auch nicht. Den wenigstens ist bewusst, dass sie bloß eine Stimmung nachäffen, die aus allgemeinem Gejammer geboren wurde.
Ich erlebte es gerade live, seit ich unterwegs war, um Brötchen und Aufschnitt zu holen. Die Praxis war zu, es war mein freier Tag. Der einzige der Woche, an dem ich nichts hören wollte von Mobbing im Büro. Nur ein Tag wöchentlich ohne Ehemänner, die weinerlich beteuerten, nicht schuld zu sein, dass sie ihre Frauen betrogen. Ich wollte nur ich selbst sein und dieses Selbst war meist guter Dinge. Leise einen alten Song von Mungo Jerry trällernd turnte ich dynamisch durch die Regalreihen.
Die anderen nicht. Überall nur miesepetrige Mienen.
An der Fleischtheke führte ich einen pragmatischen Dialog zum Erwerb von Aufschnitt mit einer lausig gelaunten Marmormaske. Es war zum Kotzen, langsam verrutschten selbst mir die Mundwinkel. Verbissen spannte ich die Gesichtsmuskeln an und schob sie hoch. Nach dem freudlosen Gezicke an der Kasse, derweil ich die kleine Menge Einkäufe im Korb verstaute, summte mein Handy. Schon während ich es aus der Tasche zog, erkannte ich Lindas Nummer.
Seit ihrer Scheidung lebten wir zusammen. Womöglich war ihr noch was eingefallen, das ich mitbringen sollte. Lust, erneut reinzugehen, hatte ich nicht, trotzdem fragte ich fröhlich: „Was denn?“
Ich hatte ja keine Ahnung. Ich hielt ihr zugute, dass ihre Stimme nicht mal bebte. Sie klang ausgesprochen pragmatisch.
„Du musst sofort nach Hause kommen. Wir haben einen Toten in unserem Garten.“
*
In meinem Cabrio, mit überhöhter Geschwindigkeit nach Hause düsend, war ich felsenfest davon überzeugt, Linda hätte ihren Ex abgemurkst. Es wäre längst überfällig.
Ich hatte mich regelrecht darum gerissen, Frühstück zu besorgen, um ihm nicht über den Weg zu laufen. Er sollte die Kinder zu einer Urlaubsreise abholen, und ich hatte gehofft, dass er längst weg wäre, wenn ich heimkam. Sofern er nicht der Tote war.
Ich brauste in die kleine Straße, rumpelte auf die Einfahrt, riss die Tür auf und raste in unseren Bungalow. Durch das Untergeschoß hastete ich hinaus in den Garten, wo ich Linda über einem leblosen, blutverschmierten Körper vorfand, der definitiv nicht ihr Ex Jonas war.
Da lag Torben Hahn, der Nachbar von gegenüber. Linda pumpte auf seiner Brust herum.
„Highway to hell“, sang sie dabei beachtenswert melodisch, und fast hätte ich gelacht. Man neigt dazu, hysterisch zu lachen, wenn man überfordert ist. Mein Herz schlug wie eine Kriegstrommel, äußerlich blieb ich besonnen.
Ich kniete mich neben Linda und legte eine Hand auf ihre Schulter. „Lass es, Linda. Der ist mausetot.“
Sie schaute hoch und schob den Vorhang ihres langen blonden Haares zur Seite. Schweiß perlte auf ihrer Stirn.
„Ich weiß. Aber ich hatte gehofft, er bleibt wenigstens so lange am Leben, bis er erklären kann, dass ich nichts damit zu tun habe.“ Sie sprang auf die Füße. „So ein Arschloch!“
„Pst, beruhige dich, Linda. Was ist denn passiert?“
Ich sank auf die Fersen zurück und sah ihr dabei zu, wie sie wutschnaubend durch unseren gepflegten Garten tigerte.
„Das ist es ja. Nichts. Ich hatte gerade Jonas mit den Jungs raus bugsiert, stehe mit einer Tasse Kaffee im Wohnzimmer, gucke raus und da kommt er an gewankt. Wie ein Zombie! Die Arme ausgestreckt, das Messer in der Brust!“
Sie gestikulierte hektisch zu dem Horngriff, der aus der schmalen Männerbrust ragte. „Ich war drauf und dran, den Rettungsdienst anzurufen! Da kippt der aus dem Sulky!“
Stumm blieb ich sitzen. Um mich herum leuchtendes Grün, weil wir brav sprengten. Um den Lavendel summten die Hummeln.
Wir hätten noch immer den Rettungswagen und die Polizei anrufen können. Wir hätten es sogar tun müssen. Dass wir darauf verzichteten, war nicht kaltherzig. Ebenso wenig wie unsere relativ coole Reaktion auf eine Leiche im Garten. Wir hatten beide schon Tote gesehen. Linda, weil sie Neurologin war, und ich wegen meiner gelegentlichen Zusammenarbeit mit der Polizei. Doch schwerer wog die Tatsache, dass Torben Hahn ein Arschloch war, mit dem wir dauernd Zoff hatten. Der Ärger war nicht unbemerkt geblieben. Die ganze Nachbarschaft wusste Bescheid. Ich hatte zwar nicht die Absicht, die Leiche verschwinden zu lassen, doch wenn sie gefunden wurde, dann bitte nicht bei uns.
Ich überlegte, wo wir ihn hin verfrachten sollten, und hatte sofort das zum Verkauf angebotene Nachbargrundstück auf dem Schirm. Hinter jenem Gebäude endete unsere kleine Sackgasse. Die Lehrerin, der es gehörte, hatte in ihrem letzten Lebensjahrzehnt nicht mehr im Garten gearbeitet, der war völlig verwildert.
„Hol mal eine Plane aus der Garage“, sagte ich gedämpft.
Linda guckte mich verdutzt an.
„Vom Renovieren im Frühling“, schob ich hinterher. „Unter den übrig gebliebenen Farbeimern im Regal.“
Es dauerte einige Sekunden, aber dann hastete sie in die Garage. Zurück kam sie mit einer durchsichtigen Abdeckplane von der dickeren Sorte. Neben mir fing sie an, das Zeug auszubreiten. Mit dem Messer in der Brust würden wir den Mann leidlich rollen können, also wickelte ich einen Zipfel der Plane um das Messer und zog es mit einem schmatzenden Geräusch aus seinem Körper. Angewidert legte ich es auf die Plane. Wir rollten Torben Hahn darauf, darin ein und schon mal ein Stück zur Hecke. Wir hatten eine Stechginsterhecke, die keine akkurate Mauer zum Nachbargrundstück darstellte, sondern einige natürliche
Lücken aufwies. Nach weiter rechts schoben wir ihn. Im Schutz zweier Tannen hielten wir inne. Mir lief der Schweiß in Strömen den Körper hinab.
„Lange sollte er nicht liegen bleiben. Bei der Hitze.“
Linda nickte. „Die Wesels nebenan sind nicht da. Er ist zur Arbeit.“
„Okay. Sie habe ich im Supermarkt gesehen. Als ich los jagte, bog sie zu Rossmann ab.“
„Dann haben wir ein paar Minuten.“
Synchron schauten wir zu den leeren Fenstern des Wesel-Hauses. Dann rollten wir die Leiche weiter. Als wir davon überzeugt waren, sie korrekt platziert zu haben, wickelten wir sie aus und spurteten geduckt auf unser Grundstück zurück. Ich entdeckte Blutflecken, im dichten Gras kaum auszumachen, und doch schlug ich vor, den Rasen zu sprengen. Linda rannte zum Wasserhahn und drückte ein paar Knöpfe. Sofort hoben sich die Sprengdüsen aus der Wiese und sprudelten kühles Nass. Mit den Füßen rieb ich über die besudelten Stellen. Die Luft wurde feucht und duftete nach Frische, in der wir still herumtollten, das Wasser auf unserer Haut genossen und die letzten Spuren, die auf Torben Hahns Anwesenheit hindeuteten, vernichteten.
Erfrischt kehrten wir im Wohnzimmer ein, wo ich auf das weiche graue Sofa plumpste. Linda holte zwei Handtücher. Dankbar rubbelte ich mich trocken.
„Sie werden es natürlich erfahren“, nuschelte sie ins Frotteehandtuch, mit dem sie über ihr Gesicht rieb. „Dass wir Streit mit ihm hatten, meine ich.“
„Sicher.“ Mit dem Handtuch auf dem Bauch lehnte ich mich zurück. „Aber alle in der Straße hatten Streit mit ihm.“
„Meinst du, sie wird der Polizei was sagen?“ Mit dem Kinn zuckte sie zur Tür und meinte das Haus der Hahns gegenüber. Genaugenommen die Frau, die darin war. Martina Hahn, Torbens Ehefrau. Die Wurzel alles Zankes. Und jemand, den wir schon lange kannten. „Sie werden es erfahren. Früher oder später. Aber die hat so dermaßen nicht mehr alle Nadeln an der Tanne.“
Lange sahen wir uns an. Ein feines Lächeln breitete sich auf unseren Zügen aus.
„Es wird genau das geschehen, was sie hasst“, meinte Linda gehässig. „Sie wird im Mittelpunkt stehen.“
„Man wird in ihrem Leben herumwühlen.“ Ich grinste hämisch.
„Und wir sehen dabei zu.“
„Es könnte etwas stressig werden.“
Linda zuckte die Schultern, schwang sich hoch und schlenderte zur Jukebox, die an der schmalen Wand zwischen dem offenen Wohnzimmer und der weitläufigen Küche stand. Zwei Knöpfe drückte sie. Die Mechanik setzte sich schwerfällig in Gang, es knisterte. Bad Moon arising, den Refrain, sangen wir lauthals mit.
*
Im Prinzip verbrachten wir die nächsten Stunden mit Warten. Bedachte man, dass wir einem Tsunami an Ereignissen entgegensahen, waren das gemütliche Stunden. In Shorts und Tops lümmelten wir auf den weich gepolsterten Gartenliegen unter dem großen beigen Sonnenschirm und schauten dem Poolwasser beim Glitzern zu.
Das Schweigen, das uns dabei Gesellschaft leistete, war warm und behaglich. Nichts, das lastete. Ich nuckelte eben am Strohhalm, der in meiner Colaflasche stak, als wir Gisela Wesels Auto hörten. Dann, wie der Motor erstarb. Das Klappen des Kofferraumes, das Knirschen der Tür und eine Weile nichts mehr. Ich stellte die Flasche auf das kleine Tischchen neben der Liege.
Mit einem Seitenblick sah ich, wie sich Lindas Lippen bewegten. Sie zählte still, ich grinste. Bei dreiundzwanzig hörten wir einen eindringlichen Schrei.
Nein, das war gnadenlos untertrieben. Es war ein Gekreisch, das jeder Barnaby-Folge würdig war.
„Und jetzt?“ Linda setzte sich auf. „Sollen wir signalisieren, dass wir sie gehört haben?“
„Lieber nicht.“
„Du hast recht.“ Sie lehnte sich wieder zurück, griff nach der Sonnencreme und schmierte ihr Dekolletee ein. In vielerlei Hinsicht war Linda vernünftiger als ich. Sie fuhr auch Fahrrad mit Helm, was mir im Traum nicht einfiele. Ich hasste Kopfbedeckungen jeder Art.
„Elias hat mich gefragt, warum du rauchst. Obwohl du doch weißt, dass es ungesund ist“, sagte sie und meinte ihren neunjährigen Sohn.
„Er weiß schon, dass sein Vater raucht, oder?“
„Schon, aber nichts, was Jonas tut, halten seine Kinder für vernünftig.“
Ich gluckste leise, dann erfüllte der Klang von Martinshörnern die Luft. „Ich glaub, es geht los.“
„Hm.“
Nach etwa einer halben Stunde, in der wir den Geräuschen auf der Straße gelauscht hatten, stand ich auf, schob mir die Sonnenbrille in den kinnlangen blonden Bob und nahm die leere Colaflasche. „Willst du auch noch was trinken?“
„Ich komme mit.“
In der zur Straße gelegenen Küche linsten wir aus dem Fenster. Draußen tat sich Bemerkenswertes. Zwei Streifenwagen parkten auf dem Bürgersteig. In einen Leichenwagen wurde soeben der Zinksarg mit Torben Hahns Überresten verfrachtet. Gisela Wesel, die ihn gefunden hatte, hockte winselnd auf der Bordsteinkante und sülzte einen Rettungssanitäter voll. Der junge Mann tat mir aufrichtig leid. Ich fand keinen vernünftigen Grund, aus dem Frau Wesel nicht längst in die Sicherheit ihres Hauses enteilt war. Manche Leute nutzten einfach jede Gelegenheit, sich in den Mittelpunkt zu rücken. Andere mieden es pathologisch, so wie die frischgebackene Witwe. Martina Hahn.
Der Gedanke, ihr demnächst über den Weg zu laufen, verursachte mir Bauchschmerzen. Ich zog eine Grimasse, nicht nur weil mir Beileidsbekundungen schwerfielen. Die üblichen Phrasen drückten selten aus, was ich meinte. Doch in Martinas Fall würde es umgekehrt sein. Wir alle wussten, dass sie zu echten Gefühlen, die über ihre eigenen Bedürfnisse hinausgingen, nicht fähig war. Aber jetzt darüber nachdenken?
Ich wischte die Gedanken fort und konzentrierte mich auf das Gewusel vor dem Fenster. Ein Spurensicherungszelt war zwischen unserem und dem leerstehenden Haus aufgebaut, in dessen Garten wir den komischen Kauz gerollt hatten.
Heilige Scheiße! Wie hatte mir das Detail entgehen können?
„Ich hatte vergessen“, wisperte ich, „dass er ja blutend in unseren Garten getorkelt war. Der Weg muss blutverschmiert sein.“
„Stimmt.“ An den Kühlschrank gelehnt mit Blick zum Fenster nahm Linda einen langen Zug aus ihrer Colaflasche. „Wird schon schiefgehen.“ Sie zog die Brauen zusammen. „Guck mal.“
Ich guckte raus. „Och.“
Vor dem Haus des Opfers parkte ein schwarzer Porsche, der eindeutig auf die Anwesenheit eines bestimmten Mannes hindeutete. Mir war klar gewesen, dass ein Mord nichts für die Kreispolizeibehörde des Rhein-Erft-Kreises war. In diesem Kreis, in einem Nest namens Stommeln, kaum 20 Kilometer außerhalb Kölns, wohnten wir.
Frau Wesel hatte die Notrufnummer gewählt. Die Streifenpolizisten dürften die Mordkommission in Köln informiert und die einen Ermittler oder zwei rausgeschickt haben. So weit, so normal. Doch ich hatte nicht ansatzweise damit gerechnet, dass sie ihn schicken würden. Maurice Kohn. Eins neunzig groß, 95 Kilo, nur Muskeln, aber von der schlanken Art, die nicht so plump daherkam. Blond, blauäugig, der Blick fast magisch, wenn er einem tief in die Augen sah.
Und das hatte er im letzten Sommer getan, als wir an einem Fall gearbeitet hatten, zu dem die Polizei mich als psychiatrische Gutachterin hinzugezogen hatte. Wir hatten uns intensiv in die Augen gesehen und uns beinahe gegenseitig die Kleider vom Leib gerissen, wäre mir nicht rechtzeitig aufgefallen, dass er einen Ehering trug. Unsere Arbeit war ein einziger Eiertanz gewesen. Ich weiß nicht, als was wir nach dem Fall auseinandergegangen waren.
Freunde?
Vielleicht. Obwohl es weitaus mehr Gründe als seine Ehe gegeben hatte, mich nicht auf ihn einzulassen. Von Anfang an hatten wir uns in der Wolle gehabt. Mir war klar gewesen, dass wir ursächlich wegen unterdrückter Sehnsüchte gestritten hatten. Wir schrien uns aufgrund fachlicher Differenzen nur an den Tagen nicht an, an denen wir uns geküsst hatten. Wir hatten uns häufig geküsst. Selbst, nachdem ich ihm an den Kopf geworfen hatte, dass er ein selbstverliebter Blödmann wäre, der nur nach einer Abwechslung vom Ehebett gierte, hatte die Luft zwischen uns geknistert.
Ich schaute ungeniert aus dem Fenster, um ihn zu sehen. Vor dem Hahn-Haus stand er neben einer kleinen Frau in Zivil, die ich nicht direkt erkannte, die aber zweifellos eine Kollegin war. Niemand öffnete. Er klingelte noch einmal und wartete ab. Erneut tat sich nichts.
„Sie ist da“, hörte ich Linda neben mir. „Martina Hahn ist immer zu Hause.“
„Das weißt du und ich weiß das“, murmelte ich. „Er wird es gleich von uns erfahren.“
Maurice wandte sich um und schaute über die Straße. Mir gefiel, was ich sah. Er trug beige weite Leinenhosen. Das langärmelige Leinenhemd hatte er bis zum Ellenbogen hochgekrempelt. Ach Gott, diese Arme. Ich verlor mich in die Erinnerung an die sehnig-muskulösen Unterarme und die exotischen Tribles, die von seiner Geschmacksverirrung auf Fußhöhe ablenkten. Linda, weitaus weniger verklärt, entging die nicht.
„Er trägt Kalbslederslipper ohne Socken.“ Sie kicherte.
Ich giggelte mit. „Ich hab‘ ihm gesagt, wie affig das aussieht. Sneakers wären cooler.“
„Er kommt rüber.“ Sie schnellte an die Jukebox, derweil ich zusah, wie er etwas im Wagen verstaute und zu unserem Haus guckte. Zwischen uns die Scheibe, blickten wir uns an. Die Überraschung in seinem leicht gebräunten Gesicht wich einem schiefen Lächeln. Dann setzte er sich in Bewegung, überquerte die Straße. Die Mechanik der Jukebox klackte. Musik erfüllte den Raum.
Es klingelte.
Der Gesang fing an.
Hey, there people I’m Bobby...
Natürlich entging ihm die Anspielung nicht, als er, in der Tür stehend, die Musik vernahm. Doch er grinste unwiderstehlich jungenhaft. „Ich freue mich auch, dich zu sehen, Caro.“
Ich schickte einen Seitenblick zu Linda, die breit grinsend Verlegenheit vortäuschte, und stellte sie ihm vor.
„Hi, Maurice. Das ist Linda Naumann. Wir wohnen zusammen. Linda, das ist Maurice Kohn. Ich hab‘ von ihm erzählt.“
„Halloho.“ Sie winkte albern und huschte in die Küche. „Ich mach mal Kaffee.“
Ich hingegen lotste ihn ins Wohnzimmer, wo er sich lässig in einen Sessel fallen ließ. Der Vollautomat lärmte. Maurice sah sich um. „Schick hast du es hier.“
„Yo“, meinte ich lasch. „Erzähl. Was ist draußen los?“
Kurz guckte er zur Decke. „Euer Nachbar Torben Hahn ist mit einem Messer ermordet worden. Wir haben ihn im Garten des leerstehenden Grundstücks zu eurer Rechten gefunden. Frau Wesel hat ihn durch ihr Fenster entdeckt. Ist euch etwas Außergewöhnliches aufgefallen?“
Ich schüttelte mit Linda, die mit einem Tablett hereinkam, auf dem drei Kaffeetassen standen, gleichzeitig den Kopf. Während wir alle unsere Tassen an uns nahmen, erzählten wir ihm von meinem Einkauf. Auch von Jonas Naumann, der Lindas und seine Kinder zum Urlaub abgeholt hatte, und dass wir dann, weil wir beide heute frei hatten, das getan hatten, was für den Tag geplant war: im Garten herumlungern.
„Wir haben nur keine Bikinis mehr an, weil wir hörten, dass draußen etwas los ist.“ Ich zuckte mit dem Daumen Richtung Straße. „Wir gingen davon aus, dass jemand klingeln wird. Ich nehme an, ihr befragt hier jeden.“
„Schade“, lächelte er vage und meinte den Bikini. Ich fühlte meine Ohren heiß werden.
Er räusperte sich. „Wir haben schon mit einer Frau Kunze gesprochen. Mit Frau Wesel reden wir, sobald es möglich ist.“ Er machte eine kleine Pause. „Vielleicht kannst du als Psychologin mit ihr…“
„Eher friert die Hölle zu.“
„Was?“ Er blinzelte.
„Nichts. Nein, ich werde mich nicht dafür hergeben, Frau Wesel eine Plattform fürs Wichtigtun zu geben. Maurice, hör zu!“ Ich beugte mich vor. „Von allen wirst du hören, dass Martina Hahn nicht richtig tickt. Dass sie der Anlass für jeden Streit ist, den der Tote hier von den Zäunen gebrochen hat. Ich erzähl‘ dir mal gleich das Wichtigste. Sie lebt da drüben in der Festung mit ihrem Mann. Mit jedem einzelnen Pflegedienst des Ortes haben die sich schon überworfen. Momentan kommt einer die zwanzig Kilometer aus Bergheim, weil sie alle anderen schon verschlissen haben.“
„Wozu brauchen sie Pflegedienste?“
Störrisch verschränkte ich die Arme vor der Brust. „Frau Hahns Vater lebt da mit ihnen. Denk‘ nicht, er wär‘ besonders alt. Er ist Dachdeckermeister und hatte vor Jahren einen schweren Unfall. Vom Dach gefallen, zack Querschnitt. Halswirbelsäule. So richtig da ist er auch nicht.“
Ich wischte mit der Hand vor meinem Gesicht rum, während ich weiterredete. „Aber ich bezweifle, dass er einen Hirnschaden hat. Ich vermute, dass sie ihn mit Sedativa vollpumpt. Ein vernünftiges Wort kriegt er jedenfalls nicht raus.“
„Das sind schwere Anschuldigungen.“
„Sie ist Gaga. Und ich weiß, dass du drüben geklingelt hast. Sie hat nicht aufgemacht, aber sie ist da.“ Ich lehnte mich zurück, schlug die Beine übereinander.
„Caro, es ist schon schräg, dich so über die Seelenzustände anderer reden zu hören.“ Das Bedauern in seiner Stimme wiederholte den Vorwurf, den er mir während unserer gemeinsamen Arbeit nicht selten gemacht hatte. Dass ich für eine Psychiaterin nicht sehr einfühlsam wäre.
Dabei ist es überhaupt nicht wahr!
Ich bin überaus empathisch. Ich habe eine Menge Leute mit echten Problemen kennengelernt, die die Empathie bekamen. Und meine Hilfe, wenn sie sie haben mochten. Doch wohin ich mit grundsätzlicher Menschenliebe kam, hatte ich ja zuletzt heute früh im Supermarkt gesehen. Wenn ich irgendetwas beschwören sollte, dann das: Wie man in den Wald hineinrief, schallte es nicht hinaus. Ich trällerte in jeden Wald friedlichen Gesang und bekam dauernd ein Fauchen zurück. Doch ich hatte nicht vor, diese alberne Grundsatzdiskussion erneut mit ihm zu führen.
„Aber es ist wahr“, sprang Linda für mich in die Bresche. „Sie ist da. Martina Hahn ist immer zu Hause.“
„Kommen wir mal zu den Streitereien zurück.“ Maurice hob beide Brauen. „Ihr auch?“
Linda kniff sich in die Nase, wie sie es ständig tat, wenn sie nervös war. „Jaha, wir auch.“
„Und?“
„Nichts und. Ich habe zwei Söhne. Neun und zwölf. Beide finden es lustig, ihr am Wochenende die Tageszeitung aus dem Briefkasten zu klauen. Sie holt sie dann immer hier ab.“
„Kein Machtwort gesprochen?“
Nein, dachte ich, selbstverständlich nicht, denn auch wir fanden es lustig. Wir sahen sie immer schon von Weitem durchs Küchenfenster. Wie sie kämpfte und mit sich rang, weil wir sie zwangen, rauszugehen. Und wie sie wieder dieses hochmütig arrogante Gesicht aufsetzte, mit dem sie uns früher zur Weißglut gebracht hatte. Denn das war die eigentliche Krux. Linda und ich kannten sie. Und sie kannte uns.
In meinem Job war ich weit davon entfernt, die Menschen und ihre Taten in Gut und Böse zu unterteilen. Letztlich ist das meiste, was wir tun, denken und fühlen, grau. Und mir war bewusst, wie niederträchtig es sich anhörte, wie ich hier über sie redete. Und doch waren wir nicht die Bösen in dieser Geschichte. Nicht wirklich. Man denke an das Grau.
Innerlich fing ich wieder zu kochen an. Wie stets beim Gedanken an Martina. Ich war sicher, sie hatte ihrem Mann nie erzählt, dass wir uns von früher kannten. Und ich hatte momentan nicht die Absicht, es Maurice Kohn zu erzählen.
„Pfft“, machte Linda. „Jungs.“ Dabei hob sie die Schultern.
„Torben Hahn kam her und sprach ein Machtwort“, erläuterte ich. „Marc, das ist der Zwölfjährige, hat die Tür aufgemacht. Hahn hat dem Jungen eine Backpfeife verpasst, ihn am Ohr gezogen und angebrüllt.“
„Und das war lustig?“
„Lustig?“, echote ich.
„Na ja, weil du so vor dich hinlächelst.“
„Ist dir schon mal aufgefallen, Maurice, dass viele, im ersten Augenblick ärgerliche Momente im Nachhall voller Komik sind? Es war lustig, was danach geschah. Linda ist ausgeflippt.“
Ich sah sie vor mir. Wie sie das Geschirrtuch genommen und krakeelend an die Tür gerast kam. Wie sie damit auf Hahn eingedroschen hatte, als wäre er eine Wespe, derweil sie ihm mit drastischen Worten erklärt hatte, dass niemand, NIEMAND ihre Kinder anzufassen und erst recht nicht zu schlagen hätte.
Ich linste verstohlen zu Maurice, der nachdenklich auf der Unterlippe kaute. Draußen werkelten die Techniker. Ein Auto wurde angelassen und brauste davon.
„Was lässt euch glauben, dass sie zu Hause ist?“, fragte er.
Ja, was? Weil das ihre Art war? Niemals auch nur mit irgendjemanden zu reden, der nicht zur Familie gehörte? Sich abzuschotten, aber nicht verängstigt, sondern mit der Arroganz derjenigen, die überzeugt waren, jeder andere Mensch wäre weit unterhalb ihrer Würde?
„Sie wissen“, warf Linda ihre Stimme in den Raum, „dass ich Neurologin bin?“
„Ist das so?“
„Ja, bin ich. Was Martina Hahn angeht: Ich bin schon Leuten mit Frontalhirnsyndrom begegnet, die normaler sind. Denken Sie daran, wenn Sie sie kennenlernen.“
*
Ich weiß nicht, warum ich darauf bestand, mitzugehen. Ich schätze, ich wollte beobachten, wie sie auf die Nachricht reagierte, dass ihr Mann umgebracht worden war. Maurice konnte sich nicht vorstellen, dass sie zu Hause war, weil jede andere Frau durchs Fenster gesehen hätte, was vor der Tür passierte, und rausgerannt gekommen wäre.
Weinend. Entsetzt. Verzweifelt. Das waren gängige Reaktionen. Ihr Ausbleiben hieß für ihn, dass sie nicht da war. Er versuchte nicht, mich abzuschütteln, als ich energisch die Straße kreuzte und auf das Haus zusteuerte.
Mannshohe Palisaden umstellten das rote zweistöckige Backsteinhaus. Die Rollos zur Straßenseite waren runtergelassen. Allein durch einen handbreiten Schlitz lechzten die Zimmerpflanzen nach jedem bisschen Licht.
„Pass auf.“ Ich hob eine Hand zu Maurice, die so viel sagen wollte, wie du wirst ja sehen. Abwartend stand er neben mir auf der Rampe zur Haustür. Ich klingelte.
Wartete.
Nichts geschah.
Ich klingelte erneut.
Es war nichts zu hören, sah man von dem schrillen Klingelton ab, der bis nach draußen dröhnte. Ich wiederholte den Versuch. Während wir warteten, sagte Maurice: „Ich habe mich gefragt, ob wir mal gemeinsam essen gehen sollten.“
Ärger kroch in mir hoch. Ich musterte ihn von oben bis unten, rupfte seine in die Hosentasche versenkte rechte Hand heraus und ignorierte dabei, wie es in meinem ganzen Leib kribbelte, nur weil ich seine Haut berührte. Seinen Ehering wollte ich ihm vor die Linse halten, aber als ich die Hand draußen hatte, glotzte ich verdutzt auf seinen Ringfinger. Kein Ring. Ich blinzelte. So was konnte man abziehen.
Er zog eine Grimasse „Es hat nicht mehr geklappt.“ Er klingelte wieder.
„Seit wann?“ Mein Herz, mein armes Herz pochte schneller.
„Eigentlich seit Jahren schon. Aber getrennt haben wir uns vor vier Monaten.“
„Ah“, täuschte ich Desinteresse vor.
Von drinnen näherten sich endlich Schritte. In mir überschlugen sich die Gedanken mit den Gefühlen. Es hatte ja noch mehr Ursachen für Missstimmungen zwischen uns gegeben als die Existenz einer Ehefrau.
Trotzdem hauchte ich wie eine arme Irre: „Ja. Ich würde gern mit dir essen gehen.“
Die Schritte im Haus verhielten. Wir lauschten der Abfolge vierer Verriegelungsmechanismen, die zur Seite geschoben wurden. Ich kannte das ja, genoss aber die Skepsis in Maurice Zügen. Die Tür öffnete Martina nur einen Spalt weit, sodass ich mich nicht verstecken musste. Da wo ich stand, konnte sie mich nicht sehen.
„Frau Hahn“, hörte ich Maurice wohltuende Stimme. „Mein Name ist Kohn von der Polizei. Können wir uns einen Augenblick unterhalten?“
Auffällig war das Ausbleiben irgendeiner Regung, und wäre es nur Überraschung. Man bekam nicht alle Tage Besuch von der Polizei. Mich erstaunte es nicht, dass sie seinen Ausweis an sich nahm und ihn eingehend studierte, um dessen Echtheit zu überprüfen. Nach meiner Einschätzung war die Frau hochgradig paranoid. Meine Patientin war sie nie gewesen. Ich wäre getürmt, wenn sie versucht hätte, zu mir zu kommen, doch die Gefahr lag bei null. Sie hielt sich für grundlegend normal. Psychisch gesund. Und jeden anderen hielt sie für einen unterbelichteten Schwachkopf.
„Nein“, entschied sie störrisch und gab Maurice den Ausweis wieder zurück. Beim Anblick seiner verblüfften Miene drängte ich das Lachen nieder.
„Das war keine Bitte“, entgegnete er scharf.
„Was wollen Sie denn?“
Wie ungehalten sie klang. Als wäre es eine Unverschämtheit, dass die Polizei wegen der Ermordung ihres Mannes mit ihr reden wollte. Die Existenz der Menschheit war eine Zumutung für sie.
„Können wir drinnen darüber sprechen?“ Maurice zuckte mit dem Kopf zur Tür und schickte mir einen raschen Blick, mit dem er mir befahl, dass ich draußen zu warten hätte. Ich lächelte in mich hinein, wissend, dass es so weit nicht käme. Auch ihn würde sie nie hineinlassen.
„Über was denn?“ Martina wich nicht einen Schritt zur Seite, vergrößerte den Türspalt nicht einen Zentimeter.
„Ihr Mann ist eben tot aufgefunden worden, Frau Hahn.“ Gewaltiger Ärger schwang in seiner Stimme mit. „Er wurde mit zahlreichen Messerstichen getötet. Darüber würde ich gern mit Ihnen reden.“
„Das ist natürlich ärgerlich“, hörten wir sie sagen. Ich ging fast in die Knie, so versuchte ich, das Lachen zurückzudrängen. Sein Gesichtsausdruck war zum Schießen. Ich ging jede Wette ein, dass er so was noch nie erlebt hatte. Ich habe das gewusst. Ich habe es genauso kommen sehen.
„Ich verstehe, dass das ein Schock für Sie ist“, versuchte er es. „Aber …“
„Schock? Das ist kein Schock. Das ist Mist. Er sollte heute meinen Vater von der Tagespflege abholen.“
Ich wusste genau, wie sie jetzt guckte. Von oben herab, und doch würde ihr Gesicht Nachdenken und Verwerfen spiegeln. Ich kannte sie so gut.
„Vielleicht“, bat Maurice warmherzig, „reden wir doch drinnen darüber. Wenn Sie möchten, kann ich eine Psychologin herbeiholen. Aber lassen Sie uns hineingehen.“
Ich unterdrückte den Drang, ihm auf den Fuß zu treten. Einen Psychologen vorzuschlagen, war das Dümmste, das man bei jemandem wie Martina tun durfte. Seelenklempner waren für sie wie versponnene Esoteriker. Das hatte rein gar nichts mit mir zu tun. So war es immer schon gewesen. Ich wunderte mich nicht, dass sie es weit von sich wies. Mit wenigen Worten.
„Nein“, beharrte sie. „Wenn Torben tot ist, habe ich keine Zeit für so einen Unsinn. Ich muss mich jetzt allein um einen Haufen Dinge kümmern. Bitte gehen Sie jetzt.“
Sie knallte die Tür zu.
Wir lauschten der viermaligen Verriegelung.
„Ich hab’s dir gesagt.“ Entschuldigend und doch grinsend breitete ich beide Hände zur Seite aus.
Wie ratlos er aussah. Diese Haltung machte ihn schärfer als jede Machopose. Wir verabschiedeten uns, nachdem wir ein Essen verabredet hatten, und dann flitzte ich zurück in mein Haus. Linda, die dicken Haare lose hochgetürmt und mit Schweißperlen auf der Stirn, begrüßte mich mit einem Glas Wasser zur Erfrischung und den Ergebnissen ihrer Überlegungen.
„Ich habe mir gedacht, Caro, dass wir es ihm besser sagen. Dass wir sie von früher kennen.“
Ich rollte mir das vor Kälte beschlagene Glas über die Stirn. „Wir gehen morgen Abend zusammen essen.“
Ihre Mundwinkel hoben sich zu einem strahlenden Lachen. „Und seine Frau?“
„Scheint Ex zu werden.“ Wie ein Sack fiel ich aufs Sofa. „Ich werde es ihm sagen. Doof, dass wir die Leiche weggerollt haben. Wenn ich gewusst hätte, dass er es ist, der hier ermittelt, hätten wir alles so lassen können, wie es war.“
Sie prustete resigniert. „Ist nicht mehr zu ändern. Aber ehrlich, Caro, ich frage mich, wer diese Nullnummer umgenietet hat.“
„Das werde ich herausfinden.“
*
In der Nacht lag ich wach und grübelte. Am frühen Nachmittag war Maurice wieder auf der Straße aufgetaucht, ohne dass er sich bei mir gemeldet hätte. Ich hatte ihn mit der Kollegin gesehen, die mich an ein weiteres Problem zwischen uns erinnert hatte. Sie hatte die Nachbarn befragt, war nicht mit ihm in Martinas Haus gegangen. Dass Martina ihn schließlich doch reingelassen hatte, grenzte an ein Wunder. Mein Verstand nahm an, er hatte ihr mit der Verschleppung ins Präsidium bedroht. Mir kam jetzt erst in den Sinn, dass sie tatverdächtig war, aber mein Herz schlug Salti wegen dieser Kollegin. Auch mit ihr hatte er damals was am Laufen gehabt. Warum hatte ich mich so bereitwillig zum Essen einladen lassen?
Der nächste Zickzack meiner Hirnwindungen endete wieder bei Martina als potenzieller Mörderin. Ich probierte vergeblich, den Gedanken aufzuhalten, denn mit einem Mal war sie da. Die Angst.
Es war eine Sache, der Ermordung eines Menschen, mit dem man nur Ärger in Verbindung brachte, relativ gleichgültig gegenüberzustehen. Eine andere, zu kapieren, dass der Mord genau vor der eigenen Haustür geschehen war. Und dann so brutal. Mich tröstete wenig, dass die Tat nach einer ganzen Menge freigesetzter negativer Emotionen aussah. Sie wirkte wie eine sogenannte Tat aus Leidenschaft. Ein Totschlag, weniger ein Mord, der Planung und Vorsatz voraussetzte. Das wiederum machte uns verdächtig. Ich wusste, dass wir es nicht gewesen waren. Aber die anderen? Und was tat der Mörder jetzt?
War sie es gewesen?
Wenn ja, warum?
Und waren wir die nächsten Opfer?
Aus Martinas Sicht gab es eine Reihe Motive, uns loszuwerden.
Ich wälzte mich im Bett von einer Seite auf die andere, setzte mich auf und lauschte dem Summen der Klimaanlage. Nichts, womit ich mich abmühte, genügte. Warf ich die Decke vom Körper, fror ich. Kuschelte ich mich ins Federbett, schwitzte ich. Lindas tappende Schritte näherten sich. Ich setzte mich auf und knipste die Nachttischlampe an. In einem blauen Trägertop und im Slip stand sie im Rahmen.
„Ich kann nicht schlafen“, sagte sie erschöpft. „Ich muss immer daran denken, dass da draußen ein Mörder herumläuft.“
„Ich auch“, räumte ich ein. „Aber das ist total bescheuert.“
Sie strich sich die langen Haarsträhnen aus dem Gesicht, die sich aus ihrem dicken Zopf gelöst hatten, und kam näher. „Ich bin so froh, dass die Kinder nicht da sind.“ Sie setzte sich aufs Bett. „Ich versteh‘ nicht, warum das erst jetzt passiert. Das mit der Angst. Warum haben wir nicht eine Sekunde vorher daran gedacht, wer den Schwachkopf umgenietet hat?“
„Wir hatten einen Schock. Wir haben ohnehin eine Menge Unsinn gemacht.“
„Ich konnte nur daran denken, dass er Marc geschlagen hat. Und dass ich ausgeflippt bin. Und dass ich Angst hatte, jemand würde glauben, ich hätte ihn umgebracht.“
„Ging mir ja auch so.“ Ich griff ihre Hand, hielt sie sanft. „Wer ihn umgebracht hat, überlege ich erst seit ich hier liege und vergeblich versuche, zu schlafen.“
Linda entzog mir ihre Hand und krabbelte neben mich unter die Decke. „Meinst du, hier läuft ein Irrer rum?“
„Ich weiß, dass hier seit Jahren eine Irre rumläuft.“
Sie lachte. Möglichst ohne Linda zu stören, angelte ich nach dem Sprudel neben dem Bett und schraubte die Flasche auf.
„Eine Irre, die uns hasst und der wir eine Menge Gelegenheiten gaben, den Hass zu potenzieren.“ Ich nahm einen langen Schluck und reichte Linda die Flasche. „Aber sie hat uns nicht umgebracht.“
„Meinst du wirklich, sie hasst uns?“
Vage schüttelte ich den Kopf. „Ich glaube nicht. Sie ist sauer, dass sie unwissentlich in unsere Nähe gezogen ist. Solange sie uns aber nicht sieht, kann sie vergessen, dass es uns gibt. Das war ja immer ihre Hauptintention.“
„Glaubst du, sie hat ihren Mann umgebracht?“ Lindas Stimme vibrierte vor Furcht.
„Nein. Das passt nicht zu ihr. Er verdiente das Geld und sprang, wenn sie pfiff. Der hörige Sklave, den sie braucht.“
„Aber, Caro!“, rief sie verzweifelt. „Wenn es nicht Martina war, wer war es dann? Wenn sie es nicht war, dann ist es vielleicht doch ein Verrückter, der hier wahllos Leute absticht!“
Ich rieb mir die Augen. „Das glaube ich nicht, Maus. Ich glaube, was passiert ist, hat mit Martina zu tun.“
Ich legte den Arm um sie, und sie kuschelte sich an meine Schulter. „Ich male mir immer aus“, nuschelte sie, „was wäre, wenn ich runter ginge und da stünde plötzlich ein Typ mit einem Messer.“
„Mach das nicht“, wisperte ich in ihr Haar. „Es hat mit ihr zu tun. Morgen Abend treffe ich Maurice. Vielleicht kriege ich dann schon was raus.“
„Okay.“ Sie klang schläfrig, drehte sich von mir weg, doch entschlossen, in meinem Bett zu schlafen.
So vernünftig Linda als Neurowissenschaftlerin war, so ängstlich war sie im Alltag. Sie machte sich tausenderlei Gedanken über potenziell krebserregende Bestandteile irgendwelcher Lebensmittel. Sie neigte zu Gedankenschleifen und Was-wäre-wenn- Konstellationen. Vermutlich wurde man so, wenn man Kinder hatte. Ich war froh, keine zu haben. Hätte ich Kinder, müsste ich mich am Ende selbst therapieren.
*
„Ich habe dann den Blutdrucksenker abgesetzt.“
Äh, was?