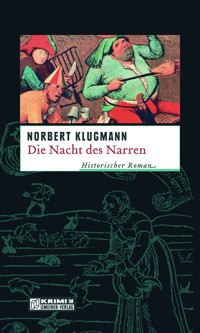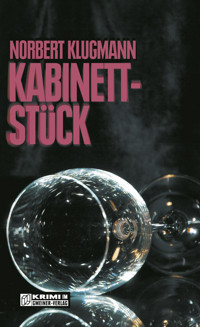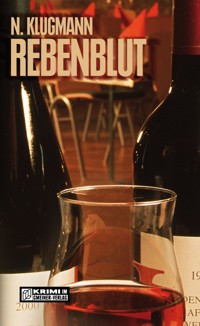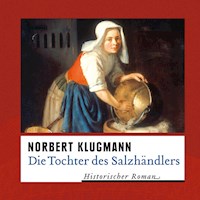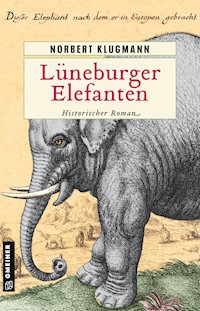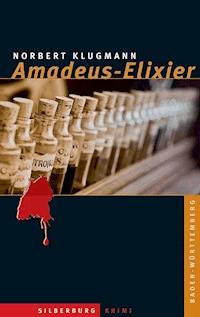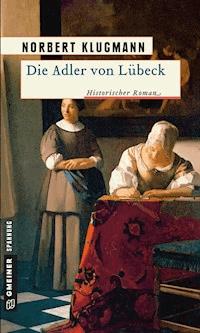
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Trine Deichmann
- Sprache: Deutsch
Lübeck 1602. Nach dem mysteriösen Tod des ebenso erfolgreichen wie gehassten Reeders und Werftbesitzers Rosländer rätselt die Stadt, was mit seinem Unternehmen passieren wird. Doch statt die Werft zu verkaufen, plant die Witwe Anna, ein Schiff zu bauen, wie es Lübeck, die Hanse und der Raum um das Baltische Meer noch nicht gesehen haben. Das Schiff soll sogar noch größer werden als die legendäre „Adler von Lübeck“. Die Lübecker Kaufleute sind empört, sprechen von Größenwahn und fürchten um ihre Geschäfte. Nur die Hebamme Trine Deichmann und ihre Freundinnen stehen auf Annas Seite. Ihre Hilfe kommt zur rechten Zeit, denn auf der Rosländer-Werft geschehen merkwürdige Dinge …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 456
Veröffentlichungsjahr: 2009
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Norbert Klugmann
Die Adler von Lübeck
Besuchen Sie uns imInternet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2009 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried5, 88605Meßkirch
Telefon 07575/2095-0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendungdes Bildes »Schreibende Frau mit Dienstbotin«
von Jan Vermeer van
1
Der Sand reichte bis zum Horizont. Er war extrem fein. Wenn man ihn packte, fühlte er sich an wie Mehl. Bei jedem Schritt sanken die Füße bis über den Knöchel ein. Nach 20Schritten wurde die Fortbewegung zu harter Arbeit, 100Schritte später tat jeder Schritt weh. Noch schlimmer dran waren die Männer, die Lasten trugen, Kisten oder Fässer. Sie hatten sich Untersätze zurechtgezimmert, auf denen sie die schweren und sperrigen Gegenstände stapelten. Die Schlitten sanken tief ein, man brauchte zwei Männer, besser waren vier, um sie aus dem Sand zu ziehen, um sie einige Schritte zu bewegen, bevor die Träger die Kraft verließ.
Wenn der Hunger kam und sie eine Rast einlegten, waren sie kaum mehr als 500 Schritte vorangekommen. Der Kapitän ging von Mann zu Mann und sprach jedem gut zu. Mit gesenktem Kopf hockten sie im Sand, langsam bewegten sich die Kiefer, manchmal spuckten sie aus, der Sand war überall.
Wenn der Kapitän seine Runde beendet hatte, brauchte er selbst Trost und Zuspruch. Dann schleppte er sich zu dem Mann mit dem Federschmuck. Ein Kapitän suchte keinen Trost außer bei einer Flasche Rum oder einem Fässchen mit rotem Wein. Bestenfalls durfte ihn die Hure trösten, oder der schmächtige Schiffsjunge mit der Gestalt eines Mädchens konnte zeigen, dass er zu mehr imstande war, als Schüsseln fallen zu lassen und Essen zu versalzen. Aber in keinem Fall ließ ein Kapitän erkennen, dass er überfordert war. Ein einziger Moment der Schwäche und niemand würde ihn mehr ernst nehmen.
Nur bei dem Mann mit dem Federschmuck galt das nicht. Wer sich ihm anvertraute, vergab sich nichts. Der mit der Feder stand so himmelhoch über allen anderen, dass die Regeln, die für alle galten, auf ihn nicht zutrafen. Der Mann mit dem Federschmuck strahlte etwas aus, was man außerhalb von Schlössern, Gotteshäusern und Gelehrtenstuben nicht antraf. Er war kein Hexenmeister und kannte sich doch aus in Eingeweiden, Kräutern und dem Stand der Gestirne; war kein General, kein Beichtvater, keine Hebamme, kein weiser Greis und kein Staatsmann, der Frieden zwischen den Völkern stiftete. Er war ein Teil von allem und jedem. Er strafte nicht, verbot nicht, drohte nicht und folterte nicht. Für ihn war ein Mann immer ein Mann, auch wenn er vor Angst weinte und sich vor Verzweiflung in die Hosen schiss. Er hatte Arme amputiert, wenn der Barbier geflohen war, hatte Kindermördern den Kopf vom Hals getrennt und die Wette gegen den stärksten Mann des Landes gewonnen, als er 14 Morgen Land umgegraben hatte, ohne einmal abzusetzen. Er hatte Frauen Geld gegeben, damit sie ihren Kindern Milch kaufen konnten, und Jünglingen Geld für die Kutschfahrt nach Prag, wo sie sich ein Studium leisten konnten, weil er sie auch dafür ausgestattet hatte.
Der Mann mit dem Federschmuck hatte Branntwein-Gelage überstanden, nach denen zwei Männer nicht mehr aufgewacht und andere erblindet waren, er hatte im Lauf einer Orgie acht Kinder gezeugt, von denen fünf noch lebten, hatte mit einem wütenden Keiler gerungen, mit nacktem Oberkörper und ohne Waffe. Er hatte ein Bootsrennen gegen den besten Skipper des Nordens gewonnen und er hatte den gusseisernen Topf in der Fluchbüchse leer gegessen, obwohl ihn das fast das Leben gekostet hatte und er ohne die Kenntnisse der Hebamme Trine Deichmann an durchgebrochenem Magen gestorben wäre. Er hatte sich mit so vielen Männern geprügelt, dass niemand die genaue Zahl kannte, und dabei nicht mehr als vier Zähne und den kleinen Finger der linken Hand eingebüßt. Er hatte im Dom die Predigt zur Walpurgisnacht gehalten–nachts um zwei vor allen Saufkumpanen, die er im Lauf der Nacht um sich gesammelt hatte. Wie überhaupt seine Zechgelage Tagesgespräch gewesen waren–nicht zuletzt, weil seine Frau an ihnen teilgenommen hatte, worauf er stolz war.
Mit einem Seufzer ließ der Kapitän seinen Kopf gegen die Schulter des Mannes mit dem Federschmuck sinken. Eine Hand klopfte beruhigend auf den Rücken des Kapitäns.
»Wir schaffen das«, sagte der Mann, dem alle vertrauten. »Wir dürfen nicht ungeduldig werden.«
»Aber der Sand, der viele Sand…«
»Du glaubst, weil du nur Sand siehst, gibt es nur Sand. Aber es gibt eine Welt hinter dem Sand. Dorthin müssen wir gelangen, dort warten sie auf unsere Waren.«
»Habt Ihr nicht manchmal das Gefühl, dass wir schon jahrelang im Sand unterwegs sind?«
Der Mann mit dem Federschmuck lächelte. Sein Blick ging zum Himmel, wo es nicht gut aussah. Bald würden es die Männer merken. Bis dahin mussten sie Vorbereitungen treffen.
Als der Wind stärker wurde, war der Wall aufgebaut. Sie hatten sich in Tücher und Decken eingewickelt, die nur einen Schlitz für die Augen ließen. Und bald nicht einmal den, denn gegen den Sand gab es kein Mittel. Man musste hinter dem Stoff atmen, und unter dem Stoff schlugen ängstliche Herzen.
Jeder Mann kannte Stürme, für keinen war es das erste Mal. Aber mancher Sturm war schwach und wollte nicht auf Touren kommen. Mancher Sturm tobte, als wolle er Löcher in den Himmel reißen und jeden verschlingen, in dessen Adern warmes Blut floss. Ein Heulen, das so klang, als würde der Sand brüllen, füllte die Ohren der Männer. In wenigen Minuten waren sie zugeweht, bedeckt von Sand, der in Mengen heranraste, als würden 1.000Männer ihn in den Wall schütten. Sie lagen dort, wo der Mann mit dem Federschmuck lag. Die Zier für seinen kahlen Kopf trug er nicht mehr, zusammengerollt ruhte der Lederreif in einer Kiste. Eben war noch Tag gewesen, jetzt war alles düster und diffus, ein grünlich-braunes Leberwurstgrau hatte alle Farben verschluckt. In den Ohren war das Heulen, die Luft war gesättigt mit Sand, das Atmen ging flach und fiel immer schwerer. Wie Kinder vor der Geburt im Leib der Mutter lagen die Männer zusammengekrümmt im Schutz der Kisten. Im Zentrum ihres Kreises lag der Mann, dessen Nähe sie suchten. Er war nicht weniger von Sand bedeckt als alle anderen, dennoch suchten alle seine Nähe. Der Sandsturm heulte. Es gab nur noch dieses Geräusch: laut, wütend und durch das Gleichmaß besonders furchtbar. Es gab keine Hoffnung mehr, kein Auf und Ab, es gab nur noch das Heulen und den Sand.
2
Lange stand AnnaRosländeram Fenster, die Decke hielt sie vor der Brust zusammen. Langsam beruhigten sich ihr Atem und der Schlag des traurigen Herzens. Jede Nacht kämpfte sie mit der Erinnerung und erwachte jedes Mal keuchend, verschwitzt, voller Angst. Keine Aussicht, danach wieder Schlaf zu finden. In den ersten Nächten hatte sie dagegen gekämpft, mit jeder Minute Schlaflosigkeit war die Verzweiflung gewachsen. Den Fehler beging sie nicht mehr, weil sie einen Weg gefunden hatte, um die Zeit abzukürzen. Sie ging in die Küche hinunter, behutsam setzte sie Schritt auf Schritt, denn die Haushälterin schätzte es nicht, wenn man ihre Arbeit erledigte. Die treue Dienerseele meinte es gut, aber manchmal war es doch eine rechte Last mit ihr, denn sie vertrug keinen Widerspruch und regte sich schnell auf. Anna Rosländer stand vor dem eisernen Herd und rieb die klammen Hände über der Platte. Ihre Hände wollten einfach nicht mehr warm werden. Seit dem Verlust hatte sich vieles geändert. Anna Rosländer war keine alte Frau, mit 48 Jahren zog man nicht ins Witwenstift. Nichts von dem, was sie zurzeit bedrückte, hatte mit ihrem Alter zu tun. Dennoch wünschte sie sich manchmal 15 Jahre zurück, vieles wäre leichter gefallen. Junge Frauen waren oberflächlich. So lästig das manchmal im Umgang mit ihnen fiel, so sehr hätte es ihr jetzt geholfen. Sie sehnte sich nach den zierlichen Sorgen der Jungen: wenn die Kinder ihre Krankheiten bekamen, wenn der Hauslehrer sich als taube Nuss erwies und der Musiklehrer zu viel redete und zu wenig musizierte, wenn die kunstfertigen Tischler endlich mit dem Treppenhaus zurande kamen und die neue Bernsteinkette aus Danzig ihr herrliches Spiel der braunen und gelben Töne zeigte–nichtsnutzige Anlässe, nach denen sich Anna Rosländer sehnte.
Neugierig öffnete sie die Deckel der beiden Stieltöpfe. Wasser und Brühe. Einen Moment erwog sie, das Wasser mit Rum und Zucker in einen hilfreichen Rum zu verwandeln, und entschied sich dann für Brühe. Der Rum reichte nur bis in den Magen, die Brühe erreichte die entlegensten Verzweigungen des Menschen.
Plötzlich war da das Geräusch: ein dumpfer Knall, in der stillen Nacht doppelt überraschend. Zwei Minuten später stand sie vor der Tür, in jeder Hand einen Becher.
»Querner, Querner«, sagte sie leise, fast zärtlich. Sie stellte einen Becher ab und fuhr durch den Haarschopf. Der schlafende Mann brummte, zog Spucke hoch, schluckte, erwachte und fuhr in die Höhe. Der Becher mit der Brühe schwankte, aber er fiel nicht um.
»Um Gottes willen, die Herrin«, stieß er hervor. Seine Stimme war brüchig, wie sie sich nach dem Erwachen anhört.
Sie standen sich gegenüber, beschämt der eine, sich ihrer unzulänglichen Bekleidung bewusst die andere. Valentin Querner fuhr sich mit beiden Händen durch die Haare und sah gleich viel manierlicher aus. Der Schreck in den Augen blieb.
»Das ist mir ja so unangenehm«, murmelte er. »Das ist mir noch nie passiert. Na gut, selten.«
»Ihr müsst Euch nicht entschuldigen. Warum seid Ihr überhaupt noch hier? Ihr gehört nach Hause um diese Zeit.«
Er verzichtete darauf, sie an das zu erinnern, was ihr wohl bekannt war. Auf Valentin Querner wartete niemand, keine Frau, keine Eltern, kein Kind. Er lebte in der Mansarde in einem der schlechten Häuser an der Trave. Der Raum war zugig, niedrig, düster. Unfassbar, dass ein dermaßen begabter Arbeiter in solchen Verhältnissen hauste.
Anna war einmal dort gewesen, als ihm in der Werft der Großmast beinahe das Bein zerschmettert hatte. Sie hatte darauf bestanden, dass Querner in ein Krankenhaus ging. Aber der Kerl war so stur, wie er begabt war. Dreimal täglich war das Hausmädchen die Treppen hinaufgestiegen. Als sie sich weigerte, weil ihr Geruch und Schmutz angeblich auf die Galle schlugen, schickte man den Knecht, und einmal ging Anna persönlich. Nie würde sie das entgeisterte Gesicht des Patienten vergessen, als plötzlich eine vornehme Person bei ihm auftauchte. Anna Rosländer hatte sich den jungen Kerl zur Brust genommen, dass ihm Hören und Sehen vergangen waren. Sie hatte ihn ausgeschimpft wie einen Schüler und ihn aufgefordert, nie mehr so leichtfertig mit seiner Gesundheit umzugehen. Danach hatten sie nie wieder darüber gesprochen, aber ihr Verhältnis war seitdem auf eine Weise privat geworden, dass es manch Drittem aufgefallen war.
Sie wusste nicht, ob Querner sich seitdem besser ernährte und Rücksicht auf sich nahm. Besser gekleidet war er keineswegs. Er sah so aus, als würde er gerade aus der Werkstatt kommen oder gleich dorthin gehen. Dabei verbrachte er einen immer größeren Teil seiner Zeit im Kontor. Immer wieder fragten auswärtige Werften an, ob der gefragte Techniker bereit sei, für sie zu arbeiten. Zuerst hatte Querner abgesagt, wie es sich gehört, wenn man auf der Lohnliste eines Reeders und Werftbesitzers steht. Doch Rosländer war mit so vielen Kollegen per du und intim, dass er seinem besten Mann praktisch befohlen hatte, sich nicht zu zieren. So kam es, dass Querner für Werften in Wismar, Rostock und Stralsund aktiv geworden war. Morgens um halb sieben erschien er am Arbeitsplatz, und wenn der letzte Kollege abends nach Hause ging, legte Querner die Papiere für den Holk zur Seite und widmete sich einer Galeone–wenn er nicht seiner Leidenschaft frönte, von allen bekannten Schiffstypen das Beste zu nehmen, das Alltägliche zu ignorieren, um auf diese Weise Schiffstypen zu entwerfen, die das Baltische Meer noch nicht gesehen hatte.
»Mann Gottes, was ist denn das für ein Riese?«, fragte Anna Rosländer und beugte sich über die Zeichnung.
»Ach, das ist gar nichts«, antwortete Querner und rollte den heißen Becher mit Brühe zwischen den Handflächen hin und her.
»Dafür, dass es nichts ist, kommt es mir aber ziemlich groß vor.«
»Man sitzt abends lange im Kontor. Man beginnt zu träumen. Man beginnt zu zeichnen. Eins kommt zum anderen. Am Ende ist das Schiff da. Danach wendet man sich wieder den vernünftigen Dingen zu.«
Anna Rosländer hatte das Entwerfen nicht gelernt. Aber sie lebte lange genug in diesem Metier, um die wesentlichen Eigenschaften des Schiffs zu erkennen, das auf Querners Papieren stand. Und noch etwas erkannte sie: Es handelte sich nicht um eine Skizze, nebenbei hingeworfen, wie man Gesichter oder Blumen malt, während man sich mit einem Kollegen unterhält. »Querner, das sind 90 Meter. Was denkt Ihr Euch dabei?«
»Gar nichts. Wie gesagt, rein gar nichts.«
»Und dass es 3.500Tonnen Wasser verdrängt und fünf Masten hat, das sagt wohl auch nichts?«
Er war eingeschüchtert. Vielleicht fand er, dass sie zu aufgeregt und ablehnend redete. Aber so war es nicht. Sie war einfach überrascht. Als sie nach einer halben Stunde in die Küche hinuntergingen, um neue Brühe zu holen und einen Blick in die Speisekammer zu werfen, waren sie mitten im Gespräch. Anna Rosländer trug mittlerweile einen rotschwarzen Hausmantel. Als Rosalia, das Hausmädchen, von den huschenden Geräuschen erwachte, traf sie in der Küche auf zwei Menschen, die sich angeregt über einen Plan beugten, den Rosalia zuerst für den Wochenplan hielt. Sie protestierte sofort, weil sie immer bereit war, vermeintliche Einmischungen in ihren Bereich zurückzuweisen.
Fünf Minuten später saßen sie zu dritt am Tisch, vertilgten Sülze mit Mostrich und Brot mit Pflaumenmus. Während Querner mit dem Messer Großsegel, Fock und Blinde nachfuhr und sie ins Verhältnis zur üblichen Breite der Segelbahn setzte, entging Anna Rosländer nicht, wie liebevoll Rosalia den jungen Mann betrachtete–und keineswegs den Plan des Schiffs. Das wäre doch was, dachte Anna, du würdest regelmäßig etwas zu essen bekommen, du hättest Knöpfe an den Stellen, wo sie hingehören, und sie würde dir auch zeigen, wie die Liebe geht.
3
Es war dochnoch ein Tagmit Stapellaufwetter geworden. Die Wimpel knatterten im kräftigen Wind, der vom Meer kam. Und als Diederich, die treue Seele, mit einem dieser mächtigen Hiebe, mit denen er in jungen Jahren Walfische erlegt hatte, den letzten Keil wegschlug, fand der Neubau gemächlich seinen Weg über die schiefe Ebene ins Wasser der Trave. Es gab ordentlich Wellengang, von dem sich die Möwen hoch hinauf und tief hinuntertragen ließen, wobei sie die Menschenansammlung am Ufer nicht aus dem Auge ließen, denn früher oder später würden Reste ins Wasser fliegen, dann würden die grauweißen Schreihälse zur Stelle sein.
Der kleine Holk war der letzte einer Reihe von drei Schiffen, die hinauf ins Dänische gehen würden. Der Stapellauf war kein Ereignis, über das man noch in einem Jahr erzählen würde. Aber auch kleine Aufträge machten die Werftbetreiber fett. Der Holk würde im Spanien- und Portugalhandel fahren: Lebensmittel für die Südländer, Salz, Öl und Südfrüchte für die Fischmäuler. Kein Grund für eine ausufernde Feier. So fanden sich an der Tafel im Schatten des Lagerhauses nicht mehr als 20 Gäste ein und ließen es sich gut gehen. Anna Rosländer, Witwe des umstrittenen Reeders und Werftbesitzers, saß auf dem Ehrenplatz an der Stirnseite.
»Sie sieht wieder besser aus«, murmelte Schnabel, seines Zeichens Reeder und Werftbesitzer.
»Wurde ja auch Zeit«, murmelte Ratsherr Gleiwitz, dessen Vorliebe für unbezahlte Rechnungen und Gurken im Fass nur von seiner Abneigung gegen nachvollziehbare Buchführung übertroffen wurde. »Du kannst ja nicht zwei Jahre um deinen Mann trauern–zumal wenn er dir jahrelang Hörner aufgesetzt hat.«
Theodor Horn war nicht zum Lästern aufgelegt. Der hiesige Reeder hatte neben seiner Gattin einen Gast an der Seite, einen Mann in weinrotem Anzug. Er war rundlich, besaß flinke Augen und eine Stirnglatze, dennoch wirkte er keineswegs harmlos, er strahlte eine Zielstrebigkeit aus, der man sich besser nicht in den Weg stellte.
Anna Rosländer kannte den Rundlichen, ließ das aber nicht erkennen. Zweimal wurde ein Platz frei, zweimal rückten die Eheleute Horn und der Gast einen Platz auf die Stirnseite zu, bis der Reeder Annas direkter Nachbar war. Er verlor keine Zeit, als er eine Hand auf ihre Hand legte und mit tiefer Stimme sagte: »An einem Tag wie diesem denken wir alle an den guten Gatten. Ich hoffe, ich reiße keine Wunden auf.«
Anna hielt seinem Blick stand und erwiderte: »Ohne Rosländer säßen wir alle nicht hier.«
»Ich glaube, wenn Theodor stirbt, sterbe ich auch«, quakte Theodors bessere Hälfte dazwischen. Ihr Talent, im richtigen Moment das falsche Wort zu finden, wurde nur von ihrer Angewohnheit übertroffen, in geselligen Runden zu vorgerückter Stunde heikle Anekdoten von bekannten Lübecker Persönlichkeiten zu erzählen, für die sie die Namen um eine Kleinigkeit veränderte, um sodann mit dem guten Gefühl in die Vollen zu gehen, dass die Würde der Bloßgestellten hinreichend gewahrt worden sei. Aus Mannhardt wurde Frauhardt, Düppel führte den Namen Knüppel und Knechtersand hieß Rechterhand.
»Ich sterbe noch nicht«, stellte Horn klar und stellte endlich seinen Gast vor. Stanjek, Andreas Stanjek aus Riga, seines Zeichens Kaufmann mit besten Beziehungen zum russischen Zaren und einer Unmenge lokaler Machthaber, die in Lübeck niemand auch nur dem Namen nach kannte.
Anna lächelte nicht, aber der Blick, den sie Stanjek zuwarf, war offen. Sie dachte: Jetzt geht es los.
Bevor es losging, steckte ihre Nase in einem Blumenstrauß. Erst verdutzt, danach niesend, starrte sie in lachende Gesichter, von denen eins direkt vor ihr stand, das andere zwei Schritte dahinter. Anna Rosländer umarmte ihre Freundin Hedwig Wittmer, die Ehefrau des Brauereibesitzers. Danach begrüßte sie Hedwigs Begleiterin.
»Ich freue mich sehr«, sagte Anna Rosländer. »Es ist nicht so, dass ich von unfreundlichen Gesichtern umgeben wäre. Aber wenn Ihr dabei seid, habe ich das Gefühl, es gehört sich so.«
»Ich musste sie am Strick hinter mir herziehen«, rief Hedwig, die gerade dabei war, die Handkuss-Technik der Lübecker Männer über sich ergehen zu lassen.
Trine Deichmann sagte: »Wenn ich nicht in der Nähe gewesen wäre…« Sie spürte, wie missverständlich sie sich äußerte, und fügte schnell hinzu: »Ihr wisst, wie es mir geht.«
Das wusste Anna Rosländer in der Tat: »Ihr glaubt, Ihr gehört nicht dazu, wenn sich die Pfeffersäcke den Wanst vollschlagen.«
Im selben Moment wisperte Gleiwitz: »Keine Feier ohne Hexe.«
»Hexen waren es früher«, entgegnete Schnabel, »jetzt heißen die Damen Hebammen und tun so, als könnten sie nicht mehr fliegen.«
Mit beiden Armen simulierte er das Schlagen von Flügeln. Gleiwitz tat so, als habe er seit Langem keinen so guten Witz gehört. Es fiel ihm leichter, wenn es ihm gelang, die Erinnerung an seine Johanna auszublenden. 16 Stunden hatte Trine Deichmann um Johannas Leben gekämpft, 16 Stunden, in denen Gleiwitz um zehn Jahre gealtert war. So viel Blut, so viel Angst, so viel Ungewissheit. Und über allem Gejammer und Geschrei die energische Hebamme, die neben der Gleiwitz-Küche zwei weitere Räume mit Beschlag belegt hatte und am Ende elf Frauen in Trab gehalten hatte, dazu ein Kräuterweib, und als alles nichts mehr half, einen Barbier und zwei Ärzte aus dem Krankenhaus. Während die Mediziner mit Johanna unaussprechliche Dinge anstellten, hatte die Hebamme Gelegenheit gefunden, vor Gleiwitz zu treten, ihn in die Arme zu nehmen und sie hatte zu ihm gesagt: »Wenn Ihr keinen Mut habt, wird Eure Frau keinen Mut haben. Ihr beide müsst jetzt zusammenhalten. Wenn Ihr ein Paar seid, seid Ihr so stark wie wir anderen zusammen. Reißt Euch zusammen, Gleiwitz, ich will sehen, dass Ihr brennt und stark seid.«
Er war stark gewesen, bis Johanna ihren letzten Atemzug getan hatte. Er hatte die Ärzte und den Barbier befragt, in den folgenden Tagen hatte er sie besucht und erneut befragt. Er wollte einfach nicht aufhören mit dem Fragen, aber soviel er auch fragte, keiner von ihnen hatte einen Fehler der Hebamme gefunden. Stattdessen hatte einer gesagt: »Ohne die Deichmann wäre Eure Frau nach zwei Stunden tot gewesen. Hätte Euch das besser gefallen?«
Bis heute war Gleiwitz über die fürchterlichen Tage nicht hinweggekommen. Er wusste, dass die Hebamme keinen Fehler begangen hatte, aber er wusste auch, dass Johanna ohne sie nicht so lange gelitten hätte. Dafür hasste er Trine Deichmann und wartete auf die Gelegenheit, ihr die Quälerei heimzuzahlen. Der Ratsherr Gleiwitz war ein armer Mann, jedes Mal, wenn er seine kleine Tochter ansah, dachte er an Trine Deichmann. Mehr als einmal hatte er gedacht: Wenn sie Ähnlichkeit mit der Hexe bekommt, bringe ich sie um.
»Das ist unsere städtische Hexe«, flüsterte Reeder Horn seinem Gast zu.
»Ihr holt euch solche Frauen in den städtischen Dienst?«, fragte Stanjek staunend. »Bei uns leben sie in den Wäldern und müssen aufpassen, dass sie keinem über den Weg laufen, der Lust verspürt, sie ins Feuer zu werfen.«
»Das ist bei uns im Grunde nicht anders«, entgegnete Horn großspurig, während er zusah, wie die Witwe mit den gerade angekommenen Frauenzimmern palaverte. »Bei uns fällt es nur sofort auf, wenn einer ein Feuerchen anzündet. Deshalb haben wir sie angestellt, das ist der beste Weg, sie unter Kontrolle zu halten.«
Trine Deichmann war die oberste der Hebammen, die von der Stadt Geld bekamen, um arme und reiche Frauen zu betreuen, während der Schwangerschaft, bei der Geburt und 14 Tage nach der Geburt. Die Deichmann besaß »guten Ruf« und »gute Hände«. Nicht alle Hebammen waren im gleichen Maße talentiert, aber die Deichmann war über alle Maßen gewieft und gab ihr Wissen seit vielen Jahren an die Lehrtöchter weiter.
Als Lübecker Mann musste man aufpassen, wer alles in der Nähe war, wenn man anfing, Witzchen über Hebammen zu machen. Mehr als einem Freund und Kollegen von Gleiwitz war der Himmel auf den Kopf gefallen, nachdem seiner besseren Hälfte hinterbracht worden war, zu welch gemeinen Äußerungen sich ihr Gatte in geselliger Männerrunde hatte hinreißen lassen. Gleiwitz wusste von einem Fall, in dem es zur Scheidung gekommen war. Das hatte nicht allein an der Hebamme gelegen, aber ohne die Hebamme wären sie heute noch ein Paar gewesen, das war amtlich.
Die fest angestellten Hebammen unterstanden der Aufsicht und Kontrolle des Rates, der diese Pflicht an ein Gremium übertragen hatte, weil sich kein Mann darum riss, mit Einzelheiten dieses Gewerbes befasst zu werden. Von den Hebammen, die der Deichmann unterstanden, hatte eine in der letzten Zeit unrühmlich von sich reden gemacht. Man war ihr auf die Schliche gekommen, dass sie Abtreibungen durchgeführt hatte. Und wenn darin auch solide Mitbürger verwickelt gewesen waren, so konnte diese Hexe nicht gehalten werden, nicht einmal von der Deichmann. Die wusste, wann sie ein Opfer bringen musste, um nicht ihr gesamtes fliegendes Geschwader zu gefährden.
Gleiwitz konnte der Deichmann seinen Respekt nicht versagen. Wäre sie ein Mann gewesen, wäre er gern mit ihr befreundet gewesen. Aber mit der Deichmann war nicht gut Kirschen essen. Sie besaß einen offenen Blick, hatte nichts Geducktes und Liebedienerisches an sich. Ja, sie tat so, als habe sie das Recht, Stolz auf ihre Profession zu empfinden. Dabei wurden ihre Kolleginnen in anderen Regionen angeklagt und verurteilt, aber die Lübecker hatten nun mal einen Narren an ihr gefressen–die Lübecker Frauen. Denn von den Männern bekannten sich nur zwei Handvoll zu den Hebammen. Allerdings handelte es sich dabei nicht um die kleinsten und gemeinsten. Die Hebammen standen unter höchstem Schutz. Gleiwitz hätte gern gewusst, womit sie diese einflussreichen Männer erpresste, damit die zu ihr hielten. Sicher hatte es mit Abtreibungen zu tun, alle Hebammen führten Abtreibungen durch, so wie jeder Tischler Reparaturen durchführte und jeder Metzger die Schweine seines Nachbarn schlachtete. Hebamme und Abtreibung–das gehörte zusammen wie Möwenschiss und Glück.
»Ich war in der Nähe«, sagte Trine Deichmann zur Witwe.
»Da habe ich ja Glück gehabt. Wer ist es denn? Eine unserer leichtfertigen Schwestern?«
Verdutzt von Annas Offenheit, blickte sich Trine um. In der Tat hatte sie bei einer Hafenhure vorbeigeschaut. Dieser Berufsstand bereitete ihr wenig Sorgen. Huren besaßen eine stabile Gesundheit und neigten nicht dazu, über Wehwehchen zu jammern oder Befürchtungen zuzugeben. Vor allem gab es in der Regel keinen Mann und Vater. Dieser Menschenschlag bereitete Trine Deichmann nicht selten den größten Verdruss. Einerseits hochnäsig, andererseits unwissend, wussten Männer nicht, wie man einer Hebamme gegenübertrat. Zwar fühlten sie Erleichterung, denn die Hebamme übernahm einen Teil der Verantwortung, den die Männer gar zu gern auf deren Schultern abluden. Andererseits gab es auch Vertreter des Männergeschlechts, die sich der Hebamme gegenüber benahmen, als sei sie ihre Mutter, wenigstens eine mütterliche Freundin. Oft handelte es sich dabei um Männer, die zum ersten Mal Vaterfreunden entgegensahen.
Anna Rosländer beschaffte für die späten Gäste freie Plätze. Nach dem zweiten Becher verloren auch die Arbeitsleute ihre Scheu vor dem Auftrieb vornehmer Herrschaften. Anekdoten machten die Runde, in denen es um Vorfälle und Unfälle beim Bau des Holk ging, der vor den Augen der Festgesellschaft im Wasser dümpelte. Anna hatte unmissverständlich verboten, heute an Arbeit auch nur zu denken. So würde der Innenausbau warten müssen, denn einige ihrer Arbeiter retteten sich in die Arbeit, um nicht reden zu müssen. Dabei war ihre Angst vor einer Blamage unbegründet. Am Tisch saßen nur Menschen vom Fach. So sehr sich mancher Kaufmann und Ratsherr von seiner Dünkelhaftigkeit lenken ließ, so unbezweifelbar war, dass die Arbeiter der Werft Könner waren. Einigen eilte ein trefflicher Ruf voraus, um die besten schwelte ein Kampf der Werftbetreiber. Jeder wollte dem Konkurrenten den Tischler und Segelmacher abwerben. Wenn ein Spezialist von auswärts nach Lübeck übersiedelte, musste er sich um seine berufliche Zukunft keine Sorgen machen. Zwar waren die großen Zeiten der Hanse vorbei, aber Lübeck war keineswegs auf den Stand eines Provinzstädtchens zurückgefallen. Es musste sich den Ruhm der führenden Adressen am Baltischen Meer nur mit mehreren Städten teilen.
Trine Deichmann aß, für ihre Verhältnisse aß sie sehr viel. Wer sie kannte, wusste, dass dies ein schlechtes Zeichen war. Den meisten Menschen schloss Kummer den Magen zu, Trine begann zu fressen. Das viele Essen bereitete ihr keinen Genuss, aber sie musste dem Drang nachgeben.
»Wenn sie etwas umsonst kriegen, werden sie munter«, murmelte Ratsherr Gleiwitz.
Schnabel, der Reeder, arbeitete sich erneut auf Anna Rosländer zu. Das fiel ihm leicht, denn nach dem Essen vertrat man sich die Beine. Anna stand am Kai, Schnabel musste annehmen, dass sie ihr jüngstes Produkt betrachtete. Er konnte nicht wissen, dass Annas Blick weit darüber hinausging.
»Das war das letzte«, sagte Schnabel.
Anna schwieg. Sie war nicht überrascht, dass der Kollege und Konkurrent über die Auftragslage ihres Hauses informiert war. Der Holk war in der Tat diejenige Bestellung, die ihr Mann noch zu Lebzeiten aufgenommen hatte. Im Grunde starb er heute den zweiten Tod. Die Rosländer-Werft hatte in den letzten Monaten nicht aufgehört zu arbeiten. Mancher Auftrag war hereingenommen worden, mehr Reparatur als Neubau. Mit seiner nächsten Bemerkung bewies Schnabel, dass er über die Zahlen bestens informiert war. Für ein Handelshaus zwischen Lübeck und Hamburg war ein Schiff auf Kiel gelegt worden, mit einem hiesigen Weinhaus war man fast einig über den Verkauf eines Schiffs von überschaubaren Ausmaßen.
Schnabel trumpfte mit seinem Wissen nicht auf, ließ es nebenbei einfließen, als sei es das Natürlichste von der Welt, Einblick in die Auftragsbücher der Konkurrenz zu haben.
»Es gab bessere Zeiten«, gestand Anna Rosländer. »Es gab auch schon schlechtere Zeiten. Geduld gehört zum Geschäft.«
Schnabel hatte das sichere Gefühl, dass die letzten Worte speziell für ihn ausgesprochen worden waren. Aber Schnabel war nicht zum Stapellauf gekommen, um sich satt zu essen und den Wein der Rosländers zu trinken. Ihm war es um etwas anderes zu tun. Seitdem er gesehen hatte, dass mit Stanjek ein auswärtiger Werftbetreiber Witterung aufgenommen hatte, stand Schnabels Entschluss fest.
»Ihr habt Ruhe verdient«, sagte er.
»In meinem Haus war es in der letzten Zeit sehr, sehr ruhig.«
»Das kann ich mir gut vorstellen«, gestand er eilfertig zu. So sehr Schnabel von der Gier getrieben wurde, so sehr war es ihm darum zu tun, nicht als einer zu erscheinen, der gierig war. Es musste so aussehen, als würde er ein barmherziges Werk tun. Monatelang hatte er darüber nachgedacht, viele Gespräche hatte er darüber geführt: mit Freunden, Kollegen, nicht zuletzt mit Rechtskundigen und keineswegs nur mit Lübeckern. So sehr Schnabel die Hamburger verachtete, so nützlich konnten sie ihm jetzt sein. Eine halbe Tagesreise Abstand schuf die Distanz, die Rat und Urteil sachlicher ausfallen ließen. Außerdem stieg die Chance, dass Anna Rosländer nicht zufällig bei denselben Leuten um Rat nachsuchte.
Jetzt hatte der Reeder und Werftbetreiber Schnabel eine Entscheidung gefällt. Hatte er zu lange gezögert? War er womöglich nicht der Erste, der mit der Witwe sprechen würde? Die Familien Rosländer und Schnabel hatten sich nie nahe gestanden. Dazu war der Rosländer ein zu wilder Geselle gewesen. Wenngleich Schnabel neidisch zugehört hatte, wenn von den jüngsten Besäufnissen der Rosländers gemunkelt wurde, hatte ihm die frömmlerische Art seiner eigenen Gattin jede Teilnahme verhagelt. »Die sind uns zu ordinär«, lautete einer ihrer Standardsätze. »Wir haben Ansprüche«, lautete ein anderer.
Zähneknirschend hatte sich Schnabel gefügt–nicht ohne zwischendurch Signale auszusenden, dass er den Kollegen durchaus schätzte. Nie war ein Signal zurückgekommen, Rosländer hatte es nicht mit Etikette und Umgangsformen. Er hatte in der Fluchbüchse unter Zeugen sechs Liter Wein getrunken und im Wettkampf mit einem örtlichen Fischer 28 gebratene Heringe aus der Pfanne gegessen–mitsamt Haut, Kopf und Gräten. Dem Fischer hatte die Hebamme in den Schlund greifen müssen, um ihn davor zu bewahren, an einer Gräte jämmerlich zu ersticken. Es war Joseph Deichmann, Ehemann der Hebamme, der das Lokal betrieb–nicht zu seinem Schaden, denn an seinen Tischen fanden sich vom Kaufmann bis zum Tagelöhner alle Menschen, die eine Lübecker Adresse vorweisen konnten. Mehr verlangte Joseph von seinen Gästen nicht. Dass sie sich anständig benahmen, geschah ganz von allein, wenn auch nicht immer ohne Hinweis der Hebamme. Einem Radaubruder hatte sie ein Messer zwischen zwei Finger gestoßen, seitdem zitterte diese Hand jedes Mal, wenn er der Deichmann im Stadtbild begegnete. Einem anderen hatte sie mit einer Pfanne ein Muster auf die Wange geschlagen, das nie mehr verschwunden war. Einem dritten hatte sie damit gedroht, ihn seiner Manneskräfte zu berauben, wozu nichts weiter nötig sei, als ein Kraut über seinem Kopf auszustreuen, und wenn er das nicht glauben würde, sollte er es eben riskieren. Beim eiligen Aufbruch war der abergläubische Kerl mit der Schulter gegen den Türrahmen geprallt. Der Schmerz hatte wochenlang angehalten.
4
»Wollt Ihr nicht endlich zu Eurem Thema kommen?«
Überrascht blickte Schnabel die Witwe an. Ihr Hals war zu dick, ihre Gesichtszüge waren nicht zart, der Kragen des Kleides lugte über den Kragen der Jacke, die wiederum nicht elegant wirkte, sondern bestenfalls praktisch. Anna Rosländer sah aus wie die Frau eines Handwerkers, nicht wie die Witwe des größten Lübecker Werftbetreibers und Reeders. Vor allem jedoch sah sie nicht glücklich aus. Schnabel schöpfte Mut.
»Ihr habt Euch das Recht erworben, endlich zur Ruhe zu kommen«, sagte er.
»Ich höre.«
»Zur Ruhe nach einem Leben voller Aufregungen. Es liegt mir fern, auf Euer Alter anzuspielen, aber in aller Demut denke ich, dass es ein Alter gibt, in dem man nicht mehr gewillt ist, dazuzulernen. Ich weiß nicht, ob ich mich klar ausdrücke.«
»Redet einfach weiter.«
»Ihr und Euer Mann, dessen Ruf von England übers Dänische bis weit in den Osten gedrungen ist, habt uns in den Jahren Eures gemeinsamen Wirkens viel Freude bereitet. Uns und der Stadt. Ihr seid Fleisch vom besten Lübecker Fleisch. Eure Schiffe befahren das Baltische Meer und sind weit darüber hinaus nach Norden und Westen vorgedrungen. Es würde mich nicht wundern, wenn in diesem Moment Menschen an der Küste Afrikas stehen, wie wir beide, und zusehen, wie eines Eurer Salzschiffe an ihnen vorbeifährt.«
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!