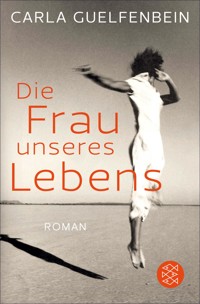8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Von einer der beliebtesten Autorinnen Südamerikas Ana, eine berühmte Fotografin, kehrt nach 21 Jahren in London zurück in ihr Heimatland Chile. Zurück bleiben ihr Lebensgefährte Jeremy und ihre Geliebte Elinor. Kaum angekommen in Chile wirbelt Ana die Familie mit ihrer unkonventionellen Art gehörig durcheinander, und bald kündigt sich Besuch aus London an. Ein feinsinniger Roman über eine Frau, die in ein altes, neues Leben findet – temperamentvoll und lebensmutig erzählt von Carla Guelfenbein.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 406
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
CARLAGUELFENBEIN
Die andere Seite der Seele
Roman
Über dieses Buch
Ana, eine berühmte Fotografin, kehrt nach 21 Jahren in London zurück in ihr Heimatland Chile. Zurück bleiben ihr Lebensgefährte Jeremy und ihre Geliebte Elinor. Kaum angekommen in Chile wirbelt Ana die Familie mit ihrer unkonventionellen Art gehörig durcheinander, und bald kündigt sich Besuch aus London an.
Ein feinsinniger Roman über eine Frau, die in ein altes, neues Leben findet – temperamentvoll und lebensmutig erzählt von Carla Guelfenbein.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Carla Guelfenbein, geboren 1959 in Santiago de Chile, gehört zu den erfolgreichsten Autorinnen ihres Landes. Als Reaktion auf das Regime Pinochets verließ sie als junge Frau Chile und studierte in England Biologie und Design. Heute lebt sie als Schriftstellerin und Drehbuchautorin wieder in ihrer Heimat. Ihre Romane wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt; auf Deutsch sind bereits erschienen ›Die Frau unseres Lebens‹, ›Der Rest ist Schweigen‹ und ›Nackt schwimmen‹. Für ihren letzten Roman, ›Stumme Herzen‹, erhielt Carla Guelfenbein den renommierten Premio Alfaguara.
Thomas Brovot übersetzt aus dem Spanischen und Französischen (u. a. Juan Goytisolo, Federico García Lorca, Mario Vargas Llosa, Severo Sarduy) und lebt in Berlin. Seine Arbeit wurde ausgezeichnet mit dem Übersetzerpreis der Spanischen Botschaft und dem Helmut-M.-Braem-Übersetzerpreis.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Inhalt
Widmung
Daniela
Ana
Cata
Ana
Daniela
Cata
Daniela
Ana
Cata
Daniela
Ana
Daniela
Ana
Cata
Ana
Daniela
Ana
Cata
Ana
Cata
Daniela
Cata
Ana
Daniela
Ana
Epilog
Danksagung
Für Carlos Altamirano,
für alles …
Daniela
Trotz Regen sind heute Abend mehr Leute da als sonst. Auf den beschlagenen Scheiben ziehen die Tropfen Furchen, ähnlich dem Schweißfädchen, das dem Mann hinter der Theke über die Stirn rinnt. An unserem Tisch messen zwei mir unbekannte Typen beim Armdrücken ihre Kräfte. Auf ihren Gesichtern liegt etwas Wildes und zugleich Unschuldiges. Als der Korpulentere der beiden von dem Schmächtigeren besiegt wird, zeigt Rodrigo ein Lächeln und zieht ein kleines Notizbuch aus der Jackentasche. Schon seit ein paar Monaten trennt er sich nicht davon, immer macht er sich Notizen, sammelt Gesten, Gesichtsausdrücke für die Figur, die er spielt. Eine nervige Angewohnheit, nie weiß man, wann eine unschöne Miene für die Ewigkeit festgehalten bleibt, ein Ausdruck, den man von sich selbst gar nicht kennt und von dem man am liebsten auch nichts wissen will. Rodrigo weiß das natürlich, und in meiner Gegenwart lässt er das Notizbuch normalerweise stecken. Ich ziehe an meiner Zigarette und blase ihm den Rauch ins Gesicht. Er schaut auf, und zum ersten Mal am Abend schenkt er mir diesen aufmerksamen, unwiderstehlichen Blick, der für ihn so charakteristisch ist. Ein solches Zeichen reicht, um mir den Wind aus den Segeln zu nehmen, und ich erinnere mich daran – oder stelle mir vor? –, dass er mich auserwählt hat, niemanden sonst, und dass ihm all die anderen Frauen, die um ihn herumschwirren, egal sind. Rodrigo lässt den Blick wieder sinken und schreibt zu Ende. Eine junge Frau kommt an unseren Tisch, in der Hand hält sie ein ähnliches Notizbuch. Offenbar denkt sie, dass diese Gemeinsamkeit ihr das Recht gibt, sich zu uns zu setzen. Sie ist klein, mit vorstehenden Brüsten, wie diese Bodenschwellen, die einen zum Langsamfahren zwingen. Mit matten, wohlkalkulierten Bewegungen zündet sie sich eine Zigarette an, und ohne dass jemand ein Wort zu ihr gesagt hätte, hebt sie an und breitet sich aus über die privatesten Dinge eines chilenischen Autors, der in Sevilla lebt.
Vor ein paar Tagen hat mir mein Vater bei seinem wöchentlichen Anruf erzählt, dass Tante Ana heute kommt. Zu ihrem Empfang gibt es am Sonntag bei meinen Eltern eins dieser ausufernden Essen im großen Familienkreis. Ich habe noch nie verstanden, warum sie so viel Wert auf diese Zusammenkünfte legen, wo sich sowieso alle tödlich langweilen. Ein echtes Gesprächsthema gibt es nicht, und was sie sich sagen könnten, liegt unter tonnenschweren Konventionen begraben.
Tante Ana kenne ich nur von einem Foto auf dem Nachttisch meiner Großmutter. Trotzdem hat dieses Bild schon immer eine seltsame Faszination auf mich ausgeübt. Ich habe nie herausfinden können, was genau diese Wirkung hervorruft. Es mag ihre ungezwungene, fröhliche Haltung sein, oder weil auf ihrem Gesicht nicht die Spur von Dunkelheit liegt, vielleicht ist es auch das explodierende Sonnenlicht auf dem weißen Gebäude im Hintergrund. Ihre Hand umfasst eine andere, die Hand eines Mannes, den der Fotograf meinte, in der Anonymität belassen zu müssen. Womöglich reizt mich auch allein die Vorstellung, dass diese Frau, die so anders ist als meine Mutter und ihre Freundinnen, anders als jede mir bekannte Frau, meinen Nachnamen trägt und ein Teil von mir ist. Auf dem Foto trägt Tante Ana einen silbernen Skarabäus an ihrem T-Shirt. Ich habe genauso einen, den habe ich in einem Antiquitätengeschäft auf der Calle Brasil unter einem Haufen Tinnef entdeckt. Meine Mutter war strikt dagegen, in ihren Augen war diese Brosche absolut geschmacklos, aber als ich dann hinausging, hatte ich sie an meinem Jackenaufschlag stecken.
Die aufdringliche Frau hat sich vorgearbeitet, und statt auf einem Stuhl am Rand sitzt sie jetzt Rodrigo gegenüber. Sie versucht ihn anzumachen, das ist nicht zu übersehen, aber Rodrigo schenkt ihr nicht die geringste Beachtung. Er ist so feinfühlig und streichelt immer mal wieder meine Hand, schaut mich wissend an oder lächelt mir zu. Egal, mich langweilt dieses Spielchen, und irgendwann stehe ich auf, nehme meine Coca-Cola light und gehe zur Theke, wo ich Gabriel gesehen habe.
»Möchtest du nicht was Stärkeres?«, fragt Gabriel und deutet mit dem Kinn zu dem Tisch, wo Rodrigo mal wieder der Mittelpunkt der Aufmerksamkeit ist.
»Das bin ich gewohnt«, sage ich.
Gabriel ist mein bester Freund. Er wohnt für ein paar Wochen bei uns, ich selber habe ihn eingeladen, nachdem er mit seiner letzten Freundin Schluss gemacht hat. Zwar kenne ich kaum einen Menschen, der so in sich ruht wie er, aber der Welt gegenüber macht er immer den Eindruck eines hilflosen Neugeborenen.
Meine Coca-Cola ist lauwarm und sprudelt mit keinem Bläschen mehr. Aber egal. Etwas Starkes brauche ich auch nicht, um das hier durchzustehen. Rodrigo bedeutet es nicht viel, dass er der Frauenschwarm in einer Soap ist. Mit dem Geld, das er beim Fernsehen verdient, möchte er sein eigenes Theaterstück aufführen, und er hat mir versprochen, dass ich die weibliche Hauptrolle bekomme.
Jemand hat die Tür des Oasis ein Stück offen gelassen, und immer wieder weht mir ein Schwall eisiger Luft in die Kehle, so als würde ein Riese aus Eis seinen Atem über mir ausstoßen. Die Frau am Tisch hat ihre Triebe kaum noch unter Kontrolle, sie lacht aus vollem Hals und wirft sich Rodrigo fast in die Arme. Sein Blick geht durch sie hindurch und angelt nach mir. Ich schaue zu Boden. Natürlich ist das alles völlig harmlos, und trotzdem, allein bei dem Gedanken, ich könnte ihn verlieren, durchläuft es mich kalt. Ich beschließe zu gehen, morgen steht mir ein langer und langweiliger Probentag bevor. Die Theatertruppe, zu der ich gehöre, führt König Ödipus auf. Zwar bin ich in dem Stück bloß ein Bote, aber ich habe allen weisgemacht, ich würde die Hauptrolle spielen, die von Iokaste. Niemand kennt die Wahrheit, nicht mal Rodrigo. Ich nehme meine Jacke, und als ich mich von Gabriel verabschiede, sagt er mir, dass er heute Abend nicht kommt. Wo er die Nacht verbringen will, sagt er nicht, aber in seinen Augen bemerke ich einen geheimnisvollen Glanz, auch wenn er mich fest ansieht, so als wollte er mir etwas mitteilen. Doch dann knöpft er mir nur den Mantel zu und gibt mir einen Kuss auf die Wange.
»Wir sehen uns morgen«, sagt er und schaut mich weiter mit diesen Augen an, die ich von klein auf kenne und die mich an die traurigen Augen der Clowns erinnern, verborgen hinter ihrem aufgeklebten Lächeln. Hoffentlich findet er bald eine neue Freundin, die Einsamkeit tut Gabriel nicht gut.
Auf dem Weg zur Tür ducke ich mich, damit Rodrigo nicht sieht, dass ich gehe. Ich hasse die Rolle der Spielverderberin. Aber ich bin kaum zehn Schritte gegangen, da spüre ich, wie er mich rasch um die Taille fasst, und wir gehen gemeinsam nach Hause.
*
Als wir in unserer Wohnung sind, umarmt mich Rodrigo. Seine Arme sind warm, sein Atem sanft. Seine Küsse werden feuriger und wandern meinen Hals hinunter bis zu den Nippeln meiner kleinen Brüste. Wir stehen an die Tür gelehnt, sein Schwanz drückt sich hart in die Kleidung, seine Hände halten meine Hüften, ziehen sie zu sich und fahren weiter, wollen mir zwischen die Beine. »Meine Iokaste«, stammelt er, sein Atem geht stoßweise. Seine Worte dringen mir in die Ohren wie diese Presslufthämmer, die die Straßen aufreißen. Kaum mache ich eine distanzierende Bewegung, lässt er ab.
»Egal«, sagt er, offenbar ist er nicht böse. »Ich bin sowieso spät dran, ich muss zurück zum Dreh, es fehlen noch ein paar Außenaufnahmen. Macht dir doch nichts aus, oder?«
Ich gebe ihm einen Kuss und sage, dass ich müde bin, ich könnte auf der Stelle einschlafen. Er soll gehen, wohin auch immer.
Vor genau einem Monat habe ich mit dieser schrecklichen Farce angefangen. Ich erinnere mich noch gut, wie wir an dem Morgen, ehe ich zum Vorsprechen für König Ödipus ging, miteinander geschlafen haben. Rodrigo hat mich dann bis vor die Tür des Theaters gebracht, und dort sagte er mir, ich hätte Talent und würde bestimmt die Rolle der Iokaste bekommen, jede Wette. Er war sich ganz sicher, und für einen Moment glaubte ich ihm. Danach konnte ich nicht anders, es ging einfach nicht. Wenn Rodrigo herausfand, wie unbedeutend ich war, wie untalentiert, wie unfähig, würde er mich verlassen. An dem Tag, als sie mir die Rolle des Angelo gaben, des Botenjungen, rief Rodrigo alle unsere Freunde an, und bis in den Morgen feierten wir meine Rolle der Iokaste. Ein Glück, dass der Regisseur, ein für die Inszenierung eingeladener Franzose, vor lauter Geltungsdrang aus der Aufführung ein einziges Geheimnis macht. Auf diese Weise, sagt er, würden die Erwartungen hochgeschraubt. Aber Scheiße, wenn das alles rauskommt, was dann? Ich kann nicht denken. In meinem Kopf wird alles neblig, trüb. Ich muss essen.
Kaum ist Rodrigo durch die Tür, läuft mir ein Speichelfädchen über die Unterlippe. Durchs Fenster sehe ich, wie sein Motorrad an der Ecke Mosqueto verschwindet. Am Himmel sind schwarze Wolken.
Ich muss runter zum Laden von Don Rata, diesem verkappten Stinkstiefel, der in seiner immer geöffneten und mit angestaubten Süßigkeiten vollgestopften Bude auch seinen ganzen Verdruss auf der Theke ablädt. Widerlich, aber mir bleibt keine andere Wahl. Ich springe die Treppe hinunter. Als ich zum Laden komme, bleibe ich stehen. So kann ich mich unmöglich sehen lassen, mit seinen wachsamen Augen wird Don Rata den Schweiß auf meinen Händen bemerken, das vor Angst jagende Herz, meinen trockenen Mund, der sich nach Nahrung zum Durchspülen sehnt. Ich muss die Ruhe bewahren, ein Lächeln aufsetzen, mir eine gute Strategie ausdenken. Um mich herum ist eine unwirkliche Stille, das muss dieser laue Wind sein, der das Laub der Platanen aufwirbelt und den Regen ankündigt. Auf einmal nehme ich Schritte wahr, innerhalb von Sekunden werden sie lauter. Die Kälte, die ich schon den ganzen Tag gespürt habe, wird noch schneidender. Ich höre eine Frauenstimme, sie ruft meinen Namen. Jemand hat mich erkannt. Ich will verschwinden, mich in Luft auflösen, sterben. Ich drehe mich um, sehe ihren stechenden Blick.
»Geht ihr heute Abend nicht in die Kneipe?«, fragt sie. Jetzt erkenne ich sie, eine Schülerin von der Theaterschule, die immer um Rodrigo herumflattert. Ich könnte sie erwürgen, aber irgendeine himmlische Kraft hält mich zurück.
»Waren wir schon. So ein Pech, du hast ihn verpasst«, fertige ich sie ab und schaue ihr unbeirrt ins Gesicht. Sie deutet ein Lächeln an und verschwindet genauso schnell, wie sie aufgetaucht ist. Wieder bin ich allein auf der Straße. Ich sehe mein grässliches Spiegelbild im Schaufenster, wende mich ab, atme tief ein und betrete den Laden.
»Zum Glück ist Ihr Geschäft immer auf«, begrüße ich Don Rata. »Rodrigo sagt, er hat einen Haufen Freunde eingeladen, und ich habe nichts, was ich ihnen anbieten könnte. Und das um diese Uhrzeit! Ich nehme drei Tüten Chips, die großen, und drei mit Erdnüssen, haben Sie vielleicht noch eine andere Marke als die da? Ach ja, und noch vier Tüten von den Sticks, den salzigen da oben, und diese abgepackten Muffins, ein halbes Dutzend wird reichen. Und noch ein Kastenbrot, Butter und so dreihundert Gramm Käse. Außerdem brauche ich noch einen Becher Eis, das Schoko-Haselnuss soll nicht schlecht sein, ein paar Schachteln Gebäck zum Kaffee und drei Flaschen Coca-Cola.«
Ich trinke zwar keinen Alkohol, nehme aber noch zwei Flaschen Wein, um den Besuch meiner Freunde glaubhafter erscheinen zu lassen. Mit drei großen Plastiktüten gehe ich hinaus, zwei mit Essen und die andere mit den Flaschen, der Gehilfe von Don Rata begleitet mich und trägt sie hoch in den vierten Stock. Als ich die Tür schließe, schlägt mein Herz wieder schneller, ich kippe alles auf den Tisch, das Gebäck, das Brot, die Erdnusstüten. Der Blick trübt sich, meine Hände zittern, rasch öffne ich die Verpackungen, ich will diesen Tunnel von Lebensmitteln sehen, in den nur ich hineinkann. Ich schaue auf die Uhr, noch drei Stunden, dann kommt Rodrigo zurück, bis dahin müssen sämtliche Spuren beseitigt sein.
Nach der ersten Chipstüte zittern meine Hände nicht mehr, und ich reiße die zweite auf, die dritte, ein Gebäckstück nach dem anderen verschwindet in meinem Mund, noch ehe ich überhaupt gekaut habe. Mein Gott, tut das gut! Friede, der ersehnte Friede, der in Wellen meinen Körper durchströmt, und sollte er sich davonmachen, hole ich ihn mit zehn Löffeln Eis zurück, stopfe auch meinen Kopf voll, lulle mich ein, schalte jeden Gedanken aus, jeden Anflug von Schuld. »Bleib«, flüstere ich, »so geht es mir gut, essen, bis ich satt bin«, ein großer Schluck Coca-Cola und eine Pause, nur ein paar Sekunden, um durchzuatmen … und dann die Muffins, ein wenig gummiartig, aber was soll’s, sie sind so schön süß, und in die Cola getunkt rutschen sie die Kehle hinunter. Nach und nach verringere ich das Tempo, und auf dem Teppich liegend schaue ich an die Decke und kaue langsam ein Stück Brot, während ich den Löffel in das Schälchen tauche, wo die Eisreste flüssig werden. Ich habe praktisch alles verschlungen, und tief dort unten, zerdrückt von den Unmengen, die ich zu mir genommen habe, ruhen, endlich besänftigt, meine Gefühle. Und ich trete in mein Schloss. Es ist ein sonniger Morgen, durch die Fenster sickert das Licht, zeichnet die Muster des Buntglases auf den Boden: kleine purpurrote Blumen und blaue Asterisken, orange Sterne mit sechs oder sieben Spitzen, bauschige himmelblaue Wolken, ihr Widerschein auf dem Kräuterbett wird zu einem großen Kissen, auf dem ich es mir bequem mache und ausruhe …
Aber die Ruhe ist nicht von Dauer. Der Wind schlägt jetzt an die Fenster, nicht an die meines Schlosses, sondern an die des Wohnzimmers hier, wo mein gefühlloser Körper auf dem Boden liegt. Mein Blähbauch schmerzt. Ich will die Augen nicht öffnen. Bleib noch, Friede, bitte, geh nicht, wiege mich noch ein bisschen, verlass mich nicht. Ich taste nach einer Erdnuss, ein paar Chips, die mir in der Eile runtergefallen sein könnten, ein paar Krümel, was auch immer, Hauptsache, es füllt den letzten Hohlraum meines Körpers aus und bringt mich zurück in mein Schloss. Ein Blitz ist durch den Himmel gezuckt und hat ihn in zwei Hälften gespalten. Ich schaue zum Fenster, nicht zu meinem, wo die Sonne hereinscheint, sondern zu dem anderen, dem winterlichen. Eine Seite des Himmels ist nun erleuchtet, die andere liegt im Dunkeln. Ich kann nicht aufhören, diesen dunklen Teil zu betrachten, der sich auftut wie eine Krypta, und ich falle hinein, falle wie Alice im Albtraumland. Es hat gedonnert. Ich schließe die Augen und zähle, eins, zwei, drei, vier, fünf, ich weiß nicht, warum ich zähle, vielleicht um den Regen nicht zu hören, die Donnerschläge an den Scheiben, um nicht zu hören, wie der Tod umgeht. Durch die geschlossenen Pupillen dringt das Licht eines ganzen Trupps von Strahlen, die den Himmel weiter in tausend Stücke schlagen, tausend dunkle Löcher, durch die ich falle und falle.
Auf einmal bohrt sich mir der Schmerz in den Magen, ein Stich zerreißt mich, vornübergebeugt bahne ich mir einen Weg zum Bad, wasche den rechten Zeigefinger und stecke ihn mir so tief wie möglich in den Hals. Das Essen, kaum gekaut und noch unverdaut, schießt mir aus dem Mund. Schwall auf Schwall zieht alles, was ich zu mir genommen habe, in umgekehrter Richtung durch meinen Körper, und all das, was ich nicht länger gespürt habe, wird zu stinkender Kotze, die an meinen Fingern klebt, meinem Gesicht, den Klamotten. Nach ein paar Minuten trockne ich mir die Hand ab und stecke sie mir wieder in den Hals. Das Ganze wiederhole ich noch zwei Mal, bis die Erschöpfung mich niederzwingt, und ich falle mit den Knien auf den Fliesenboden. Im Mund bleibt ein herber Geschmack. Ich lasse den Kopf aufs Klo sinken, ich stinke, möchte mich am liebsten noch mal übergeben, aber innen drin ist alles leer. Mein Zahnfleisch ist taub von der Säure des Erbrochenen. Es ist kalt, ich zittere am ganzen Leib. Aber das habe ich verdient, weil ich mich habe gehenlassen. Ich wasche mich langsam und schlage mit der geballten Faust gegen die Wand, bis ich sehe, dass die Hand blutet. Es ist nichts Schlimmes, auch wenn es weh tut. Das hat so ein Dreckstück wie ich davon. Ich höre auf, lehne mich an die Wand und schließe die Augen. Nach und nach atme ich wieder ruhiger, gleichmäßiger. Draußen regnet es, und ich bin von oben bis unten versaut.
Ich muss mich berappeln, alle Beweise vernichten. Ich putze mir die Zähne mit einer alkalischen Zahnpasta, um die Wirkung der Magensäure abzuschwächen. Wische das Bad, sammle die Verpackungen auf, die im Wohnzimmer verstreut auf dem Boden liegen, wasche meine Sachen und hänge sie über den Duschvorhang. Dann lege ich ein billiges Parfüm auf. Mein Vater hat es längst aufgegeben, mir Flacons mit Chanel Nº 5 zu schenken, die später dann im Zimmer von Marcelina auftauchen, meinem alten Kindermädchen. Schließlich ziehe ich die Waage unterm Bett hervor und stelle mich nackt drauf. Ich habe kein Gramm zugenommen. Jetzt kann ich schlafen. Im Spiegel betrachte ich meinen Körper: Kein Zweifel, ich bin eine Schauspielerin, tue so, als wäre ich jemand, aber in Wirklichkeit bin ich ein Niemand.
Durchs Fenster werfe ich einen Blick auf die Platanen, die unter dem bleiernen Regen einen grauen Ton angenommen haben, wie Gespenster, die vor dem Licht fliehen.
Ana
Jeremy bittet sie nonchalant herein, als würde das Taxi nicht mit ihrem Koffer auf sie warten, um sie zu ihrem Flug nach Chile zu bringen; als hätten sie nicht bis vor zwei Wochen noch hier zusammengelebt, in dieser Wohnung, in die Ana jetzt unsicheren Schrittes einzutreten versucht, ohne die Fassung zu verlieren. Als die Schwelle dann überschritten ist, bleibt sie reglos im Wohnzimmer stehen, die Katze auf dem Arm, mit der freien Hand reibt sie sich wie besessen die Nase (eine für sie typische Geste, die er mal beschrieben hat als etwas wie ein Komma, eine Pause, um Kräfte zu sammeln und einen unangenehmen Moment zu überspielen), und sie fragt sich, wohin Jeremy an diesem Morgen wohl geht mit seiner extrafein gebügelten Hose, der dazu passenden Jacke und der gelben Krawatte, schließlich weiß sie, wie ungewöhnlich eine derart förmliche Kleidung für ihn ist. Zwischen ihnen ist es aus, dessen ist sich Ana sehr bewusst, trotzdem würde sie ihn am liebsten umarmen und mit ihm in den breiten, weichen roten Sessel sinken, ihm Worte ins Ohr flüstern, die ihn erregen, würde ihn am liebsten zum Lachen bringen und mit Küssen alles Geschehene vergessen machen. Verstohlen beobachtet sie Jeremys blasse Augen, die sie von einem Ort aus ansehen, zu dem sie nicht mehr gehört, und dabei sagen sie so etwas wie: »Alles überwunden«, was natürlich aufgesetzt sein kann, aber es kommt so übermächtig rüber, so unerschüttert, dass Ana nur noch deprimierter ist, und statt ihn zu umarmen, setzt sie die Señora Palmer langsam auf dem Boden ab. Die Katze trottet zum Sessel, drapiert dort ihr weißes Fell, und nachdem sie ihren großen Kopf auf ein Samtkissen gebettet hat, schaut sie beide an.
»Vergiss nicht, dass die Señora Palmer verfroren ist, auch wenn man das nicht meinen sollte, so dick und behaart …«, sagt Ana, die Augen niedergeschlagen, feucht, sie weiß genau, dass eine derartige Geste, die unvermittelt hervorbricht, wenn sie etwas nicht glauben mag, Jeremy rührt. Nur diesmal nicht. Trotz seiner unbekümmerten Haltung und der gleichgültigen Miene, die ihm seine hochgezogenen Brauen verleihen, errät Ana an seinen fahrigen Händen und seinem scheuen Blick den Wunsch, diese Formalität so schnell wie möglich hinter sich zu bringen. Doch dann regt sich ihr wiederbelebter heroischer Geist, und an die Decke schauend, als ginge sie die Liste der Empfehlungen durch, die sie ihm zu der Katze geben muss, macht Ana einen Schritt auf Jeremy zu, und sie stehen einander gegenüber. Wer sich jetzt zuerst bewegt, muss mit einer Abfuhr rechnen. Sie reibt sich die Nase, streckt die Hand aus, um sich zu verabschieden, doch mit einem Ruck zieht Jeremy sie zu sich hin. Es ist ein zarter, unentschlossener Kuss.
»Glaub nicht, dass ich dir verziehen habe«, sagt er mit ernster Stimme, und dann zeigt er sein phlegmatisches Lächeln eines wohlerzogenen Engländers. »Ich tue das nur, damit die Señora Palmer beruhigt ist und denkt, alles wäre in Ordnung. Alles wäre wie immer. Auch wenn wir beide wissen, dass es eine große Lüge ist.«
»Du weißt ja, sie schläft gerne bei laufendem Fernseher«, sagt Ana, und schon verschwindet sie im Treppenhaus.
Auf der Fahrt zum Flughafen nimmt sie eine Schlaftablette. Eine von den Tabletten, die sie immer dabei hat für die großen Beben. Beben, die ihr die Ruhe rauben und die wohlbemessene Distanz aufheben, die sie den Dingen gegenüber wahrt.
*
Auf den wenigen Metern zum Terminal überschlägt Ana noch einmal im Stillen die Jahre. Genau einundzwanzig. Sie sollte gerührt sein, denkt sie, ein paar Tränen vergießen oder sich wenigstens freuen, dass sie endlich wieder zurück ist. Sie schaut auf, und ganz hinten, jenseits der Betonplatten und des Nebels, sieht sie die phantasmagorische, fast graue Silhouette der Kordilleren. Eine Gruppe junger Leute überholt sie. Sie tragen alle das Gleiche, das gegelte Haar nach hinten gekämmt, und die ganze Zeit reden sie und schwenken synchron die erhobenen Arme wie irgendwelche Stars. Ein Chor, der sich ungezwungen in einem chilenisch gefärbten Spanisch ausdrückt und durch einen Spalt in ihrer Erinnerung sickert. Sie greift wieder nach ihrem Rollkoffer, geht nun schneller. Das Gebäude für die Passkontrolle ist ein einziges Stimmengewirr. Sie fühlt sich etwas besser als beim Abflug. Dank der Tablette hat sie den ganzen Flug geschlafen, außerdem trennen sie jetzt Tausende Kilometer von London und von Jeremy. Die Reise nach Chile hat sich genau im richtigen Moment ergeben, sie hätte beinahe schon Mitleid gehabt mit sich selbst und, schlimmer noch, Jeremy um Verzeihung gebeten für etwas, was irgendwann einfach passieren musste. Aber dann rief Allan Jenkins an, der Artdirector der Sunday Times. Chile, sagte er, sei wegen des Prozesses gegen Pinochet wieder im Blick. Er wollte etwas ohne jeden politischen Anstrich, für den Porträtteil. Ana schlug vor, zehn außergewöhnliche Persönlichkeiten aus der chilenischen Gesellschaft zu fotografieren, und er war einverstanden.
Ein Beamter mit dunklem Gesicht und Rasenmäherfrisur bittet sie um den Pass. In strenger Reihenfolge schaut er mehrmals auf ihr Gesicht, auf das Foto und auf den Computerbildschirm. Schließlich gibt er ihr den Pass zurück, schwingt sich zu einem Lächeln auf und wünscht ihr in demselben Singsang, den sie eben schon gehört hat, einen schönen Aufenthalt.
Durch die Scheibe zum Wartebereich sieht sie Joaquín, ihren ältesten Cousin, er ist der Einzige aus der Familie, dem sie ihr Kommen angekündigt hat. Neben ihm steht eine Frau. Joaquín löst sich von ihr und kommt auf Ana zu, mit diesem schaukelnden Gang der großgewachsenen Männer, bei denen alles zu Armen und Beinen wird. Die Frau wirft ihr blondes Haar zurück, und mit erhobenem Kinn wendet sie sich ab, schaut auf einen unbestimmten Punkt an der Scheibe. Sie hat eine ausgeprägte Nase, die ihrem Gesicht, im Profil, etwas Ungestümes verleiht.
»Willkommen, meine liebe Cousine …«, sagt Joaquín mit klarer, kraftvoller Stimme.
Hinter ihm bemerkt Ana die blauen Augen der Frau, ihr Blick ist jetzt auf sie und Joaquín gerichtet. Vielleicht wird deshalb aus einer vielversprechenden Umarmung ein unbeholfener Wangenkuss. Joaquín nimmt Anas Koffer, und sie gehen auf die Frau zu, die sie lächelnd erwartet, mit verschränkten Armen und hin- und herschwingendem Haar. Joaquín stellt sie einander vor, und Cata, seine Frau, die Ana noch nie gesehen hat, umarmt sie fest, so wie alte Freundinnen sich umarmen, die gemeinsam aufgewachsen sind und sich nach vielen Jahren wiedersehen.
Als sie dann beim Wagen sind, bestehen Joaquín und seine Frau darauf, dass Ana sich vorn hinsetzt, damit sie sich die Stadt besser anschauen kann. Eine Weile sprechen sie vom Flug, von der Verspätung, unterbrechen ungeschickt einer den anderen, bis Joaquín auf einmal, nach einer unbehaglichen Stille, sagt:
»Wir haben für dich ein Zimmer hergerichtet, es geht zum Garten hinaus, mit eigenem Eingang. Ich glaube, du wirst dich dort wohlfühlen.«
Rasch erklärt Ana ihnen, dass man ihr von London aus ein Zimmer im Sheraton reserviert hat.
»Aber das ist doch nicht nötig, bei uns hast du es viel schöner. Hotels sind so unpersönlich.« Joaquíns Stimme will freundlich klingen, aber die Enttäuschung ist ihm anzuhören. »Außerdem hat Cata alles getan, damit es dir an nichts fehlt. Du hättest sie mal sehen sollen, gestern war sie den ganzen Nachmittag bei Franklin und hat nach einer Nachttischlampe gesucht«, unterstreicht er noch, während er im Rückspiegel nach seiner Frau sieht.
Ein heiseres Kichern ertönt.
»Erzähl Ana nichts von Franklin, Joaquín, bei all den Antiquitätenhändlern, die es in London gibt: Portobello, Camden …«, sagt Cata, und dabei stößt sie einen wehmütigen Seufzer aus.
»Aber das Zimmer ist schon gebucht …«, versucht Ana es noch einmal.
»Ach was! Das hat sich in einer Minute geklärt, ich cancel das«, sagt Joaquín und greift nach dem Handy auf der Mittelkonsole.
»Vielleicht möchte sie ja ein wenig unabhängig sein«, schaltet Cata sich ein, recht bestimmt, noch ehe er auf die Tasten tippt.
Joaquín lässt ab von seinem Vorhaben, schaut im Rückspiegel wieder nach seiner Frau, in seinem Blick ist kein Lächeln. Cata hat sich bequem zurückgelehnt, sie macht nicht den Eindruck, als fühlte sie sich angesprochen. Er tritt aufs Gas.
Im Stillen dankt Ana Cata für ihren Beitrag, auch wenn sie ahnt, dass ihre Motive nicht gerade selbstlos sind. Das Letzte, was sie will, ist, von ihrer Familie absorbiert zu werden. Wenn sie nicht aufpasst, das weiß sie genau, hat sie im Nu einen Haufen Verpflichtungen am Hals.
Unterdessen hat es angefangen zu regnen. Sie fahren durch ein Santiago, das Ana nicht mehr kennt. Der Horizont ist dunkel, und auf dem nassen Asphalt spiegeln sich die Lichter der Autos. Die Geräusche des Verkehrs und des Regens dringen durch die Scheiben ins Wageninnere. In der Ferne leuchtet hier und da ein Licht auf, und nach und nach ragen die abgetrennten Köpfe der Hochhäuser hervor, kratzen am grauen Tuch des Himmels. Ana fragt nach den Kindern von Cata und Joaquín. Es sind drei. Daniela, die Älteste, Hernán und Francisco. Cata ist überrascht, als sie hört, was Ana über ihre Kinder alles weiß. Nicht nur, wie alt sie sind, sondern auch Dinge, an die sich nur jemand erinnern kann, der ihnen sehr nahesteht. Ana erklärt ihr, dass sie es von der Großmutter der Kinder hat, die ihr lange Briefe schreibt, Briefe, die sie mit größter Aufmerksamkeit liest, schließlich sind es die Kinder ihres liebsten Cousins. Bei diesen Worten zeigt Joaquín ein breites Lächeln, und sein Gemüt, noch angeknackst nach Anas Ablehnung ein paar Minuten zuvor, hellt sich ein wenig auf. Schon bald sind sie, fast ohne dass Ana es merkt, beim Sheraton.
Der Río Mapocho, dem Hotel gleich gegenüber, fließt trübe dahin, bleigrau.
*
Ana schreckt aus dem Schlaf auf. Da war ein schwarzes Gittertor in ihren Träumen, und sie kriegt das Bild nicht mehr aus ihrem Kopf. Dahinter ein Garten, Blumenbeete. Und in der Mitte dieses Gartens ein leuchtend weißes Haus vor tiefdunklem Grund, als hätte sich der Himmel aufgetan und ein Sonnenstrahl fiele von hoch oben genau darauf. Es ist das Haus ihres Großvaters, durch ein offenes Fenster im Erdgeschoss kann sie ihn erkennen, auf seinem Ledersessel, demselben wie immer, nur dass sich sein blauer, hellwacher Blick von früher jetzt in einer nicht existierenden Ferne verliert. Es sind vielleicht seine letzten Tage, und die Altersdemenz verleiht seinen Gesichtszügen etwas Gelöstes. In der Stille des Zimmers spielen die Sonnenstrahlen auf dem Holzfußboden. Auf dem Tisch neben der Terrassentür stehen eine Porzellantasse und ein Teller mit ein paar Scheiben Toast, Zeichen dafür, dass Teezeit ist. Ana denkt sich, dass eine einzige Bewegung genügen würde. Sie muss sich nur neben ihn setzen, seine Hände nehmen und diesen Moment festhalten, um endgültig zurückzukehren. Aber sie kann nicht. Oder will nicht. Das Bild des Großvaters löst sich auf, und vor ihren Augen, im Fenster des Hotels, erscheint der schwarze Himmel.
Der Großvater konnte damals nicht ahnen, dass dieses Mädchen, mit dem er stundenlang und bis ins kleinste Detail die Weltkarten betrachtete, einmal den Lebensunterhalt damit verdienen würde, an einem Ort einzuschlafen und an einem anderen wieder aufzuwachen. Und genauso wenig konnte er ahnen, dass diese Routen, die sich durch Meere und Gebirge, durch Wüsten und Wälder zogen, in dem Kind eine große Unruhe weckten, eine Abneigung gegen alles Starre, jeden Anker. Gut möglich, denkt Ana ein wenig traurig, dass Chile nach all den Jahren bloß eins dieser Länder ist, durch die sie gezogen ist. Eine Reise, bei der die Orte des Aufbruchs und der Rückkehr sich nicht von anderen Orten unterscheiden. Und dann wird auch Chile zu einer bloßen Anekdote, einer pittoresken Erinnerung.
*
Der Vormittag zeigt sich wolkenlos, auch wenn die Ruhe auf der Terrasse erahnen lässt, wie kalt es ist. Joaquín hat sie um zehn Uhr angerufen, er müsse sie so schnell wie möglich sehen, sagte er, und zwischen seinen Worten brodelte es vor Ungeduld. Jetzt scheint er ruhiger zu sein, denn während sie zum Speiseraum des Hotels gehen, bleiben sie sogar ein paarmal stehen, um Bekannte von ihm zu grüßen. Der Speiseraum ist fast leer, nur hier und da ein Geschäftsmann und ganz hinten vier Frauen, die sich, so wie sie schnattern, prächtig zu amüsieren scheinen. Als Ana und Joaquín Platz genommen haben, sehen sie, dass eine der Frauen ihre Serviette auf den Boden wirft und den Tisch verlässt, ohne sich von den anderen zu verabschieden. Auf ihren schwarzen Stöckeln schaukelt sie hin und her. Als sie an ihnen vorbeikommt, bleibt sie stehen und grüßt Joaquín überschwänglich, dabei wirft sie verstohlene Blicke in Richtung ihrer Freundinnen, die sie mit einer Mischung aus Spott und Wut beobachten.
»Hexen sind das«, sagt sie zu Ana gewandt. »Wenn du wüsstest, was die über dich erzählen. Du bist Ana Bulnes, nicht wahr?« Ana lächelt, bejaht, und die Frau spricht weiter. »Sie haben dich in der Zeitung gesehen.«
»Das kann nicht sein«, sagt Ana. »Keine vierundzwanzig Stunden hier und schon berühmt. Ich in der Zeitung?«
»Ich zeige es dir gleich«, schaltet Joaquín sich ein, versucht abzuwiegeln.
»Keine Sorge, Joaquín, sag der Catita, dass ich sie noch heute Nachmittag anrufe, ja? Also dann, ich gehe jetzt, diese Hexen haben mir die Laune verdorben.«
Die Frau entfernt sich mit ihrem Geschaukel, als wollte sie die im Raum schwebenden Tuscheleien der Freundinnen verwehen.
Als sie hinter den Türen des Speiseraums verschwunden ist, breitet Joaquín eine Zeitung auf dem Tisch aus. Doch Ana schaut nur auf die Fältchen, die seinen Mund konturieren.
»Hier, sieh mal«, drängt Joaquín sie, als er merkt, dass Ana sich nicht im Geringsten für die Zeitung interessiert.
Es ist ein Foto von Ana, aufgenommen am Flughafen. Die dunkle Brille und der lange schwarze Mantel, den sie sich aus der Garderobe ihrer Freundin Elinor ausgesucht hat, verleihen ihr eine tragische Note. Gar nicht so schlecht, denkt sie, ein Hauch von Schicksal ist nie verkehrt. Auf derselben Seite ist auch ein Foto ihrer Eltern, sie sehen aus wie verarmte Aristokraten.
»Das war wegen der Fußballspieler«, sagt Joaquín.
»Welche Fußballspieler?«, fragt Ana so verdutzt wie belustigt.
»Die in deinem Flugzeug saßen. Am Flughafen war ein Heer von Fotografen. Hast du sie nicht bemerkt?«
»Ehrlich gesagt, nein, ich habe nur euch gesehen. Na ja, mehr dich als Cata.«
Joaquín zeigt ein Lächeln, das sein Gesicht nicht auszufüllen vermag, so als schämte er sich, angesichts der Umstände Freude über ihre Worte zu verspüren.
»Einer von denen muss das Foto von dir gemacht haben, und dann muss irgendein Redakteur die Geschichte aufgezogen haben. Für eine Schlagzeile lassen die sich keine Gelegenheit entgehen«, sagt er bissig.
Ana nimmt die Zeitung und liest mit leiser Stimme den Artikel.
»Kretins sind das«, murmelt Joaquín.
»Nicht gleich so verbittert, mein Lieber. Wen kümmert’s. Wenn sie eine Story brauchen, bitte sehr, umso besser für mich. Dann bin ich schon bekannt, falls ich eines Tages wieder in Chile lebe. Außerdem, so schlecht komme ich gar nicht weg. Da steht, dass ich mit dem europäischen Adel verkehre und dass ich als Fotografin eine Berühmtheit bin«, und dann bricht Ana in schallendes Gelächter aus. In dem Moment kommt ein Kellner mit einer Kanne Kaffee.
»Dir ist wirklich egal, dass sie solche Sachen über meinen Onkel sagen?«, will Joaquín wissen.
»Über meinen Vater? Nein. Er ist ein bezaubernder Mensch. Ich mag ihn wirklich sehr, aber er hat nun mal einen Betrug begangen, und es ist kein Geheimnis, dass er aus Chile abhauen musste.«
»Wie cool du bist, Ana«, sagt er, auf Streit ist er nicht aus.
»Nein, cool sicher nicht. Ich habe nur schon eine Menge mitgemacht, das reicht. Ich will nicht so tun, als wäre ich irgendjemandes Opfer.«
An Joaquíns Hals bemerkt sie ein leichtes Zittern.
Zum Glück für Ana lenkt ihr Cousin das Gespräch in eine andere Bahn. Er spricht von den Zeiten, die der »Flucht« vorangingen, wie einige es nannten, dem »selbstgewählten Exil«, so andere, dieser Zeit, nach der er sich sehnt, sagt er, als sie beide noch Kinder waren und der Großvater ihnen mit hochtrabenden Worten von der Freiheit erzählte, der echten Freiheit, wobei er sich über den Schnurrbart strich, der so glatt und dicht war wie das Fell einer Katze. Irgendwann fragt Ana ihn nach Cata. Eine sehr gutaussehende Frau, sagt sie, und Joaquín stimmt mit einem angedeuteten Lächeln zu. Sie sprechen auch von den Kindern, aber gleich sind sie wieder zurück in der Vergangenheit. Ana hat den Eindruck, dass Joaquín etwas verbirgt, es kommt ihr merkwürdig vor, wie prompt und ausweichend er auf ihre Fragen antwortet, kaum dass es um sein Leben, seine Familie, seine Arbeit geht, und dabei betont er, dass er nicht nur ein angesehener Augenarzt ist, sondern drei reizende Kinder hat, die er über alles liebt, eine in vielerlei Hinsicht beispielhafte Frau und ein ruhiges Leben, nein, da gebe es nicht viel mehr zu erzählen, viel lieber würde er ihr zuhören, mehr darüber erfahren, wie für sie diese einundzwanzig Jahre gewesen sind, in denen sie sich aus den Augen verloren haben. Er will wissen, wie das so ist, wenn man ein Leben führt wie sie, ohne Familie, wenn man mit einem Fotoapparat durch die Welt zieht und sich vor nichts und niemandem zu verantworten hat. Ana muss lachen, als sie hört, wie Joaquín ihr Leben beschreibt, eine Beschreibung, die dieses Leben zu einer Karikatur macht, auch wenn es gar nicht so weit von der Wirklichkeit entfernt ist.
»Also ehrlich, die drei an dem Tisch da hinten machen sich nicht mal die Mühe, ihr Interesse an uns zu verbergen«, flüstert Ana und deutet mit einem maliziösen kleinen Schwenk ihrer Augen auf sie.
»Das sind Freundinnen von Cata. Na ja, Cata hasst sie und vergöttert sie. Wirklich zum Lachen, bestimmt machen sie sich schon ihren Reim.«
»Dass ich deine Geliebte bin, zum Beispiel.«
»Genau.«
»Und das stört dich?«
»Nein, überhaupt nicht. Es amüsiert mich.«
»Dann sollen sie sich auch amüsieren«, sagt Ana, beugt sich über den Tisch und gibt ihm einen Kuss. Joaquíns Lippen sind sanft. Beim Kontakt mit ihren Lippen haben sie gezittert, haben aus den Erinnerungen einen früheren Kuss geborgen.
Der Flug nach London ging am nächsten Tag, und sie verabschiedeten sich versteckt unter der Treppe. Ana weiß noch genau, wie sie ihn an den Schultern fasste, die Augen schloss und ihre Lippen lange auf die seinen legte, so wie wenn man versucht, einen Geschmack zu erkennen oder die Erinnerung an einen Duft zu bewahren. Und dann drückte sie ihn an sich. Unter dem Hemd schlug Joaquíns Herz wie wild drauflos. Nach ein paar Sekunden löste sie sich von ihm und rannte davon. Ihre Eltern verabschiedeten sich an der Tür von ihr. Ana umarmte den Großvater. Joaquín war an der Treppe stehen geblieben und schaute zu ihr hin. Als sie ihn so sah, sein blasses Gesicht, erschrak sie, seine Augen waren tränenfeucht, sein weißes Hemd hing aus der Hose heraus. Er sah krank aus, und Ana dachte schon, er würde sterben. Wann immer ihre Eltern einen Brief aus Chile erhielten, fragte sie, ob jemand aus der Familie gestorben sei. Ihr Vater verzog das Gesicht und antwortete, sie sei wohl nicht richtig im Kopf. Ihre Mutter aber sah sie an und zitterte am ganzen Leib.
»Du bist immer noch dieselbe«, hört sie Joaquíns Stimme.
»Ist das jetzt gut oder schlecht?«
»Dieser Kuss bringt uns noch in die Bredouille …«, sagt Joaquín ein wenig schelmisch. Seine Augen glänzen. Er macht den Mund auf, will etwas sagen, doch dann hält er inne.
»Was ist, na los, was wolltest du mir sagen«, insistiert Ana.
Er schüttelt den Kopf, will nicht weitersprechen. Doch angesichts ihrer Beharrlichkeit fragt er:
»Erinnerst du dich an diese Kladde? Dein Tagebuch.«
»Was weißt du von meinem Tagebuch?«
Und Joaquín erzählt ihr, immer wieder unterbrochen von kurzen, ansteckenden Lachanfällen, dass Tante Estella, Anas Mutter, die das Tagebuch gefunden hatte, es als Allererstes seiner Mutter zeigte. Beide Frauen schlossen sich in einem Zimmer ein, und dann las Tante Estella laut vor. Joaquín, der sich rückblickend dermaßen schämt, dass Ana lächeln muss, erklärt ihr, dass er so etwas vorher nie gemacht hat, an dem Tag aber habe er an der Tür gelauscht, um zu hören, was sie sagten.
»Tante Estella hat andauernd gestockt und irgendwelche Stoßseufzer von sich gegeben à la: Wie kann meine Tochter nur so versaut sein! Meine Mutter wollte sie beruhigen, hat sie aber auch gedrängt weiterzulesen. Bald konnte sie nicht mehr aufhören, sie las wie eine Verrückte«, Joaquín prustet jetzt vor Lachen. »Ich glaube, so geil waren sie in ihrem ganzen Leben nicht.«
»Und du?«
»Ich auch.«
Die drei Frauen am hinteren Tisch haben um ihre Mäntel gebeten. An Eleganz mangelt es ihnen nicht. Es ist diese wohldosierte Eleganz, die die Frauen einer bestimmten Gesellschaftsschicht überall auf der Welt auszeichnet. Das übertriebene Make-up jedoch und die gepflegten Frisuren verleihen ihnen, zumindest in Anas Augen, etwas eindeutig Lokales.
»Es mag dich verwundern, aber dein Tagebuch ist bei mir, und ich finde es immer noch, wie soll ich sagen … na ja, unglaublich erotisch.«
Der Satz schwebt noch im Raum, als die drei Frauen auf ihren Tisch zukommen. Wahrscheinlich haben sie die letzten Worte gehört, denn sie wechseln verstörte, verschwörerische Blicke.
Joaquín steht auf und grüßt sie. Ana beobachtet ihn. Alles an ihm ist so korrekt, dass es schon künstlich wirkt. Nachdem er eine jede mit einem Lob bedacht und sich zu mehr als einem Lächeln hat hinreißen lassen, stellt er Ana als die »verlorene und wiedergefundene« Cousine vor, und für sie klingt es wie die Schätze des Indiana Jones.
»Und Catita, wie geht es ihr? Wir haben sie ja schon ewig nicht mehr gesehen bei unserem Donnerstagsfrühstück, ist etwas mit ihr?«, fragt eine der Frauen, und dabei springt ihr Blick zu Joaquíns Augen, um dann spitz in die von Ana einzufallen.
»Nein, nichts. Du weißt ja, sie hat alle Hände voll zu tun mit der Winterkollektion.«
»Wir haben dich in der Zeitung gesehen«, bemerkt eine andere in Richtung Ana, von Höflichkeit keine Spur.
»Ja, ich weiß, Joaquín hat es mir gezeigt«, sagt Ana und lächelt.
»Ist das nicht schrecklich? Da kommt man an und hat gleich eine solche Öffentlichkeit.«
»Ehrlich gesagt, mir ist das egal«, sagt Ana und wuschelt sich demonstrativ durchs Haar.
»Ich an deiner Stelle wäre nicht so ruhig, du hast ja keine Vorstellung, wie es zugeht in diesem Land«, meint eine andere in vertraulichem Ton.
»Tatsächlich? Das würde mich interessieren«, sagt Ana, sie ist amüsiert über den Verlauf, den die Unterhaltung genommen hat.
»Na ja, jedes Thema wird hier gleich zu einem Skandal, schrecklich«, fährt die Frau fort und versucht, die Verärgerung in ihrem Gesicht in Einklang zu bringen mit ihrer gespielten Verbundenheit.
»Ich denke nicht, dass ich ein besonders interessantes ›Thema‹ bin, ich bin eher langweilig.«
»Ach ja?«, fragt die Frau mit leisem Spott.
»Definitiv«, sagt Ana.
»Das glaube ich nicht«, widerspricht eine der anderen und wirft einen Blick zuerst zu Ana und dann zu Joaquín.
In dem Moment verabschiedet sich die schickste der Frauen, die die Gruppe anzuführen scheint, von Joaquín, und die beiden anderen folgen ihr.
Als die drei verschwunden sind, brechen Joaquín und Ana in schallendes Gelächter aus.
»Ich sage es ja«, japst Joaquín, immer noch lachend. »Sie können es einfach nicht fassen.«
»Wegen dem Kuss?«
»Das sind professionelle Klatschmäuler, da ist es egal, was wir gemacht haben, die hätten uns sowieso durch ihre Mühle gedreht.«
Nach einer Pause fängt Joaquín wieder an.
»Nur eins verstehe ich nicht, Ana. Woher hattest du diese Sachen?«
»Welche Sachen?«
»Die du in deinem Tagebuch beschrieben hast.«
»Alles ausgedacht.«
»Aber das waren Einzelheiten, die ein dreizehnjähriges Mädchen nicht wissen kann.«
»Wusste ich auch nicht. Man fragt ja auch niemanden, woher er weiß, wie man isst oder trinkt. So was weiß man einfach.«
»Mit dem Unterschied, dass du es in dein Tagebuch geschrieben hast.«
»Ich nehme an, das ist der Unterschied zwischen einem Verrückten und einem Vernunftbegabten.«
»Und der besteht noch mal worin?«
»Der Vernunftbegabte sagt weder, was er denkt, noch, was er fühlt.«
»Ein Lügner also.«
»Ein vorsichtiger Mensch, würde ich sagen.«
»Dann gehöre ich zweifellos zu dieser Gruppe. Meine verwegenste Tat war, einen Sommer lang im Haus von Großvater zu bleiben, statt mit meinen Freunden in Urlaub zu fahren. Erinnerst du dich? Das war eine einzigartige Gelegenheit. Nachts habe ich in deinem Tagebuch gelesen, und tagsüber war ich der ältere Cousin, den alle dafür bewunderten, mit welcher Geduld er den jüngeren Cousins und Cousinen Pirouetten im Wasser beibrachte. Besonders dir, klar.«
»Schwein!«
»Aber das wusstest du nur allzu gut«, sagt er und streicht sich mit den Fingern durchs Haar. »Du hast dein Handtuch ein paar Meter neben meins gelegt und dich von oben bis unten eingecremt, natürlich ohne auch nur ein einziges Mal zu mir rüberzuschauen. Du warst echt ein grausames Mädchen.«
»Bin ich noch«, sagt Ana.
In Ana steigen noch einmal dieselben Gefühle auf wie an jenem Nachmittag, als ihre Mutter mit dem Tagebuch nach Hause kam. Ana hatte es unter ihrem Kopfkissen verwahrt, und nie hätte sie gedacht, dass jemand so unverschämt sein könnte, es ohne ihre Erlaubnis dort hervorzuholen. Ein solches Eindringen in ihre Privatsphäre erschien ihr noch schamloser, perverser und kranker (Wörter, mit denen ihre Mutter sie bedachte) als die Geschichten, die sie in dem Tagebuch erzählte. Nach ihrer Tirade packte die Mutter Ana am Handgelenk und schleifte sie ins Badezimmer, ließ die Wanne einlaufen, zog sie aus und steckte sie kurzerhand hinein, das Wasser war brodelnd heiß. Mit einer Wäschebürste schrubbte sie sie ab, dabei sagte sie immer wieder, sie sei ein Schwein.
Joaquín erzählt jetzt, wie Tante Estella am nächsten Tag erneut mit dem Tagebuch kam und wie die beiden es, nachdem sie es bis zum Ende gelesen hatten, in den Mülleimer warfen. Nur haben sie nie erfahren, und Ana wusste es bis zu diesem Moment auch nicht, dass Joaquín das Tagebuch damals an sich nahm. Er hat es noch immer und verspricht, es ihr zurückzugeben.
Die Erinnerung an ihre Mutter und wie sie sie von oben bis unten abschrubbte, hat sie durcheinandergebracht. Zum Glück sprechen sie bald vom Haus des Großvaters. Das Haus steht seit zwei Jahren zum Verkauf, und wie Joaquín sagt, ist der verlangte Preis so hoch, dass niemand sich dafür interessiert. Er schlägt vor, zusammen hinzugehen, bevor sie wieder fährt.
»Das würde ich unheimlich gern«, sagt Ana und seufzt, sie muss an dieses seltsame nächtliche Traumbild denken.
»Für wie lange bist du hier?«, fragt Joaquín auf einmal, ohne ihr in die Augen zu sehen, und dabei zieht er sein Portemonnaie aus der Jackentasche. So beiläufig er es dahinsagt, bemerkt Ana doch eine kleine Unruhe in seiner Stimme.
»Willst du mich schon wieder loswerden?« Ana lacht. »Also, länger als eine Woche sollte ich für die Reportage nicht brauchen. Mehr bezahlt mir die Zeitung nicht. Sieben Nächte im Hotel, damit hat sich’s. Außerdem erwartet mich drüben ein Haufen Arbeit.«
Joaquín sagt, es sei schon spät, er müsste längst in seiner Praxis sein. Als er sich den Mantel übergezogen hat, teilt er Ana noch mit, dass es am Sonntag bei ihm zu Hause ein großes Familienessen für sie geben wird.
Ana sieht ihm nach, sieht, wie er sich mit seinem schlotternden Gang eines großgewachsenen Mannes entfernt. Sie bestellt einen Martini, zündet sich eine Zigarette an. Sie wollte es ihm nicht sagen (vielleicht, um dieser Wehmut, die in zarten Wellen in ihr aufgestiegen ist, nicht die Tore zu öffnen), aber er hat sich genauso wenig verändert. In seinem Lachen schwingt noch dieselbe Schüchternheit und Aufrichtigkeit mit wie damals. Und dennoch, sosehr sie diese gemeinsamen Erinnerungen genossen hat, spürt sie eine gewisse Distanz, als beträfen all die Anekdoten nicht sie, sondern jemand anderes. Sie muss an eine Erzählung von Henry James denken, die sie vor ein paar Monaten gelesen hat. Darin kehrt ein Mann nach mehr als dreißig Jahren in Europa zurück nach New York. Kaum angekommen, wird für ihn die Frage zur fixen Idee, was aus ihm geworden wäre, wenn er zu Hause geblieben wäre. Er fragt sich sogar, wer er bei seiner Abreise nicht länger war, und vor allem, ob seine Abwesenheit ihn zu einem besseren oder schlechteren Menschen gemacht hat als der, der er hätte sein können.
Bisher hat Ana sich die Frage noch nicht gestellt, aber sie nimmt an, dass all das, dieses Zurück zu den Wurzeln, die Zugehörigkeit, bloß abstrakte Begriffe sind. Denn was man für lange Zeit hinter sich lässt, bleibt niemals intakt, schlimmer noch, meist verschwindet es. Und sosehr sie es sich vielleicht wünscht, ist es unmöglich, nach einundzwanzig Jahren zurückzukommen und zu erwarten, dass im Haus des Großvaters die Fenster zur Sonne hin offen stehen oder dass es nach diesem schwarzen Tabak riecht, den alle so hassten und der sie dazu brachte, von fernen Ländern zu träumen; unmöglich, am selben Ort die Bücher über Schiffe und Galaxien vorzufinden und die Stimme von Großvater zu hören, wie er ihr die in den Himmel gezeichneten Wege aufzeigt. Die Wirklichkeit ist vergänglich, denkt sie. Ihre eigene besteht aus tausend Inseln, die es ihr erlauben, von einer zur anderen zu hüpfen oder zu fliehen, wenn eine von ihnen unerträglich wird oder langweilig. Lebendig hält sie allein, und hier meldet sich ihr Optimismus zurück, diese Möglichkeit, sich zu verwandeln, in Bewegung zu sein.