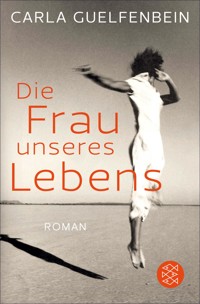
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wie stark darf man in das Leben eines anderen Menschen eingreifen? In ihrem internationalen Bestseller erzählt Carla Guelfenbein einfühlsam von einer Dreiecksbeziehung, die sich zwischen tiefer Freundschaft, Liebe und Verrat bewegt. Ein überraschender Anruf, eine Einladung nach Chile – das Land, das der rastlose Kriegsreporter Theo bisher zu meiden gewusst hat: zu viele mühsam verdrängte Erinnerungen an eine Freundschaft, an eine Frau. Kurz entschlossen tritt Theo die Reise an, ohne damit zu rechnen, dass er an Antonios Seite die Frau finden wird, die er nie hat vergessen können: Clara. Nur vorsichtig tasten sich die drei an ihre gemeinsame Vergangenheit heran und an den Sommer 1986, als ihre Freundschaft jäh zerbrach. Sie hatten sich an der Universität von Essex kennengelernt: Theo, aus guter englischer Familie stammend, und der charismatische Exilchilene Antonio. Dessen unangepasster Blick und kämpferische Reden eröffnen Theo eine neue Welt, und zwischen den beiden Männern entwickelt sich eine intensive Freundschaft, in der kaum Platz für andere Menschen bleibt. Antonio, der vermeintlich Starke, ist besessen von dem Gedanken, in sein Heimatland zurückzukehren und dort wie sein vom Militär getöteter Bruder gegen die Diktatur zu kämpfen. Gerade er aber trägt schwer an der Liebesbeziehung zwischen seiner engsten Freundin, der Tänzerin Clara, und Theo. In einer rauschhaften Nacht begeht Antonio nicht nur Verrat an Theos Freundschaft, er stellt ihn auch vor die schwierigste Entscheidung seines Lebens.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 338
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Carla Guelfenbein
Die Frau unseres Lebens
Roman
Über dieses Buch
Sie hatten sich an der Universität von Essex kennengelernt: Theo, aus guter englischer Familie stammend, und der charismatische Exilchilene Antonio. Dessen unangepaßter Blick und kämpferische Reden eröffnen Theo eine neue Welt, und zwischen den beiden Männern entwickelt sich eine intensive Freundschaft, in der kaum Platz für andere Menschen bleibt. Antonio, der vermeintlich Starke, ist besessen von dem Gedanken, in sein Heimatland zurückzukehren und dort wie sein vom Militär getöteter Bruder gegen die Diktatur zu kämpfen. Gerade er aber trägt schwer an der Liebesbeziehung zwischen seiner engsten Freundin, der Tänzerin Clara, und Theo. In einer rauschhaften Nacht begeht Antonio nicht nur Verrat an Theos Freundschaft, er stellt ihn auch vor die schwierigste Entscheidung seines Lebens.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Carla Guelfenbein, geboren 1959 in Santiago de Chile, gehört zu den erfolgreichsten Autorinnen ihres Landes. Als Reaktion auf das Regime Pinochets verließ sie als junge Frau Chile und studierte in England Biologie und Design. Heute lebt sie als Schriftstellerin und Drehbuchautorin wieder in ihrer Heimat. Ihre Romane wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt. Bei S. Fischer sind bereits erschienen »Der Rest ist Schweigen«, »Nackt schwimmen« und Guelfenbeins letzter Roman, »Stumme Herzen«, für den sie mit dem renommierten Premio Alfaguara ausgezeichnet wurde.
Thomas Brovot übersetzt aus dem Spanischen und Französischen (u. a. Juan Goytisolo, Federico García Lorca, Mario Vargas Llosa, Severo Sarduy) und lebt in Berlin. Seine Arbeit wurde mit dem Übersetzerpreis der Spanischen Botschaft und dem Helmut-M.-Braem-Übersetzerpreis ausgezeichnet.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die Originalausgabe erschien 2005 unter dem Titel »La mujer de mi vida« bei Alfaguara/Aguilar Chilena de Ediciones S.A., Santiago de Chile
© 2005 by Carla Guelfenbein. All rights reserved.
Für die deutschsprachige Ausgabe: © 2018 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: bürosüd, München
Coverabbildung: Charley Stadler
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-490340-8
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Widmung
Claras Tagebuch, Juli 1986
I Dezember 2001
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
II Sommer 1986
5. Kapitel
Claras Tagebuch
6. Kapitel
7. Kapitel
Claras Tagebuch
8. Kapitel
Claras Tagebuch
9. Kapitel
Claras Tagebuch
10. Kapitel
Claras Tagebuch
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
Claras Tagebuch
15. Kapitel
Claras Tagebuch
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
Claras Tagebuch
19. Kapitel
Claras Tagebuch
20. Kapitel
Claras Tagebuch
21. Kapitel
III Zurück
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
Dank
Für meine Eltern und meine Kinder
Isidoro, Eliana, Micaela und Sebastián
Antonio singt, Theo singt, ich singe. Alles leuchtet auf und verschwindet auf unserem Weg, die Gärten mit ihren Lauben, die Kastanienalleen, die Blätter im Spiel des Lichts. England gleitet vorüber wie ein flüchtiger Vorhang. Ich gebe mich der Freude hin, dass ich lebe, genieße das Gefühl, dass wir Freunde sind. Viele Gewissheiten habe ich nicht, aber eins weiß ich sicher: wir sind zu dritt, und dieser breite Strom der Zeit, der vor uns hinfließt, ist mächtig, und er gehört uns.
Claras Tagebuch, Juli 1986
I
Dezember 2001
1
Zwei Männer ließen Antonios Sarg in die Grube hinab und bedeckten ihn mit Erde. Clara pflückte eine Blume und warf sie ins Grab. Ich wollte sie umarmen, aber etwas an ihr hielt mich zurück. Besser gesagt, alles an ihr hielt mich zurück. Ich steckte die Hände in die Hosentaschen, um dem Drang zu widerstehen. Der Wind frischte auf, in der Ferne begann der See Wellen zu werfen. Ein Blitz kündigte das Gewitter an. Wir stiegen den Hang hinab, auf einem von Efeu überwachsenen Pfad, Clara vorneweg, mit erhobenem Kopf und unerforschlicher Miene. Ohne den Regen hätte man uns wahrscheinlich für Ausflügler gehalten. Ich ging langsamer, um mich von den anderen zu lösen. Hätte jemand mein Schweigen durchbrochen und mich gefragt, warum ich hier sei, hätte ich ihm nicht sagen können, dass Antonio der beste Freund war, den ich je hatte, dass wir uns vor fünfzehn Jahren verraten und seitdem nicht mehr gesehen hatten.
Hinter einer Wegkehre blieb unsere kleine Gesellschaft stehen. Clara drehte sich um und schaute mir in die Augen. Den ganzen Tag hatte ich darauf gewartet, dass sie mich wahrnahm, aber in dem Moment wusste ich nichts anzufangen mit diesem Blick. Wenige Sekunden nur, dann ging sie weiter. Kaum hatte sie ein paar Schritte getan, quoll ihr etwas Gelbliches aus dem Mund. Ihre Mutter versuchte noch, sie zu stützen, während wir anderen verdutzt dastanden und zusahen, wie Clara in den Matsch fiel. Ich hätte nie gedacht, dass etwas so weh tun kann.
2
Drei Tage vorher hatte ich ein Flugzeug nach Chile genommen. Es war das erste Mal, dass ich in Antonios und Claras Land reiste. Als Reporter hatte ich öfter die Gelegenheit gehabt, aber jedes Mal drückte ich mich und schaffte es, den Erinnerungen aus dem Weg zu gehen. All die Jahre hatte ich mir den Kopf mit unmittelbareren Erlebnissen vollgeschlagen. Doch eine einzige kleine Geste genügte, und meine Entschlossenheit fiel in sich zusammen. Eine Geste, der ich machtlos gegenüberstand wie einem Naturereignis. Ich begriff es, kaum dass ich ihn hörte, plötzlich am Telefon, nach fünfzehn Jahren, Antonio mit seiner drängenden Stimme.
»Theo, weißt du nicht mehr, wer ich bin?«, fragte er, als ich schwieg.
Bald hatte sich meine Verwirrung so weit gelegt, dass ich die üblichen Fragen stellen konnte. Und während ich ihm zuhörte, kamen die Erinnerungen auf schneidenden Schwingen herbeigeflogen, klar wie am ersten Tag. Einmal wollte ich schon auflegen, tat es aber nicht. Vielleicht aus Höflichkeit, vielleicht aus Neugier, oder es war meine Schwäche, die mich zurückhielt. Ich hörte nicht nur weiter zu, ich nahm auch seine Einladung an, die Weihnachtstage in Chile zu verbringen.
Ich war drauf und dran, mich zu rechtfertigen und ihm zu sagen, dass das Fest ohnehin vor der Tür stand und ich dann wahrscheinlich allein sei. Rebecca, die Mutter meiner Tochter Sophie, hatte mir ein paar Tage vorher eine Mail geschickt und mit Hunderten von Wörtern, wo zehn genügt hätten, erklärt, dass Sophie dieses Jahr Weihnachten nicht bei mir in London verbringen könne. Russell, der wohlhabende Texaner, mit dem sie in Jackson Hole lebte, feiere seinen sechzigsten Geburtstag. Es sah ganz so aus, als würde mein Weihnachtsfest zu einer winterlichen Reise durch die kläglichsten Aspekte eines Lebens als Single.
Ich sagte ja, ohne zu überlegen oder die Folgen zu bedenken, ohne mich zu fragen, warum Antonio mich nach all diesen Jahren ans Ende der Welt einlud, wie er es nannte. Ich sagte ja, ohne mich an die Mühe zu erinnern, die es mich gekostet hatte, das alles zu vergessen, ohne mich auch nur zu fragen, ob Clara auch da sein würde.
Zwei Wochen später schloss ich meine Wohnungstür und reiste nach Chile. Im Flugzeug trank ich gleich ein paar Whiskys und nahm eine Schlaftablette. Nach einem Zwischenstopp in Santiago landete ich an einem Nachmittag in Puerto Montt. Es war der 24. Dezember. Während ich am Gepäckband auf meinen Koffer wartete, wurde mir klar, dass die Heftigkeit, mit der mir das Herz durch die Brust jagte, einen Grund hatte. Ich war nicht vorbereitet auf das, was mir bevorstand. Nicht auf die Begegnung mit Clara und noch weniger darauf, sie zusammen zu sehen. Warum hatte Antonio sie nicht erwähnt?
Als ich sie kennenlernte, war sie erst zwanzig gewesen. Jetzt, fünfzehn Jahre später, war ihr Körper einer Tänzerin noch der gleiche, nur ihre sanften Züge waren gereifter, ausgeprägter. Ich umarmte sie höflich. Alle Gefühle waren aus meinem Körper gewichen, ein Schutz gegen die Lächerlichkeit.
»Ich kann es kaum glauben, dass du da bist«, sagte sie und zog mich an sich.
Antonio klopfte mir auf die Schulter, und wie aus einem Impuls heraus umarmte er mich. Wir besahen uns, erforschten uns, wünschten uns mehr oder weniger bewusst, es möge der andere sein, an dem die Zeit die tieferen Spuren hinterlassen hatte. Antonio war immer noch eine imposante Erscheinung. Zwar hatte er nicht zugenommen, doch eine gewisse Schwere in seinen Bewegungen deutete auf ein gesetztes Leben.
Wir stiegen in einen Pick-up und sprachen während der Fahrt von meinem Flug, von dem Ort, zu dem wir fuhren, und wie angenehm es doch war, die Feiertage fern der Stadt zu verbringen. Clara saß auf dem Rücksitz. Als ich mich zu ihr umdrehte, blitzte die Abendsonne auf ihrer dunklen Brille, und ich konnte ihre Augen nicht sehen. Bei der ersten Gelegenheit erzählte ich ihnen von meiner Tochter. Ich zeigte ihnen sogar ein Foto von Sophie. Ich musste es tun. Beide sollten wissen, dass ich nicht allein auf der Welt war. Außerdem wollte ich gleich die Karten auf den Tisch legen und wünschte mir, sie täten es auch. Doch nichts von dem, was Antonio sagte, gab mir eine Vorstellung von ihrem Leben oder davon, was sie heute verband. Er erzählte scheinbar unbedeutende Anekdoten und verlor sich in Einzelheiten, an denen er seine Freude zu haben schien, die für mich aber keinen Sinn ergaben. Es war, als beträte ich ein Labyrinth, ohne einen Faden, der mich wieder herausführte. Derweil schien Clara, ein stilles Lächeln auf den Lippen, meine Verwirrung zu genießen, die Fallen, die Antonio mir wie Minotaurus stellte, um mich, seine Beute, zur Verzweiflung zu bringen. Seit ich sie im Flughafen gesehen hatte, folgte ich jeder ihrer Bewegungen, wartete nur darauf, dass ihre Körper sich berührten, dass ein Blick mir verriet, welcher Art ihre Beziehung war. Immerhin erfuhr ich, dass Clara das Tanzen aufgegeben hatte und nun Kinderbücher schrieb und illustrierte. Ich musste an die vielen Zeichnungen in ihrem roten Tagebuch denken, das sie immer bei sich gehabt hatte.
Die Straße wurde zu einer kaum befestigten Piste, einem Auf und Ab durch eine Hügellandschaft mit Wäldern und Wiesen. Die Sommerhäuser verschwanden und wichen einer Hütte hier und da, aus deren einzigem Fenster uns ein dunkles Augenpaar vorbeifahren sah. Nach unzähligen Kurven und Steilstücken kamen wir auf eine Anhöhe, wo ein kleines Holzhaus stand. Unter uns sah ich den blauen Spiegel eines Sees.
Wenn Antonio mich zu seinem Refugium brachte, dem Ort, den er mit Clara teilte, wollte er sich vielleicht an mir rächen, ging es mir durch den Kopf.
Im Haus erwarteten uns Marcos, ein alter Freund von Antonio, den ich in London kennengelernt hatte, und Pilar, seine Frau. Sie waren in fröhlicher Stimmung, offenbar hatten sie schon vor einer Weile mit dem Weihnachtsfest begonnen. Das Haus war nicht sehr groß, auch wenn die Fensterfront, die zum See und zu den Hügeln hinausging, einem das Gefühl von Weite gab. Gewöhnt an die schmalen Fenster der englischen Landhäuser, war mir diese plötzliche Offenheit fast unangenehm. Ein Sofa mit allerlei bunten Kissen dominierte das Wohnzimmer. An einer Wand hing das Blatt eines Flugzeugpropellers.
Marcos stürzte mit einer so unbeherrschten Bewegung auf mich zu, dass er beinahe das Gleichgewicht verlor. Mit seinem lässig über die Schulter geworfenen Pulli, der gebräunten Haut und dem vollen grauen Haar hatte er etwas von einem gereiften Gigolo, ganz anders als der Revolutionär, den ich in London kennengelernt hatte.
Kurz drauf zeigte Antonio mir mein Zimmer. Nur ein Bild hing in dem Raum: ein Stich, Darwin im Gespräch mit den Eingeborenen Patagoniens. Zwei ovale Spiegel an den Türen eines Schranks spiegelten unsere Körper. Während ich ein paar Sachen aus dem Koffer nahm, setzte sich Antonio aufs Bett und schaute aus dem Fenster.
»Ich weiß nicht, warum ich mir das immer vorgestellt habe«, sagte er.
»Was vorgestellt? Den Ort hier, unser Treffen?«, fragte ich verwirrt.
»Bestimmt habe ich dir einmal das Gedicht von Horaz vorgelesen, das er an seinen besten Freund schrieb. Darin erzählt er von einem Ort, Tibur, wo er im Alter einmal zur Ruhe kommen will. Erinnerst du dich?«
»Ja, zum Teil. Würdest du mich nach Gades begleiten …«
»Nach Kantabrien, zu den wilden Syrten … Ans Ende der Welt. Erinnerst du dich an den Schluss?«
»Ehrlich gesagt, nein.«
»Dort wirst du die warme Asche deines Dichterfreundes einst mit schuldgen Tränen netzen.«
»Du und deine Klassiker. Du hast dich kein bisschen verändert«, sagte ich.
Er lachte schallend, stand auf und umarmte mich.
»Zum Glück, meinst du nicht? Auf dass manche Dinge sich niemals ändern«, sagte er und machte ein zufriedenes Gesicht.
3
Ich bin sicher, dass jeder Moment alle zukünftigen in sich birgt, nur dass wir sie noch nicht entziffern können. Erst im Rückblick tritt zutage, wie die Dinge sich im Verborgenen fügen, und dann sagen wir uns, dass alles auf die Art geschehen ist, wie es geschehen musste. Ein aufmerksameres Auge, das in der Lage wäre, das Unsichtbare zu durchschauen, hätte die Zeichen wahrgenommen. Doch abgesehen von dem kryptischen Gespräch mit Antonio deutete nichts darauf hin, was Tage später geschehen sollte.
Kaum hatte Antonio mich im Zimmer allein gelassen, rief ich Sophie an, um ihr frohe Weihnachten zu wünschen. Begeistert erzählte sie, dass es bei Russells Fest ein Feuerwerk und Musiker gebe und dass der Weg zum Fluss dann mit bunten Sternen beleuchtet sei. Sie fragte mich, ob mein Geschenk noch heute komme oder ob sie bis morgen warten müsse. Bei all der Hektik meiner Reise nach Chile und der Unruhe, in die sie mich versetzte, hatte ich vergessen, es ihr mit einem Paketdienst zu schicken. Das passierte mir nicht zum ersten Mal. Ihre Stimme wurde schärfer. Ich sah sie vor mir, wie sie im Stolz ihrer acht Jahre die Nase reckte. Sie sagte, sie müsse jetzt noch etwas fertig machen, ich solle sie später anrufen. Sophies Stimme und ihre verdeckten Vorwürfe, wie sie für Erwachsene so typisch sind, verstörten mich. Es war nicht leicht, aus der Ferne Vater zu sein. Jede Nachlässigkeit, jedes Wort, im Alltag ohne größere Bedeutung und jederzeit umkehrbar, bekamen ein Gewicht, das ich nur schwer wieder ausgleichen konnte.
Antonio, Marcos und Pilar erwarteten mich auf der Terrasse. Clara war zum See hinunter schwimmen gegangen.
»Hier, von Clara«, sagte Antonio und reichte mir einen Pisco Sour, »hat sie extra für dich gemacht.«
Von weitem sah ich Clara ins Wasser steigen. Ich musste an ihre wohlgeformten Tänzerinnenbeine denken, ihren Bauch mit den festen Muskeln an den Seiten und ihre wunderbaren Brüste. Nichts davon konnte ich auf die Entfernung erkennen, aber es kam mir in den Sinn wie Tausende Male zuvor in all diesen Jahren.
Die untergehende Sonne entflammte die Landschaft und enthüllte jedes Detail: die rötlichen, gewundenen Stämme der Myrtenbäume, das satte Grün der Boldosträucher, das Filigran der Südbuchen, deren Namen Antonio aufzählte, als nähme er sie mit dem Bezeichnen in Besitz. Dann sahen wir Clara den Hang heraufkommen, und so, wie er es mit den Bäumen getan hatte, nannte Antonio ihren Namen: »Clara.« Er nahm sein Glas am unteren Ende, hielt es sich vors Auge und folgte ihr durch das trübe Glas.
»Alles in Ordnung?«, fragte sie in die Runde, als sie zu uns auf die Terrasse kam. Und dann, zu mir gewandt: »Entschuldige, dass ich einfach gegangen bin, Theo, ich dachte, ihr wollt bestimmt einen Augenblick allein sein.«
Ich merkte, dass sie es war, die erst einmal allein sein musste. Vielleicht war die ganze Situation für sie genauso schwierig wie für mich. Mir gegenüber war sie jedenfalls im Vorteil. Sie hatte von meinem Besuch gewusst, während ich es immer noch nicht schaffte, ihren unerwarteten Anblick zu verdauen.
Clara und Pilar gingen in die Küche. Ich trank meinen Pisco Sour und folgte ihnen. Ich dachte, ich könnte ihnen helfen, aber beide winkten ab. Durchs Fenster sah ich die weiten, grünenden Wiesen.
»Habt ihr das Häuschen schon lange?«
»Etwa fünf Jahre«, antwortete Clara. »Marcos und Pilar haben uns zum ersten Mal hierher gebracht.«
Pilar erzählte mir die Geschichte der Gegend. Voller Genugtuung versicherte sie, Marcos und sie seien die ersten Fremden gewesen, die sich hier niedergelassen hätten.
»Wir machen mal einen Ausflug zu ihrem Haus, du wirst staunen«, sagte Clara, während sie weiter hantierte.
Dann drehte sie sich um und schaute mich lange an, als wollte sie nach einer Erinnerung haschen.
»Du hast dich verändert, Theo«, sagte sie lächelnd.
Letzten Endes lief alles darauf hinaus, herauszufinden, was heil geblieben und was mit der Zeit kaputtgegangen war, als könnten wir unser eigenes Leben erst im Vergleich mit dem gelebten Leben der anderen beurteilen. Ich hätte ihr gern gesagt, dass sie sich nicht sehr verändert hatte, aber das hätte bedeutet, dass meine Gefühle sich auch nicht geändert hätten. Ich machte eine resignierte Miene, die lustig sein wollte, und verließ die Küche.
Ich setzte mich zu Antonio und Marcos. Sie blickten ins Dunkel der Landschaft. Aus dem Kamin drang die Hitze der brennenden Scheite. Antonio füllte mein Glas nach. Er erzählte von seinen Plänen, die Stadt zu verlassen und hierher zu ziehen, wo er weiter seine Kolumnen für verschiedene Zeitungen schreiben wollte. Als ich wissen wollte, welche Art Kolumnen er schrieb, lachten beide. Offenbar beschäftigte er sich hauptsächlich damit, gegen Gott und die Welt vom Leder zu ziehen. Dann versuchte ich in Erfahrung zu bringen, was aus seinen Idealen geworden war, aber er wich meiner Frage aus und sprach von den Klassikern, die, wie es schien, von einem Hobby aus Studententagen zu einer echten Leidenschaft geworden waren.
»Cicero unterteilt die Menschen in solche, die nach Ruhm streben, die kaufen oder verkaufen, und solche, die das Geschehen und die Art, wie es geschieht, betrachten. Offenbar gehöre ich mittlerweile zu Letzteren«, sagte er mit einem ironischen Lächeln. »Was meinst du, Marcos?«
Marcos machte eine vage Handbewegung, die durchaus Zustimmung bedeuten konnte, und stand auf, um das Feuer zu schüren. Antonio zündete sich eine Zigarette an. Der Mond beschien die im See versinkenden Hänge.
»Und dein Vater?«, fragte ich, wohl wissend, dass seine Erwähnung eine für uns beide unbequeme Erinnerung heraufbeschwören musste.
»Er ist vor über zehn Jahren an Krebs gestorben, Bauchspeicheldrüse«, sagte er, ohne mich anzuschauen.
Seine Bitterkeit war nicht zu überhören. Mit dieser knappen Erklärung hatte er alles gesagt.
Es waren zu viele Dinge, die sich nicht ansprechen ließen, zu viele Momente, an die keiner von uns dreien sich erinnern wollte, und doch waren sie da, nach all den Jahren, lauerten in den Falten unseres Gedächtnisses, unseres Bewusstseins, darauf wartend, hervorzubrechen.
»Erzähl mir von deiner Tochter, von Sophie. Wer ist ihre Mutter?«, fragte er und lenkte so unser Gespräch in harmlosere Gefilde. Er sprach die Wörter »Tochter« und »Sophie« sehr sanft aus. Er beugte sich vor, schaute mich an und wartete, dass ich etwas sagte.
Während der langen Stunden im Flugzeug hatte ich mir die eindringlichsten Momente meines Lebens als Kriegsreporter noch einmal vergegenwärtigt. Antonio hatte mir den Anstoß gegeben, seinetwegen und wegen Clara hatte ich die nötige Courage, die Wut und den Idealismus aufgebracht, all die Zeit in irgendwelchen Schützengräben zu hocken. Und jetzt, wo Antonio vor mir saß, verspürte ich das kindische Bedürfnis, mich vor ihm als tapferer Mann zu beweisen, als ein Mensch, der bereit ist, sein Leben für eine Handvoll Überzeugungen hinzugeben. Aber nichts davon schien in seinem Kokon Platz zu haben. Einstweilen hatte ich keine andere Wahl, als ihm von Rebecca zu erzählen und wie es dazu kam, dass sie die Mutter meiner einzigen Tochter war. Ich hätte schweigen können, aber egal, welches Türchen Antonio wählte, am Ende gelangten wir unweigerlich in diesen Raum, der seit fünfzehn Jahren verschlossen war. Undenkbar, dass er mich an diesen abgelegenen Ort gerufen hatte, um mit mir ein paar Cocktails zu trinken und von Dingen zu sprechen, die ihn letztlich nichts angingen.
Clara kam aus der Küche und ging in ein Zimmer neben meinem. Antonio fing meinen Blick auf und lächelte.
Am liebsten hätte ich Rebecca als eine dieser Frauen stilisiert, die das Schicksal von Männern, ganzer Länder prägen, hätte verheimlicht, dass es sich um eine US-Amerikanerin handelte, deren auffälligstes Merkmal ein Körper war, mit dem sie jeden um den Verstand brachte.
»Ich habe Rebecca in Mexiko kennengelernt. Ich war dort, um über die Wahlen zu berichten. Sie sang in der Bar des Hotels, wo die meisten Reporter wohnten. Drei Wochen waren wir zusammen. Tagsüber ging ich meiner Arbeit nach, und abends saß ich in der Bar und hörte ihr zu. Die ersten Tage waren berauschend, aber dann verlor sie ihren geheimnisvollen Reiz. Rebecca war eine dieser Frauen, die allzu freimütig reden und alles auf ein paar billig parfümierte Sätze reduzieren.« Antonio und Marcos stimmten lächelnd zu, mit dieser Kumpelhaftigkeit der Männer, wenn sie von Frauen sprechen. Ich fühlte mich unangenehm berührt. »Nach den Wahlen flog ich zurück nach London«, fuhr ich fort. »Rebecca brachte mich zum Flughafen. Als wir uns verabschiedeten, sagte sie mir, sie sei schwanger. Neun Monate später wurde Sophie geboren.«
»Lebst du mit deiner Tochter zusammen?«, fragte Antonio.
»Nein, nicht.«
Das war der wunde Punkt. Ich lebte nicht mit Sophie zusammen. Überhaupt waren wir nie länger als zwei Wochen am Stück zusammen gewesen. Rechtfertigungen hatte ich zur Genüge, meine unbeständige Arbeit oder wie sehr Sophie an ihrer Mutter hing. Aber es bereitete mir immer wieder Gewissensbisse, und ich war nicht bereit, sie mit Antonio zu teilen.
Zum Glück erschienen Clara und Pilar im Wohnzimmer. Clara trug eine bequeme Hose und Sandalen. Ein changierendes Tuch bedeckte ihre Brust und ließ ihren flachen, gebräunten Bauch frei. Das Haar hatte sie hochgesteckt.
»Du siehst phantastisch aus«, sagte Antonio und sah mich fest an.
Offenbar sollte ich jetzt etwas sagen, aber ich schwieg. Antonios Blicke machten mich langsam rasend. Brauchte er mich und meine Sehnsucht nach Clara, um selbst in Schwung zu kommen? Oder war ich der Zuschauer, ohne den sein Leben keinen Halt fand? Wie auch immer, für mich war es schwer, sie nicht anzuschauen. Die Anmut ihrer Bewegungen, die Kraft ihres Körpers, die Tiefe ihres Blicks, all das, was bei einer Jugendlichen überschoss, hatte mit dem Alter sein Maß gefunden und wirkte umso eindrucksvoller.
Clara setzte sich neben Antonio. Mit einer besitzergreifenden Geste streichelte er ihren Hals. Clara blieb steif sitzen. Und als stünde auch ihm ein bisschen Zärtlichkeit zu, nahm Marcos seine Frau bei der Hand und zog sie zu sich heran. Es lag etwas Falsches in dieser zur Schau gestellten Nähe, trotzdem ertrug ich sie nur schwer. Ich spürte einen Krampf im Magen und das Bedürfnis, auf die Toilette zu gehen, mich zurückzuziehen, Schutz zu suchen an einem vertrauten Ort.
Als ich aus dem Bad kam, konnte ich der Versuchung nicht widerstehen und warf einen Blick in Antonios und Claras Zimmer. Im Unterschied zu den anderen, eher nüchtern eingerichteten Räumen hatte ihr Zimmer etwas Gemütliches. Die Wände waren mit einem dunklen Stoff bezogen, und auf dem Boden lag ein Teppich aus ungekämmter Wolle. Neben einem Ledersessel warf eine Stehlampe ihren kupferfarbenen Schein. Doch dann schlug mir das Herz: Auf dem Nachttisch erblickte ich Claras Tagebuch mit dem roten Einband. Warum hatte sie es nach all den Jahren noch bei sich? Am liebsten hätte ich es eingesteckt. In diesem Büchlein, das wusste ich, hatte Clara Tag für Tag aufgeschrieben, was in jenem Sommer 1986 geschehen war.
Als ich zurückkam, stand das Essen auf dem Tisch. Antonio legte Wert darauf, dass ich mich ans Kopfende setzte.
»Antonio und Clara sprechen so oft von dir«, sagte Pilar. »Wie es scheint, hattet ihr damals viel Spaß.«
»Ich versuche immer, eine schöne Zeit zu haben«, antwortete ich.
Ein ausgehungerter Hund stand vor der Terrassentür und wedelte heftig mit dem Schwanz.
»Hast du gehört, Marcos? Das ist mal ein gutes Lebensmotto«, sagte Pilar und schob sich ein Stück Brot in den Mund.
»Manchmal klappt das nicht mit dem Spaß, sosehr wir uns auch anstrengen«, bemerkte Marcos, ohne irgendwen anzuschauen.
»Ist alles eine Frage der Einstellung«, verkündete Pilar, »wusstest du das nicht?«
Und während sie das sagte, schaute sie nicht Marcos an, ihren Mann. Ihre Augen waren mit einer Hartnäckigkeit auf Antonio gerichtet, dass es schon an Dreistigkeit grenzte.
»Oder bist du nicht der Ansicht, Antonio?«
Marcos fing an, auf seinem Stuhl zu schaukeln und mit dem Fuß zur Hintergrundmusik den Takt zu schlagen.
»Das muss jetzt nicht sein, Pilar, wirklich …«, mischte Clara sich ein, plötzlich sehr ernst.
Wortlos stand Antonio mit einem Stück Fleisch in der Hand auf, öffnete die Tür und gab es dem Hund. Dann streichelte er ihm über den knochigen Rücken.
Pilar überging Claras Worte und fuhr fort:
»Du bist schon lange in einem Alter, wo man sich mit dem zufrieden gibt, was man hat. Und es genießt. Wie das hier zum Beispiel.« Sie hob das Kinn und schaute in eine unbestimmte Richtung. Offenbar meinte sie nicht sich, sondern diesen Augenblick, den wir miteinander teilten. Erneut schaute sie zu Antonio.
Ich war mir nicht sicher, aber ich hatte den Eindruck, dass diese an ihren Mann gerichteten Worte für Antonio gedacht waren. Ihre Ausdrucksweise schien mir jedenfalls auf eine Weise unangemessen, dass es mir peinlich war.
Inzwischen schien der Mond herein. Wir schwiegen einen Moment und beobachteten, wie das Licht über den See bis zu den benachbarten Hügeln wanderte. Was Pilar zuletzt gesagt hatte, war im Grunde gar nicht so albern. Dort saßen wir bei einem formidablen Weihnachtsessen, und der Mond scheute sich nicht, uns daran zu erinnern.
Nach dem Essen setzten wir uns vor den Kamin. Clara brachte uns Kaffee, setzte sich neben Antonio aufs Sofa und zündete sich ein Zigarillo an. Eine CD von Joni Mitchell dämpfte das Bellen des Hundes, der sich vor dem Fenster postiert hatte und auf eine weitere Belohnung wartete.
»Weißt du noch, wie ich dich zum ersten Mal nach Wivenhoe mitgenommen habe?«, fragte mich Antonio.
Er wusste, ich konnte es unmöglich vergessen haben.
»Wie könnte ich mich nicht erinnern, vor allem an diese eingebildete Französin mit ihrer Theorie über Parmenides«, sagte ich, um irgendetwas beizusteuern.
»Und wie dieser Argentinier dauernd versuchte, Clara zu becircen«, sagte Antonio mit einem süffisanten Lächeln, als wäre er von allen Männern der einzige gewesen, der für ihre Reize unempfänglich war.
Clara sprang vom Sofa auf und lehnte sich gegen das Fenster. Antonio spielte ein Spiel mit mir und mit Clara. Er zog die Fäden des Gesprächs, unserer Gesten, unserer Gedanken. Genau wie früher.
Antonio war sich Claras Verärgerung bewusst und fragte mich nach London, nach den Orten, an denen wir so oft gewesen waren. Er hatte eine Möglichkeit gefunden, die Vergangenheit an die Gegenwart zu binden und so einen Weg abzustecken, auf dem wir durch die Erinnerungen streifen konnten, ohne uns weh zu tun. Ich sparte nicht mit Einzelheiten. Doch irgendwann merkte ich, dass meine Worte ihn nicht interessierten und er längst woanders war.
Clara dagegen blickte mich aufmerksam an, als klammerte sie sich inmitten dieses Sturms der unterschwelligen Gefühle an etwas leidlich Handfestes. Sie fragte mich, ob ich in jüngster Zeit einmal in Swiss Cottage gewesen sei, ihrem alten Viertel. Ich erzählte ihr, überall seien neue Häuser entstanden, ziemlich luxuriös, verglichen mit dem, was sie von früher kannte. Doch dann schwieg ich und versuchte, mich an etwas weniger Allgemeines zu erinnern.
»Das ist alles hundert Jahre her, oder?«, sagte sie.
»Hundertfünfzig«, sagte ich. Wir lachten beide und schauten uns in die Augen.
Für einen Moment hatte ich das Gefühl, dass nur sie und ich dort waren. Wieder vereint.
»Theo ist Kriegsreporter, wusstet ihr das?«, sagte Antonio plötzlich zu Marcos und Pilar.
»Das hattest du erwähnt. Wirklich unglaublich«, bemerkte Marcos.
Antonio schlug die Beine übereinander und lehnte sich zurück.
»Ich habe mich immer gefragt, was die Leute dazu treibt. Ich meine, so ein Nomadenleben zu führen, ein so einsames, gefährliches … Ich kann es nur schwer begreifen, und das sage ich mit allem Respekt«, fuhr Marcos fort.
»Es geht darum, zu informieren. Wenn die Guten nichts tun, siegen die Bösen«, sagte ich, wohl wissend, dass ich unerträglich korrekt war.
»Du klingst wie im Kino«, sagte Pilar.
»Um ehrlich zu sein, das sind die Worte einer Korrespondentin von CNN, die sich nach dem Tod eines guten Freundes in Sierra Leone vor sich selbst dafür rechtfertigen wollte, dass sie ihr Kind verließ und erneut in den Krieg zog.«
Endlich hatte ich Gelegenheit, mich mit meinen vorgefertigten Geschichten auszubreiten, doch ein Kloß im Hals hinderte mich daran. Besagter Freund war Miguel Gil gewesen, ein spanischer Reporter, der vor etwas mehr als einem Jahr in einem Hinterhalt ums Leben gekommen war. Sein Tod war uns an die Nieren gegangen, genau wie der von Kurt Schork, ebenfalls Opfer des Überfalls. Aber es hatte keinen Sinn, weiterzureden. Was immer ich sagte, würde an der Oberfläche bleiben. So ist es immer, wenn man versucht, über das Grauen Konversation zu führen. Es bildet sich eine feste Membran, die das menschliche Elend fernhält und die kleine Dosis Wirklichkeit, sofern sie denn durchdringt, anmaßend erscheinen lässt.
»Es gibt auch anderes«, sagte ich auf der Suche nach einem Fluchtweg.
»Zum Beispiel?«, fragte Clara.
»Ich weiß nicht, zum Beispiel sich bewusst zu sein, dass man lebt und dass das vielleicht genügt.«
Was ich gesagt hatte, war weder richtig noch falsch, aber zumindest ließ es meine Erinnerung aus dem Spiel, all das, was mir wichtig war.
»Klingt nach New Age … gefällt mir«, bemerkte Pilar.
»Am Ende geht es ja doch immer um das Gleiche«, sagte ich. »Dich für das Leben zu entscheiden und gegen das Sterben. Und unterwegs stellst du dir vor, dass du nicht ganz allein bist. Dass das, was du bist und tust, jemandem etwas bedeutet …«
Meine Worte waren im Grunde nur Wiedergekäutes. Doch Antonio, der die distanzierte, selbstzufriedene Pose des Gastgebers bewahrt hatte, fuhr dazwischen:
»Großartig, wie einfach die Dinge für dich geworden sind. Ehrlich, Theo. Ich wünschte, ich könnte dasselbe sagen.«
Ich wollte ihm nicht antworten, vor allem weil ich sah, dass Clara sich auf die Unterlippe biss und auf den Boden starrte. Zum ersten Mal seit meiner Ankunft bemerkte ich die Spuren, die die Zeit in ihrem Gesicht hinterlassen hatte. Es war, als hätte sich unter ihre Haut, die zwar noch glatt war, aber nicht mehr so seidig wie in ihrer Jugend, eine tiefe Müdigkeit geschlichen, vielleicht Schmerz.
»Erzähl uns was Aufregendes«, bat Pilar mit einem theatralischen Schwenk ihrer Arme. »Ich bin verrückt nach Kriegsgeschichten«, worauf sie tirilierte wie ein Vögelchen.
Ich dachte, ab einem gewissen Alter sollten Frauen sich nicht derart entblößen. Was bei einer jungen Frau sinnlich erscheint, wirkt bei ihnen nur lächerlich. Meine Miene hatte mich offenbar verraten.
»Wir haben alle das Recht, uns zu amüsieren, Darling«, sagte sie.
Bevor ich den Mund auftun konnte, ergriff Antonio das Wort.
»Wivenhoe. Das waren noch Zeiten!« Hartnäckig kehrte er an diesen Ort zurück. »Erinnerst du dich an unseren Ausflug zum Supermarkt? Ich werde nie dein panisches Gesicht vergessen, Theo, niemals«, und er lachte schallend.
Ich konnte meine Wut über seine Worte nicht verbergen. Ich wollte ihm etwas sagen, ihn provozieren, wollte den Grund hören, warum er mich derart plump anging. Aber wie immer beherrschte ich mich.
Clara nahm Antonios Hand. Es war keine zärtliche Geste, eher eine Bitte um Mäßigung.
»Entschuldige, Theo«, murmelte Antonio, und seine Miene war nun betrübt. Unsicher umfasste er meine Schulter.
Niemand sagte mehr etwas. Marcos wiegte den Kopf hin und her, als bedauerte er etwas. Seine Augen waren gerötet.
Kurz darauf machte sich das Paar auf den Weg. Ihr Haus war nicht weit. Der Mond mit seinem fast taghellen Licht stand hoch am Firmament.
Clara zündete sich ein weiteres Zigarillo an und setzte sich auf die Stufen der Terrasse. Mit seiner typischen Art, die Dinge zu zelebrieren, ging Antonio durchs Haus und machte überall das Licht aus. Er kam mir vor wie ein Nachtwächter, der durch die Straßen zieht und die Laternen löscht. Danach setzte er sich mit seinem Glas Whisky zu Clara. Sie schloss die Augen, als machte sie eine Tür zu. Mein Groll wuchs noch mehr, und ich verschwand in die Küche und fing an, das Geschirr zu spülen.
Ich war noch nicht weit gekommen, als ich sah, wie Clara am Türrahmen lehnte, Zigarillo in der Hand.
»Lass doch, Theo. Morgen kommt eine Frau, die alles spült und aufräumt. Wie du weißt, sind wir hier in der Dritten Welt.«
»Aber es entspannt mich.«
Vor dem Dunkel des Wohnzimmers verschwammen ihre Umrisse. Ich stellte die Teller ab und ging zu ihr. Wir standen uns gegenüber.
»Antonio ist schon im Bett«, sagte sie und rührte sich nicht von der Stelle.
Ihr Haar hatte sich aus der Spange gelöst, mit einem Schwung ihres Kopfes ließ sie es herabfallen. Ich hätte sie so gerne berührt.
»Ich glaube, ich gehe auch. Ich bin hundemüde.« Ich trocknete mir die Hände an der Hose und verließ die Küche, ohne sie anzuschauen.
»Du bedeutest Antonio sehr viel. Wusstest du das?«, hörte ich sie von der Küchentür aus sagen, wo sie immer noch reglos stand.
Der Klang ihrer Stimme hatte etwas Verletzliches und Beherrschtes zugleich.
»Er hat mir nicht gesagt, dass du hier bist. Wusstest du das?«, fragte ich meinerseits.
»Er dachte, wenn er es dir sagt, kommst du nicht«, antwortete Clara und drückte das Zigarillo in einem Aschenbecher aus.
»Wäre das nicht besser gewesen?«
»Bestimmt nicht. Du wirst schon sehen, hier ist es traumhaft, wir können eine schöne Zeit verbringen. Es hängt von uns ab.«
»Du klingst wie deine Freundin Pilar.«
Wir lachten beide.
»Du weißt, was ich meine«, sagte sie ruhig.
»Allerdings. Es kann die Hölle sein, vor allem, wenn Antonio es darauf anlegt«, sagte ich, wie um mich zu rächen.
»Er hat ein schweres Jahr hinter sich, gib nichts auf seine Ausfälle. Außerdem, du kennst ihn ja, er ist eben so.«
»Vermutlich, ja, auch wenn ich mir nicht sicher bin, dass ich ihn kenne. Es ist so viele Jahre her.«
»Da hast du recht. Aber keine Angst, ich sorge schon dafür, dass es ein paar schöne Tage werden. Überlass es mir.«
Sie schenkte mir ein Lächeln, hob die Hand und strich mir mit einer Geste über die Wange, die mir fast mütterlich erschien. Dann drehte sie sich langsam um und verschwand im Dunkel des Flurs.
Vielleicht, dachte ich, versuchte Clara mir zu sagen, dass wir uns nur alle bemühen mussten, so zu tun, als wäre nichts zwischen uns gewesen, und am Ende waren wir selbst davon überzeugt.
Ich folgte ihr mit ein paar Schritten Abstand. Sie öffnete die Tür und blieb kurz stehen. In ihrer Miene sah ich eine unendliche Traurigkeit, und in dieser Traurigkeit ein Strahlen, als hätte sich etwas in ihr bewegt.
Ich ging in mein Zimmer und setzte mich auf die Bettkante. Die noch brennenden Lichter am Ufer gegenüber hingen im Nichts. Eine alte Gleichgültigkeit überkam mich, etwas Haltloses, eine Apathie, die im Laufe der Jahre an meinem Herzen genagt hatte und von der ich nie gedacht hätte, dass ich sie in Claras Nähe spüren würde. Ich begriff, dass es ein Sieg und zugleich eine Niederlage war. Ich war gefühllos gegenüber Clara geworden, und das war ohne Zweifel ein Sieg. Aber wenn selbst ihre Traurigkeit mich nicht mehr berührte, würde mich vielleicht nichts mehr berühren.
4
Das Erste, was ich am Morgen des 25. Dezember sah, war ein rechteckiges Fleckchen Sonne auf dem Boden meines Zimmers. Ich brauchte ein paar Sekunden, um Raum und Zeit zu sortieren. Ein Klopfen, das von draußen hereindrang, lockerte die frühe Stille auf. Ich schaute aus dem Fenster. Im Garten hackte ein Mann einen Baumstamm in kleine Scheite. Ein Mädchen mit langem schwarzem Haar sammelte in der Nähe Reisig, es musste seine Tochter sein. Ich beobachtete sie. Ihre ruhigen, bestimmten Bewegungen, ihre Gelöstheit von allem, was sie umgab, brachten mich auf den Gedanken, dass in dieser gleichsam ursprünglichen Arbeit vielleicht das Geheimnis lag, das die Zeit anhielt.
Ich zog mir einen Pullover über und ging ins Wohnzimmer. Antonio schlief auf dem Sofa. Er musste mitten in der Nacht hergekommen sein, ich hatte nichts gehört. Seine nackten Füße lugten zwischen den Falten der Decke hervor. Auf dem Boden, neben einem leeren Glas, lag ein aufgeschlagenes Buch. Ich nahm es vorsichtig, um ihn nicht zu wecken. Überall auf den Seiten waren Striche, Kringel, Randbemerkungen, die einen parallelen Pfad durch den Text schlugen. Es war keine saubere Arbeit, im Gegenteil, es sah aus, als wäre das Buch einem kleinen Kind in die Hände gefallen. Ich blieb an einem mehrfach unterstrichenen Satz hängen: Jeder hat seine Eitelkeit, und in seiner Eitelkeit vergisst er, dass es andere mit einer verwandten Seele gibt. Aufs Geratewohl schlug ich eine weitere Seite auf. Antonio hatte zwei Sätze unterstrichen: Wir alle haben etwas Verachtenswertes. Jeder von uns trägt an einem Verbrechen, das er begangen hat, oder dem Verbrechen, das seine Seele von ihm verlangt.
Der Text war mir unheimlich. Ebenso der Gedanke, dass ich, wenn ich weiterblätterte, etwas über Antonio herausfinden könnte, das mich nichts anging. Ich legte das Buch wieder an seinen Platz und ging auf die Terrasse. Der Nebel hüllte die Berge in einen Schleier. Als ich zurückkam, schlief Antonio noch.
Ich ging wieder in mein Zimmer, legte mich aufs Bett und versuchte zu lesen. Nach einer Weile hörte ich Geräusche. Clara und Antonio frühstückten in der Küche. Als Antonio mich sah, stand er auf und umarmte mich. Ich spürte seinen Atem an meinem Ohr, er roch säuerlich. Clara drückte mir die Hand und küsste mich auf die Wange. Ich hatte den Eindruck, sie versuchte mir etwas zu sagen, das sich nicht aussprechen ließ. Während sie für mich Kaffee aufsetzte, fragte Antonio mich, wie viele Menschen ich schon hätte sterben sehen, und ich antwortete, ich zählte sie nicht. Dann wollte er wissen, ob ich mich jemals auf dem Schlachtfeld verliebt hätte. Seine Frage ärgerte mich. Er wusste, dass er eine Grenze überschritt. Claras brüske Bewegungen und ihr Schweigen zeigten, dass Antonios Fragen auch sie verstimmten. Aber sie hielt ihn nicht zurück.
Nach dem Frühstück rief ich Sophie an. Der Empfang war nicht gut, und ich musste vom Garten aus telefonieren. Ihre Vorwürfe hatten ein bitteres Gefühl hinterlassen. Ich wollte mich entschuldigen und versprechen, ihr so bald wie möglich ein Geschenk zu schicken. Zum Glück hatte Sophie die Sache schon vergessen, ihre ganze Sorge galt nun der bevorstehenden Geburt eines Fohlens. Sie erzählte mir auch, vor ein paar Tagen hätten sie die Farm eines neuen Freundes von Rebecca besucht, und der hätte sie auf einer Araberstute reiten lassen.
»Und wer ist dieser Freund?«, fragte ich.
Nicht dass mich Rebeccas Privatleben interessierte, ich fürchtete nur immer, sie würde das sorgenfreie Leben, das Russell ihr bot, zerstören und damit auch das von Sophie.
»Er ist Pferdezüchter«, sagte sie.
Als ich auflegte, wurde mir erneut bewusst, wie unwichtig ich in Sophies Leben war. Es war eine zweischneidige Sache: Einerseits verringerte es die Bedeutung dessen, was ich tat, und garantierte mir meine Freiheit; andererseits schwächte es das Gefühl der Zusammengehörigkeit, das mir in den schwierigsten Momenten immer ein Halt war. Ich schaute zum Haus, Clara beobachtete mich durchs Fenster.
»Es ist das erste Mal, dass ich Weihnachten ohne meine Tochter verbringe«, sagte ich, als ich hereinkam.
»Auf dem Foto, das du uns gezeigt hast, sieht sie sehr hübsch aus. Sie ist bestimmt reizend.«
»Sagst du das wegen mir?«, fragte ich und zog ein Gesicht.
Clara nickte mit einem Lächeln.
»Du könntest auch eine wunderschöne Tochter haben.«
»Hilf mir mal eben«, bat sie und wechselte rasch das Thema. »Wir machen heute ein englisches Picknick, wie du es noch nie erlebt hast.«





























