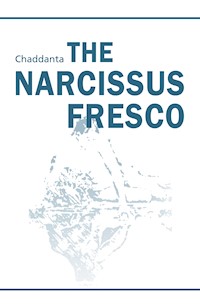3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Trügerische Gesten verantwortungsloser Politiker lösen eine Völkerwanderung aus. Millionen Menschen machen sich auf die Suche nach einer neuen Heimat und einem besseren Leben. Manche von ihnen haben in einem Bürgerkrieg Hab und Gut verloren, andere sind von religiösem Fanatismus getrieben oder ganz einfach verwegene Glücksritter. Sie finden Aufnahme in einem kulturell erstarrten Land ohne Selbstbehauptungswillen, das von korrupten Eliten und manipulierenden Medien beherrscht wird. Die falschen Versprechungen der Staatsführung, die nicht auf Seiten ihrer Bürger steht, führt in Verbindung mit enttäuschten Erwartungen der Einwanderer zu einer bürgerkriegsähnlichen Entwicklung, welche in einer Apokalypse zu enden droht. Dieser Roman ist eine erschreckende und gleichermaßen realistische Zukunftsvision.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 198
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Chaddanta
Die Anvertrauten
Für Doris
Chaddanta
Die Anvertrauten
Der vorliegende Roman ist eine Dystopie und daher seinem Wesen nach fiktiv.
Die Protagonisten wie auch die Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind zufällig.
Lektorat
Firma SAMO s.r.o.
Satz/Umbruch, Bildbearbeitung, Umschlaggestaltung
libergraphix
www.libergraphix.de
© 2016
Fiat iustitia, ruat caelum
Tagebuch-Eintragung
Es ist jetzt ein Jahr her, daß ich den Sprung in die Selbständigkeit wagte und meine eigene Praxis eröffnete. Ich weiß noch, wie ich im Möbelhaus die beiden bequemen Ledersessel aussuchte, welche jetzt ganz sichtbar diesen Raum dominieren. In einem sorgfältig bemessenen Abstand sollten sie sich gegenüber stehen, so daß sowohl mein Patient als auch ich selbst fest verortet sein würden und somit keine Möglichkeit hätten, einer Frage, einem Problem oder irgendeiner, wie auch immer gearteten Konfrontation auszuweichen. Immer noch schmücken ausschließlich die beiden Zeichnungen Heidelberger Örtlichkeiten – der Alten Brükke sowie der Schloßruine – die Wände. In der Ecke links jenes Sessels, auf welchem meine Patienten zu sitzen pflegen, steht auf einem kleinen Holztisch die Bronzestatue Der Lenker der Rosse. Ich habe sie nicht nur aus ästhetischen Gründen so im Raum plaziert. Immer wenn einer meiner Patienten sein Temperament und dessen Schwankungen beklagt oder seine ungestümen Gefühle nicht mehr in den Griff bekommt, verweise ich auf diesen Fahrer eines antiken Streitwagens, welcher die Zügel nie aus der Hand gibt. Im Rücken des Analysanten steht die imposante Bücherwand mit der Gesamtausgabe C. G. Jungs, zahlreichen Nachschlagewerken und allerlei Fachliteratur, welche sich über die Jahre meines Studiums und meiner Berufstätigkeit angesammelt haben. Meine Selbständigkeit entbindet mich endlich von systemischen oder gar hypnotischen Therapieansätzen, wie sie in der Klinik, in welcher ich zuvor gearbeitet hatte, gebräuchlich waren. Ich kann jetzt jene Methodik einsetzen, die ich über die Jahre hinweg selbst entwickelt habe, ohne dafür Kritik befürchten zu müssen. Und ich bin in der Lage, mir meine Patienten auszusuchen. Das ist mit das Wichtigste in meinem Beruf. Jeder Zahnmediziner kann jeden Zahn ziehen. Der eine mag mehr Geschicklichkeit an den Tag legen als der andere, beim einen mag es mehr schmerzen als beim anderen, aber das ist und bleibt von untergeordneter Bedeutung. Meine Profession ist grundsätzlich anders. Sie setzt eine Disposition des Patienten voraus, die mir entgegenkommt. Bei manchen ist sie von Anfang an nicht gegeben, und ich muß die Behandlung ablehnen. Bei anderen zeigen sich erst nach einiger Zeit unüberwindliche Widerstände, und ich breche die Therapie dann unter einem Vorwand ab. Selten ist meine Arbeit langfristig gänzlich ohne Erfolg, aber auch nur in wenigen Fällen gelingt mir ein wirkliches Meisterstück. und die seelischen Probleme eines Menschen lösen sich in Nichts auf. Trotzdem wurde mir heute einmal mehr bewußt, wie sehr es mich mit Befriedigung erfüllt, anderen Menschen zu helfen.
Tagebuch-Eintragung
Ich habe mir diesen Sonntag Zeit für einen Besuch in meiner Geburtsstadt genommen. Der Anlaß ist der Einbau eines neuen Heizöltanks in dem Mehrfamilienhaus, in welchem ich die ersten elf Jahre meines Lebens aufwuchs, und welches inzwischen mir gehört. Mehr als sechzig Jahre sind vergangen, seit mein Großvater es erbauen ließ und knapp zwanzig Jahre, seit meine Mutter es mir als Schenkung übertrug. Der Nießbrauch liegt immer noch bei ihr. Da sie im Ausland lebt und der Immobilienverwalter im Urlaub ist, begutachte ich den neuen Tank selbst. Der Garten gehört zur Wohnung im Erdgeschoß, deshalb spreche ich dem Mieter eine kurze Benachrichtigung auf seinen Telefonbeantworter. Er ist Zahnarzt, und das Verhältnis zu ihm, wie auch zu den anderen Bewohnern, ist unkompliziert. Über die Kellerräume gelange ich durch den überdachten Bereich mit den Wäscheleinen in den Garten. Den kleinen, umzäunten Pool wollte ich schon lange zuschütten lassen. Als Kinder ließen wir an heißen Sommertagen manchmal Wasser ein. Das war immer ein besonderer Spaß, aber schon am nächsten Tag fischten wir mit unserem Schmetterling-Netz allerlei Getier aus dem Becken und fingen an, uns zu ekeln. Ich beschließe, mich mit dem Dentisten zu beraten. Eventuell könnte man auch einen Teich anlegen, wenigstens wenn er Interesse an Fischen oder Seerosen hat. Bei meinem letzten Besuch war der untere Teil der Stahltür zum Raum mit dem Heizöltank durchgerostet gewesen. Inzwischen ist ohne mein Wissen eine neue Tür eingebaut worden, für welche ich keinen Schlüssel besitze. Mein Besuch war also umsonst gewesen. Ärger über den Verwalter steigt in mir auf, wie einzelne blubbernde Blasen giftiger Dämpfe an der Wasseroberfläche eines Geysirs. Aber diese inneren Disharmonien legen sich schnell wieder, und ich sehe mich im Garten um. Vieles ist noch genauso wie in meiner Kindheit: der japanische Kirschbaum etwa oder der Haselnußstrauch an der Grenze zum nachbarlichen Grundstück. Andrea hatte hier gewohnt und manchmal mit mir gespielt, obwohl sie schon etwas älter gewesen war. Ich kann mich nur noch schattenhaft an sie erinnern und würde sie auf der Straße sicherlich nicht mehr erkennen. Ich frage mich, was aus ihr geworden ist. Da ist eine spürbare Verbundenheit zwischen diesem teilweise verwilderten Garten, seinen Menschen und mir. Es ist eine völlig andere Beziehung als jene zwischen mir und meinen Patienten. Sie wurde nie gezielt herbeigeführt und war keinem dienstbaren Zweck unterworfen. Gerade deshalb erscheinen mir diese Dinge plötzlich so schicksalhaft und wertvoll. Sie wurden mir zu einer Zeit mit auf den Weg gegeben, zu welcher ich ihre Bedeutung noch gar nicht einschätzen konnte. Wer gibt diese frühen Prägungen, Freuden, Überraschungen sowie Enttäuschungen mit auf den Weg? Von meinem atheistischen Standpunkt aus der schiere Zufall. Ein religiöser Mensch würde hingegen eine göttliche Fügung vermuten. Eigentlich spielt es keine Rolle, dieses Gefühl zu hinterfragen. Oder vielleicht doch? Möglicherweise läßt sich die Verwurzelung erst im Zusammenhang mit ihrer Genese sinnvoll einordnen. Ich beschließe, meiner ehemaligen Grundschule noch einen Besuch abzustatten. Auf dem Weg dorthin komme ich an der ehemaligen Stadtbücherei vorbei. Wie so viele andere öffentliche Einrichtung ist sie geschlossen worden. Heutzutage fehlen dafür die finanziellen Mittel. Genaugenommen „fehlen“ sie eigentlich nicht, sie werden nur gemäß einer anderen Priorität eingesetzt. Dabei leben in diesem Stadtteil noch viele Menschen, die deutsch sprechen. Ich werfe einen kurzen Blick durch die Glastür, und mir fällt ein, wie die geduldige Bibliothekarin uns Schüler wiederholt mit mahnenden Worten aus dem Erwachsenenbereich zu verweisen pflegte. Von verbotenen Büchern geht auf viele Menschen eine magische Anziehung aus. Eventuell hängt dies auch mit solch biographischen Erlebnissen zusammen. Wenige Meter weiter befindet sich mein ehemaliger Schulhof. Heute ist er naturgemäß verwaist. Die vier Sitzbänke, die wir immer als Tore beim verbotenen Fußballspiel mit einem alten Tennisball benutzt haben, stehen noch genauso da wie vor drei Jahrzehnten. Einmal hat der Hausmeister den Ball an sich genommen, mit einem Messer hinein gestochen und ihn in einem Müll-Container nahe der Turnhalle entsorgt. Wir haben ihm das damals übel genommen. Dabei hatte er eine fast unerschöpfliche Geduld bewiesen, wenn es darum ging, jene kegelförmigen Milchkartons aufzusammeln, welche wir, einmal leer getrunken, wie kleine Pyramiden auf den Boden stellten und mit einem lauten Knall zertraten. Jenseits des Sportplatzes sehe ich die stacheldrahtbewehrten Mauern der zur damaligen Zeit von US-Soldaten genutzten Kaserne. Als meine Großmutter väterlicherseits an Krebs erkrankt war, besuchten wir, das heißt mein Bruder, meine Mutter und ich, sie fast täglich mit unseren Fahrrädern. Der Weg führte an jenem Teil der Kaserne vorbei, der nicht durch eine Mauer, sondern nur durch einen hohen Maschen-Draht von der Öffentlichkeit abgegrenzt war. Dahinter spielten junge Männer in Kampfanzügen Baseball, und wenn wir drei wie eine kleine Entenschar vorbeizogen, dann wurde das Spiel nicht selten unterbrochen. Lachend und johlend stemmten sich einzelne gegen den Zaun und riefen uns auf Amerikanisch Anzüglichkeiten und allerlei Mehrdeutiges hinterher, das meine Mutter mit unbeirrtem Blick ignorierte und wir beiden Brüder zur damaligen Zeit noch nicht einordnen konnten. Kürzlich schnappte ich irgendwo ein Zitat auf: Heimat sei dort, wo man sich nicht erklären müsse. Ich hatte längere Zeit über diesen Satz nachgedacht, und meine Zweifel ließen sich nicht ausräumen. Ein unbeschränktes Hausrecht hatten wir zu dieser Zeit schon aufgrund dieser fremden Soldaten nicht gehabt. Vielleicht war Heimat eher etwas Verborgenes, das eigentlich nur für einen selbst galt. Der Heimat fehlt die Mitteilbarkeit. Sie bleibt in tiefen Schichten der Kindheit vergraben und läßt sich als Gefühl allenfalls erahnen.
Traumaufzeichnung
Erster Traum: Ein Verkehrsschild signalisiert radioaktive Strahlung.
Zweiter Traum: Ich begegne einer schwarz gekleideten Frau, die einen Rosenkranz betet.
Dritter Traum: Ich sehe mich in einem grotesken Kostüm gekleidet. Besonders die kniehohen, purpurfarbenen Strümpfe fallen mir auf.
Der erste Traum signalisiert eine unsichtbare Gefahr. Das Symbol des Rosenkranzes mußte ich in meinem Traumlexikon nachschlagen. Es prophezeit Kummer und Leid. Darauf deutet auch die mediterran wirkende Witwe hin. Der dritte Traum paßt nicht zur Traumserie. Normalerweise deutet solch eine Traumsequenz auf ein vorschnelles Urteil über einen anderen Menschen hin.
Tagebuch-Eintragung
Heute Abend klingelte es an meiner Tür, und als ich öffnete, stand Frau Oppermann vor mir. Sie wirkte traurig, obwohl sie zu lächeln versuchte.
„Wir müssen gehen“, sagte sie ohne Umschweife. „Und ich wollte noch den Schlüssel zurückbringen.“
Nach meiner Scheidung hatte sie mir viel im Haushalt geholfen. Gegen Bezahlung natürlich, aber zeitweilig hatte sie sich fast aufgeopfert. Sie und ihr Ehemann waren ehrliche Menschen, verläßlich und in jeder Hinsicht vertrauenswürdig.
„Sie ziehen weg von hier? Und das so plötzlich?“
„Ja, im April kam von der Stadt die Kündigung. Uns wurde gesagt, in drei Monaten müsse das Haus geräumt sein.“
„Und wer wird nun dort einziehen?“
„Niemand. Das Haus wird abgerissen, das Nachbargebäude übrigens auch. Sie kennen ja die Krothes. Die müssen auch weg von hier.“
„Ich verstehe nicht. Warum werden denn die Behausungen abgerissen?“
„Das ist wegen der Flüchtlinge. Das Grundstück gehört der Gemeinde. Hier werden für die Ankömmlinge neue Heime gebaut. Wir selbst werden mit den Kindern in einer Altbauwohnung untergebracht.“
Monatlich kommen zur Zeit Hunderte von Migranten in unserer Stadt an. Die örtliche Behörden können gar nicht anders, als für die Zugeteilten Platz zu schaffen, und sie beginnen bei jenen, die sich am wenigsten wehren können. Der alte Oppermann hatte seine Stelle als Stellwerker bei der Bahn vor Jahren verloren und lebt seither mit seiner sechsköpfigen Familie von der Sozialhilfe und Gelegenheitsarbeiten.
„Haben sie bei der Stadtverwaltung nicht Einspruch erhoben? Sie wohnen doch dort schon seit mehr als zehn Jahren.“
„Es hat nichts genutzt. Ich habe den kleinen Garten so sehr geliebt.“
Sie zuckt mutlos mit den Schultern und reicht mir ein Stück Papier. „Das ist unsere neue Adresse. Wir würden uns freuen, wenn Sie wieder einmal Arbeit für uns haben.“
Es ist die Unterschicht im Land, die sich herumschubsen lassen muß. Sie ist diesem Staat auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Vor wenigen Tagen hatte sich der Bürgermeister in der Lokalpresse für sein Engagement für die Integration der Einwanderer feiern lassen. Von den Oppermanns und Krothes war da keine Rede gewesen.
Nachbetrachtungen zur Sitzung mit Monika Z.
Im Mittelpunkt der heutigen Konsultation stand Z.‘s Schilderung eines Freibad-Besuches zusammen mit ihren beiden jüngeren Söhnen. Es war auffallend, wie sie diese unspektakuläre Freizeitgestaltung in allen Details erinnerte. Sie gab die Eintrittspreise auf den Cent genau an, benannte den Firmennamen des diensthabenden Wachdienstes und wußte die Öffnungszeiten des Bades an Werkwie auch an Sonn- und Feiertagen anzugeben. Während ihre Kinder sich ganz unbefangen in das sommerliche Treiben einbrachten, widmete Z. ihre Aufmerksamkeit vor allem der soziologischen Situation und kontrastierte diese mit ihren eigenen Kindheitserinnerungen. Wir begannen darüber zu diskutieren, warum es in früherer Zeit in Freibädern keiner Wachdienste bedurfte. Die Patientin erklärte, daß der hohe Anteil muslimischer Männer unter den Badegästen diesen Schutz notwendig mache. Sie will schon kurz nach dem Betreten den Freibades beobachtet haben, wie Gäste aus dieser Bevölkerungsgruppe die „strategisch wichtigen Positionen“ der Badeleitern besetzt hielten. Außerdem äußerte Z. hygienische Bedenken gegenüber sogenannten Burkinis, also religiös motivierten Ganzkörperbadeanzügen muslimischer Frauen. Wiederholt beklagte sie das Fehlen eines Bademeisters. Z. räumte ein, daß sie sich in ihrer Jugend auch oft mit Freundinnen an einem Baggersee verabredet hatte, der offiziell gar nicht zum öffentlichen Schwimmbetrieb zugelassen war. Die Person des Bademeisters gehörte somit nicht zwingend zu ihrer Erfahrung eines Badebetriebes. Wir vertieften die Frage nach der psychologischen Bedeutung des Bademeisters für die Patientin persönlich. Z. sah in dieser Person eine interkulturelle Institution, deren Präsenz für sie verbindliche soziale Regeln im Umgang unter den Besuchern garantierte. Die schwer zu vereinbarenden kulturellen Normen zwischen den zugewanderten und den angestammten Badegästen beunruhigten die Patientin. Ihre Beunruhigung verdichteten sich in der Sehnsucht nach einer Sicherheit gewährenden, überparteilichen Instanz. Während der Sitzung war mir selbst die eher negative Konnotation des Bademeisters aus meiner Schulzeit bewußt. Ich sah in ihm einen eher wenig qualifizierten Ordnungshüter, wobei es bei seiner damaligen Ordnungsfunktion eher um die Einhaltung von Vorschriften als um die Schlichtung von Konflikten ging. Z.‘s gemeinsamer Besuch des Freibades mit ihren zwei Söhnen rief mir auch eine unangenehme Situation aus meiner Kindheit in Erinnerung. Da das städtische Schwimmbad in erheblicher Entfernung zu meiner Grundschule lag und keine geeigneten Busverbindungen bestanden, arrangierte die Elternschaft mit ihren Privatautos einen Fahrdienst. Nach dem Schwimmunterricht kam eine der Mütter in die Umkleide der Jungen und verweilte dort ohne erkennbaren Grund, bis einer der Knaben sie schließlich zum Verlassen des Raumes aufforderte. Dies deckt sich mit der übertriebenen Fürsorge der Patientin gegenüber ihren Kindern. Natürlich ist der eigentliche Grund ihres Verlangens nach einem Bademeister die Sehnsucht nach einer Vaterfigur. Ich werde ihr in den kommenden Sitzungen einen ungezwungeneren Umgang mit ihren Kindern nahelegen. Sie sollte zudem versuchen, mit gesellschaftlichen Veränderungen, welche sie ohnehin nicht aufhalten kann, konstruktiver umzugehen.
Tagebuch-Eintragung
Eine kollektive Trunkenheit verbreitet sich angesichts der in immer größerer Zahl eintreffenden Flüchtlinge im Land. Sie begrüßt das Fremde unbesehen seiner Absichten, Motive und Instinkte. Es ist ein gönnerhafter Rausch, der gerade deshalb so spendabel daherkommt, weil es sich fast ausschließlich um gemeinschaftlichen Besitz handelt, der verschenkt wird. Den Angetrunkenen fehlt es daher an und ab auch an der gebotenen Zurückhaltung im Umgang mit den Begünstigten. Man scheut nicht davor zurück, sich aufzudrängen. Es ist eine ungleiche Party mit mehr oder weniger besoffenen Gastgebern und ungebetenen Gästen, welche sich mit ihren Hausherren nur ungern gemein machen wollen. Sie bleiben nüchtern und wissen, was sie wollen. Ihre Pläne gehen weit über die bloße Begrüßung hinaus. Sie sind gekommen, um zu bleiben und das kann sehr lange dauern. Vielleicht fühlen sie sich von den befremdenden Umarmungen und dem überschwenglichen Salut auch abgestoßen. Ein Gläubiger mit seinem Katalog von Forderungen unter dem Arm wünscht nicht, daß die Masse ihm Münzgeld zuwirft. Und überhaupt, eigentlich waren vorgängig gar keine Einladungen versandt worden, so wie sich das gehört. Es hatte zwar eine Art Ankündigung gegeben, die in etwa lautete, da sei „noch so viel Platz“, aber die Gäste hatten selbst einen Fuß in die Tür stellen müssen, und das haben sie nicht vergessen. Es ist also ein eigenwilliges Schauspiel, das sich in aller Öffentlichkeit vor mir abspielt. Dazu gehört auch, daß es weder einen vorab bestimmten Anfang noch ein absehbares Ende hat. Schärft man seine Sinne, dann bemerkt man schnell, daß die nimmermüden Gastgeber längst nicht mehr so alkoholisiert sind, wie sie vorgeben zu sein. Vom dionysischen Taumel ist wohl nur noch ein wohliges Schwindelgefühl geblieben. Trotzdem würde es keiner von ihnen wagen, die Musik ausklingen zu lassen, denn das wäre der Moment, in welchem allen bewußt würde, daß keiner der Gäste je dazu getanzt hatte.
Traumaufzeichnung
Erste Traumsequenz: Ich stehe in einem Personenaufzug, der hinunter fährt. Mir fällt auf, daß die einzelnen Stockwerke auf der Leiste mit den Knöpfen nicht mit Zahlen. sondern mit Buchstaben beschriftet sind.
Zweite Traumsequenz: Ich befinde mich in jenem katholischen Kindergarten, der einst zusammen mit einem Waisenhaus von Nonnen geführt wurde. Ein blondes Mädchen tritt an mich heran und erklärt mir, daß ihre Mutter sie heute abholen werde. Sie sagt dies auf eine sehr naive Art und lächelt hoffnungsvoll dabei. Irgendwie weiß ich, daß es so nicht sein wird, aber es ist unmöglich für mich, ihr das zu sagen.
Der erste Teil des Traums symbolisiert meinen Weg in die unteren Schichten des Unbewußten. Der zweite Teil steht in Verbindung mit einem Tagesrest. Eine Patientin hatte mir gestern von ihrer Schulzeit in einem Nonnenkloster erzählt. Die Begegnung mit den Ordensschwestern sei einer der Gründe dafür, warum sie mit der Kirche nichts mehr zu tun haben wolle, erklärte sie. Das gefühlsbetonte Auftreten des Mädchens im Traum läßt jedoch vermuten, daß mehr dahinter steckt. Es geht offenbar um eine enttäuschte Hoffnung, die ich mir noch nicht eingestehen will.
Tagebuch-Eintragung
Heute Nachmittag war ich mit Bernhard Joggen. Wir fuhren in seinem Wagen zum Sportplatz. Als Anwalt kommt er kaum ohne Auto aus. Dabei ist er finanziell mehr als klamm. Mandanten ohne Rechtsschutzversicherung lehnt er neuerdings generell ab. Wir laufen fünf Runden auf der Aschenbahn. Bernhard nimmt jeweils unsere Zeit, notiert sie in einem Notizbuch und vergleicht die Werte miteinander. Er war bisher immer der Sieger.
„Du bist heute Deine zweitschlechteste Zeit gelaufen“, sagt er ernst. „Nur im Mai vergangenen Jahres warst Du noch langsamer.“ Wir sind beide längst in einem Alter, in welchem die exakte Messung der körperlichen Leistung überflüssig wäre. Aber es gehört für Bernhard eben dazu, und deshalb sage ich nichts.
„Laß uns in die Klause gehen!“ schlage ich vor.
Ich profitiere von den Begegnungen mit Bernhard. Er gibt mir kostenlos juristische Ratschläge und unterhält mich mit kuriosen Geschichten aus dem sozialen Milieu seiner mittellosen Mandanten. „Ich habe Dir doch von dem Mann erzählt, den ich in einer Mietrechtsangelegenheit vertrete.“
„Du meinst jenen, dem nach einem Aufenthalt in der Psychiatrie die Wohnung gekündigt wurde.“
Ja, genau. Er hat mich anläßlich der Besprechung unserer Prozeßstrategie zu sich nach Hause eingeladen. Als er die Tür öffnete, stand er in einem blütenweißen Anzug vor mir. Er bat mich, Platz zu nehmen und setzte sich an den Flügel. Das Klavierstück habe er selbst komponiert, erklärte er mir. ‚Nur für Akademiker‘, wie er betonte.“
Ich muß lächeln. Bernhard kann stundenlang solche Anekdoten zum besten geben. Eigentlich fallen diese unter seine Schweigepflicht, aber das ist ihm egal. Wir kennen uns schon viele Jahre, und er hatte meine Scheidung durchgezogen.
„Mein neuster Fall hat mit der Flüchtlingskrise zu tun. Ich vertrete einen Übersetzer, der von einem Antragssteller während der Arbeit angegriffen und leicht verletzt wurde.“
Er macht eine Pause.
„Sie lügen alle. Die Flüchtlinge, die Willkommens-Bürger, die Fälscher-Industrie, die Anwälte, die auf die Durchsetzung des Bleiberechts spezialisiert sind – alle betrügen sie – ohne Ausnahme.“
Bernhard sieht mich durchdringend an. Vielleicht hatte er es lange Zeit für unmöglich gehalten, solch einen Satz irgendwann einmal auszusprechen.
„Was ich da zu hören bekomme, ist wie eine Ausdünstung, die sich über das ganze Land verbreitet. Es ist nicht nur das Asylsystem, der Gestank kommt mittlerweile durch jede Ritze dieses Staates. Das Recht verkommt zur Gaunerei, und die Kriminellen bereichern sich mit unverhohlener Schamlosigkeit. Da melden sich täglich Christen, die behaupten, wegen ihres Glaubens verfolgt zu werden. Nach wenigen Minuten stellt sich dann heraus, daß sie nicht einmal wissen, wofür der Heilige Abend steht. Mysteriöse Narben aus der Kindheit oder medizinischen Eingriffen werden als Beweise für Folter präsentiert und dazu passende politische Zusammenhänge dreist erfunden.“
So direkt und schonungslos hat Bernhard noch nie mit mir über ein Thema gesprochen. Ich erinnere mich an den unappetitlichen Fall eines Exhibitionisten, der von einem Meineid seiner Ehefrau gedeckt wurde. Bernhard blieb auch dann noch sachlich, als es schwer fiel, ihm noch weiter zuzuhören.
„Ich frage mich, wie man einer Arbeit nachgehen kann, bei der man täglich von früh bis spät belogen wird? Wie fühlt sich so ein Beruf ohne Ethos an?“
„Alle Beteiligten wissen, daß sie hintergangen werden. Aber sie dienen damit ihrer Ideologie und meinen, Gutes zu tun. Eine Eheschließung mit einer hiesigen Frau ist ein möglicher Weg, eine Duldung zu erwirken. Niemand schert sich darum, daß die vorgelegte Sterbeurkunde der Gattin in der Heimat eine Fälschung ist. Dabei wissen es alle. Sie tun nur so, als sei das Dokument echt. Dasselbe gilt für die vorgelegten Todesdrohungen islamischer Terrororganisationen. Briefkopf und Unterschrift sind zwar echt, man kann die Schreiben aber gegen Geld bestellen.“
Wir setzen uns an einen der Tische vor der Gaststätte und bestellen Bier. Es ist ein warmer Sommertag.
„Es gibt Menschen, die in der schummrigen Subkultur der Migranten das pralle Leben sehen“, sagte Bernhard. „Meist leben sie selbst in ganz anderen Verhältnissen, suchen aber immer wieder die Nähe zu dieser Kloake der Schlüpfrigkeit. Die Frauen sind fast schlimmer als die Männer. Sie flattern als ehrenamtliche Helferinnen in diesem Milieu herum, als müßten sie dort Nester versorgen.“ „Manchmal frage ich mich, ob es ein schlechtes Gewissen ist, daß diese Frauen antreibt. Vielleicht haben sie irgendetwas in ihrem Leben getan, das sie meinen, wiedergutmachen zu müssen?“
Bernhard geht auf meine Frage nicht ein.
„Man kann sich kaum etwas aggressiveres und skrupelloseres als meine Kollegen vorstellen. Meist sind es Kolleginnen, welche die Interessen der Einwanderer vertreten. So wie der Übersetzer mir die Vorgänge geschildert hat, wird er schon im Vorfeld unter Druck gesetzt, Widersprüche der Antragsteller zu beschönigen oder auszulassen. Hin und wieder muß er nachträglich selbst eine Geschichte erfinden, die irgendwie schlüssig zusammenpaßt. In diesem Fall hat die Anwältin von Anfang an gefordert, er solle auf ihr Plädoyer hinwirken, oder es werde negative Konsequenzen für ihn haben.“
„Fordert er Schadensersatz?“
„Ja, aber ich fürchte, es wird ein politischer Prozeß werden, und da hat er schlechte Karten. Man will verhindern, daß er mit seiner Schilderung der Zustände an die Öffentlichkeit geht.“
Eine Bekannte aus früheren Tagen gesellt sich zu uns an den Tisch, und das Gespräch nimmt eine andere Wendung.
Tagebuch-Eintragung
Gestern Abend war ich zu Besuch im Parkcafé. Seit meiner Scheidung besuche ich dieses Bordell ein bis zwei Mal pro Woche. Davor, als Sandra und ich schon kaum mehr miteinander sprachen, seltener. Von außen wirkt das Etablissement unauffällig wie ein Hotel. Es rekrutiert seine Gäste durch Mund-zu-Mund-Propaganda. Wenn die Tür dann elektrisch geöffnet wird und man den Barbereich betritt, wird schnell klar, um was es hier geht. An Orten wie diesem bringen die Frauen eine seltene Saite zum Schwingen. Ein Ingenieur, der viele Jahre in arabischen Ölstaaten beschäftigt war, erzählte mir einmal von den Sitten am Hofe seines Gastlandes und der Hochzeit des Prinzen. Von Geburt an hatte der Thronfolger, wie es die Tradition befielt, die Frauen im Palast nur verschleiert gesehen. Er kannte ihre Namen und wußte, ihre Stimmen zu unterscheiden. Dennoch hatte er noch nie einer von ihnen ins Anlitz geschaut. Das änderte sich erst am Tag seiner Hochzeit. Für die Dauer dieses einen Festes zeigten all jene Frauen, die er schon viele Jahre kannte, unverhüllt ihre Gesichter. Doch schon am nächsten Morgen war alles wieder beim alten, und nur in seiner Erinnerung wußte er noch von der Anmut der einen und der Schönheit der anderen. Ähnlich verhält es sich mit den Frauen des horizontalen Gewerbes. Hier läuft das Drängen der Männer ins Leere, da es auf keinen Widerstand mehr stößt. Alles ist eine Spur ungenierter, aber gerade deshalb persönlicher: die Blicke, die Kleidung, die Sprache, wie auch die scheinbar zufällige Berührung. Wahrscheinlich hat jeder heute lebende Mensch Ahninnen, welche sich in ferner Vergangenheit für einen geldwerten Vorteil auf eine sexuelle Handlung einließen. Das ist jenes geheime Erbe der Frauen, das sich mir an diesem verwunschenen Ort enthüllt. Es lädt ein und wartet ab, reizt meine Sinne und prüft mein Begehren, bietet sich an und gibt sich mir hin. Ich hatte zuvor angerufen und gebeten, daß Gysèle auf mich warten möge. Sie trägt an diesem Abend ein beiges, klassisch geschnittenes Kostüm, und wir setzen uns an einen der kleinen Tische im hinteren Bereich. Sie freut sich, mich zu sehen. Wir kennen uns schon lange. Wie immer bin ich um die ersten Worte verlegen.
„Wir waren am Wochenende auf dem Volksfest“, sagt Gysèle auf eine Art, als würde sie ein Schachspiel eröffnen.
„Ich habe es noch nie besucht“, antwortete ich. „Ist es wirklich so international?“
„Ja, das kann man schon sagen. Und wenn dann Bier getrunken wird, hat mancher bald so einen sitzen, daß er nicht mehr stehen kann. Bei den Männern vom dunklen Kontinent ist es jedoch meist genau umgekehrt.“
Ich muß lachen. Gysèle hat einmal mehr den genau richtigen Ton getroffen.