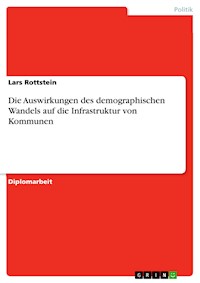
Die Auswirkungen des demographischen Wandels auf die Infrastruktur von Kommunen E-Book
Lars Rottstein
0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Diplomarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich Politik - Politisches System Deutschlands, Note: 1,3, Universität Kassel, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Konsequenzen des demographischen Wandels in Deutschland sind seit Jahrzehnten bekannt. Bevölkerungsforscher weisen immer wieder auf den demographischen Wandel hin. In Deutschland war Mitte der 1970er Jahre zum ersten Mal ein negatives natürliches Bevölkerungssaldo zu beobachten. Seitdem stagnieren die Geburtenzahlen auf dem niedrigen Niveau von 1,4 Kindern pro Frau. Da es Anfang der 1990er Jahre zu starken Zuwanderungen kam, setzte sich kaum einer mehr intensiv mit dem Thema der demographischen Entwicklung auseinander. Erst seitdem die Entwicklungen in den ostdeutschen Bundesländern sichtbar wurden, gerieten die Auswirkungen des demographischen Wandels auf die städtischen Strukturen verstärkt in die politische Diskussion. Seit dem beschäftigen sich immer mehr Kommunen mit der demographischen Entwicklung. Für eine Kommune ist es wichtig, zukunftsfähige Anpassungsstrategien zu entwickeln, um sich auf den demographischen Wandel einzustellen. Für die kommunale Entwicklungsplanung sind die Bevölkerungsentwicklung und die Bevölkerungsstruktur entscheidende Bezugsgrößen. Dies betrifft vor allem die Auslastung bestehender Infrastruktureinrichtungen und die für die Zukunft erforderlichen Neuinvestitionen. Für die Gegenwart und Zukunft stellt die demographische Entwicklung eine der größten Herausforderungen dar. Der demographische Wandel ist in Deutschland durch eine steigende Lebenserwartung der Bevölkerung bei gleichzeitigem Rückgang der Geburtenzahlen unter das Reproduktionsniveau gekennzeichnet. Daraus resultieren eine zunehmende Alterung und die quantitative Abnahme der Bevölkerung. Der demographische Wandel ist so tief greifend, dass alle Lebensbereiche von ihm betroffen sind. Im Bereich der sozialen Infrastruktur muss sich die Bereitstellung von Kinderbetreuung, Pflegeheimen und Tagesstätten verändern, um den Bedürfnissen und dem Bedarf der Gesellschaft zu entsprechen. Der demographische Wandel wird sich jedoch räumlich sehr differenziert auswirken. In strukturschwachen und ländlichen Regionen wird es zu starken Einwohnerverlusten kommen. Dabei wird in vielen Regionen die Tragfähigkeit von Infrastruktureinrichtungen gefährdet sein. In anderen Regionen, wie z. B. im süddeutschen Raum und hier besonders in München, wird der demographische Wandel weniger stark ausfallen. Es wird zwar auch hier zu Veränderungen in der Altersstruktur kommen, aber die Bevölkerung wird größtenteils nicht rückläufig sein.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2007
Ähnliche
Page 1
Die Auswirkungen des demographischen
Wandels auf die Infrastruktur
Page 4
Page 5
Tabellenverzeichnis
Tab. 1: Altersaufbau der Bevölkerung Deutschlands..................................................... 31 Tab. 2: Wohnsituation in Deutschland 2002 .................................................................. 56 Tab. 3: Anpassungsfähigkeit und betriebstechnische sowie investive Maßnahmen bei Auslastungsproblemen für die Ver- und Entsorgungssysteme............................... 61
Page 6
Abkürzungsverzeichnis
Abb. Abbildung BMFSFJ Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend BMVBS Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung ca. circa DDR Deutsche Demokratische Republik d. h. das heißt NRW Nordrhein-Westfalen ÖPNV Öffentlicher Personennahverkehr SGB Sozialgesetzbuch Tab. Tabelle TAG Tagesbetreuungsausbaugesetz u. a. unter anderem
Page 7
1 Einleitung
1.1 Problemstellung
Die Konsequenzen des demographischen Wandels in Deutschland sind seit Jahrzehnten bekannt. Bevölkerungsforscher weisen immer wieder auf den demographischen Wandel hin. In Deutschland war Mitte der 1970er Jahre zum ersten Mal ein negatives natürliches Bevölkerungssaldo zu beobachten. Seitdem stagnieren die Geburtenzahlen auf dem niedrigen Niveau von 1,4 Kindern pro Frau.1Da es Anfang der 1990er Jahre zu starken Zuwanderungen kam, setzte sich kaum einer mehr intensiv mit dem Thema der demographischen Entwicklung auseinander. Erst seitdem die Entwicklungen in den ostdeutschen Bundesländern sichtbar wurden, gerieten die Auswirkungen des demographischen Wandels auf die städtischen Strukturen verstärkt in die politische Diskussion. Seit dem beschäftigen sich immer mehr Kommunen mit der demographischen Entwicklung. Für eine Kommune ist es wichtig, zukunftsfähige Anpassungsstrategien zu entwickeln, um sich auf den demographischen Wandel einzustellen. Für die kommunale Entwicklungsplanung sind die Bevölkerungsentwicklung und die Bevölkerungsstruktur entscheidende Bezugsgrößen. Dies betrifft vor allem die Auslastung bestehender Infrastruktureinrichtungen und die für die Zukunft erforderlichen Neuinvestitionen. Für die Gegenwart und Zukunft stellt die demographische Entwicklung eine der größten Herausforderungen dar. Der demographische Wandel ist in Deutschland durch eine steigende Lebenserwartung der Bevölkerung bei gleichzeitigem Rückgang der Geburtenzahlen unter das Reproduktionsniveau gekennzeichnet. Daraus resultieren eine zunehmende Alterung und die quantitative Abnahme der Bevölkerung. Der demographische Wandel ist so tief greifend, dass alle Lebensbereiche von ihm betroffen sind. Im Bereich der sozialen Infrastruktur muss sich die Bereitstellung von Kinderbetreuung, Pflegeheimen und Tagesstätten verändern, um den Bedürfnissen und dem Bedarf der Gesellschaft zu entsprechen. Der demographische Wandel wird sich jedoch räumlich sehr differenziert auswirken. In strukturschwachen und ländlichen Regionen wird es zu starken Einwohnerverlusten kommen. Dabei wird in vielen Regionen die Tragfähigkeit von Infrastruktureinrichtungen gefährdet sein. In anderen Regionen, wie z. B. im süddeutschen Raum und hier besonders in München, wird der demographische Wandel
1Vgl. Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (2004), S. 21.
Page 8
weniger stark ausfallen. Es wird zwar auch hier zu Veränderungen in der Altersstruktur kommen, aber die Bevölkerung wird größtenteils nicht rückläufig sein. Jede dieser demographischen Prognosen, besonders wenn sie dreißig oder sogar fünfzig Jahre in die Zukunft weisen, sollte man mit Vorsicht genießen, da Änderungen in den verschiedenen Bereichen zu erheblichen Veränderungen in der Prognose führen können. Denn wer hätte z. B. in den 1950er Jahren mit der Einführung und der Wirkung der Pille rechnen können.
1.2 Zielsetzung und Themeneingrenzung
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den Auswirkungen des demographischen Wandels auf die Infrastruktur von Kommunen. Es soll ein Überblick über die Problematik des demographischen Wandels gegeben werden, welche Probleme auf Deutschland in den nächsten Jahrzehnten zukommen, wenn nichts getan wird. Das Ziel der Arbeit ist es, neben diesem Überblick zukunftsfähige Anpassungsstrategien als Reaktion auf den demographischen Wandel zu entwickeln und am Beispiel der Stadt Kassel anzuwenden.
Die enorme Komplexität des demographischen Wandels bedarf einer sinnvollen Eingrenzung des Themas. In Abstimmung mit dem Betreuer bildet die Begriffsdefinition der Demographie eine Grundlage dieser Arbeit. Als Nächstes interessiert die Bevölke-rungsvorausberechnung bis zum Jahr 2050, die Veränderungen in der Größe und vor allem im Altersaufbau der Bevölkerung in Deutschland unter aus heutiger Sicht realistischen Annahmen zeigt. Diese Annahmen wurden unter den wichtigsten Determinanten der Bevölkerungsvorausberechnung getroffen: der Fertilität, der Lebenserwartung sowie der Außenwanderungen. Im Folgenden werden dann Anpassungsstrategien für verschiedene Bereiche der Infrastruktur gezeigt. Diese Strategien werden schließlich auf die Stadt Kassel angewandt.
Auf die weiteren Einzelheiten der Untergliederung wird näher in der Vorgehensweise eingegangen.
Das Themengebiet des demographischen Wandels ist so umfangreich, dass nicht auf alle Details eingegangen werden kann, so dass der Anspruch auf Vollständigkeit nicht er- füllt ist.
Page 9
1.3 Vorgehensweise
In Anschluss an die Einleitung, werden im zweiten Abschnitt ein demographisches Grundwissen und aktuelle Trends in der demographischen Entwicklung dargelegt. Des Weiteren wird auf den Strukturwandel sowie auf die Bevölkerungsvorausberechnung bis zum Jahr 2050 eingegangen.
Im dritten Abschnitt werden erst einmal die Grundlagen der Infrastruktur näher erläutert, bevor dann auf die Zusammenhänge zwischen der Demographie und der Infrastruktur eingegangen wird. Nachdem dies erläutert ist, steht die Entwicklung der Infrastruktur von Kommunen unter demographischen Gesichtspunkten im Vordergrund. Hierbei werden die aus der demographischen Entwicklung resultierenden Konsequenzen aufgezeigt. Als erstes erfolgt die Betrachtung der Entwicklung der sozialen Infrastruktur. Weiterhin wird betrachtet, inwiefern sich die demographische Entwicklung auf die technische Infrastruktur mit den Bereichen des öffentlichen Personennahverkehrs und der Wasserversorgung auswirkt.
Aufbauend auf dem resultierenden Ergebnis soll im Abschnitt 4 auf die demographische Entwicklung der Stadt Kassel eingegangen werden. Zuerst wird eine Prognose für die Bevölkerungsentwicklung der Stadt Kassel bis zum Jahr 2050 gegeben. Danach werden zukunftsfähige Anpassungsstrategien für die verschiedenen Bereiche der Infrastruktur entwickelt. Bevor auf die Bevölkerungsentwicklung in Hessen eingegangen wird, werden die Zielsetzungen der Stadt Kassel, wie sie die demographische Entwicklung bewältigen will, erläutert.
Der Abschnitt 5 soll die Ergebnisse zusammenfassen und einen Ausblick für die Zu- kunft geben.
Page 11
Die Zahl der Bevölkerung wird mittels der demographischen Grundgleichung fortgeschrieben. Dies basiert auf den Ergebnissen einer Bevölkerungszählung. Dabei verändert sich die Ausgangsbevölkerung (t0) auf Grund von demographischen Ereignissen. Hierzu zählen die Geburten, Sterbefälle sowie die Zu- und Fortzüge.7
2.2 Determinanten der Demographie
Die demographische Entwicklung wird durch die drei Hauptdeterminanten Fertilität, Mortalität und Migration bestimmt. Diese drei Faktoren beeinflussen die Bevölkerungsentwicklung und daher werden sie im Folgenden näher dargestellt.
2.2.1 Fertilität
Die Fertilität ist die erste Determinante der Demographie. Sie ist ein Bestandteil der natürlichen Bevölkerungsentwicklung, welche Geburten und Sterbefälle umfasst. Diese natürlichen, demographischen Ereignisse verändern die Bevölkerungszahl undstruktur.8Um das natürliche Bevölkerungssaldo herauszubekommen, werden Geburten und Sterbefälle eines Beobachtungszeitraums einander gegenübergestellt. Von einem positiven Bevölkerungswachstum wird dann gesprochen, wenn in einem räumlich abgegrenzten Gebiet die Anzahl der Geburten gegenüber der Anzahl der Sterbefälle überwiegen.
Die Fertilität bezeichnet die Geburtenhäufigkeit, d. h. die tatsächliche Realisierung von Nachkommen in einer Bevölkerung.9Die absolute Zahl an Geburten hängt vom generativen Verhalten einzelner Individuen ab. Dies sind alle allgemein akzeptierten Normen und Verhaltensweisen, die den Kinderwunsch und seine Realisierung beeinflussen. Die einfachste Messgröße zur Beurteilung der Fertilität ist die Geburtenziffer (rohe Geburtenziffer). Sie bezieht sich auf die absolute Bevölkerungszahl und ergibt sich aus der Zahl der Lebendgeburten eines Jahres je 1.000 Einwohner.10Entscheidend für die Geburtenhäufigkeit sind aber die Frauen im Alter zwischen 15 und 45 Jahren, also der potenziell gebärfähige Teil einer Bevölkerung. Bei dieser Messziffer wird somit nicht die Gesamtbevölkerung berücksichtigt, sondern nur der gebärfähige Teil einer Bevölke-7Vgl.Münz (2002), S. 2.
8Vgl. Statistisches Landesamt Baden-Württemberg (2002), o. S.
9Vgl. Höhn (1987), S. 96.
10Vgl. Münz/Ulrich (2000), S. 20.
Page 12
rung.11Die meisten Industrieländer unterschreiten jedoch schon seit den 1970er Jahren die “magische Schwelle“ von 2,1 Kindern pro Frau, die reichen würde um eine Elterngeneration vollständig zu ersetzen.12
2.2.2 Mortalität
Die zweite Determinante der Demographie ist die Mortalität, worunter man die Zahl der Sterbefälle einer Bevölkerung innerhalb eines bestimmten Zeitraums versteht. Die Sterblichkeit wird mittels der Sterberate wiedergegeben, sie wird definiert durch die Zahl der Sterbefälle je 1.000 Einwohner pro Jahr.13Die Lebenserwartung ist mit Mortalität eng verbunden und gilt als die wichtigste demographische Messziffer zur Beurteilung der Sterblichkeitsverhältnisse. Der Begriff Lebenserwartung bezieht sich auf die durchschnittliche Anzahl von Lebensjahren, die ein Mensch auf Grund der zu einem Zeitpunkt geltenden altersspezifischen Sterblichkeitsverhältnisses noch leben wird.14In Folge des medizinischen Fortschritts und der veränderten Lebensbedingungen ist die Höhe der Lebenserwartung einem ständigen Wechsel unterzogen. Sie ist ein guter Indi-kator für die Qualität der Gesundheitsversorgung und den Lebensstandard eines Landes, z. B. soziales Umfeld, ausreichend Heizung, warme Kleidung, Qualität von Wohnung und Arbeitsplatz etc.15So ist die Lebenserwartung von Land zu Land sehr unterschiedlich.
Im Vergleich von Mann und Frau haben Frauen eine längere Lebenserwartung. Die Differenz zwischen Männern und Frauen wird als Übersterblichkeit bezeichnet.
Einflussgrößen für die Mortalität sind vor allem:16
•Ökologische Determinanten (Vorsorge vor Naturkatastrophen, Umwelt)•Sozioökonomische, politische und kulturelle Determinanten (z. B. Verbesserung des Arbeitsschutzes, Verringerung der körperlichen Arbeit, bessere Ernährung, Krieg)
•Medizinische Determinanten (z. B. Schutzimpfungen, Hygienevorschriften)
11Vgl. Münz/Ulrich (2000), S. 20.
12Vgl. ebenda, S. 22.
13Vgl. Höhn (1987), S. 70.
14Vgl. Münz/Ulrich (2000), S. 14.
15Vgl. ebenda.
16Vgl. Wikipedia (2006c), o. S.
Page 13
2.2.3 Migration
Die Migration ist der dritte wichtige Bestimmungsfaktor in der Bevölkerungsentwicklung. Sie wird als die Veränderung der Bevölkerung nach Zahl und Struktur durch Zu-und Fortzüge definiert.17Um das Wanderungsvolumen darstellen zu können, bedarf es der Berechnung des Wanderungssaldos. Hierbei wird die Summe aus Zu- und Fortzügen gebildet. Um die Nettowanderungsrate zu ermitteln, muss die Differenz zwischen Zu- und Abwanderungen je 1.000 Einwohner berechnet werden.18
Migration kann in drei Formen erfolgen:
•Emigration (Auswanderung) ist das freiwillige oder erzwungene Verlassen des Heimatlandes auf Dauer. Sie erfolgt aus wirtschaftlichen, politischen oder anderen individuellen Gründen.
•Immigration (Einwanderung). Hierbei verlegt eine Person dauerhaft ihren Wohnsitz in ein anderes Land.•Permigration (Durchwanderung).





























