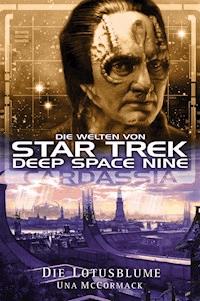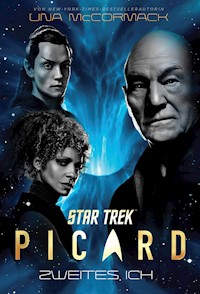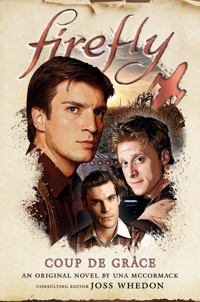Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Cross Cult
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Kathryn Janeway enthüllt ihre Karriere in der Sternenflotte, von ihrem ersten Kommando bis zu ihrer epischen Reise durch den Delta-Quadranten, die zu ihrem Aufstieg zum Vice Admiral im Sternenflottenkommando führte. Entdecken Sie die Geschichte der Frau, die weiter gereist ist als je ein Mensch zuvor, Jahrzehnte von zu Hause entfernt gestrandet war und neue Welten und Zivilisationen kennengelernt hat. Erfahren Sie, wie sie die Sternenflotte und den Maquis zu einer Mannschaft zusammenbrachte, neue Allianzen mit Spezies in der ganzen Galaxis schmiedete und eine der größten Bedrohungen der Sternenflotte – die Borg – in ihrem eigenen Territorium besiegte. Außerdem erhalten Sie Einblicke in Janeways Beziehungen zu den wichtigsten Figuren wie Seven of Nine, ihrem Freund Tuvok, Neuankömmlingen wie Neelix und ihrem Stellvertreter Chakotay.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 386
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DIE AUTOBIOGRAFIE VON
KATHRYN JANEWAY
DIE GESCHICHTE DES CAPTAINS, DER SO WEIT REISTE, WIE NIEMAND ZUVOR
VONKATHRYN M. JANEWAY
HERAUSGEGEBEN VON UNA McCORMACK
INS DEUTSCHE ÜBERTRAGEN VON ROSWITHA GIESEN
Die deutsche Ausgabe von DIE AUTOBIOGRAFIE VON KATHRYN JANEWAY wird herausgegeben von Cross Cult/Andreas Mergenthaler, Teinacher Straße 72, 71634 Ludwigsburg. Verlagsleitung: Luciana Bawidamann; Übersetzung: Roswitha Giesen; verantwortlicher Redakteur und Lektorat: Markus Rohde; Lektorat: Katrin Aust; Korrektorat: Verena Jung; Satz: Rowan Rüster; Printausgabe gedruckt von CPI books GmbH. Printed in Germany.
Titel der Originalausgabe: THE AUTOBIOGRAPHY OF KATHRYN JANEWAY
TM ® & © 2022 by CBS Studios Inc. © 2022 Paramount Pictures Corporation. STAR TREK and related marks and logos are trademarks of CBS Studios Inc. All Rights Reserved.
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without prior written permission from the publisher.
Illustrationen: Russell Walks
Redaktion Titan Books: Cat Camacho
Design Innenteil: Rosanna Brockley/MannMade Designs
This translation of THE AUTOBIOGRAPHY OF KATHRYN JANEWAY, first published in 2020, is published by arrangement with Titan Publishing Group Ltd.
German translation copyright © 2022 by Cross Cult.
ISBN Printausgabe: 978-3-96658-948-2 (Oktober 2022)
E-Book ISBN: 978-3-96658-949-9 (Oktober 2022)
WWW.CROSS-CULT.DE
INHALT
EINLEITUNGvon Commander Naomi Wildman
KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
KAPITEL 8
KAPITEL 9
KAPITEL 10
KAPITEL 11
KAPITEL 12
Für Daniel,für viele Jahre anregender Gesprächeund die besten Ideen
EINLEITUNG
VON COMMANDER NAOMI WILDMAN
ALS ICH EIN KLEINES MÄDCHEN WAR, WOLLTE ICH RAUMSCHIFFCAPTAIN WERDEN. Natürlich haben viele Kinder dasselbe Ziel, aber ich wollte nicht auf irgendeinem Raumschiff Captain werden. Nein, mir schwebte ein ganz bestimmtes vor. Ich wollte Captain der U.S.S. Voyager werden.
Eigentlich war dieses Ziel gar nicht so ungewöhnlich, denn ich kam im Delta-Quadranten zur Welt und verbrachte den größten Teil meiner Kindheit an Bord der Voyager. Daher war unser Captain meiner Meinung nach die beste Person in der gesamten Galaxis. Wenn ich groß war, wollte ich wie sie werden. Und bis dahin gab ich mich damit zufrieden, ihre Assistentin zu sein.
Die meisten Leute in meinem Alter haben die Geschichte der Voyager in ihrer Kindheit mitverfolgt – verloren im Delta-Quadranten, siebzigtausend Lichtjahre von der Heimat entfernt, versuchte sie, zu Familie und Freunden zurückzukehren. Für mich war das Alltag. Vielleicht waren Sie ganz aufgeregt, als bekannt gegeben wurde, dass man die Voyager gefunden oder eine Komm-Verbindung hergestellt hatte, oder, die aufregendste Nachricht überhaupt, dass unser Schiff nach nur sieben Jahren über einen Transwarpkanal nach Hause gebracht worden war.
Bestimmt war das für Sie ein großes Abenteuer, aber für mich, na ja, für mich war es mein Zuhause. Meine Mom, Sam Wildman, diente als Ensign, als die Voyager entführt wurde – und fand dann heraus, dass sie schwanger war. Meine Geburt gehört zu den vielen außergewöhnlichen Geschichten jener Jahre, aber dadurch kannte ich in meiner Kindheit kein anderes Leben. Mein Zuhause war ein kleines Schiff, weit entfernt vom Ausgangspunkt seiner Reise, voller Angehöriger der Sternenflotte und des Maquis und vieler anderer interessanter Leute. Die meiste Zeit flogen wir ruhig durch den Weltraum – manchmal wurden wir von Vidiianern, Hirogen oder Kazon angegriffen. In meiner Kindheit waren meine Freunde ein Talaxianer, eine Ocampa und zwei befreite Borg-Drohnen, die das Leben als Individuen erlernten. Logikspiele brachte mir ein besonnener Vulkanier bei und wie ich alles in meiner Umgebung reparieren konnte, eine Halbklingonin. Den Holoroman Captain Proton spielte ich schon, als die meisten noch nie davon gehört hatten. Mut, Weisheit und Anmut im Gefecht lernte ich vom besten Captain, den es gab – Kathryn M. Janeway.
Admiral Janeway, wie man sie heute nennt, inspirierte über die Jahre zahllose Menschen. Wer sonst hätte diese Mannschaft zusammenhalten können? Wer sonst hätte mit Intelligenz und einer starken Persönlichkeit eine Gruppe Sternenflottenoffiziere und Maquis-Kämpfer dazu gebracht, sich zusammenzuraufen und einen Kurs Richtung Heimat einzuschlagen? Wer sonst hätte gegen die Borg-Königin kämpfen, die Hirogen besiegen oder derart souverän die Holofigur Arachnia, Königin des Spinnenvolkes, Erzfeindin von Captain Proton, spielen können? Wer sonst hätte sich fast täglich die Zeit genommen, um nach ihrem jüngsten Besatzungsmitglied Naomi zu sehen, das sie so sehr liebte und bewunderte? Wer sonst hätte dieses kleine Mädchen zu seiner Assistentin ernannt?
Als ich dieses kleine Mädchen war, wollte ich wie Kathryn Janeway werden. Doch eigentlich kann sie niemand ersetzen – und Kathryns größte Fähigkeit besteht darin, Leute dazu zu ermutigen, ihr Bestes zu geben. Viele von uns verdanken ihr so viel. Vielen Dank, Admiral, dass Sie uns nach Hause gebracht haben – aber vor allem vielen Dank dafür, dass Sie an uns geglaubt und das Beste aus uns herausgeholt haben. Es kann immer nur einen Captain der Voyager geben – Kathryn Janeway.
Naomi Wildman
Führungsoffizier, Deep Space K-7
KAPITEL 1
ZU HAUSE IST ES DOCH AM SCHÖNSTEN · 2336–2347
ALS ICH EIN KLEINES MÄDCHEN WAR, BASTELTE MEINE MUTTER POP-UP-BÜCHER. Wissen Sie noch, welche ich meine? Wenn man eine Seite umblättert, klappt sich eine ganze Szenerie auf. Selbst heute, in fortgeschrittenem Lebensalter, finde ich diese Werke wunderbar. Wahrscheinlich liegt es an der Kunstfertigkeit, der sorgfältigen Konstruktion und, ja, auch der Technik, die dafür nötig ist. Die Bücher meiner Mutter waren echte Wunderwerke.
Meine kleine Schwester und ich hatten jeweils ein Lieblingsbuch. Phoebe, drei Jahre jünger als ich, liebte Alice im Wunderland – eine angemessene Wahl für ein kreatives und künstlerisch begabtes kleines Mädchen, das in einer Wunderwelt zu leben schien. Auch ich liebte dieses Buch. Meine Mutter hatte aus Karton und Transparentpapier einen kleinen Tunnel gebaut, durch den man sehen konnte, wie Alice und das weiße Kaninchen hinunterfielen. Etwas später klappte man ein Haus auf, aus dem die riesigen Arme und Beine von Alice herausschauten. Das brachte uns immer zum Lachen. Doch das schönste Bild waren die unzähligen Spielkarten, die durch die Luft flogen, wenn wir, zusammen mit Alice, sagten: »Ihr seid doch nichts weiter als ein Kartenspiel!«
Ja, ich liebte das Wunderland, aber eigentlich schlug mein Herz für Der Zauberer von Oz. Aus irgendeinem Grund berührte mich die Geschichte von Dorothy Gale. Von einem Wirbelsturm ihrer Familie entrissen und in ein fremdes Land davongetragen, musste sie mit Verstand, Herz und Mut überleben, neue Freunde kennenlernen und ihren Weg zurück nach Hause finden. Meine erste Ahnung vom Abenteuer. Im sicheren Zuhause, umgeben von meiner liebevollen Familie, träumte ich davon, nach Oz zu fliegen. Mom hatte das Buch raffiniert gebastelt, vom Zyklon, der über die erste Seite rauschte, und der kleinen grünen Brille, in einem Umschlag versteckt, den man öffnete, um die Smaragdstadt zu erkunden, bis zur allerletzten Seite, auf der, wie aufregend, die meiner Meinung nach aufwendigste Konstruktion meiner Mutter zu finden war: ein Ballon aus Karton, der flach auf den Seiten lag, bis man ihn an einem Faden zwischen zwei Halmen nach oben zog und auseinanderdrückte, sodass darunter der winzige Korb baumelte. Als kleines Kind verbrachte ich viele Stunden mit diesem Buch. Nicht nur die Geschichte hatte mich verzaubert, ich wollte herausfinden, wie meine Mutter alles zusammengebaut hatte. Mom pflegte zu sagen, dass Daddy mir das Fliegergen vererbt hätte, das Verlangen, loszufliegen und in den Weltraum zu reisen. Doch eine große Rolle spielte ihr wunderbarer, zauberhafter Ballon aus Karton, der den weiten Weg von Oz zurücklegte.
Wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, ist mir heute klar, dass sich in diesen Büchern die Interessen der ganzen Familie vereinten. Meine Mutter, mit Mädchennamen Gretchen Williams, war Künstlerin. Ständig experimentierte sie mit neuen Formen, doch ihr wahres Talent waren Illustrationen. Wahrscheinlich kennen Sie sie als Autorin dutzender Kinderbücher und -holoromane. Generationen von Kindern liebten ihre Geschichten. Phoebe trat in ihre Fußstapfen, denn sie hatte ihre künstlerische Ader geerbt. Auf einem meiner Holofotos stehen die beiden nebeneinander, Mom mit Pinsel in der Hand und Farbklecks auf der Nase, daneben Phoebe in gleicher Pose. Ich war keine Künstlerin. Meine Häuser standen schief, meine süßen Fellwesen erschienen bedrohlich, meine Menschen passten eher in einen Horrorholoroman. Allerdings kann ich sehr genaue Schaubilder zeichnen.
Ich war die Naturwissenschaftlerin, die Technikerin, die Praktikerin, die gern mit Zahlen umging. Ich blickte in die Sterne und zeichnete sie auf, ich wünschte mir Maschinen, wollte fliegen. Insofern kam ich nach meinem Vater Edward, Freunde nannten in Ted, meine Mutter Teddy, einen begeisterten Hobbypiloten und Astronomen. Außerdem war er Flaggoffizier der Sternenflotte, und diese Tatsache prägte mein Leben erheblich. Unsere Kindheit zeichnete sich durch die Traurigkeit über seine unvermeidliche Abwesenheit und, mindestens genauso sehr, durch die Freude über seine Anwesenheit aus, die wir intensiv erlebten. Mehr als alles andere wünschte ich mir, dass mein tapferer, fröhlicher, wunderbarer Vater stolz auf mich war. Mehr als alles andere wünschte ich mir, dass er mich als Captain eines Raumschiffs erleben würde, genau wie er es war. Dass sich dieser Wunsch nicht erfüllte, bedauere ich bis heute zutiefst. Mein Vater erlebte, wie ich auf die Akademie ging, aber nicht, wie ich Captain eines Schiffes wurde, ganz zu schweigen davon, dass ich eines von der weitesten Reise, die je ein Schiff unternommen hatte, sicher nach Hause brachte. Aber ich greife zu weit voraus. Kehren wir noch einmal an den Anfang zurück, zu einer kleinen Farm im mittleren Westen, auf den Nordteil des amerikanischen Kontinents der Erde.
Unsere Familie war auf einer kleinen Farm bei Bloomington in Indiana zu Hause. In dieser Gegend hatte die Familie meiner Mutter seit Generationen gelebt, sie waren waschechte Einwohner des Mittleren Westens. Wir kannten die Familiengeschichte der Williams (Pioniere, Siedler, die traditionellen Planwagen) und sowohl meine Großeltern mütterlicherseits als auch meine Mutter stellten sicher, dass wir die vollständige Geschichte dieses Landes, auf dem wir lebten, kannten und nicht nur die lückenhafte Erzählung, die einst in Zeiten von Nationalstaaten und der US-amerikanischen Ideologie des Manifest Destiny gelehrt worden war. Zu den Völkern, die hier vor der Ankunft meiner Vorfahren gelebt hatten, gehörten die Potawatomi, amerikanische Ureinwohner der Great Plains, die im neunzehnten Jahrhundert vertrieben worden waren. Sie selbst nennen sich Neshnabé, das Urvolk. Meine Mutter sorgte dafür, dass Phoebe und ich verstanden, dass das Land, das wir unsere Heimat nannten, bereits die Heimat vieler Menschen vor uns gewesen war und die vieler nach uns sein würde. Auch die Geschichten anderer Völker erzählte sie uns. Eine meiner Lieblingsgeschichten war die Cherokee-Geschichte der Wasserspinne. Eine Freundin meiner Mutter hatte ein Buch darüber geschrieben und illustriert, das ich sehr mochte. Die Wasserspinne geht auf eine weite Reise, um das Feuer zu finden, damit die anderen Tiere überleben können. Diese prahlen damit, dass sie es finden werden, und lachen sie aus, als sie erklärt, es schaffen zu können. Doch dann webt sie aus ihren Fäden ein Boot und segelt über das Wasser, bringt ein glühendes Stück Kohle mit und wird für ihren Mut und ihre Ehre gefeiert. Auf meiner Reise nach Hause dachte ich häufig an die Wasserspinne.
Meine Großeltern mütterlicherseits, Hector und Ellen Williams, lebten auf ihrer Farm, deren Land direkt an unseres grenzte, und so waren Phoebe und ich oft bei ihnen. Zu meinen frühesten Erinnerungen gehört eine alte Eiche, die auf der Farm meiner Großeltern stand. Auf diesem alten Baum habe ich klettern gelernt und Grandpa baute mir eine Schaukel, die er an seinen Ästen installierte. Wie gern habe ich dort gespielt! An einem besonders heißen Sommernachmittag, als die Erwachsenen schwitzend im Schatten saßen, wollte niemand mit mir spielen. Nach einem Wutanfall tobte ich mich an der Schaukel aus und ließ sie bestimmt eine Stunde lang meinen Frust spüren. Dass sie dabei nicht herunterkam, zeigt, was für ein talentierter Zimmermann mein Großvater war. Als ich keine Lust mehr hatte, kletterte ich den Baum hoch und schmollte noch einige Zeit. Schließlich jedoch, ich war immer noch wütend, aber auch müde und überhitzt, bereute ich, was ich getan hatte, und ging wieder ins Haus, wo Grandma alle mit Slush erfreute. Eine Stunde später brach das unvermeidliche Gewitter herein und ich sah vom Fenster aus zu, wie sich der Regen ergoss. Erst kam der Donner, dann die Lichtshow und ich zählte vom Blitz bis zum Donner, um zu wissen, wie nah das Gewitter war. Und dann – ich sehe es noch genau vor mir – schlug der Blitz genau in die Eiche ein und spaltete sie in der Mitte.
Ich schrie so laut, dass die ganze Familie angerannt kam. Als Erster war Grandpa da, doch er konnte mich nicht zum Sprechen bewegen. Aber er verstand, als ich auf den Baum zeigte. Er legte mir den großen Arm um die Schulter und drückte mich an sich.
»Das ist gruselig, was, Katy? In einem Augenblick steht der Baum groß und stark dort und im nächsten ist er weg.«
Ja, er verstand mich. Blitze schlagen so plötzlich, so unerwartet ein. Ein alter Baum, der mich am Nachmittag noch getragen hatte, war am Abend plötzlich verschwunden. Wenn ich heute daran zurückdenke, weiß ich, dass ich damals zum ersten Mal spürte, dass uns das Unglück selbst an sicheren Orten ereilen kann, dass wir uns nicht auf alle Widrigkeiten vorbereiten können, die das Leben für uns bereithält. Ich weiß auch, dass es meine erste Berührung mit der Sterblichkeit war, die Erkenntnis, dass selbst alte, starke Dinge plötzlich auf dem Höhepunkt ihrer Kraft zusammenbrechen können.
In dieser Nacht ließ das Gewitter das Haus erzittern, doch der nächste Morgen war sonnig und hell. Grandpa und ich gingen gemeinsam nach draußen und betrachteten unseren armen, alten, ausgebrannten Baum. Ich vergoss ein paar Tränen, bis Grandpa mich ablenkte und sagte, dass wir ein Geschenk für meine Mutter suchen wollten. Und genau das taten wir. Wir fanden ein gutes, großes Stück angebranntes Holz und brachten es, wie zwei stolze Jäger, zu ihr nach Hause: ein schönes Stück Holzkohle für Mommy, mit dem sie mir Bilder malen konnte.
Die Familie meines Vaters, die Janeways, stammte ursprünglich aus Westirland und war deutlich öfter umhergezogen als die Williams-Sippe, doch mindestens seit dem frühen zwanzigsten Jahrhundert war Portage Creek in Indiana ihre Heimat. Meine Großeltern väterlicherseits kamen zurück nach Bloomington, als meine Großmutter, Caitlin Janeway, eine Professur an der Universität annahm. Sie war Raumfahrtingenieurin und Materialwissenschaftlerin mit dem Spezialgebiet Weltalllegierungen und reihte sich in eine lange Folge von Frauen unserer Familie ein, die sich dem Erforschen der Sterne widmete. Ich habe die Ehre, diese Tradition fortzuführen. Mein Großvater väterlicherseits, Cody Janeway, war bei der Sternenflotte, stieg bis zum Rang eines Commanders auf und diente auf verschiedenen Raumschiffen als leitender Wissenschaftsoffizier. In der Familie kursiert die Legende, dass er einmal die Möglichkeit ablehnte, unter einem gewissen Captain Kirk zu dienen, aber dafür konnte ich keinerlei Beweise finden und Granddad, der alte Schlawiner, nickte und zwinkerte zu dieser Geschichte nur. Wie gern würde ich die Wahrheit herausfinden. Bei Familienlegenden wird doch zu gern übertrieben. Granddad nahm eine Lehrstelle an der Universität an, als meine Großmutter ihren Lehrstuhl übernahm, und beide schienen zufrieden, endlich sesshaft geworden zu sein, sodass ihre Kinder im Teenageralter mehrere Jahre in Folge dieselbe Schule besuchen konnten. Da sie in der Großstadt Bloomington wohnten, nannten Phoebe und ich unsere Großeltern väterlicherseits Stadt-Granny und Stadt-Granddad. In unserem Alltag spielten sie nicht dieselbe Rolle wie die Eltern meiner Mutter, Grandpa und Grandma, doch sie hatten trotzdem beträchtlichen Einfluss auf unser Leben.
Obwohl unsere Eltern so nah zueinander aufwuchsen, trafen sie in der Highschool nie aufeinander und wurden einander auch nicht von gemeinsamen Freunden vorgestellt (obwohl es davon mehrere gab, wie sich herausstellte). Nein, sie lernten sich ausgerechnet in Genf kennen. Wie war das möglich, wo meine Mutter freiwillig nie weiter als nach Bloomington reiste und sich selbst dann darüber beklagte, dass sie ihre Kunst und die Farm verlassen musste? Nun ja, kurz vor ihrem Highschool-Abschluss entdeckte meine Mutter humanitäre Interessen für sich. Ich glaube, sie hatte Aufnahmen der Flüchtlingskrise auf Koltaari gesehen. Irgendwie überredete eine Lehrerin der Schule sie dazu, eine Jugendkonferenz zu besuchen, die in den alten UN-Gebäuden in Genf abgehalten wurde. Dort kamen junge Leute aus der ganzen Föderation zusammen, um mehr darüber zu erfahren, wie Föderation und Sternenflotte die Flüchtlingshilfe unterstützen konnten. Meine Mutter war unsicher. Die Veranstaltung dauerte einen ganzen Monat lang. Doch ihre Leidenschaft siegte über die Häuslichkeit und sie reiste pflichtbewusst mit. Sogar meine Mutter, eine echte Nesthockerin, musste zugeben, dass diese Reise, die längste Zeit, die sie je fern von zu Hause verbracht hatte, es wert gewesen war. Sie brachte einen jungen Mann mit nach Hause, einen Sternenflottenkadetten, der in dieses ruhige und talentierte Mädchen völlig vernarrt war. Sie heirateten in dem Jahr, als beide zweiundzwanzig wurden und mein Vater den Abschluss an der Sternenflottenakademie machte.
Da beide wussten, dass mein Vater in seinem Beruf über lange Zeiträume abwesend sein würde, aber dennoch bald eine Familie gründen wollten, entschieden sie sich, sich in der Nähe der Eltern meiner Mutter niederzulassen. So hatte Mom gute Unterstützung, als wir klein waren, und konnte ihre Arbeit als Künstlerin und Illustratorin fortführen. Grandpa und Grandma waren daher wichtige Personen in unserem Leben. Als Hochzeitsgeschenk überließen sie meinen Eltern das Land neben ihrer eigenen Farm. Dort bauten meine Eltern ihr Haus und begründeten ihre eigene kleine Farm. Ich weiß, dass viele Leute ihre Familie möglichst schnell verlassen wollen, sobald sie volljährig sind, doch bei meiner Mutter war das nicht der Fall. Sie war einfach nicht so reiselustig wie ihr Ehemann und ihr ältestes Kind. Auf dem Land, wo sie geboren worden war, fühlte sie sich glücklich. Dort hatte sie alles, was sie brauchte. Das ist einer der vielen Aspekte, in denen wir uns nie ganz verstanden – aber das ist wohl die sogenannte wahre Liebe, nicht wahr? Sie will nichts ändern, sie akzeptiert den anderen, so wie er ist. Doch Kinder sind sensibel. Ich wusste, dass es da diese Lücke in ihrem Verständnis für mich gab, und wenn ich darüber nachdachte, machte mich das traurig.
Aber ich möchte Ihnen keinen falschen Eindruck vermitteln. Stellen Sie sich vor allem ein sehr glückliches, geliebtes kleines Mädchen vor, das in vieler Hinsicht eine idyllische Kindheit hatte. Der größte Kummer in meiner frühesten Kindheit war – und Phoebe wird mir ganz sicher verzeihen, dass ich das sage – die Ankunft des Babys. Ich war drei Jahre alt und hatte bis dahin immer im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit aller Erwachsenen in meiner direkten Umgebung gestanden. Mit Grandpa grub ich den Garten um und aß Welsh-Rarebit-Käsetoast. Mit Grandma backte ich Plätzchen und andere Leckereien. Und Mommy und Daddy waren nur auf der Welt, um nach meiner Pfeife zu tanzen. Doch dann … Was soll ich sagen, ich wusste, dass etwas nicht stimmte, als Mommy plötzlich dauernd Mittagsschlaf machte, obwohl ich ihn mir gerade abgewöhnte, und nicht mehr so gern mit mir auf dem Boden spielte. Dann wurde sie immer dicker und dicker … Die Leute fragten Sachen wie »Freust du dich auf das Baby, Katy?« und »Du hast einen Spielkameraden, wenn das Baby kommt, nicht wahr, Katy?« und »Möchtest du einen Bruder oder eine Schwester, Katy?«.
Na ja, ich kann Ihnen sagen, dass mir die Idee mit dem Baby nicht besonders gefiel, ganz und gar nicht. Ich war ein intelligentes Kind und deshalb ahnte ich, was das bedeuten würde. Alle würden um den Neuankömmling herumscharwenzeln und niemand würde noch mit Katy spielen wollen. Und als das dumme Ding dann kam … Das war doch kein Spielkamerad! Ein kleines, rotes, schreiendes Ding. Mein Gott! Was für ein Betrug! Ein lauter, nerviger, anspruchsvoller Betrug!
»Sieh mal, Kathryn«, sagte Mommy und hielt das Wesen auf dem Arm. »Das ist deine kleine Schwester Phoebe.«
Misstrauisch betrachtete ich das kleine Bündel. »Mommy, können wir es gegen einen Welpen umtauschen?«, fragte ich.
Das wird mir immer wieder unter die Nase gerieben. Aber den Welpen bekam ich: Jess, ein so wundervoller Bordercollie, dass es mir heute noch die Tränen in die Augen treibt, wenn ich an sie denke. Sie war eine zehn Wochen alte kleine, warme Fellnase voller Energie und Liebe, als ich sie bekam, und Grandpa half mir dabei, sie zu erziehen. Wir liebten uns heiß und innig. Jess trottete mir überallhin hinterher und schlich sich nachts in mein Zimmer, obwohl Grandpa mich eindringlich gewarnt hatte, dass sie kein guter Arbeitshund würde, wenn ich sie verwöhnte. (Das stimmte nicht.) Auf den Holofotos aus dieser Zeit sind wir immer zusammen zu sehen und ich liebte sie von ganzem Herzen. Aber dennoch wusste ich, dass Jess ein Trostpreis war und ich mit Phoebes Ankunft einen kleinen Teil von Mommy verloren hatte. Meine wunderschöne und geheimnisvolle Mutter, die ich immer mehr als alle anderen liebte, musste ich nun teilen. Ich war nicht mehr allein ihr Lebensmittelpunkt und würde es niemals mehr sein.
So sah meine früheste Kindheit aus. Wir waren eine sehr glückliche, eng verbundene Familie, in der zwei kleine Mädchen in der Liebe ihrer Bezugspersonen schwelgen durften und ermutigt wurden, ihre eigenen Wege zu gehen. Schon bald zeigte Phoebe ein künstlerisches Talent, das dem meiner Mutter gleichkam, ständig war sie mit Farbe vollgeschmiert und formte Tonskulpturen. Etwa zur Zeit von Phoebes Ankunft begann meine Mutter damit, Rosen zu züchten, zunächst nur als Zeitvertreib, doch allmählich wurde sie richtig ehrgeizig. Das war sehr untypisch für meine Mutter, auch wenn sie sich bei all ihren Vorhaben hervortat. Nach jeder ihrer Töchter hat sie eine Rosensorte benannt. Ich erinnere mich daran, wie ich ihr eines Morgens, kurz nachdem das Baby gelandet war, draußen half – stolz im kleinen blauen Overall und mit kleiner Schaufel, glücklich, dass ich Zeit mit Mommy verbringen durfte –, als ein Mann am Tor vorbeilief, stehen blieb und mir bei der Arbeit zusah. Mom ging hin und begrüßte ihn. Er nickte in meine Richtung und sagte: »Schön, wenn ein Junge seiner Mom hilft.«
Ein Junge?! Das war unerträglich. Das durfte ich nicht durchgehen lassen. Wenn man den Erzählungen glauben darf, funkelte ich diesen Mann wütend an – spießte ihn mit dem Blick auf, so meine Mutter – und wies ihn mit den folgenden legendären Worten zurecht: »Katy kein Junge! Katy Mädchen!«
»Nie wieder habe ich einen Mann so schnell rennen sehen. Sie hat ihn mehr oder weniger aus der Stadt gejagt«, meinte Mom. Ich liebte es, wenn sie diese Geschichte erzählte. Ich genoss den Glanz in ihren Augen. Mommy war stolz auf mich und das bedeutete mir alles.
Ich möchte Ihnen beschreiben, wie meine Mutter damals war. Ein Freigeist – aber ruhig, eigenbrötlerisch. Meine Mutter war ein sehr tiefes, stilles Wasser, es schien, als wäre irgendein Naturgeist für kurze Zeit in den Körper einer Sterblichen geschlüpft. Auf dem Meer wäre sie ganz sicher eine Selkie gewesen, hier in der Ebene war sie vielleicht ein Fluss- oder Seegeist, den das Leben mit uns gewöhnlichen Sterblichen gelockt hatte. Sie war so viel wie möglich draußen, im Garten oder bei der Arbeit auf der großen Terrasse hinter dem Haus. Bei schlechtem Wetter nutzte sie einen Schuppen als Atelier, doch der Regen ängstigte sie nicht, nein, sie ging oft hinaus, lief ihm über unser Land entgegen und kam völlig durchnässt, aber mit leuchtenden Augen nach Hause. Sie war liebenswürdig, witzig, oft zerstreut, wie es sehr kreative Menschen manchmal sind, und hatte unendlich viel Kreativität für ihre zwei kleinen Kinder übrig. Muss ich erwähnen, dass ich sie über alles liebte?
Oft fragt man mich, wie es war, eine Mutter zu haben, die Kinderbücher schrieb. Tatsächlich nahmen Phoebe und ich es im Großen und Ganzen als selbstverständlich hin. Sie hatte so viele Geschichten zu erzählen! Phoebe mochte eher Fantasy: natürlich das Wunderland, später liebte sie Meg Murrys Reisen durch das Universum mithilfe des Tesseracts, Bintis Karriere an der Oomza-Universität, Awinita Fosters aufregende Abenteuer auf dem leuchtenden Pfad. Mir gefielen eher realistischere Geschichten: wie die Melendy-Kinder sich ein neues Zuhause auf dem Land aufbauten und die Natur und die Menschen ihrer Umgebung erkundeten. Omakayas und ihre Familie aus dem Birkenrindenhaus, die in der Nähe des Lake Superior aufwuchs. Cassie Logans Überlebenskampf unter den Jim-Crow-Gesetzen, die Geschichten über Mildred Jones und ihre Freunde, die in den 2080er-Jahren eine postatomare Welt wiederaufbauten. Selbst meine geliebte Dorothy Gale war durchaus praktisch veranlagt, denn sie konzentrierte sich mindestens genauso sehr darauf, nach Hause zurückzukehren, wie auf die Wunder, denen sie begegnete.
An einen Fall, bei dem Mommy uns ihre Geschichten zeigte, kann ich mich erinnern, und zwar als man sie eingeladen hatte, für die bekannte Kinderholoromanreihe Flotters Abenteuer zu schreiben. Ich glaube, das war für sie eine neue Richtung. Bis dahin hatte sie nicht für Holoromane geschrieben, auch wenn danach zahlreiche folgten, aber ein Flusswesen kam ihr natürlich sehr entgegen. Außerdem war sie sehr motiviert, ihre Ideen auszuprobieren. Und natürlich liebte ich sie! Mommy hatte ein Händchen für Geschichten und ein Auge für Details. Was für eine wunderbare Welt sie erschuf: ein wirklich zauberhafter Ort, für die meisten Kinder eine erste Begegnung mit den Möglichkeiten der Holosuite – teils Spiel, teils Schauspiel, aber voller Fantasie. Zunächst probierten nur Mommy und ich es aus. Phoebe hielt man selbst für die harmlosen Wagnisse im Wald der Ewigkeit für zu jung. Mommy und ich wanderten mit Flotter und Trevis durch den Wald und bauten gemeinsam einige Teile der Welt. Doch schon bald wollte Phoebe mitmachen und ich muss zugeben, dass ich darüber nicht erfreut war. Aber Phoebe, ich schwöre, die Überflutung war ein Unfall.
Viele Leute erzählen mir, wie sehr sie Flotter als Kind geliebt haben (ich glaube, die einzige Person, der ich begegnet bin, bei der es anders war, war ein ehemaliger leitender medizinischer Offizier der Enterprise, der ihn ›diesen dämlichen Baum-Schwachsinn‹ nannte), und viele erinnern sich an bestimmte Abenteuer, die meine Mutter schrieb, etwa die Begegnung mit den Glühwürmchen und das Steinhaus am Fluss. Zu meiner großen Freude liebte auch die junge Assistentin des Captains der Voyager, die unnachahmliche Naomi Wildman, diese Geschichten sehr. Eine weitere Generation ließ sich von ihnen verzaubern. Wenn man mich also fragt, wie es war, eine Mutter zu haben, die Kinderbücher schrieb – jetzt wissen Sie’s. Doch ein Teil meiner Mutter, ein sehr wichtiger Teil, blieb für immer geheimnisvoll, nicht greifbar. Als Kind versucht man, diese Kluft zu überwinden, doch vielleicht zeichnet sich das Erwachsensein dadurch aus, zu akzeptieren, dass man die Kluft zwischen sich und seinen Eltern nie ganz überwinden kann.
Im Alter von sieben Jahren ging ich, immer darauf bedacht, ihre Anerkennung zu gewinnen, begeistert auf den Vorschlag meiner Mutter ein, Ballettunterricht zu nehmen. Ich gebe offen zu, dass Ballett nicht meinen Talenten entspricht. Ich war ein starkes und lebhaftes Kind, durchaus sportlich, aber nicht so, wie man es als Primaballerina sein muss. Doch was mir an Naturtalent fehlte, machte ich durch Begeisterung und Fleiß wett. Mein »sterbender Schwan« ging in die Familiengeschichte ein. Mir war damals klar, dass es nicht aus den richtigen Gründen war, und ich erkannte, dass ich höchstens in Komödien die Bühne erobern würde, aber niemals in Tragödien. Zum Tanzunterricht ging ich viele Jahre lang, weniger Ballett, eher Paar- und Charaktertanz, und gewann mit meinem Charleston sogar eine Bronzemedaille, doch halten wir einfach fest, dass dies nicht die Fähigkeiten wären, auf die ich im Notfall eine neue Karriere aufbauen wollen würde. Phoebe weigerte sich strikt, Ballettunterricht zu nehmen. Dafür bin ich ihr für alle Zeiten dankbar, denn ganz sicher wäre sie erstklassig gewesen und hätte mich ein weiteres Mal künstlerisch übertroffen.
Phoebe und ich verbrachten viel Zeit draußen im Garten, vor allem weil meine Mutter, die sich diesem Ort so stark verbunden fühlte, uns dazu ermutigte. Ich muss zugeben, dass ich das als Kind nicht besonders zu schätzen wusste. Viel lieber hätte ich Flugzeugmodelle gebaut, aber da Mom es so wollte, bekam sie es. Im Sommer, als ich neun und Phoebe sechs war, beschloss Mom, dass wir alt genug wären, um unsere eigenen kleinen Beete zu bewirtschaften. Sie sagte uns, dass wir beim nächsten Mal, wenn Dad zu Hause sei, aussuchen dürften, wohin wir fuhren, wenn wir darauf etwas anbauten. Dass wir in Moms geliebtem Garten eine solche Verantwortung übernehmen durften, bedeutete uns sehr viel. Also grub ich pflichtbewusst die Erde um und pflanzte Gemüse an, das waren viele Stunden echte Knochenarbeit. Phoebe, das schlaue Mädchen, warf Samen in die Luft und erklärte Mom, dass sie eine Blumenwiese säe. Da sie dort viele Stunden auf dem Bauch liegend verbrachte, die blühenden Blumen und die Insekten und wilden Tiere betrachtete, die ihren Wildgarten bevölkerten, und von ihnen detailgetreue Zeichnungen anfertigte, musste Mom zugeben, dass sie ihren Teil der Vereinbarung eingehalten hatte. Aus dem von mir gezogenen Gemüse machten wir Biryani nach Grandmas Geheimrezept und aus den Bildern, die Phoebe gemalt hatte, machten wir Postkarten. Ich verdiente mir den Besuch im Smithsonian Air and Space Museum und Phoebe ihren im Van-Gogh-Museum. Aber verdammte Axt, war ich neidisch auf Phoebe, die kleine Schlawinerin!
Als Daddy nach Hause kam, war er nicht der wütende Verbündete, den ich erwartet hatte. Während ich ihm voller Entrüstung die Geschichte über Phoebes Schummelei erzählte, brach er in Gelächter aus. »Arbeite schlauer, nicht härter, Katy!«, riet er mir. Das war kein schlechter Rat und ich nahm ihn mir zu Herzen – mir ist bewusst, dass ich die Dinge manchmal etwas zu eng sehe (etwa, dass ich kein Abweichen von den Uniformrichtlinien der Sternenflotte erlaubte, obwohl wir siebzig Flugjahre von der nächsten Sternenflottenbasis entfernt waren), und ich tue mein Bestes, um nicht zu festgefahren zu sein. Doch ich muss sagen – denn es könnte ja sein, dass einige Sternenflottenkadetten diese Memoiren lesen –, dass mir harte Arbeit nie geschadet hat und uns diese Regeln in harten Zeiten zusammengeschweißt haben.
Eine Postkarte, die Phoebe gebastelt hat, habe ich noch immer. Darauf ist eine Dodecatheon meadia zu sehen, eine Primelart, die in unserer Region Amerikas beheimatet ist. Man kennt sie auch als Sternschnuppenblume. Für eine Sechsjährige ist es ein wunderschönes Kunstwerk. Sie hat die zurückgebogenen Blütenblätter mit genauem Blick eingefangen und in zartem Lavendelton gemalt. Stadt-Granny zeigte ihr, wie man der Karte den Duft der Blume verleihen konnte, die darauf zu sehen war, und da dieses Verfahren von Stadt-Granny stammte, hielt er sich wirklich lange. Phoebe und ich machten darüber Witze, doch es kam eine Zeit, in der ich für Stadt-Grannys Fähigkeiten dankbar war.
Denn diese Karte begleitete mich auf all meinen Wegen. Sie ging mit mir an die Sternenflottenakademie und danach auf die Al-Batani und die Billings. Und natürlich kam sie mit mir auf die Voyager und den ganzen Weg bis in den Delta-Quadranten und zurück. Ich hatte sie in meinen Schreibtisch gelegt, damit sie nicht verloren ging, holte sie aber sehr häufig heraus, wenn ich allein war und mich verlassen fühlte. Dann nahm ich gerade noch die allerletzte Spur des Dufts wahr (im dritten oder vierten Jahr unserer Reise war er praktisch ganz verflogen). Oft drehte ich die Karte um und las die Nachricht, die meine Schwester geschrieben hatte. Direkt vor meiner Abreise zur Akademie hatte sie die Karte hervorgekramt und geschrieben: »Für meine große Schwester Katy, möge sie immer nach den Sternen greifen.« Diese Worte gaben mir in vielen langen, dunklen Nächten zwischen unbekannten Sternen Kraft, als ich nach dem einen suchte, das mich nach Hause zu meiner geliebten Familie führen würde: zu Phoebe, zu den Großeltern auf dem Land, den Großeltern in der Stadt und, am allerwichtigsten, zu Mom.
Da meine Erzählung meine ersten Lebensjahre umfasst, habe ich vielleicht automatisch zum großen Teil über meine Mutter geschrieben, doch nun möchte ich Ihnen von meinem Vater erzählen. Schließlich war er der große Held meiner frühen Kindheit. Edward Janeway war durch und durch Sternenflottenoffizier: ein erstklassiger Kadett, der ein angesehener Offizier wurde und schnell Karriere machte, sodass er, kurz vor meinem Wechsel auf die Highschool, zum Vice Admiral befördert wurde. Wie viele andere, die zur Sternenflotte gehen, hatte er als Kind die Sterne beobachtet. Er war ein begeisterter Amateurastronom und liebte das Fliegen. Zu Beginn seiner Karriere bei der Sternenflotte arbeitete er als Testpilot, doch nach Phoebes Geburt hörte er auf die Sorgen meiner Mutter um seine Sicherheit und erklärte sich bereit, Kommandoposten zu übernehmen. Natürlich war er deshalb oft abwesend, häufig beim Sternenflottenkommando, was nicht besonders schlimm war, denn dort konnten wir ihn in den Schulferien wochenweise besuchen. Doch noch häufiger war er gar nicht auf der Erde. Als Kind nimmt man das Leben so, wie es ist, und so nahmen Phoebe und ich hin, dass Daddy lange Zeit abwesend war. Das hieß aber nicht, dass wir das gut fanden. Da Daddy keine Fehler machen konnte, brauchten wir einen anderen Schuldigen – und das waren eindeutig die Cardassianer.
Die Cardassianer waren die Monster unserer Kindheit, wie wahrscheinlich für viele in unserer Generation, und da die andauernden Grenzkonflikte in den 40er- und 50er-Jahren schließlich zu einer echten Auseinandersetzung führten, ist diese Meinung vielleicht verständlich. Seit dem Dominion-Krieg hat sich natürlich viel verändert, doch aus meiner Sicht und der meiner Schwester waren die Cardassianer, diese aggressiven, scheinbar monströsen Fremden, der einzige Grund dafür, dass Daddy so oft nicht zu Hause war. Ich habe viel Zeit gebraucht, um zu erkennen, woher meine Feindseligkeit gegenüber den Cardassianern stammte, und noch länger, um diese abzulegen und ihnen mehr Verständnis entgegenzubringen.
Ganz sicher hilft hier etwas mehr Kontext. Der erste Kontakt zwischen der Föderation und den Cardassianern lag viele Jahre zurück, doch seit dem frühen 24. Jahrhundert hatte die Cardassianische Union ihre imperialistischen Ambitionen deutlich aggressiver verfolgt, insbesondere ihre Expansion nach Bajor in den 2310er-Jahren. Heute wissen wir, dass die Bedingungen auf Cardassia Prime immer schwieriger wurden. Die intensive industrielle Landwirtschaft auf einer ohnehin trockenen Welt hatte in kürzester Zeit zur Bodenerschöpfung geführt. Daher machten die Cardassianer Jagd auf die Ressourcen anderer Welten. Letztlich führte diese Expansion zur offiziellen Annexion von Bajor im Jahr 2328 (acht Jahre vor meiner Geburt). Während mein Vater Karriere machte, waren die Ambitionen der Cardassianer und ihr wiederholtes Eindringen in den Föderationsraum eines der größten Probleme, die auch seine Tochter Jahre später zu Beginn ihrer Karriere beschäftigen würden. Damals versuchte das Sternenflottenkommando hauptsächlich, den Ausbruch eines echten Krieges zu verhindern und dabei gleichzeitig die Welten an unseren Grenzen zu schützen und die Bajoraner zu unterstützen, ohne unsere Prinzipien der Nichteinmischung zu verletzen. Ich stand damals kurz vor dem Wechsel auf die Highschool, daher sagten mir diese Dinge nichts, doch sie begründeten die ständige Abwesenheit meines Vaters, prägten meine Kindheit und lieferten den Hintergrund für meine spätere Entscheidung, der Sternenflotte beizutreten.
Wenn Daddy zu Hause war, war Mommy glücklich, und wenn Mommy glücklich war, waren wir alle glücklich. Genau wie allen anderen Aufgaben widmete Daddy sich dem Vatersein mit Hingabe und vollster Konzentration. Er war zwar nicht die ganze Zeit da, doch wenn er da war, dann voll und ganz. Heute ist mir klar, dass er bis in die frühen Morgenstunden wach geblieben sein muss, um Berichte und Nachrichten zu bearbeiten, damit er danach seinen Töchtern seine volle Aufmerksamkeit schenken konnte. Und was hatten wir für einen Spaß, wenn er bei uns war! Er vereinte in sich die Autorität eines Vaters mit dem Übermut eines Onkels, der Neugier eines Kindes und dem Führungsinstinkt eines geborenen Lehrers. Klingt das, als hätte ich ihn vergöttert? Natürlich tat ich das. Er war mein wunderbarer Daddy, Sternenflottencaptain und absoluter Held. Ich wollte sein Augenstern sein.
Wenn er zu Hause war, ließ er sich immer irgendein neues Projekt oder einen Ausflug für die ganze Familie einfallen. Er ging mit uns allen zelten und stellte sicher, dass wir in der Wildnis überleben und uns selbst versorgen konnten, er zeigte uns, wie wir etwas zu essen und frisches Wasser finden konnten. Phoebe förderte er in ihrem Interesse an der Natur und mir half er dabei, zu verstehen, wonach ich suchen und warum ich auf meine Umwelt achten sollte. Er erkannte, dass ich den Blick nach oben wandte, und in tiefschwarzen Nächten unterm Sternenhimmel brachte er mir die Namen der Sternbilder bei. Meine ersten Reisen zu den Sternen unternahm ich mit ihm. Auch Phoebe brachte er die Sternbilder bei. Er erkannte, dass die mythologischen Namen ihre Fantasie anregten. Wir lernten den Namen des Mars in verschiedenen Sprachen, einige davon lebend, andere längst vergessen. Mars, Huoxing, Nergal, Wahram … Mir wurde klar, dass dort eine andere Art von Welt existierte, die ich entdecken konnte: keine erdachte Fantasiewelt, sondern echte Planeten, die ich eines Tages vielleicht besuchen könnte. Und Daddy nahm uns tatsächlich zum Mars mit, als Phoebe in die Highschool kam.
So sah ein typisches Projekt von Daddy aus: Damals war ich etwa acht Jahre alt. Er befand, dass auf unserer Farm ein Teleskop fehlte. Aber natürlich! Schließlich war er bei der Sternenflotte, so seine Begründung. Er musste immer ein Auge auf alles haben, selbst im Urlaub. Also bauten wir eins. Die gesamte Janeway-Williams-Verwandtschaft tat sich zusammen und baute das verdammte Ding. Und das war kein kleines Teleskop, sondern ein richtig großes, um das uns jeder edwardianische Gentleman beneidet hätte. Natürlich wurde Stadt-Granny einbezogen, da sie sozusagen Spezialistin für solche Dinge war, und ich glaube, sie stellte sicher, dass die benötigten Teile repliziert wurden. Auch Stadt-Granddad machte sich nützlich, denn er brachte einige Studenten aus höheren Semestern mit, die bei der Renovierung des alten Schweinestalls halfen, in dem das Teleskop seine neue Heimat finden sollte. Grandpa ließ sie für ihr Abendessen schuften. Sie mussten sägen und hämmern, Ausrüstung holen und tragen. Hoffentlich bekamen diese Leute dafür Extrapunkte, was für ein unglaublicher Machtmissbrauch!
Wir Mädchen überwachten das Geschehen von Anfang bis Ende: die Fertigung der Teile, den Schliff der Linsen, den Bau des Gehäuses, den Zusammenbau des Gerätes. Mein Gott, das war Zauberei, nein, noch besser – es war Wissenschaft. Es gab kein Geheimnis, keinen Trick. Man konnte es bauen, anfertigen und doch, zusammengebaut zeigte es die Schönheit und Majestät, die atemberaubende Pracht der Sterne. Draußen auf der Veranda legte Mom große Bögen schwarzes Papier aus. Mit ihr zusammen erstellten Phoebe und ich Sternenkarten. Als wir schließlich fertig waren, gingen wir eines späten Abends, lange nach unserer Schlafenszeit, hinaus und Daddy zeigte uns die Sterne. Dort verbrachte ich viele Nächte, lernte die Namen der Sternbilder und schlich mich, viel später, als meine Eltern vielleicht ahnten, vorbei an ihrem Schlafzimmer ins Bett, den Kopf voller Wunder des Weltraums.
An meinem neunten Geburtstag fuhr Dad mit mir zu unserem örtlichen Flugverein und flog mit mir in einem Kleinflugzeug. Das war so aufregend! Endlich flog ich! Wir waren etwa zwanzig Minuten in der Luft und Dad flog mit mir über das Land, das mir so vertraut war. Ich sah unser Haus, alle Orte, die ich so gut kannte – unsere Farm, die von Grandpa und Grandma, unsere Schule, die Straße Richtung Stadt –, doch von oben, wie eine Karte, aber in echt. Dieser kleine Ausflug veränderte meine Sicht auf die Welt völlig. Von diesem Zeitpunkt an konnte mich die Erde allein nie mehr zufriedenstellen.
Als wir älter wurden, führte mein Vater diese Tradition fort und ging mit mir und Phoebe allein auf Ausflüge. Für jemanden in einer Eltern- oder Mentorenrolle ist es, glaube ich, durchaus eine gute Taktik, dem Schützling die ungeteilte Aufmerksamkeit zu schenken. Phoebe wünschte sich in der Regel Kulturbesuche. Sie klapperte die wichtigen Galerien auf Erde, Luna und Mars ab. Ich hingegen ließ die Kultur links liegen und floh in die Berge. Ich wollte nach draußen. Ich wollte wandern und klettern und Ski fahren und Wildwasserrafting machen und mich einfach bewegen oder, am allerbesten, fliegen. Fast hätte ich ihn dazu gebracht, mit mir zum Bungeejumping zu gehen (es war nicht schwer, ihn zu überreden, wenn ich ehrlich bin), doch dann bekam Mom Wind davon und war kategorisch dagegen. Ihre Begründung war, dass ich doch wenigstens ein zweistelliges Alter erreichen sollte, bevor ich mein Leben riskierte (da hatte sie vermutlich recht).
Ich habe Bungeejumping bis heute nicht ausprobiert. Wahrscheinlich sollte ich sofort eine Reise nach Queenstown buchen, von einer Brücke springen, spüren, wie ich durch die Luft sause, und auf dem Weg zum Wasser rufen: »Das ist für dich, Dad!« Einer der Vorteile des Alters ist, dass man sich nicht mehr darum schert, wie exzentrisch man wirkt. Das genieße ich in den letzten Jahren und ich habe vor, diese Freiheit voll und ganz auszukosten.
Doch in meinem zehnten Lebensjahr standen mir solche Freiheiten nicht zu und nachdem die Pläne von meinem Vater und mir, uns von einer Brücke zu stürzen, vereitelt worden waren, schlug er vor, stattdessen zum Grand Canyon zu reisen – dem größten Graben der Erde, wie Dad ihn nannte. Mein erster Eindruck war nur ein riesiges, staubiges Loch im Boden, doch die folgenden zwei Wochen gehörten zu den prägenden Erlebnissen meines Lebens. Wir reisten per Transporter nach Flagstaff in Arizona und nahmen dann einen kleinen Flyer zum North Rim. Dort wanderten wir jeden Tag einige Kilometer und schliefen im Zelt. Nach dem Kochen und Abwasch legten mein Dad und ich uns auf den Rücken und blickten in die Sterne. Manchmal erzählte er mir Geschichten von Welten, die er gesehen hatte. Manchmal lagen wir einfach ruhig da und genossen still die Anwesenheit des anderen. Ich dachte daran zurück, wie ich über unser Zuhause geflogen war, und fragte mich, wie andere Welten wohl aus großer Höhe aussahen.
»Eines Tages möchte ich dorthin«, sagte ich.
»Wohin, Kätzchen?«, fragte er. Ich glaube, für diesen Spitznamen empfand ich eine Art Hassliebe.
»Da oben hin.«
Er sah in den Himmel. »Wohin? Luna? Mars?«
»Dad!«
»Ach, ich verstehe. Die Sternenflotte«, entgegnete er.
»Wie ist es da?«, fragte ich. »Keine Geschichten. Wie ist es wirklich?«
Ich sah ihn lächeln. Er schien … verwandelt, anders kann ich es nicht beschreiben. »Es ist unvergleichlich, Kätzchen«, antwortete er. »Es ist wunderbar.«
Wieder sah ich zu den Sternen. So glücklich habe ich mich nie wieder gefühlt. Ich dachte daran, von zu Hause fort und auf die Akademie zu gehen. Ich stellte mir vor, wie ich auf der Brücke eines Raumschiffs stand, die Leute mich Captain nannten und ich das Kommando hatte. Doch dann lief es mir kalt den Rücken hinunter. »Glaubst du, Mom wäre einverstanden?«
»Was sollte Mom dagegen haben?«
»Es ist weit weg von zu Hause … Du weißt, wie sie ist. Zu Hause ist es doch am schönsten …«
Ich beobachtete ihn aus dem Augenwinkel und konnte sehen, dass er mich verstand. »Weißt du, Mom und ich möchten nur, dass du deinen eigenen Weg gehst. Herausfindest, wozu du bestimmt bist. Vielleicht führt dich das an Orte, die ich oder Mom uns nicht im Ansatz vorstellen können, aber damit muss man rechnen, wenn man Kinder bekommt. Man möchte, dass die Kinder in Sicherheit sind, in der Nähe – aber letzten Endes muss man sie dorthin ziehen lassen, wohin sie gehen wollen. Man muss ihnen nur zeigen, wie man den Kopf über Wasser hält.« Er lächelte mich an. »Wohin auch immer du gehst, Kathryn, wir unterstützen dich.«
Muss ich erwähnen, wie sehr ich ihn liebte? Muss ich erwähnen, wie sehr ich sie alle liebte: meine schlaue, neugierige, außergewöhnliche Familie. Meine wunderschöne, sensible Mutter, meine talentierte, kreative Schwester, meinen tapferen und großartigen Vater? Wenn ich an diese Zeit zurückdenke, sehe ich sie so vor mir: Phoebe liegt bäuchlings auf der Blumenwiese und betrachtet mit scharfem Blick alles in ihrer Umgebung. Dad blickt mit großen Augen zu den Sternen und sehnt sich nach Abenteuern, zu sehen, was da draußen ist. Und Mom liegt neben mir auf dem Bett, liest mir aus meinem Lieblingsbuch vor und flüstert mir leise zu: »Es ist nirgends besser als daheim … Es ist nirgends besser als daheim …«
KAPITEL 2
NACH DEN STERNEN GREIFEN · 2348–2353
IN MEINER FRÜHEN KINDHEIT BESUCHTE ICH EINE KLEINE LANDSCHULE ganz in der Nähe unseres Hauses, gemeinsam mit etwa einem Dutzend anderer Kinder unterschiedlichen Alters aus der Umgebung. Phoebe und ich konnten zu Fuß dort hingehen und später nahmen wir unsere Räder und folgten den Landstraßen. Nach der Schule ließen Phoebe und ich uns auf dem Heimweg viel Zeit, hielten an und schoben die Räder über entlegene Wege, während Phoebe Proben sammelte oder ich ein Stück Land erkundete. Die Schule lag am Ende einer langen Straße: ein weißes Holzgebäude mit Blumengarten und Gemüsebeet, einem großen hölzernen Baumhaus, Klettergerüst und sogar mit einer eigenen Bühne. In den drei kleinen Klassenzimmern wurden wir nach der gemeinsamen Versammlung in Altersgruppen unterrichtet, zum Schulschluss kamen wir alle zusammen, um uns zu verabschieden. Zwar liebte ich diesen Ort und die Lehrer, die Spielen und Lernen fabelhaft und eng miteinander verwoben, sodass man mich niemals zum Lernen zwingen musste, doch im Alter von zehn Jahren wurde mir diese kleine sichere Welt zu eng und ich konnte es kaum erwarten, sie zu verlassen.
Die Highschool brachte die bis dahin größte Veränderung in meinem Leben. Morgens fuhr ich noch immer mit dem Rad, doch ich bog nicht mehr mit Phoebe auf die lange Straße zur Schule ab, sondern fuhr weiter bis zum örtlichen Transporter. Dort versammelten sich lachend, lärmend und mit den üblichen Teenager-Zankereien die Kinder der Gegend auf dem Weg nach Bloomington. Ich ging auf eine kleine unabhängige Schule mit den Klassenstufen sieben bis zwölf, doch für mich stellte das einen großen Schritt dar. An den ersten Morgen erinnere ich mich noch haargenau: Wie ich allein dastand, meine Tasche und Bücher fest an mich drückte, die versammelten Kinder anstarrte und mich fragte, wie die Schule wohl war, wenn das nur einige ihrer Schüler waren … Dann hörte ich eine freundliche Stimme, die mich rief.
»Kathryn!«
Das war Aisha, das andere Mädchen aus meiner Grundschule, das in diesem Jahr auf die Highschool kam, und bei ihr stand ihre ältere Schwester Tamara, die zwei Jahre zuvor die Schule gewechselt hatte. Erleichtert rannte ich zu den beiden. Anscheinend hatte Tamara meinen Blick richtig gedeutet, denn sie legte mir und Aisha die Arme um die Schultern und sagte: »Na los, Kiddies, ich kümmere mich um euch.«
Aisha schien verärgert (wer will sich schon auf die große Schwester verlassen müssen? Fragen Sie mal Phoebe!), aber es schadete uns nicht, Tamara als Verbündete zu haben. Sie war ein offenes, großzügiges Mädchen, das ein Auge auf uns hatte, während wir uns in den ersten verwirrenden Wochen zurechtfanden, und gleichzeitig einen angemessenen Abstand