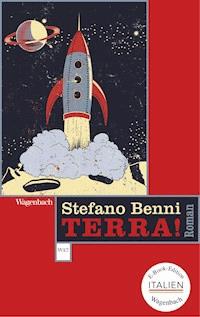Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Klaus Wagenbach
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Das unterhaltsamste Buch des bekannten italienischen Satirikers: In einer Bar auf dem Meeresgrund treffen sich Geschichtenerzähler aus der ganzen Welt. Männer mit Hut, Blondinen, der Matrose, der Teppichhändler, der Zwerg, der Koch, die Nixe, der Barmann, das kleine Mädchen, der unsichtbare Mann, der schwarze Hund, der Floh des schwarzen Hundes: sie alle – und auch noch viele andere illustre Bargäste – erzählen glaubhafte und unglaubliche Geschichten. In ihrer mediterranen Fabulierlust und durch ihre konkreten literarischen Bezüge (von E. A. Poe bis zu den amerikanischen Minimal-Poeten) bieten sie ein doppeltes Lesevergnügen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 245
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
E-Book-Ausgabe 2019 © 2019 Verlag Klaus Wagenbach, Emser Straße 40/41, 10719 Berlin Covergestaltung: Julie August Das Karnickel zeichnete Horst Rudolph. Datenkonvertierung bei Zeilenwert, Rudolstadt.
Alle Rechte vorbehalten. Jede Vervielfältigung und Verwertung der Texte, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Zustimmung des Verlags urheberrechtswidrig und strafbar. Dies gilt insbesondere für das Herstellen und Verbreiten von Kopien auf Papier, Datenträgern oder im Internet sowie Übersetzungen.
ISBN: 978380314267 2 Auch in gedruckter Form erhältlich: 978 3 8031 2344 2
www.wagenbach.de
Prolog
Ich weiß ja nicht, ob ihr mir glauben werdet. Wir verbringen die Hälfte unseres Lebens damit, uns über das lustig zu machen, woran andere glauben, und die andere Hälfte damit, an das zu glauben, worüber andere sich lustig machen.
Eines Nachts ging ich am Strand des Brigantischen Meers spazieren, da, wo die Häuser aussehen wie untergegangene Schiffe, versunken in Nebel und Meeresdunst, und wo der Wind die Oleanderzweige schlingern läßt wie Algen.
Ich weiß gar nicht, ob ich damals etwas suchte oder ob mir jemand folgte: Ich weiß nur noch, daß es eine schwere Zeit, ich aber aus irgendeinem seltsamen Grund glücklich war.
Plötzlich trat aus dem Schleier der Dunkelheit ein eleganter alter Herr in Schwarz mit einer Gardenie im Knopfloch und machte, als er an mir vorbeiging, eine leichte Verbeugung.
Neugierig folgte ich ihm. Ich ging eigentlich ziemlich schnell, aber ich hatte Mühe, mit ihm Schritt zu halten, denn er schien eine Handbreit über dem Boden zu schweben. Seine Schritte verursachten kein Geräusch auf den feuchten Holzplanken.
Der Alte blieb einen Augenblick stehen und ruderte mit den Armen in der Luft herum, als ob er die Position der Sterne berechnete. Dann nickte er und kletterte ein Treppchen hinab, das von der Mole ins dunkle Wasser führte.
»Bleiben Sie doch stehen, Herr –«, rief ich. »Tun Sie das nicht!«
Aber der Alte hörte nicht auf mich, sondern stand nach kurzer Zeit bis zur Taille im Wasser und verschwand bald darauf.
Ohne Zögern und in allen meinen Kleidern sprang ich hinterher. Das Wasser war eiskalt, und auf dem schlammigen Grund schwammen Abfälle und Seile. Ich sah mich um, suchte nach der Spur des Alten und bemerkte zu meiner großen Verwunderung eine Leuchtreklame, die ein paar Meter weiter über dem Meeresgrund schwebte, mit dem Schriftzug: »Bar«. Und genau dorthin begab sich der Alte mit der Gardenie, ruhigen Schrittes, wie ein Taucher. Auch ich schwamm, wie in einem Traum, auf jene Leuchtschrift zu, die das Wasser himmelblau strahlen ließ.
So gelangte ich zu einem Gebäude mit eingelegten Muschelschalen und einer Holztür. Sie tat sich augenblicklich auf, und der Herr mit der Gardenie faßte meine Hand. Er zog mich einfach plötzlich hinein, und da stand ich in einer gemütlichen, hell erleuchteten Bar voller Gäste. Die Einrichtung war bunt gemischt, ein paar Möbel entsprachen dem uralten Seemannsgeschmack, andere waren exotisch, wieder andere ausgesprochen modern. Die Theke sah aus wie eine Schiffsflanke, so mächtig und blankpoliert war sie. Über dem Regal mit den Flaschen befand sich ein großes Bullauge, durch das sich kandelabergleiche Korallenbänke und Fischschwärme bestaunen ließen. Die Gäste tranken und unterhielten sich wie in jeder anderen Bar auf festem Boden auch. Und sie waren, wie ihr aus dem Titelbild ersehen könnt, die extravaganteste Gruppe, die ich je gesehen habe.
Der Barmann winkte mich heran. Er hatte einen ironischen Zug um den Mund, und sein Gesicht erinnerte an das Gesicht eines berühmten Horrorfilm-Darstellers. Er lud mich zu einem Glas Wein ein und steckte mir eine Gardenie ins Knopfloch.
»Wir freuen uns, daß Sie hier bei uns sind«, sagte er leise. »Bitte nehmen Sie doch Platz, denn heute nacht wird jeder der
Anwesenden eine Geschichte erzählen.«
Ich setzte mich und lauschte den Erzählungen in der Bar unterm Meer.
DIE ERZÄHLUNGDES ERSTEN MANNESMIT HUT
Das Jahr, in dem das Wetter verrückt wurde
Die Erde,
mit der du die Kälte geteilt hast, nie kannst du anders,
als sie zu lieben.
WLADIMIR MAJAKOWSKI
Die Geschichte, die ich euch jetzt erzähle, ist eine Geschichte aus meinem Dorf; es heißt Sompazzo und ist berühmt für zwei Spezialitäten: Runkelrüben und Lügner.
Der Dorfgreis, Opa Celso, hatte geweissagt, in jenem Jahr würde das Wetter aus den Fugen gehen. Er behauptete, man könne das aufgrund dreier Zeichen schließen:
Erstens, die Bläßhühner, die jedes Jahr über das Dorf hinwegziehen, waren zwar auch dieses Jahr gezogen, allerdings per D-Zug. Der Stationsvorsteher hatte zwei Waggons voll gesehen;
zweitens, die Kirschen waren zu spät dran: Was an den Bäumen hing, war noch vom letzten Jahr;
drittens, den alten Leuten taten die Knochen nicht weh. Zum Ausgleich hatten aber alle kleinen Jungen die Gicht und alle kleinen Mädchen Rheuma.
Opa Celso hatte erklärt, wir würden unser blaues Wunder erleben.
Nun gut, der Frühling kam bereits im Februar. Sämtliche Margeriten blühten an einem einzigen Morgen auf. Es gab ein Geräusch, als ob man einen Riesenschirm aufspannt, und dann standen sie alle an ihrem Platz.
Von den Bäumen regnete es Pollen in Klumpen. Das ganze Dorf bekam das Niesen, und wir erlebten eine Epidemie höchst merkwürdiger Allergien: Manche hatten geschwollene Nasen, anderen wuchs ein Griff. Das Obst war mit einem Schlag reif: Man schlief unter einem Baum mit noch sauren Äpfeln ein und wachte marmeladebekleckert wieder auf.
Dann war der Regen dran mit Verrücktspielen. Er fiel nur einen einzigen Tag und nur auf eine Stelle: das Haus des Bürgermeisters. Dann wanderte die Wolke vorwärts und rückwärts über das Dorf und setzte jedem, der einen Hut aufhatte, kaum daß sie ihn sah, zack, den Hut mit einem Blitzlein in Brand. Dann kam ein duftender Wind mit aphrodisischer Wirkung auf. Die Leute wurden völlig fickerig und schlugen sich in die Büsche, zu zweit, zu dritt oder gleich in Rudeln. Der Priester verzweifelte. Und eines Tages, als er hinter einem Pärchen her war, das er beim Schweinigeln in der Sakristei erwischt hatte, schlug ihm selbst eine Bö ins Gesicht; man fand ihn im Heu mitsamt einem (an sich, ma non troppo, treuen) Pfarrkind.
Im April fiel der Sommer ein. Siebenundvierzig Grad. Das Korn reifte und war in zwei Tagen gar. Wir ernteten zweihundert Zentner Langbrötchen. Es war so heiß, daß die Eier nicht nur auf Autodächern weichkochten, sondern bereits im Arsch der Hennen; die Ärmsten flatterten wie wild, und morgens fanden wir Omeletts in den Nestern. Der kleine See trocknete in einem Atemzug aus. Die Fische suchten Asyl in Badewannen, und an Vertreibung war gar nicht zu denken, also mußten wir mit Forellen unter die Dusche. Katzenhaie machten Jagd auf Mäuse. Wir trugen ständig Strohhüte, aber die Sonne entzündete auch die, also griffen wir zu Blech- und Zinkhüten; daraufhin erschien Militär, denn ein Aufklärungsflugzeug hatte gemeldet, in Sompazzo sei eine Invasion vom Mars erfolgt.
Sofort danach kam der Hagel. Er begann jedesmal mit drei Donnerschlägen, dann erscholl eine Stentorstimme aus dem Himmel: »Allez!«, und dann prasselten topfkuchengroße
Hagelkörner herab. In Biolo kam eins runter, das war so groß wie ein Laib Parmesan, innendrin steckte ein Rabe.
Dann folgte afrikanische Hitze. Die Leute schliefen in ihren Kühlschränken mit Verlängerungsschnüren auf der Straße. Der Eismann arbeitete rund um die Uhr und konnte am Ende dieses Sommers einen Wolkenkratzer in Monte Carlo erwerben.
Im Herbst endlich fielen die Blätter. Es waren, genau gesagt, zwei: Eins im Schulhof und eins in Rovasio. Alle anderen waren wie angeleimt und nicht einmal mit einer Gartenschere abzukriegen. Die Trauben waren reif, aber versalzen, ich schwör’s, salzig wie eingelegte Heringe, und der Heurige taugte bestenfalls zum Abschmecken von Bratensoßen. Die Temperatur wurde wieder milder, und im November erschienen mit Verspätung die Schwalben. Ein Neunmillionenschwarm. Kein Mensch konnte mehr aus dem Haus, es herrschte ein Krach von zehntausend Dezibel. Als die Schwalben weiterzogen, kamen die Schwäne. Sie warfen sechzig chinesische Babys auf die Welt und zogen wieder ab.
Und dann kam der Nebel. Jenseits der eigenen Nasenspitze war keine Sicht mehr. Der einzige, der seelenruhig weiter spazierenging, war Äneas; seine Nase ist achtundzwanzig Zentimeter lang. Wir anderen trugen alle Nebelscheinwerfer auf dem Kopf und gingen manche Nacht ins falsche Haus, was aber nicht weiter schlimm war, denn es gab stets Überraschungen im Bett.
Die größte Gefahr waren die Lastwagen, die mit hundertzwanzig mitten durchs Dorf bretterten, denn für LKW-Fahrer ist Nebel kein Problem. Wir mußten, um heil über die Straße zu kommen, Brücken von Dach zu Dach und unterirdische Gänge bauen. Am Ende beschlossen wir, eine schöne Mauer mitten auf die Straße zu stellen, und fortan ward von LKW-Fahrern nichts mehr gesehen, nur noch ein paar Wrackteile.
Und dann kam der Winter, und es schneite augenblicklich und zwanzig Tage am Stück. In kürzester Zeit versank das ganze Dorf unter dem Weißen Gast. Nur die Schornsteine ragten noch heraus. Aber wir verzagten nicht. Wir schaufelten Schnee in Trupps: Wir aus Sompazzo-Süd schippten ihn nach Sompazzo-Nord und umgekehrt, und so lag der Schnee immer gleich hoch, aber uns war sehr warm.
Hektor, der Bäcker, arbeitete immer noch in der Unterhose, denn Bäcker sind athermisch. Jeden Morgen ging er von Haus zu Haus und warf die Brötchen durch den Schornstein. Informationen tauschten wir per Rauchzeichen aus, und abends erzählten wir uns geräucherte Witze. Am besten Witze reißen konnte der Heizer.
Uns Menschen ging es eigentlich nicht schlecht. Wir hatten unser sompazzanisches Brot mit Käse, dreitausend Kalorien pro Scheibe. Aber für die Tiere war es hart. Die Rinder hatten kein Gras zu beißen und lehnten Steaks ab. Tagelang fütterten wir sie mit Zwiebeln, aber dann stanken sie so aus dem Maul, daß das Jesuskind in der Krippe eingegangen wäre. Die Vögelchen wurden immer magerer, die Füchse ebenfalls, Wiesel konnten durch die Gitterstäbe schlüpfen, und die Wölfe kamen zuerst ins Tal herunter und dann ins Dorf, und schließlich hockten sie bei uns im Wohnzimmer, artig Pantoffeln im Maul, diese Schleimer. Und weiter fiel der Schnee und ging uns auf die Eier, und viele Dörfer waren von der Umwelt abgeschnitten: Oben in Monte Macco, so hieß es, hatten zwanzig Familien fast nichts mehr zu beißen und aßen ausschließlich Bohnen. Wir hatten einen bösen Verdacht. Es gab nämlich in Monte Macco eine Familie, die hieß Bohne, also fuhren wir hinauf, um nach dem Rechten zu sehen, aber die Ärmsten aßen tatsächlich nur Bohnen und hausten zu fünfzig in einem einzigen Haus, um Brennholz zu sparen, und knatterten dank ihrer einseitigen Ernährung derart gewisse Fürze in die Luft, daß es sich anhörte wie Krieg, und Opa Bohne schnappte die fettesten mit einem Fischernetz und steckte sie in den Kochtopf, auf daß nichts verkomme.
Ende des Jahres lag der Schnee sieben Meter hoch, und der Bäcker hatte kein Mehl mehr, also suchten wir in der Stadt um Hilfe nach. Man schickte uns drei Hubschrauber, aber die waren nicht besonders genießbar, abgesehen von den Sitzen vielleicht. Wir waren am Ende unserer Kräfte, als Opa Celso befand, der einzige, der uns noch retten könne, sei Ufizéina.
Ufizéina war Mechaniker und reparierte alles, vom hydraulischen Kran bis zur Nuckelflasche. Niemand in ganz Sompazzo konnte sich erinnern, daß irgendein Reparaturwunsch ihn je in Verlegenheit gebracht hätte. Wir trugen ihm das Problem vor: nämlich daß nichts Geringeres als das Wetter einer Reparatur bedürfe. Ufizéina dachte kurz nach, dann sagte er: »Was kaputt ist, wird heile gemacht.«
Er besah sich die Sache, nahm einen Wagenheber, zwei Planen, etwas Kitt sowie eine Pumpe und verschwand am Horizont.
Bereits am Abend war er wieder da. Er erläuterte, die Sache sei ganz einfach: Die Sonne habe sich, als sie im Morgengrauen bei Monte Macco aufgestiegen war, in einem vom Blitz zersplitterten Baum verfangen und sich ein Loch gerissen. Und tatsächlich, sie hing da am Hang und war so schlapp, daß es einen dauern konnte. Ufizéina hatte sie vulkanisiert und dann wieder aufgepumpt. In kürzester Zeit sei sie wieder prall gefüllt gewesen und hochgestiegen. Und wirklich kam sie wieder, ganz allmählich und zuerst noch matt, aber dann immer runder und strahlender, stieg hoch über Monte Macco und wärmte alles.
Der Schnee schmolz, und alles wurde wieder normal, außer uns.
DIE ERZÄHLUNGDES ALTENMIT DER GARDENIE
Der größte Koch von Frankreich
Nimmer hätt’ ich dies geglaubet,
doch ich tue, was ich kann.
LORENZO DA PONTE
Die Nacht und der Schnee hatten Paris in einen Traum in Schwarz und Weiß verwandelt. Welch ein Glück für alle diejenigen, die dem Schauspiel jenes Winters zu Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts in der Wärme ihrer Wohnung und vom Fenster aus beiwohnen durften! Aber welch eine schreckliche Nacht für die anderen! Mehr als zweihundert Clochards starben an Unterkühlung, und ebenso vielen froren Hände und Füße ab.
Den Quai des Augustins und also die Seine entlang, die finster und aufgewühlt wie der Acheron dahinströmte, kämpfte sich ein abgezehrter schwarzer Hund durch den hohen Schnee. Er war ziemlich entkräftet und starrte um sich in die wirbelnden Flocken. Er hatte Hunger, Hunger, Hunger.
Lange schleppte er sich so dahin, bis er fühlte, wie ihm die letzten Kräfte schwanden. Er dachte (falls Hunde denken), sein Ende sei nahe (falls Hunde sich ein Ende vorstellen können). Aber da traf seine Nase ein Duft (deshalb nämlich muß man Hunden ihre Weise lassen): ein paradiesischer Duft.
Ich weiß, was ihr sagen wollt: Der Mensch sei das einzige Tier, das zu Religiosität fähig ist, und das, zusammen mit dem Daumen und dem Lachen, unterscheide ihn vom wilden Tier. Aber wie anders sollte ein Streuner in einer solchen Nacht den Duft von warmem Essen wohl nennen?
Immer diesem Duft folgend, kam der Hund an ein kleines Fenster zu ebener Erde. Er versank zwar zur Hälfte im Schnee, aber er konnte, wenn er den Hals reckte, hineinspähen. Und er sah.
Er sah einen schwach erleuchteten großen Raum im Souterrain. Und mittendrin eine für zahlreiche Esser festlich gedeckte Tafel. Zwar lag der Tisch beinahe im Dunkeln, aber man konnte die Umrisse der Schüsseln mit den verschiedenen Gerichten erraten, vier Kathedralen aus Nahrungsmitteln. Hinten in dem Raum, neben dem Kamin, sah der Hund zwei Männer. Der eine offenbar Chirurg, der andere Alchimist. Der Chirurg sezierte mit einem Messerchen ein kleines Geschöpf, der Alchimist mischte Flüssigkeiten in verschiedensten Farben inmitten einer Dampfschwade. Und aus dieser Schwade stammte der Duft, der den Hund angezogen hatte.
Musik war zu hören: eine Frauenstimme. Der Chirurg summte die Melodie leise mit. Der Alchimist klopfte den Takt mit dem Fuß. Eine Girlande hing von der Decke und schaukelte in der warmen Luft vor dem Kamin wie eine Fahne. Der Hund befand, daß dieses Paradies bestimmt einen Eingang hatte.
Überlassen wir jetzt den Hund der Kälte und seiner eigenen beschränkten Kenntnis der Wunder von Menschenhand.
Wir wollen eins klarstellen:
Das Paradies ist nichts anderes als das Restaurant Bon-Bon, es hat fünf Sterne und gilt manchen als das beste von ganz Frankreich.
Die Musik ist die Arie »Ombra leggera« aus der Oper Dinorah von Meyerbeer, gesungen von der Callas, und die gilt manchen als der beste Sopran aller Zeiten.
(In jenem Jahr, in dem sich dies alles zuträgt, ist Maria Callas zwar erst sechs Jahre alt. Aber es werden noch viele andere seltsame Dinge geschehen in dieser Nacht.)
Der Chirurg, der eben eine Forelle aus Savoyen ausnimmt, ist niemand anderer als Gaspard Ouralphe; er ist der Küchenchef des Bon-Bon und gilt manchen als der beste Koch von ganz Frankreich.
Der Alchimist ist sein Assistent, Monsieur Ascalaphe; er ist Mousse- und Saucenspezialist und gilt manchen als der beste seines Fachs.
Der Duft, der den Hund betört hat, entstammt einer Mousse aus Gänseleber, Langusten und provenzalischen Kräutern mit dem Namen »Mousse Topaze«.
Auf der Girlande, die unter der Decke flattert, steht:
DRITTE JAHRESHAUPTVERSAMMLUNGDER ÜBERSEE-IMPORTEURELANG LEBE PRÄSIDENT COCQUADEAU.
Der Handelsverband der Übersee-Importeure ist einer der reichsten und gilt deshalb manchen als unanständigster Handelsverband von ganz Frankreich.
Was den Präsidenten Cocquadeau betrifft, da gibt es keinen Zweifel: Er gilt nicht nur manchen, sondern allen als der übelste und zynischste Geschäftemacher des Landes.
Aber das weiß der schwarze Hund nicht, es ist auch nicht sein Bier. Diejenigen dagegen, deren Bier es wäre, tun, als wüßten sie es nicht. Ombra leggera, non te ne andare... non tivoltare ...
Porträts
Ouralphe ist klein und rund und hat einen Kopf in Form einer Birne. Mausaugen. Stirnfalten. Zwei wie mit dem Pinsel gezogene geschwungene, schwarzglänzende Bartspitzen. Kurzer, gegabelter Kinnbart. Haare in Kaviarton, brillantiniert. Rosige Wangen, warmherziges Lächeln bei entblößten spitzen Milchzähnchen, Sperlingsnase, ein schmuckes Muttermal auf der rechten Wange, kleine und sehr gepflegte Hände. Am rechten Ringfinger ein Ring mit Goldfasan. Auf dem Kopf die große Kochmütze, nach links gerutscht und etwas schlaff. Er trägt Weiß, bis auf einen großen gelben Seidenschal mit aufgedruckten Steinhühnern. Dazu Tanzschuhe. Parfüm: ein Hauch von Moschus. Stimme: Klarinette.
Ascalaphe ist groß und hager, die eine Schulter etwas höher als die andere, die Stirn neigt zu Akromegalie. Augenbrauen buschig. Teint im Sauce-Béarnaise-Ton, große Schweinchennase. Gutmütige Augen. Zahnloser großer Mund, runde große Ohren, wenige weiße Haare. Hände wie ein Würger. Er trägt ebenfalls Weiß, bis auf ein Paar rote Socken, die aus den Schuhen leuchten wie Flammen. Es sind Sandalen. Parfüm: Mischkräuter. Stimme: Oboe.
»Maître«, sagt der gute Ascalaphe, »die Mousse ist beinahe vollkommen, aber irgend etwas stimmt noch nicht ganz. Der Sauternes buhlt um die Gans, aber sie will sich nicht hingeben. Das Aroma hängt irgendwie in der Luft. Und so kann ich doch keine Kräuter dazugeben...«
Ouralphe schneidet drei Forellenfilets zurecht und drapiert sie sternförmig auf eine Braquemond-Platte. Dann nimmt er den Kopf der schönen Savoyardin und schmückt ihn mit einem Limonenohrring. Er besieht sich die Platte aus einiger Entfernung. Findet das Grün der Petersilie zu aggressiv. Dünnt sie aus. Und segnet alles mit sechs Tropfen sizilianischen Öls.
»Mein lieber Ascalaphe«, sagt er schließlich, »es könnte sein, daß du mit dem Sauternes zu schüchtern warst und daß die Gans eine Fettleber hat, weil sie zu schnell gemästet worden ist. Gib noch zehn Tropfen Wein dazu, und der Vermählung steht nichts mehr im Wege.«
Ascalaphe befolgt den Rat, und die Mousse wird vollkommen. Der Maître irrt niemals.
Ouralphe seufzt und sieht hinüber auf die Tafel im Dunkeln, wo vier Hummer auf der kalten Platte »Le Grand Océan« hilfeheischend die Scheren schwenken. Weiter hinten nicken Schweinsköpfe auf der Fleischplatte »Massacre de Saint-Julien l’Hospitalier«. Der Berg der Zwölf Süßigkeiten glänzt noch weiter hinten und spiegelt die Rundungen des Früchte-Schlosses »Jardin de Salomé«.
»All die Arbeit für diese Koofmichs«, sagt Ouralphe niedergeschlagen zu Ascalaphe, und der steht auf und reckt sich und schüttelt die verrenkten Knochen.
»Maître, vielleicht sollten wir uns jetzt zur Ruhe legen.«
»Ich werde heute nacht nicht zu Bett gehen«, sagt Ouralphe, »es ist schon drei, und ich habe keine Lust, bei diesem Mistwetter nach Hause zu gehen. Um acht müssen wir sowieso schon wieder hier sein zum Vorbereiten. Ich werde neben dem Kamin schlafen.«
»Gestern haben Sie auch schon hier geschlafen«, sagt Ascalaphe, die mißlungene Übermutter. »Und vorgestern auch.«
»Ein General schläft immer auf dem Schlachtfeld. Und außerdem muß ich nicht allein schlafen.«
Vor einem Augenblick ist der schwarze Hund, naß und schwanzwedelnd, hereingekommen. Er hat sich zu Ouralphes Füßen gekauert und starrt ihn an wie eine Gottheit.
»Siehst du?« sagt der Koch. »Es gibt hier einen, der mich anbetet.«
»Sagen Sie doch so etwas nicht«, sagt der gute Ascalaphe.
»Ganz Frankreich verbeugt sich vor Maître Ouralphes Küche.«
»Früher vielleicht. Heutzutage schätzt man weder Erfindungsgeist noch Überraschungen. Winzige Portionen für winzige Mägen, denen alles wurscht ist, oder proteinhaltige
Hirschgespinste für exhibitionistisches Gefeiere. Das ist es, was die Leute heute wollen: Den anderen erzählen können, was sie gegessen haben. Oh, rien à faire sur Ia terre... geh, mein guter Ascalaphe. Ich werde diesem letzten Gourmet hier einen Knochen à la Grand Squelette zubereiten.« Er streichelt den Hund.
Ascalaphe tritt hinaus in die Nacht.
Der Schnee fällt noch immer.
Die Glocke von Notre-Dame schlägt vier.
Paris schläft.
Im Widerschein des Kaminfeuers, umhüllt von der Wärme eines köchelnden Suppentopfs, döst Ouralphe und verliert sich in Erinnerungen. An sein Haus auf dem Land. Gesunde und freundliche Gänse. An seine Gattin, Madame Camélie Ouralphe, die zwar weder gesund noch freundlich, dafür aber jüngst verschieden ist. An diese ganz bestimmten weichen Erdbeeren, die er heute auf dem Markt gesehen hat, zu einem unanständigen Preis. Er legt die Platte wieder auf, es ist immer noch die Callas, immer noch »Ombra leggera«.
Ob, welch großer Sopran! Nie ward eine solche Stimme geboren (in der Tat, sie war noch nicht geboren). Ouralphe fühlt sich etwas matt und schenkt sich zwei Finger breit Château Grillon ein, den mit dem Nachgeschmack von Veilchen. Ein Wein für Träume: Er sieht, umgeben von der Wärme aus dem Kamin, Pferde und Kamele und Bajaderen im Glas tanzen. Sein Kopf dreht sich. Alles scheint leicht zu schwanken, die Wände scheinen näher zu kommen, der Schnee draußen scheint schief zu fallen. Was ist denn los? Sogar der Hund hat sich verändert. Guckt so merkwürdig. Sieht aus, als ob er lacht... lacht, ja, wie die Schweinchen oben auf dem Massaker von Saint-Julien.
Jetzt steht er auf und dehnt sich. Dehnt sich lang und hoch, bis er nur noch auf den Hinterläufen steht. Ouralphe sieht im Kaminfeuer, daß es in seinem Glas schneit! Und daß die Schnauze des Hundes sich verzieht. Die Nase wird flacher, die Ohren schrumpfen. Unten an den Hinterläufen tauchen schwarze Lackschuhe auf. Dann eine rote Samthose. Das Feuer im Kamin lodert plötzlich auf. Die Vorderpfoten des Hundes werden zu Händen, an einem Ringfinger steckt ein Rubinring. Und da, Augen und Haare, schwarzgelockt, ein Schnauzer und ein Kinnbart. Als letztes verschwindet die Trüffelknolle, und zum Vorschein kommt eine angriffslustige und sehr menschliche Nase. Nur der Schwanz bleibt an seinem Platz. Herausgekommen ist ein gepflegter großer Gentleman mit einem exotischen Blick. Er könnte ein Mestize sein, von irgendeiner sehr warmen und sehr fernen Insel. Er setzt sich und lächelt. Was für Zähne!
»Teufel!« sagt Ouralphe verdutzt.
»Ganz recht«, antwortet der. »Und Sie sind der berühmte Ouralphe.«
»Ah... ah... angenehm«, sagt Ouralphe und reicht ihm die Hand. Die Hand des anderen brennt. Ouralphe schreit auf.
»Ich hätte Sie warnen sollen«, lächelt der Teufel. »Tja, ein schönes Plätzchen hier. Ich mußte erst sämtliche Quais abklappern. Man hat mir da unten die falsche Adresse genannt.«
»Da unten?«
»Da unten.«
»Sie... laufen Sie immer so rum? Ich meine, auf vier Pfoten?«
»O nein. Ich hasse diese ganze Transformiererei. Schwarzer Kater, Femme fatale, Papst, Fledermaus, Bock und dieses Zeug... Aber Sie können sich ja vorstellen, daß ein Hund nachts um vier in Paris weniger auffällt als ein eleganter Herr mit dunkler Hautfarbe.«
»Verstehe«, sagt Ouralphe. »Einen Schluck Wein?«
»Gern«, sagt der Teufel, »aber Sie müßten ihn mir direkt in den Mund schütten... Sie wissen doch, Château Grillon trinkt man nicht warm.«
Und so kippt Ouralphe einen schönen roten Schoppen in des Teufels Rachen. Der hat übrigens Mandeln und ein Gaumensegel wie jeder andere ehrwürdige Rachen.
»Und jetzt«, sagt der Teufel und leckt sich mit einer seltsamen spitzen Zunge die Lippen, »jetzt möchten Sie sicher wissen, warum ich hier bin.«
»Ich glaube«, Ouralphe seufzt, »weil ich mitkommen soll.«
»Sie sind«, der Teufel verneigt sich, »tatsächlich ein kluger Mann.«
»Aber warum ausgerechnet ich, falls das nicht zu indiskret klingt?«
»Ihre Frage, Monsieur, ist sehr aufschlußreich«, grinst der ehemalige Hund. »Stolz, Eitelkeit, Vermessenheit. Ich, Ouralphe, die Summe aller Tugenden!«
»Oh, so habe ich das nicht gemeint«, sagt Ouralphe und rührt langsam, ganz langsam die dampfende Suppe. »Ich meine bloß, warum die Ehre eines persönlichen Besuchs?«
»Weil Sie die Klassengrenzen gesprengt haben, Monsieur Ouralphe. Ich habe Ihr Sündenregister bei mir, es sieht aus wie eine von Ihren Speisekarten«, sagt der Teufel und zieht einen Zettel mit roter Schrift aus dem Umhang. »Ich lese da: übertriebener Schönheitssinn... maßloser Berufsstolz... künstlerischer Größenwahn... Neid, Zorn, Unkeuschheit und obendrein Flüche, Grausamkeiten gegen Mensch und Tier... soll ich weiterlesen?«
»Maßloser Stolz...« murmelt Ouralphe. Er steht auf und entzündet nacheinander drei Kerzenleuchter auf der gedeckten Tafel. Jeder Leuchter erhellt ein neues Wunderwerk. Dem Teufel, der schon einige Bankette mitgemacht hat, verschlägt es den Atem.
»Wenn das der Grund für meine Verdammnis ist«, sagt Ouralphe, »dann sollen Sie es wenigstens gründlich kennenlernen... Ich lade Sie zum Essen ein.«
Der Teufel grinst wieder. Was für Zähne!
»Falls Sie glauben, Sie könnten mich damit umstimmen, sage ich Ihnen- alles Gerede, daß ich angeblich gewisse Entscheidungen bereue oder bestechlich bin, ist unwahr und eine Frucht literarischer Phantasie.«
Aber Ouralphe hört nicht, was er sagt, sondern legt ihm fünfzehn verschiedene Bestecke vor. Der Teufel betrachtet sie ohne Zittern. Er ist ein Mann von Welt, und er weiß nicht nur die Forke zu benutzen. Außerdem hat er einige Stunden als ausgehungerter Hund auf dem Buckel.
»Voila, meine Meisterwerke«, sagt Ouralphe. »Nach einem uralten sizilianischen Rezept.«
Der große Ozean
Drei Kreise ziehen sich um die Mitte der Platte.
Der erste besteht aus Krebsen, zunächst in Milch ertränkt und dann gebacken, mit Schinken-Mousse und Krebscrèmekacheln, durch Rahmwindeln passiert, sowie ein paar Lebendkrebsen, die so lange gerieben wurden, bis sie rot wie gekocht waren und sich mit den gekochten gemeinsam auf die Socken machen, con grande scherzo für die Esser.
Der zweite Kreis beginnt mit einer Anguste in Ölragoût, Trüffelpilzen und Erbsen in ihrem Fischsudbad. Die Angustenschere hält einen kleinen Aal in Mandelsauce à l’Amberlin am Schwanz, der kleine Aal beißt in den Schwanz eines großen Aals, ohne Haut und in Malvasier und Sardellensauce gedämpft, der wiederum legt seinen Kopf auf einen gegrillten Hecht, welcher seinerseits vier Forellen verfolgt, eine auf Sauerampfer, eine auf Wacholder, eine auf Schlehenragoût und eine auf Karbonade. Die letzte Forelle stößt an die erste Anguste.
Der dritte Kreis besteht aus einem Karussell im BayolStil, dreihundert Austern in Salsa reale, deren jede anstelle der Perle ein Froschfleisch- oder Seeschildkrötenleberklößchen beherbergt, dazu Napfschildkröten und Röhrenmuscheln.
Im Zentrum der drei Kreise stützen vier Tintenfische eine riesige Muschel mit einer Krone aus Hummern in Sauce barcellonaise, und jeder Hummer hält ein Körbchen mit Meerzungen in der Schere. Mitten in der Muschel ragt wie die frisch geborene Venus ein großer Stör auf, gespickt mit Speck und gegart in einem Sud aus Meersaugräten.
Das Massaker von Saint-Julien l’Hospitalier
Zwei Wildschweine, drapiert wie Sphinxen im Fremiet-Stil, balancieren ein großes Tablett auf den Köpfen, und darauf liegen sechs Schweinchen, gefüllt mit Makkaroni, Käsebeize, Pfeffer, Hirn und Mark vom Rind. Jedes Schweinchen hat einen mit Frittaten garnierten Hut auf, auf welchem Hasen maurischer Art mit grünen Limonenschalenschnitzen ruhen. Die Hasen ihrerseits tragen zwischen den Zähnen Zweige, und darauf sind Wachteln alla bolognese, Tauben in der Spielhölle, Fasanen in Pistaziencreme, Rebhühner in Kichererbsen-Mousse, Schnepfen andulische Art und kalte Turteltauben à l’orange gespießt.
Der Berg der Zwölf Süßigkeiten
Der Berg hat folgenden Aufbau:
Hänge: Éclair mit Muskatellerbirnen, Türkische Torte, Cannelloni mit Quarkfüllung.
Erste Lage: Süßreisschaum, Eier in Kastaniencreme, Wutschaum von Mandeln.
Zweite Lage: Erdbeertorte, Gateau Mille Feuilles, Mokkacreme.
Dritte Lage: Weißschaum mit Zitronensaft, Mischpudding mit süßer Sahne.
Auf dem Gipfel: Ein großer Turm aus Veilchenblüten-Éclairs a 1’Ascalaphe.
Der Garten der Salomé
Eine Statuette der Todestänzerin hält ein Füllhorn voller Melonen Papayas Guayabas Araucabas Zuckermelonen und Marillen. An ihrem Hals hängen Diademe aus Weichselkirschen, um ihre Taille Orangen aus Portugal, auf ihrem Kopf steckt eine Krone aus Ananas. Zu ihren Füßen erstreckt sich ein Teppich aus Weintrauben und Kokosnüssen. Um ihr Podest herum liegen vierzig abgetrennte Köpfe von Johannes dem Täufer in Konditorcreme, und aus jedem blutet eine andere Obstgelatine.
»Extraordinär«, sagt der Teufel.
»Finden Sie?«
»Absolut extraordinär.«
»Ja, gar nicht schlecht«, räumt Ouralphe ein, »für Überseeheinis, die ein ganzes Jahr lang davon erzählen sollen. Aber Ihnen gebe ich etwas Besonderes zum Kosten.«
Der Teufel klatscht in die Hände, was, da sie lange Krallen haben, klingt wie Gabelgeklirr.
»Womit fangen wir an?«
Ouralphe serviert ihm eine ölige, dunkle Brühe, auf der ein überbackenes Floß schwimmt.
»Suppe aus Madagaskarschildkröten à la manière d’Ouralphe.«
Der Löffel des Teufels blitzt auf und ab im Schein der Kerzen.
»Exquisit!«
»Finden Sie?«
»Absolut exquisit. Aber bereits dieses erste Gericht macht Sie schuldig. Sie brüsten sich mit der Leiche einer armen Schildkröte, einer Mutter womöglich, oder vielleicht ist sie die Witwe eines Schildkröterichs, der auch schon für solche Suppen sterben mußte. Sie leben von Verbrechen.«
»Ich empfinde mich als nicht grausamer als die Natur«, entgegnet Ouralphe. »Wissen Sie, wie die Schildkröten in Madagaskar leben? Eine Schildkröte lebt hundert Jahre und legt alle zehn Jahre Eier. Um die Eier abzulegen, muß sie den ganzen Ozean bis zu einer Insel namens Malkanka durchschwimmen. Dort werden sie ihr von Möwen weggefressen, von Eingeborenen gestohlen, oder sie verfaulen im Regen. Alle, bis auf vielleicht eins von tausend Eiern, gehen kaputt. Und dann schwimmt diese arme Schildkröte durch den ganzen Ozean wieder zurück und träumt von den verlorenen Schildkrötenkindern, und so geht das weiter seinen natürlichen Gang, bis der Tod sie endlich auf ihrer schönen Schildpattbahre ereilt. Weinen Sie?«
»O nein… das ist nur die scharfe Suppe. Oder glauben Sie etwa, Beelzebub weint über Schildkröten?«
»Nein, und nicht nur der nicht, auch der Herr Gott weint darüber nicht, der Oberste Kosmoschef. Sehen Sie, ich habe mir für das Jüngste Gericht eins vorgenommen. Wenn der Erzengel mit Säbel und Dienstmütze kommt und sagt: Ouralphe, der Herr hat dir etwas zu sagen, dann antworte ich: Nein, ich habe ihm etwas zu sagen! Ich, Gaspard Bénédict Ouralphe, werde deinen Arbeitgeber fragen, wo er eigentlich gewesen ist in all den Jahren Pest und Erdbeben und den sinnlosen Kriegen, in denen wir waren, im Guten wie im Bösen, und weitergemacht haben. Es stimmt zwar, zahlen tut der, der ißt, aber ein schlechter Koch gehört entlassen. Er dagegen bleibt oben sitzen, sitzt da seit neunzehnhundert Jahren und rächt sich an uns dafür, daß er nicht auf dem Sofa gestorben ist.«
Der Teufel verschluckt sich an Suppe und Floß.
»Monsieur Ouralphe, Sie lästern Gott auf unerhörte Art!«
»Finden Sie?«
»Sie machen Ihre Lage nur noch schlimmer!«
»Ich sage einfach die Wahrheit. Wir Köche sind immer aufrichtig. Aber wissen Sie, was jetzt auf Sie wartet?«
»Nein.«
»Wachteln! Wachteln alla negresca: Entbeint und farciert mit Mark, Parmesan, Eigelb und Sahne und in einer Tunke aus schwarzen Trüffeln.«
Ouralphe steckt sieben angebratene Wachteln auf einen Spieß und hängt ihn über das Feuer. Er seufzt über der Flamme und sagt wehmütig: »Morgen früh kommen die übelsten Geschäftemacher von ganz Frankreich hierher, Sklavenhändler, Volksaushungerer, Plantagenplünderer. Fast alle sind glühende Katholiken; und wofür haben sie all das getan? Für den Fortschritt der Zivilisation und zum höchsten Ruhme Gottes!«
»Ich kenne die Sorte. Welchen Wein empfehlen Sie zu den Wachteln?«
»Moncet-Deprenelle, Jahrgang 1872.«
»Théophile Gautiers Todesjahr.«
»Ein Kunde von Ihnen? Machen Sie den Mund auf.«
»Danke, Sie liegen richtig mit Ihrer Frage. Der Koch da oben, wie Sie ihn nennen, hat sich angewöhnt, mich zu schikken...«
»Jedesmal?«
»Nicht jedesmal. Manchmal begibt Er sich auch persönlich herab und sammelt ein paar Heilige und ein paar sexuophobe Hirtenmädchen ein, damit sie ihm das Paradies bevölkern helfen. Es ist so leer da oben... Wenn Sie das sehen könnten... Wie ein Riesenhotel außerhalb der Saison. Drücke ich mich verständlich aus?«
Alle Wachteln nicken im Chor und lassen die Köpfchen sinken, weil der Spieß sich dreht.
»Sie wissen ja, wenn ich aufkreuze, protestiert kein Mensch. Ihr habt doch alle irgendwo eine offene Rechnung.«
»Und Sie treiben die Zahlungen ein... Wie ist es denn so in der Hölle?«
»Wie stellen Sie es sich denn vor?«
»Also erst mal, meiner Meinung nach hat kein Mensch die Hölle verdient. Aber jedenfalls sehe ich sie mehr oder weniger als einen Ort, an dem Tag für Tag solche Bankette von irgendwelchen Überseefritzen stattfinden, die sich Parmesan über eine Seebarbe reiben und ihre Kippen im Sorbet ausdrücken.«
»So ungefähr ist sie tatsächlich«, sagt der Teufel und hält den Mund auf wie ein Spatz. »Schenken Sie mir noch etwas Wein nach?«
Ouralphe nimmt die gerösteten Wachteln und wirft sie, eine nach der anderen, pluff, in eine Schüssel. Als sie wieder herauskommen, sind sie glasiert mit Schokolade. Der Teufel kostet eine und sagt: »Exquisit.«
»Finden Sie?«
»Absolut exquisit.«
Er klatscht in die Hände, und eine kleine Wachtel erwacht wieder zum Leben, schabt sich die Mousse vom Rücken und flattert durch den Raum. Ouralphe applaudiert.
»Bravo!«
»Künstler unter sich ...« wehrt der Teufel ab.
»Das haben Sie schön gesagt, Herr Teufel. Künstler unter sich! Und ausgerechnet Sie bezichtigen mich der Todsünde des Hochmuts! Gibt es irgendeine Kunst ohne Exzeß? Ist das, was wir Maß nennen, nicht bloß der Pantoffel, in den wir nach einer langen Reise auf den Flügeln der Vision schlüpfen? Gibt es eine Sprache ohne Metaphern, eine Mahlzeit ohne Relever, einen Teufel ohne Hauer?«
»Nun mal sachte. Kunst bedeutet auch Einfachheit.«
»Die Einfachheit ist das Gekünsteltste des Jahrhunderts«, sagt Ouralphe. »Und hier kommt meine Languste à la Mérimée: