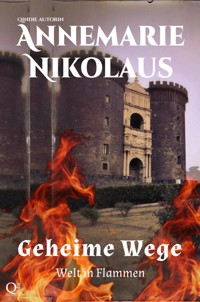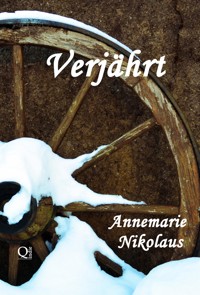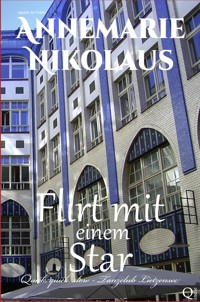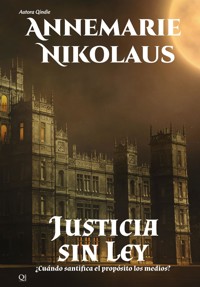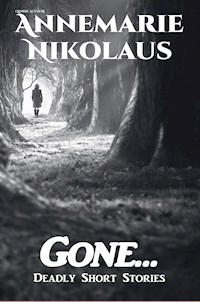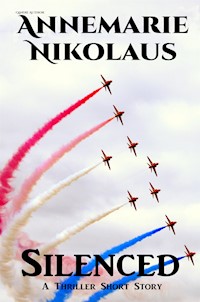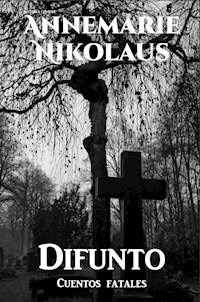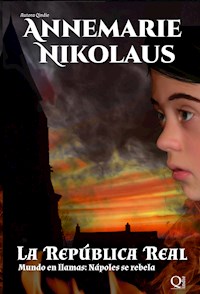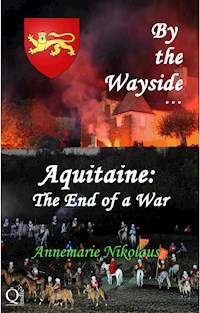5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Publisher s15153
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Bär, eine Bombe, ein Betrug.
Eine Prinzessin mit einer Mission -
und zwei ihrer Gegner beschützen sie.
1898: Vierzig Jahre sind seit dem quantenmagischen Gau vergangen, der England zerstört und ganz Europa erschüttert hat. Die Preußen haben Frankreich besetzt und Philippe von Orléans setzt auf die Hilfe der Engländer, um sich die Krone Frankreichs zu sichern
Aber ein Bourbonen-Prinz sieht sich ebenfalls als Thronanwärter, die Anarchisten wollen Frankreich als Republik und die Hugenotten sehen die protestantischen Preußen gar als Schutzmacht.
Sie alle wollen verhindern, dass es Philippes Halbschwester Céline gelingt, dem Prnzen die Unterstützung durch die englischen Armeen zu sichern.
Fasziniert Sie die phantastische Welt des Steampunk, in der sich technischer Fortschritt mit magischen Kräften verbindet?
Dann begleiten Sie »Die Bastardprinzessin« auf ihrem gefahrvollen Weg nach Cöln.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
Inhalt
Titel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Über die Autorin
Guide
Cover
Contents
Start of Content
Annemarie Nikolaus
Die Bastardprinzessin
– Clockwork Paris –
Copyright © 2025 Annemarie Nikolaus
Lizenz
Dieses Buch ist zu Ihrem persönlichen Vergnügen gedacht. Es darf weder weiterverkauft noch zur weiteren Verbreitung im Internet hochgeladen werden.
Bitte respektieren Sie die Arbeit der Autorin.
Wenn Sie dieses Buch verschenken wollen, kaufen Sie für jede Person ein zusätzliches Exemplar.
Falls Sie dieses Buch lesen, obwohl weder Sie noch jemand anderes es gekauft hat, gehen Sie bitte zu Ihrem Händler und kaufen ein Exemplar.
1
Mit einem letzten lauten »Puff« erstarb der Motor des Renault. Céline Dufour, Princesse de Murol, hielt erschrocken die Luft an; dann brach sie in Gelächter aus.
Da stand sie nun mitten in einem Wald in den Cevennen und hatte für ihren schicken neuen Dampfwagen kein Holz zum Weiterfahren. Nachdem sie zwei Stunden zuvor den Brenner das letzte Mal gefüllt hatte, waren im Anhänger nur ein paar Späne übrig geblieben, die sich in die Ecken drängten.
Um sie herum standen Eichen so mächtig, dass sie viele Jahrhunderte alt sein mussten. Dank der Druiden hatten die Bäume den großen quantenmagischen Gau vor vierzig Jahren weit besser überlebt als alle anderen Gewächse.,Vielleicht diente sie Frankreich eher, wenn sie in diesem Wald nach einem Druiden suchte statt in einer der freien Reichsstädte jenseits des Rheins nach einem Engländer. Aber die Camelots du Roy hielten Queen Victorias Streitmacht für wirkungsvoller als Magie.
Céline setzte ihre Schutzbrille ab und wischte sich mit einem Taschentuch übers Gesicht. Rußflecken – eben deshalb trug sie den alten angegrauten Fetzen immer noch mit sich.
Sie stieg aus, holte eine Landkarte aus dem Handschuhfach und breitete sie auf dem abgedeckten Anhänger aus. Drei Meilen zurück hatte sie eine einsame Longère passiert; aber Umkehren kam nicht in Frage. Die geheime Armee ihres königlichen Halbbruders war einsatzbereit. Philippe wartete nur auf Victorias Unterstützung; dann konnte er den Aufstand gegen Preußen beginnen, noch bevor der Winter kam.
Craintilleux, der nächste Ort, war mindestens doppelt so weit entfernt wie die Longère. Der Straße nach. Aber zu Fuß konnte sie quer durch den Wald gehen. Sie würde Craintilleux gewiss nicht verfehlen: Sobald sie die Loire erreichte, ging sie einfach den Fluss entlang.
Céline schloss das Verdeck des Wagens, um die Polster zu schützen, falls es regnete. Dann nahm sie ihre langläufige Pistole aus dem Handschuhfach, füllte die Taschen ihres Mantels mit Munition und hängte sich ein Pulverhorn über die Schulter. Sie konnte das Dorf wohl vor Einbruch der Dunkelheit erreichen, aber Wölfe, die aus ihrem Rudel ausgestoßen waren, jagten auch tagsüber.
Der Wald war licht, aber der Boden voller Mauselöcher und Maulwurfshügel, sodass sie ihre Schritte vorsichtig setzte. Ab und zu zeterte ein Vogel voller Empörung über die Störung. Hin und wieder knackte irgendwo ein Ast unter dem Tritt eines kleinen Tiers. Das hieß wohl, dass hier kein Raubtier unterwegs war; nach ein paar Minuten steckte sie die Pistole in den Gürtel ihres Rocks.
Bald darauf kam sie an einen schmalen Bach, in dem sich zwischen den Felsen beinlose Tiere mit schillernder Oberfläche bewegten.
Fische! In alten Büchern hatte sie Zeichnungen von ihnen gesehen; sie hatte sie für viel größer gehalten. Wenn die Menschen sich die Mühe gemacht hatten, selbst diese kaum handtellergroßen Tiere zu kochen und zu essen, mussten sie schon vor dem Gau verzweifelt gewesen sein.
Céline kniete sich ins Gras, schöpfte mit beiden Händen Wasser und trank. Dann zog sie Stiefel und Strümpfe aus und watete zum anderen Ufer. Einmal kam ein Fisch in ihre Nähe, aber als sie sich bückte und eine Hand nach ihm ausstreckte, schlug er blitzschnell einen Haken und schwamm davon.
Auf der anderen Seite trocknete sie ihre Füße am Rock ab, lief dann aber barfuß weiter, solange der Boden von weichem Moos bedeckt war. So musste es sich anfühlen, auf Wolken zu gehen. Auch im nächsten Bach schwammen Dutzende von Fischen. Die Magie der Druiden schützte noch immer diesen Wald und alles Leben darin.
Die Bäume standen nun dichter und zwischen den mächtigen Eichen reckten sich hier, umgeben von hohen Farnen, dünne Birken ins spärliche Licht. Céline folgte mehr und mehr allein ihrem Instinkt, weil die Sonne nicht mehr durch das Blätterdach drang. Erst als ihr einfiel, dass das Moos an den Bäumen ihr gleichfalls die Richtung anzeigte, ging sie unbesorgter weiter.
Als es schließlich wirklich zu dämmern begann, lag plötzlich Rauch in der Luft. Sie raffte ihre Röcke und lief schneller.
Unvermutet stand sie dann am Rand einer kleinen Lichtung, in der Mitte ein qualmender Meiler.
Céline ging um den Meiler herum und fand im Gras dahinter einen schmalen Pfad, der wieder in den Wald hineinführte. An irgendeiner menschlichen Behausung würde er wohl enden, wo sie die Nacht über unterkäme, falls sie Craintilleux nun doch nicht erreichte.
Hinter ihr knackten wieder Äste; sehr laut dieses Mal. Das war ein größeres Lebewesen als ein Vogel oder ein Eichhörnchen. Ein Wolf. Oder ein Mensch?
Sie zog die Pistole aus dem Gürtel, schüttete Pulver auf die Pfanne und schob eine Kugel in den Lauf.
Es wurde noch finsterer, obwohl hier das Blätterdach über dem Weg dünn und durchlässig war. So leise wie möglich ging sie weiter. Es drängte sie, möglichst schnell aus dem Wald herauszukommen, aber es war klüger, immer wieder stehen zu bleiben und zu lauschen.
Als es das nächste Mal knackte, überlief sie eine Gänsehaut. Die Härchen in ihrem Nacken stellten sich auf; das war viel zu nah. Aber um einen Angriff abzuwehren, brauchte sie einen Platz, wo sie freie Sicht hatte und niemand sie von hinten überfallen konnte.
Hinter der nächsten Biegung stand eine besonders mächtige Eiche. Sie stellte sich mit dem Rücken an den Stamm, spannte die Pistole und lockerte mit der Linken den Dolch in ihrem Gürtel.
Und wartete.
Wieder brachen Äste; wieder überlief sie eine Gänsehaut. Dann knackte es auch auf der anderen Seite des Weges. Zwei?
Céline kniff die Augen zusammen und versuchte, mit ihrem Blick die wachsende Dunkelheit zu durchdringen.
Es raschelte im Farn und dann gab es einen langen singenden Ton wie von einem Kater, der um sein Revier kämpfte. Automatisch entspannte sie sich und lockerte ihre Armmuskeln. Wildkatzen im Kampf mit einem Rivalen scherten sich nicht um Menschen.
Aber Knurren, nicht Fauchen, kam als Antwort auf den Gesang. Dann brach ein massiger Körper aus dem Gebüsch am Rand des Weges; eher ein Bär als ein Wolf. Das Katzentier sprang ihm mit einem schrillen Schrei aus dem Farn entgegen und wurde mit einem Tatzenschlag davongeschleudert. Es blieb auf dem Weg liegen.
Die Katze grollte aus tiefer Kehle und richtete sich wieder auf. Der Schlag hatte sie nicht einmal betäubt.
Céline hob ihre Pistole.
Das andere Tier sprang.
Céline schoss.
Das große Tier verharrte einen Moment in der Luft, dann schlug es mit einem dumpfen Ton auf dem Waldboden auf. Und wälzte sich auf die Katze.
Die Katze wimmerte leise.
Céline nahm sich die Zeit, nachzuladen. Erst, als sie wieder schussbereit war, ging sie mit vorgestrecktem Arm auf die Tiere zu.
Das Tier, das sie erschossen hatte, war tatsächlich ein Bär. Ein greises Exemplar mit grauen Flecken um die Schnauze. Die Katze winselte und richtete den Blick auf sie. Eine Wildkatze von der Größe eines Luchses, ein wunderschönes Tier.
Sie trat mit aller Macht gegen den Bären. Wenn sie ihn an den Schultern anhob, könnte die Katze darunter hervorkriechen. Aber was würde das verängstigte Tier dann machen? Sie anfallen?
Entweder befreite sie die Katze von dem Bären oder sie täte ihr einen Gefallen, wenn sie sie erschoss statt sie hier elend zugrunde gehen zu lassen.
Céline zielte auf ihren Kopf und schloss die Augen.
Sie konnte keine Katze töten!
Als sie wieder hinsah, starrte die Katze sie mit großen fragenden Augen an.
»Hab keine Angst, Kleines. Ich tu dir nichts.«
Céline steckte die Pistole ein, holte ein paar herumliegende dicke Aststücke und schob sie unter den Bären. Während sie dessen Oberkörper immer weiter anhob und mit dem Holz abstützte, beobachtete sie die Katze und redete in sanften, lockenden Tönen auf sie ein.
Der Bär war entsetzlich schwer, aber Stück für Stück bekam sie sein Gewicht von der Katze herunter. Sie keuchte; ihr fehlte bald der Atem, um weiter auf sie einzureden.
Die Katze bewegte sich schließlich, schien sich zu spannen.Céline nahm den Dolch in die linke Hand, damit sie sich notfalls verteidigen konnte.
Inzwischen direkt neben der Katze angelangt, schob sie einen weiteren ihrer Äste unter den Bären und stemmte sich gegen ihn. Mit einem lang gezogenen Schrei sprang die Katze hoch. Céline riss die Arme vors Gesicht und warf sich zur Seite. Trotzdem zog die Katze ihre Krallen über ihren rechten Unterarm.
Dann war sie fort.
Celine hatte drei tiefe, blutende Furchen in ihrem Arm. Es brannte wie Feuer. Als sie nach der Feuchtigkeit griff, die sie an der Schläfe spürte, wurden ihre Fingerspitzen rot. Und dann tat auch diese Verletzung weh.
Sie zog einen ihrer Unterröcke aus und wickelte ihn um den Arm, nachdem sie den zerfetzten Ärmel abgeschnitten hatte. Dann machte sie sich wieder auf den Weg.
Inzwischen war es so dunkel, dass sie nach dem Moos an den Bäumen tasten musste, um sich zu orientieren. Sie hätte auf der Straße bleiben sollen. Wie war sie nur auf den Gedanken gekommen, es mache einen Unterschied, ob sie das Dorf zwei Stunden früher oder später erreichte? Sie würde allemal die Nacht dort verbringen müssen.
Als sie schließlich am Ufer eines breiteren Wasserlaufs ankam, atmete sie erleichtert auf: die Loire. Flussabwärts lag Craintilleux. Dort war sie in Sicherheit, selbst wenn sie in einem Schuppen oder gar im Freien schlafen müsste.
2
Auf der Hügelkuppe zügelte Maurice Bavard sein Pferd. Vor ihm auf der Landstraße stand ein Dampfwagen. Das Verdeck war geschlossen und versperrte ihm den Blick hinein. Mitten in einem fremden Wald Pause zu machen, dazu gehörte Mut. Aber es sprach auch für großen Mut, dass die Frau den Auftrag des Orléans-Prinzen angenommen hatte.
Er stieg ab, schlang die Zügel um einen tief hängenden Ast und näherte sich; wachsam, den Degen in der Hand.
Der Renault war verlassen, der Anhänger leer: ein Beweis mehr, dass diese neumodischen Gefährte den Pferden unterlegen waren. Sein Esprit lief auch dann noch, wenn er mal nicht genug Futter bekam.
Im Handschuhfach fand er eine Landkarte vom Südosten Frankreichs, im Gepäckraum einen Koffer mit Frauenkleidern. Er hob eine der seidenen Chemisettes hoch. Wie mochte die Frau darin aussehen, deren kolorierte Daguerreotypie er in seiner Satteltasche hatte? Die bloßen Schultern und der Ansatz ihres Busens auf dem Bild ließen ahnen, dass sie eine höchst anziehende Figur hatte. Maurice grinste; er würde sie gerne in dieser Chemisette sehen.
Er suchte weiter, aber außer der Landkarte fand er keinen Hinweis, der ihm etwas nutzte: kein Brief, keine Notiz, die ihr Ziel verriet.
Er ging zwei Mal um den Dampfwagen herum, aber erst als er ein Stück in den Wald hineinlief, fand er ausreichend deutliche Spuren, die ihm zeigten, welchen Weg sie eingeschlagen hatte. Offensichtlich wollte sie das Dorf erreichen, das am Westufer der Loire lag.
Der Wald neben der Straße war zwar licht, aber der weglose Boden locker und voller Löcher; zu gefährlich zum Reiten. Wenn Esprit in eines dieser Löcher träte ... nicht auszudenken ...
Maurice ging zu seinem Pferd zurück. Die Straße entlang war er schnell genug, um vor der Frau in Craintilleux anzukommen. Falls sie überhaupt ankam. Wenn sie sich im Wald verlief und nicht vor Einbruch der Nacht herausfand, mochten ein Wolf oder die Bestie sie finden. Sie stünden dann mit der Suche nach Philippe d’Orléans’ Kontaktmann wieder am Anfang. Der Geheime Rath der Camisards hatte zwar genug Informationen, um auf den Auftrag zu schließen, den die Frau hatte, kannte aber nicht einmal ihr Ziel. Er musste mit ihr reden, bevor er sie ausschaltete ... Ein wildes Tier wäre das Dümmste, was ihm dazwischenkommen konnte.
Die Landstraße wand sich einen Hang entlang, dann ging es hinunter zu einem Bach, der sich tief in die Schlucht eingegraben hatte. Eine stabile hölzerne Brücke ohne Geländer führte hinüber.
Als es zu dämmern begann, verstummte der Wald und es gab nur das Klappern von Esprits Hufen auf dem felsigen Untergrund der Straße. Der Weg war erstaunlich gut; kein Wunder, dass die Frau es gewagt hatte, ihn mit ihrem Dampfwagen als Abkürzung zu nehmen. Sie kannte sich offensichtlich ebenso gut hier aus wie er.
Plötzlich zerriss ein Schuss die Stille. Esprit wieherte erschrocken; Maurice zügelte ihn und lauschte.
Der Schuss war aus dem Tal weit unter ihm gekommen. Vielleicht war es die Frau gewesen, die den Schuss abgegeben hatte. Er wartete auf einen zweiten Schuss. Aber es kam keiner. Entweder hatte sie ihr Ziel getroffen oder war nicht zum Nachladen gekommen. In der Dunkelheit des Waldes war es selbst für einen ausgebildeten Schützen schwierig zu treffen. Eine Gänsehaut lief ihm über den Rücken bei der Vorstellung, was das bedeuten mochte. Aber er konnte jetzt nichts tun, schon gar nicht erkunden, was eben passiert war. Nur hoffen.
Der Mond ging auf und schien immer wieder zwischen den Wolken hindurch. Er ritt schneller und bald darauf lag die Loire unter ihm. Sobald er einen geröllfreien Abstieg fand, verließ er die Straße und ritt dann am Ufer entlang, bis er das Dorf erreichte.
Am Ortsrand gab es mehrere Heuschober und viele Häuser waren aus Holz gebaut. Und allesamt in Dunkel gehüllt. Er verließ den Uferweg und ritt langsam zur Ortsmitte in der Hoffnung auf eine Relais-Station oder zumindest ein Wirtshaus.
Craintilleux war ein Straßendorf, an einem alten Handelsweg gebaut. Im Erdgeschoss hatten die Häuser allesamt Werkstätten und Läden: Einst hatten die Menschen hier von Pilgern und Händlern gelebt, die zwischen Flandern und dem Mittelmeer unterwegs gewesen waren. Auch das hatten ihnen die Preußen genommen.
Neben der Kirche standen mehrere Steinhäuser mit Ziegeldächern. In manchen schimmerte Licht aus Fenstern im ersten Stock. Kein Flackern – Ætherlampen. Wer hier am Kirchplatz wohnte, konnte sich Beleuchtung leisten.
Metallisches Quietschen wies ihm schließlich den Weg zum Wirtshaus. Ein verrostetes Schild schaukelte im Wind. Aus den Fenstern, die trotz der abendlichen Kühle offen standen, drangen Stimmen.
Maurice öffnete das Tor zum Hof. In einem Unterstand fraßen fünf Pferde gemeinsam aus einem Trog und kauten geräuschvoll. Entweder gab es keinen Pferdeknecht oder der Bursche schlief schon. Er band Esprit neben den anderen an und sattelte ab.
Im Wirtshaus empfing ihn ein hoch loderndes Kaminfeuer, das ihm augenblicklich den Schweiß auf die Stirn trieb. Eine Qualmwolke hing unter der Decke; kein Wunder, dass sie die Fenster nicht schlossen.
Hinter dem Tresen stand niemand. Der Wirt, kenntlich an seiner dunkelblauen Schürze, saß mit einem halben Dutzend älterer Männer an einem langen Tisch in der Mitte des Raums; wie die anderen mit einem Becher vor sich.
Keine Frau.
Maurice öffnete die Schließen seines Umhangs und legte ihn über seinen Arm.
Der Wirt musterte ihn eingehend und stand dann auf.
»Habt Ihr ein Bett für mich übrig?«
»Ihr könnt ein ganzes Zimmer haben, Monsieur. Sucht Euch eines aus; es ist alles frei.« Die Frau war also noch nicht angekommen. »Zu dieser Jahreszeit verirrt sich niemand hierher.« Der Wirt sah nicht so aus, als ob es ihn sonderlich bekümmerte.
»Kann ich auch noch etwas zu essen bekommen? Ein Stück Käse und ein Brot würden mir reichen.«
Der Wirt öffnete eine Tür neben dem Tresen. »Marthe! Marthe, ist von dem Huhn noch etwas übrig?«
Maurice setzte sich an einen Tisch an einem der offenen Fenster und der Wirt brachte ihm einen Tonkrug mit Rotwein und einen Becher. Dann kehrte er zu seinen anderen Gästen zurück.
Marthe war ein junges Mädchen, das mit seiner großen Nase und dem Pferdegebiss dem Wirt ähnlich sah. Sie stellte ihm wortlos einen Teller mit Käse und einem Hühnerbein auf den Tisch und legte eine halbe Baguette daneben.
Maurice ließ sich Zeit mit dem Essen. Die Gäste machten nicht den Eindruck, als ob sie so bald den Heimweg fänden. Mit ein wenig Glück konnte er sitzen bleiben, bis die Frau kam. Wenn sie in dieser Nacht überhaupt ankam.
Falls sie bis zum Morgen nicht hier auftauchte, musste er zurück in den Wald und nach ihr suchen. Er fluchte leise.
Er bestellte mehr Wein und kippte seinen Stuhl gegen die Wand.
Der Wirt brachte auch den anderen Gästen einen neuen Krug und dann gleich einen zweiten, nachdem alle Becher wieder gefüllt waren. Die Männer wurden betrunkener und sprachen lauter. Es schien sie nicht zu stören, dass ein Fremder zuhören konnte.
Am Ende des Dorfs hatte es eine Wassermühle gegeben, die in den letzten Jahren wegen des ständigen Niedrigwassers in der Loire oftmals still gestanden hatte. Daraufhin hatte der Müller umgebaut und eine Dampfmaschine in Betrieb genommen. Aber nachdem sich die Frauen in seiner Nachbarschaft beschwert hatten, dass er ihre Wäsche verrußte, hatte der Dorfrat ihn aufgefordert, eine neue Mühle, weit entfernt von Craintilleux, zu bauen. Er hatte gehorcht. Und weigerte sich seither, den Bauern des Dorfs das Korn zu mahlen.
Maurice grinste in sich hinein. Wie oft hatte er derartige Geschichten gehört! Bald würde niemand mehr auf die Dienste der Dampfmagier zurückgreifen wollen. Er leerte einen weiteren Krug. Die Männer am anderen Tisch langten bei den Schafen an, die anscheinend in großer Zahl an der Blauzunge eingingen.
Da ging die Tür langsam auf und eine Frau wankte über die Schwelle. Mit einem erleichterten Seufzer lehnte sie sich an die Wand. Sie war blass; von ihrer rechten Schläfe zog sich ein blutverkrusteter Kratzer nach unten bis auf die Wange. Es sah aus, als sei sie in Dornen hängen geblieben. Um ihren rechten Arm hatte sie einen blutigen Stoff gewickelt und in ihrem halb aufgelösten dunkelblonden Zopf hingen Kletten.
Maurice brauchte seine Daguerreotypie nicht, um sie zu erkennen. Aber die Daguerreotypie wurde ihr nicht gerecht: Sie sah sehr viel jünger aus als auf dem Bild, Anfang zwanzig vielleicht. Und war sehr viel attraktiver.
Die Männer an dem langen Tisch starrten sie allesamt an. Der Wirt stemmte beide Hände auf, um das Gleichgewicht zu wahren, während er sich schwerfällig erhob.
Maurice war schneller bei ihr als der Wirt. Er legte einen Arm um ihre Hüfte, führte sie an seinen Tisch und hielt ihr seinen halbvollen Becher hin. Die Frau ließ sich auf einen Stuhl fallen und trank mit geschlossenen Augen.
»Wirt, sie ist verletzt. Könnt Ihr für warmes Wasser sorgen?«
Der Wirt brummte etwas und rief lauthals nach Marthe.
Es dauerte eine Weile; dann kam sie mit einer Nachthaube auf dem Kopf und angetan mit einem Mantel die Treppe herunter. Sie gähnte. »Was?«
»Die Demoiselle braucht deine Hilfe.«
Die Frau schüttelte den Kopf. »Ich brauche nur ein wenig Schlaf.«
»Kommt, Mademoiselle.« Marthe legte eine Hand auf ihre Schulter. »Wir haben ein Zimmer für Euch und ich schaue mir Euren Arm an.«
Das war Maurice nun gar nicht recht, dass die Frau von seinem Tisch weggeholt wurde. Aber ihm fiel nichts ein, was er dagegen tun konnte. Doch sie würde ihm gewiss nicht davonlaufen in dieser Nacht.
Marthe führte sie in die Küche. Eine quietschende Ofentür und das Klappern von Holzscheiten hieß, dass sie für das warme Wasser neu einheizen musste. Sie würden eine Weile in der Küche bleiben.
3
Maurice ließ sich den Krug neu füllen und einen Becher für die Frau geben. Beides brachte er selber in die Küche. Hier waren die Fenster geschlossen und der Geruch von Gebratenem hing noch in der Luft. Er gab der Küche trotz ihrer Größe etwas Heimeliges, das an eine Zeit erinnerte, in der es keinen Mangel gab.
Nachdem er auch seinen eigenen Becher geholt hatte, setzte Maurice sich neben die Frau. Er fragte erst gar nicht; er begann einfach, den Stoff von ihrem Arm zu lösen. Drei lange Risse, die wieder zu bluten begannen. An den Rändern waren sie hässlich gerötet, aber es zogen sich keine verdächtigen Streifen zu ihrer Schulter hoch.
»Wie ist das passiert?«
»Eine Wildkatze.« Sie betrachtete den Arm. »Es sind bloß Kratzer. Aber ich brauche ein neues Kleid.«
Marthe hatte inzwischen das Feuer wieder in Gang gebracht und stellte einen Kessel mit Wasser auf. Sie verließ die Küche und kam gleich darauf mit mehreren sauberen Tüchern zurück.
Maurice hielt der Frau den gefüllten Becher hin. »Wie heißt Ihr?«
»Céline.« Er wartete, aber sie schien ihren Familiennamen nicht preisgeben zu wollen. Stattdessen sah sie ihn erwartungsvoll an. Er tat ihr den Gefallen und nannte seinen vollen Namen. Sie konnte eh nichts damit anfangen; er war ein Niemand.
Er nahm Marthe eines der Tücher ab, tauchte es ins warme Wasser und säuberte behutsam als Erstes den Kratzer im Gesicht. Er war nicht so tief wie die am Arm; vielleicht würde es keine dauerhafte Narbe geben. Wenn sie lange genug lebte.
Céline presste die Augen zusammen, aber sie gab keinen Laut von sich. Hart im Nehmen.
Als das Tuch blutig war, reichte Marthe ihm ein anderes. Mit schräg gelegtem Kopf musterte sie den Arm. »Was wolltet Ihr im Wald mitten in der Nacht?«
»Es schien mir der schnellere Weg, vor Einbruch der Dunkelheit irgendwo anzukommen.« Céline seufzte. »Ungefähr sechs Meilen von hier ist mir das Holz ausgegangen.«
»Das Holz?« Maurice setzte ein finsteres Gesicht auf, als begreife er in diesem Augenblick, wovon sie sprach. »Ihr reist in einem dieser stinkenden pferdelosen Fahrzeuge?«
»Sie sind bequem und praktisch.« Céline zuckte zusammen; an ihrem Handgelenk hatte er eine verkrustete Stelle abgelöst und es sickerte wieder Blut hervor.
»So praktisch, dass Ihr mitten im Wald strandet und Euer Leben beim Angriff einer Wildkatze aufs Spiel setzt?«
»Eigentlich war sie ganz ungefährlich.« Sie nahm ihm das Tuch aus der Hand. »Den Rest kann ich alleine säubern.« Mit zusammengebissenen Zählen drückte sie das Tuch auf den Unterarm.
Plötzlich lächelte sie. »Ich bin zwischen die Fronten geraten. Den Bären habe ich getötet.« Das war also der Schuss, den er gehört hatte. »Der Katze war ich dann auf ihrer Flucht im Weg.«
»Ich habe einen Schuss gehört.« Maurice kniff die Augen zusammen. »Das wart Ihr dann wohl.«
»Und Ihr seid mir nicht zu Hilfe gekommen?« Ihre Augen glitzerten schalkhaft. Schäkerte sie etwa mit ihm?
»Wenn ich Euch gesehen hätte, hätte ich keinen Moment gezögert.« Er nahm ihr das Tuch ab und tauschte es gegen ein sauberes. »So helfe ich Euch eben jetzt.«
»Mademoiselle, wenn Ihr einen Bären erschossen habt, so habt Ihr dem Dorf einen großen Gefallen getan.« Marthe öffnete einen Schrank und nahm ein Tongefäß mit einer grünlichen Paste heraus. »Macht ihr damit einen Umschlag, Monsieur.« Glaubte sie, sie gehörten zusammen?
Marthe füllte Célines Becher mit warmem Wein und legte eine Brioche und ein Stück Hühnerbrust vor sie hin. »Die Männer sind seit Monaten vergeblich hinter ihm her. Immer haben sie seine Spuren in den Monts du Forez verloren. Sie sind zu wenige, um alle Höhlen abzusuchen.«
Céline griff nach dem dampfenden Becher. »Das freut mich dann.«
Marthe ging in die Schankstube. Gleich darauf kam ein Mann in die Küche, der viele Haare im Gesicht und keine auf dem Kopf hatte. Er stellte sich als Gaston vor und war der Bürgermeister des Dorfs.
»Mademoiselle, ich habe von Marthe verstanden, dass Ihr ein ... ein Problem mit Eurem Fahrzeug habt. Wir verstehen nichts davon, aber morgen früh können wir den Dampfmagier benachrichtigen, der in Feurs lebt. Er wird Euch weiterhelfen.«
Céline lächelte. »Ich brauche keinen Magier, nur einen Karren voll mit klein gehacktem Holz. Dann kann ich weiterfahren.«
»Den geben wir Euch gerne, Mademoiselle. Und ich schicke in der Frühe ein paar Männer, um Euer Gefährt hierher zu bringen. So könnt Ihr Euch ausruhen.« Der Bürgermeister deutete auf ihren Arm. »Ihr habt viel riskiert; das hätte böse ausgehen können.«
Sie stellte den leeren Becher ab. »Der Herrgott hat mich geleitet, den Weg durch den Wald zu nehmen, um euch von der Plage zu befreien.«
Mit ihrem letzten Satz hatte sich Céline als Katholikin zu erkennen gegeben. Und Gastons Gesicht versteinerte. Die jahrzehntelangen Strafaktionen, die Dragonnaden gegen die protestantische Bevölkerung in den Cevennen, waren weder vergessen noch vergeben.
Eine Hugenottin würde Gott nie so anmaßend für sich reklamieren, wie Céline es getan hatte. Mit der Waffe war sie wohl geschickter als mit Worten. Warum mochten die Camelots du Roy sie dennoch ausgewählt haben, die Verhandlungen für Prinz Philippe zu führen? Weileine Frau abkömmlicher war als die Männer, die den Krieg gegen die Preußen vorbereiteten? Und sie die einzige Frau in jener geheimen Versammlung der Orléanisten gewesen war? Ihr Informant hatte viel zu wenig in Erfahrung bringen können, Feigling, der er war.
Dennoch bemühte sich Gaston um Freundlichkeit, während Céline mit ihm besprach, wie klein das Holz sein musste, damit sie den Brenner ihres Dampfwagens damit befüllen konnte.
Es stellte sich heraus, dass sie erst am späten Vormittag fortkommen würde, weil das Holz zuerst klein genug gehackt werden musste.
Die Vorstellung, wie sie Holzspäne schaufelte, ließ Maurice auflachen; Céline sah ihn irritiert an. »Monsieur?«
Er schmunzelte. »Da Ihr die Unbequemlichkeit einer Postkutsche scheut, wäre es nicht besser gewesen, Ihr hättet ein Pferd genommen? Oder könnt Ihr nicht reiten?«
Sie schnaubte. »Selbstverständlich kann ich reiten!«
»Ja dann. Bestimmt überlässt man Euch ein Pferd im Tausch für das Gefährt.«
»O nein!« Gaston streckte abwehrend die Hände aus. »Mit Dampfmagie haben wir nichts zu tun.«
»Mit einem Pferd käme ich nicht an mein Ziel.« Sie griff schnell nach dem Stück Hühnerbrust und biss ab. Sie hatte wohl mehr gesagt als sie wollte. Nicht geschickt mit Worten ... »Vorzüglich. Seid Ihr die Köchin, Marthe?«
Das Mädchen nickte stolz.
»Ich werde an Euer Wirtshaus denken, wenn ich auf dem Rückweg bin.«
»Wohin geht Eure Reise, Mademoiselle?«, fragte Marthe.
Wie schön; er brauchte sich nicht selbst zu bemühen.
»Ostwärts. Über die Saône hinaus.« Céline zog die Schultern hoch. »Die Luft soll dort zu schlecht sein für die Pferde.«
Marthe sah erschrocken aus. »Aber wie können das die Menschen dann überleben?«
Es wurde Zeit zu zeigen, dass er sich auskannte. »Es gibt Atemschutzmasken.« Vielleicht konnte er sich Céline als Reisegefährte andienen; es würde ihm einige Mühe ersparen. »Man kann sie an vielen Orten kaufen.«
Marthe setzte sich, offensichtlich erschüttert. »Aber wie kann man da überhaupt leben wollen?«
Er lächelte. »Irgendwo müssen die Leute ja bleiben. Es können nicht alle zu uns in die Berge ziehen.«
Céline runzelte die Stirn. »Ihr kommt Euch wohl sehr klug vor, Monsieur.«
Er lächelte breiter. »Ich heiße Maurice. Sagte ich das nicht?«
Sie hielt Marthe ihren Becher hin. »Mademoiselle?«
Marthe beeilte sich, ihn zu füllen. »Ich mache Euch ein Zimmer zurecht.« Sie schien auf eine Antwort zu warten, aber Céline hatte ihre Augen auf ihm. Nachdenklich.
»Soll ich Euch ein Bad richten, Mademoiselle?«
Céline sah zu Marthe auf. »Ja, das wäre schön.« Ihr Blick kehrte zu Maurice zurück. »Wart Ihr schon einmal östlich der Saône? Dass Ihr so klug redet?«
Er lachte. »Ich komme viel herum.«
»Dann wohnt Ihr nicht hier?«
»Monsieur ist auch auf Durchreise.« Marthe setzte einen zweiten großen Kessel Wasser auf den Herd. »Er ist kurz vor Euch angekommen.«
»Über die Straße. Zu Pferde.« Nun, da sie gesagt hatte, dass sie über die Saône wollte, konnte er irgendeine Stadt jenseits des Flusses zu seinem Ziel erklären und sie würde sich nicht wundern, wenn sie sich unterwegs wiedersahen. Er sollte besser ein Auge auf sie haben, damit ihr nichts zustieß: Wer wusste schon, ob sie auch den nächsten Agenten des Prinzen von Orléans entdecken würden!
Marthe begleitete Céline in den ersten Stock und kümmerte sich dann um das Bad. Maurice stellte sich inzwischen an den Tresen und ließ sich einen Cognac geben.
Als Marthe dann zurückkam, winkte er sie zu sich. »Die Badewanne ist wohl in Gebrauch für den Rest des Abends. Aber habt Ihr vielleicht etwas anderes, das mich wärmen könnte?«
Sie errötete und warf einen schnellen Blick zum Wirt.
Maurice griff nach einer Strähne, die sich aus ihrem Zopf gelöst hatte. »Ist er Euer Mann?«
»Aber Monsieur!« Sie kicherte.
»Euer Vater?«
Sie schüttelte stumm den Kopf. Aber verwandt war sie gewiss mit ihm; die Ähnlichkeit war unverkennbar.
»Dann ... Zeigt Ihr mir mein Zimmer?«
Sie griff nach einer Petroleumlampe am Ende des Tresens. »Kommt, Monsieur!«
Auf der Treppe griff er nach ihrer freien Hand; sie ließ es sich gefallen. Als sie vor einer Zimmertür stehen blieb, zog er sie an sich. Sie sah ihn mit großen neugierigen Augen an, aber sie wich nicht zurück.
Er öffnete die Tür und sah sich um. »Stellt die Lampe dort ans Fenster.« Er wies auf die Kommode neben dem Bett.
Dazu musste Marthe das Zimmer betreten. Er schloss die Tür hinter sich. Sie setzte die Lampe ab und kam dann mit wiegenden Hüften auf ihn zu, eine unmissverständliche Bewegung.
Maurice zog das Band aus ihrem Zopf und breitete die langen Haare über ihre Schultern. »Ihr braucht kein Hemd, um Euch zu kleiden.« Er schob ihren Mantel von den Schultern und entblößte ihre Brust. Klein und fest, Marthe war bestimmt nicht älter als vierzehn oder fünfzehen. »Schön. Eine Schande, sie überhaupt zu bedecken.«
Sie sog heftig die Luft ein, als er sich hinunterbeugte und langsam über eine Brustwarze leckte. Monsieur!« Es klang zu lahm, um als Protest zu gelten.
»Ich heiße Maurice.« Das hatte er an diesem Abend zuerst zu Céline gesagt. Plötzlich tauchte ihr zerschundenes Gesicht vor ihm auf und er war versucht, Marthe hinauszuschicken.
Aber sie legte ihre Hände in seinen Nacken und streichelte ihn mit den Daumen am Haaransatz. Damit war es entschieden. Er hob sie hoch und legte sie aufs Bett.
Sie hatte einen vollen Mund, der zum Küssen lud, und große rehbraune Augen, die ihn voller Unschuld ansahen. Freilich hätte er Esprit darauf verwettet, dass sie schon lange nicht mehr unschuldig war.
Maurice kniete sich auf den Boden, zog ihr einen Pantoffel aus und hob ihren Fuß an seinen Mund. Sie gab leise Schnurrlaute von sich, als er ihre Sohle von den Zehen bis zur Ferse mit Küssen bedachte.
Bevor er den zweiten Pantoffel von ihrem Fuß streifte, sah er auf. »Wildkatze?«
Sie gab einen kehligen Laut von sich. »Katze. Ich bin ganz zahm.«
Grinsend verfuhr er mit dem zweiten Fuß genauso wie mit dem ersten und aus ihren Schnurrlauten wurde ein heiseres Stöhnen. Sie atmete heftiger; anscheinend brauchte sie nicht viel Zuwendung. Wie armselig mussten die Liebhaber gewesen sein, die sie bisher kennengelernt hatte!
Als er ihren Fuß losließ, richtete sie sich auf und entkleidete sich hastig. Den Blick auf sie gerichtet, zog er sich absichtlich ganz langsam aus. Sie verfolgte seine Bewegungen mit Hunger in ihren Augen. Dann kniete er sich zwischen ihre einladend gespreizten Beine. Dieses Kätzchen würde sich bald in eine Wildkatze verwandeln.
***
Célines Zimmer war eine geradezu luxuriöse Angelegenheit: Es war nicht nur groß genug für die Wanne, sondern auch für ein breites Bett, in dem man zu dritt oder viert schlafen konnte. Eine Kleidertruhe, ein Nachttisch und ein gepolsterter Stuhl vervollständigten die Einrichtung. Im Kamin gewann das Feuer an Kraft, das Marthe angezündet hatte, bevor sie die Wanne füllte.
Céline zog sich mühsam aus. Die Kratzer brannten mehr, als sie sich hatte eingestehen wollen, und jede Bewegung des rechten Arms sandte einen scharfen Schmerz bis zu ihrer Schulter hoch. Aber auch der Rest ihres Körpers antwortete nach dem langen Marsch mit Protest auf jede schnelle Bewegung.
Als sie nackt war, starrte sie unschlüssig auf das dampfende Wasser. Hinein und wieder hinaus, ohne den rechten Arm zu bemühen ... Aber das Mädchen rufen, damit sie ihr half? Bestimmt war Marthe wieder schlafen gegangen und musste wer-weiß-wie-früh aufstehen. Schließlich stellte Céline den Stuhl neben die Wanne, setzte sich und ließ sich von da aus ins Wasser gleiten.
Die Wärme machte sie schläfrig und sie schloss die Augen. Wenn sie jeden Tag so viel kostbare Zeit verlor wie heute ... Am Ende hatte dieser Mann recht, dass sie zu Pferde schneller vorwärts käme; zumindest bis in die Vogesen.
Dieser Mann: Sein Gesicht war bemerkenswert. Er hatte die längsten Wimpern, die sie je bei einem Mann gesehen hatte. Trotz der vielen kleinen Fältchen um seine Augen konnte er nicht viel älter sein als sie selber. Es musste Arbeit im Freien sein, Blinzeln gegen die Sonne, was sich dort eingegraben hatte. Und er reiste nun? Er sah nicht aus wie ein Handwerker und schon gar nicht wie ein Händler; seine einfache Kleidung war eher die eines Bauern oder Landarbeiters.
Sie griff nach der Seife und begann sich zu waschen.
Das Lachen einer Frau kam aus dem Nebenzimmer. Dann war ihr Eindruck wohl falsch gewesen, dass sie und dieser Mann die einzigen Gäste waren.
Eine gedämpfte Männerstimme antwortete und die Frau lachte wieder. Céline neigte unwillkürlich den Kopf zur Zimmerwand.
Wieder der Mann. Er klang wie Maurice?
Dann quietschte ein Bettgestell und das Quietschen fand einen regelmäßigen Rhythmus.
Céline schnaufte schockiert. Sie schloss die Augen; aber was sie in ihrer Fantasie vor sich sah, konnte sie damit nicht ausblenden.
Ihre Vermutung über die beiden wurde zur Gewissheit, als bald darauf ein kehliger Schrei zu ihr drang. Ein raues Lachen folgte; ein Männerlachen. Es klang nach Triumph.
Mit einer schnellen Bewegung stand sie auf, was ihr prompt neuen Schmerz durch den Arm jagte. Sie durfte sich einfach nicht aufstützen.
Vorsichtiger geworden ließ sie sich auf dem Stuhl nieder und hievte ihre Beine aus der Wanne. Vor dem Kamin trocknete sie sich nur notdürftig ab, um endlich ins Bett zu kommen.
Mit einem wohligen Seufzer kuschelte sie sich unter das schwere Federbett, nachdem sie ihr Hemd wieder angezogen hatte. In der Eile und der Überraschung über die Aufgabe, die Philippe ihr zugedacht hatte, hatte sie vergessen, ein Nachthemd mitzunehmen. Hätte sie Élise packen lassen, wäre das nicht passiert. Aber Élise hatte ein loses Mundwerk. Noch bevor sie Murol verlassen hätte, hätte das halbe Dorf gewusst, dass sie auf eine richtige Reise ging. Und darüber spekuliert, wohin ...
Nebenan begann das rhythmische Quietschen erneut. Waren sie denn noch nicht fertig? Céline zog sich die Decke über den Kopf, aber es half nicht viel.
Je mehr sie sich anstrengte, die Geräusche zu ignorieren, umso lebhafter arbeitete ihre Fantasie. Bestimmt waren die beiden nackt. Maurice’ Hände, die so sanft ihre Verletzungen gesäubert hatten, streichelten den Busen dieser Frau. Er war doch allein gewesen; wen hatte er sich da ins Bett geholt? Marthe? Das Mädchen war bestimmt nicht älter als sechzehn. Oder hatten sie in diesem Dorf jemanden für diese ... diese Dienste?
Sie wälzte sich auf die Seite, dann wieder auf den Rücken. Schließlich legte sie sich auf den Bauch und presste das Kopfkissen über ihre Ohren.
So konnte sie nicht schlafen. Mit einem entnervten Knurren setzte sie sich auf die Bettkante. Sie griff nach einem ihrer Stiefel und warf ihn mit allem Schwung, den sie mit dem linken Arm aufbrachte, gegen die Wand. »Ruhe!«
Das Quietschen verstummte tatsächlich! Aber die Frau lachte lauthals. Das Lachen wurde gedämpfter; anscheinend hatte Maurice ihr die Hand auf den Mund gelegt. Es folgte ein langsameres, schwerer klingendes Geräusch vom Bettgestell. Kurz darauf fiel eine Tür ins Schloss und es folgten leichte Schritte auf der Treppe.
Gut! Jetzt konnte sie hoffentlich schlafen.
Céline rollte sich zusammen und schloss aufatmend die Augen. Es blieb tatsächlich ruhig.
4
Céline saß ausgeschlafen vor einer Kanne heißer Schokolade und zwei Brioches, als Maurice die Treppe in den Schankraum herunterkam. Er hatte dunkle Ringe unter den Augen; da hatte sie das Mädchen wohl nicht früh genug aus seinem Bett vertrieben.
Gähnend fuhr er sich durch die Haare. »Wo ist der Wirt?«
Sie wies mit ihrem Kopf zur Küche. Er ging zur Tür und bestellte sein Frühstück.
Gaston betrat mit zwei älteren Männern die Schankstube. »Mademoiselle, wir holen jetzt Euer Fahrzeug. Seid Ihr sicher, dass Ihr es ohne Hilfe eines Dampfmagiers wieder in Gang bekommt?«
»Das braucht Ihr nicht.« Sie wärmte ihre Finger an der dampfenden Tasse. »Wir bringen eine Karre voll Holz hin.«
Einer der beiden Männer schüttelte den Kopf. »Ihr denkt, es ist so einfach ...«
»Es ist so einfach.« Maurice stand mit seinem Frühstück vor ihrem Tisch. »Darf ich mich zu Euch setzen?« Er wartete nicht auf ihre Antwort, sondern stellte seinen Teller und den Kaffeebecher einfach ab. »Aber Mademoiselle Céline wird sicher ihr Frühstück beenden wollen.«
Was ging ihn das an? »Das kann ich auch später essen.« Wenn er weg war. Sie stand auf und griff nach ihrem Mantel. »Wirt, stellt es mir beiseite.«
Vor der Tür standen zwei Ochsen, ein Esel und vier gesattelte Pferde. Aber noch kein Karren voll Holz.
Auf den Blättern am Boden lag eine dünne Reifschicht; ein schmaler rosa Lichtstreifen am Horizont kündigte einen neuen sonnigen Tag an. Darüber aber hing eine dunkle Rauchwolke; ein beißender schwefliger Geschmack breitete sich in ihrem Mund aus. Vom Ruß in der Luft? Céline schüttelte sich und zog den Mantel fester.
»Ich lasse das Holz bringen.« Gaston schickte einen der beiden Männer fort.
Dann konnte sie ja weiter frühstücken. »Sagt mir Bescheid, Monsieur le Maire.« Fröstelnd ging sie zu ihrer Schokolade zurück.
Maurice saß an ihrem Tisch, den Kopf hinter einer Zeitung. Wo hatte er die so plötzlich herbekommen?
Die Schokolade in ihrer Tasse dampfte nicht mehr; sie ließ sich vom Wirt eine neue Kanne bringen. »Seid Ihr allein heute früh?«
Der Wirt zuckte die Achseln. »Ich komme zurecht. Marthe hat morgens auf den Feldern zu tun.«
Maurice blickte sie über die »Dépêche du Midi« an. »Schon zurück, Céline?«
Sie schnappte nach Luft. »Was fällt Euch ein, Monsieur.«
»Maurice.« Er hörte sich an wie ein Erwachsener, der am Rande seiner Geduld mit einem unbelehrbaren Kind war.
Sie deutete auf die Zeitung. »Steht etwas Wichtiges darin?«
»Das ist Ansichtssache. Der Zar hat die türkischen Baryt-Minen erobert.«
»Dann ist er bald mächtig genug, sich mit den Quantenmagiern des Empire zu messen.«
»Queen Victoria in die Suppe zu spucken, ist allemal eine gute Idee.«
»Was?«
Er funkelte sie zornig an. »Habt Ihr vergessen, dass Victorias Magier mit ihren Experimenten den Puy-de-Dôme zur Explosion gebracht und halb Clermont unter Asche begraben haben?«
»Es ist nicht bewiesen, dass der Ausbruch im Vulkanring mehr als ein Zufall war.«
Er legte die Zeitung weg. »Glaubt Ihr an Zufälle?«
»Ja.«
Er zog die Augenbrauen hoch.
»Denn sonst würde ich Euch fragen, was Ihr hier noch macht.« Sie beugte sich über den Tisch. »Ihr verfolgt mich doch nicht etwa, Monsieur!«
»Ich heiße Maurice.« Er schob seinen leeren Teller in die Mitte des Tisches. »Céline, ich war vor Euch hier.« Mit einer Fingerspitze berührte er ihr Handgelenk. Perplex über seine Vertraulichkeit, reagierte sie nicht darauf. »Da Ihr, wie es scheint, ebenfalls über die Saône wollt, haben wir kaum eine andere Wahl als den gleichen Weg zu nehmen. Außer wir schwimmen.«
»Dazu ist es zu kalt zu dieser Jahreszeit.«
Er ließ ihr Handgelenk wieder los. Seine Finger waren fest und warm gewesen und jetzt fühlte sich ihre Haut nackt an. Sie zog die Handschuhe aus der Manteltasche und streifte sie über. Mutter hatte ganz recht, wenn sie sie mahnte, in der Öffentlichkeit nie ohne Handschuhe zu gehen. Aber hier, in diesen unwirtlichen Bergen, war sie mit Handschuhen zu elegant angezogen. Keine der Frauen, die ihr in den letzten drei Tagen begegnet waren, hatte welche getragen; sie arbeiteten alle mit ihren Händen.
»Was?« Sie fuhr hoch. Was hatte er gerade gesagt?
Maurice lächelte. »Da wir wohl den gleichen Weg haben, könnten wir zusammen reisen.«
»Und wie soll das gehen? Ihr galoppiert neben mir her? Ihr bindet Euer Pferd an meinen Renault?« Wieso hatte sie jetzt nicht rundheraus abgelehnt? Das konnte sie nicht gebrauchen, dass jemand wusste, wohin sie reiste.
Das triumphierende Aufblitzen in seinen Augen hieß wohl, dass sie ihm schon zu weit entgegengekommen war. »Worum wetten wir, dass Esprit mit Eurem Gefährt mithalten kann?«
Sie hätte ihn wirklich einfach auslachen sollen. »Ich wette nie, Monsieur.«
»Maurice.« Er klang indigniert. Allein dafür lohnte es sich, ihn immer wieder mit »Monsieur« anzureden.
Sie stand auf, strich ihren Rock glatt und bezahlte ihre Rechnung.
Fünf Stunden später stoppte sie an der Weggabelung vor Pontcharra-sur-Turdine. Unter ihr, im gelblichen Dunst verborgen, lag das Saône-Tal. Nun, da sie die Berge verlassen hatte, war es erheblich wärmer. Sie stieg aus und schlug wie am Vortag das Verdeck zurück. Eine leichte Brise streichelte ihr Gesicht. So wie die Finger von Maurice, als er ihre Kratzer versorgt hatte.
Sie schüttelte den Gedanken ab und breitete ihre Landkarte aus. Es gab zwei Möglichkeiten, die Saône zu überqueren: die Brücke bei Villefranche und die Fähre nach Trévoux. Hier an der Weggabelung musste sie entscheiden, ob sie nach Norden abbog oder weiter geradeaus zur Fähre fuhr.
Falls Maurice tatsächlich auf sie angesetzt war, würde er sie an der Brücke erwarten in der Annahme, dass kein Schiffer den Renault auf seiner Fähre akzeptierte. Vielleicht stimmte das sogar.
Sie setzte sich auf den Beifahrersitz und packte die Verpflegung aus, die sie am Morgen in Craintilleux erstanden hatte. Außer Brot, Wein und Käse hatte der Wirt auch noch ein halbes Huhn für sie gehabt.
Wenn der Schiffer ihr die Überfahrt verweigerte und sie dann doch zur Brücke musste, verlor sie Zeit. Einen halben Tag vielleicht. Aber das mochte es wert sein; immerhin wäre sie Monsieur ... Maurice ... los, falls es mit der Fähre klappte. Oder nicht?
Sie öffnete die Flasche und schnitt eine große Ecke vom Käse ab.
Wenn er dagegen zur Fähre ritt – weil er sie gar nicht verfolgte ... Aber sie konnte keine Gesellschaft gebrauchen. Und erst recht musste sie unauffällig bleiben. Ein Dampfwagen und ein Pferd in Gemeinschaft wären alles andere als das.
Sie füllte den Brenner des Renaults nach und kurbelte den Motor wieder an. Es war mühsam mit der linken Hand, aber die langen Kratzer am rechten Arm taten fast mehr weh als am Abend zuvor. Natürlich hatte sie in Craintilleux kein Laudanum bekommen; der nächste Apotheker wohnte in Feurs. Ein Apotheker und ein Dampfmagier in einer Kleinstadt von ein paar tausend Einwohnern – wie mochten die miteinander auskommen? Am Ende waren sie sogar miteinander verwandt. Grinsend fuhr sie weiter.
Bald erwies es sich als Fehler, das Verdeck geöffnet zu haben. Zwar vertrieb die beständige Brise die Hitze, aber hier, jenseits des Waldes, brachte sie auch den Gestank von Schwefel mit sich. Ein eklig-saurer Geschmack brannte auf ihrer Zunge. Fähre oder Brücke – Maurice würde ihr nicht lange folgen können mit seinem schönen Pferd.
Sie hielt wieder, schloss das Verdeck und leerte eine halbe Flasche Wein, um den Schwefel aus dem Mund zu spülen. Quantenmagie mochte ja risikoreich sein, aber gesünder war sie allemal. Wenn sie funktionierte, wie sie sollte. Und das würde sie, wenn man sie erst besser begriff.
Dampfmagie war auch nicht ohne Gefahren: Gingen nicht unzählige Schiffe unter, weil die Kessel explodierten? Verbrühten sich nicht Menschen immer wieder an dem heißen Dampf und wurden bis zur Unkenntlichkeit entstellt? Über ihre Schulter warf sie einen nervösen Blick zum Brenner des Dampfwagens.
Als sie die Berge weiter hinter sich ließ, wurde der gelbliche Nebel um sie herum dichter. Rechts und links der Straße erstreckten sich Anlagen mit hohen, qualmenden Schornsteinen. Selbst in den Seidenfabriken aus Colberts Zeit arbeitete man heutzutage mit Dampfmaschinen, um möglichst viel zu produzieren. Und wofür das viele Geld? Damit Preußen noch mehr Schiffe baute und kurz vor der Eroberung des gesamten Mittelmeers stand. Wie konnten die hugenottischen Camisards das gutheißen?
Céline wickelte sich den Schal über Mund und Nase, den sie am Morgen in weiser Voraussicht aus dem Koffer genommen hatte. Es nützte freilich nur wenig und sie begann bald zu husten. Ohne ihre Schutzbrille hätte sie kaum noch gucken können; auch so brannten ihre Augen schon. Mehr und mehr kämpfte sie gegen den Reflex zu blinzeln. Wie gedachte »Monsieur« hier zu reisen? Das hielt doch kein Pferd lange aus.
Plötzlich wurde ihr bewusst, dass sie schon eine ganze Weile keine Vögel mehr gehört hatte. Sie fuhr durch ein totes Land.
Céline hieb mit der Faust aufs Lenkrad: Es wurde Zeit, das zu ändern.
Zwei Stunden später erreichte sie unweit der Saône das Dorf Ambérieux. Hier war die Luft wieder besser: Vom Mittelmeer fegte ein ungewöhnlich heißer Mistral den Fluss hoch und trug den Dreck weiter nach Norden. Und er brachte so viel heiße Luft mit sich, dass ihr das Kleid bald schweißgetränkt am Rücken festklebte.
Sie hielt für ein kurzes Abendessen in einem Gasthaus mit schwefelzerfressener Fassade. Vom Wirt erfuhr sie, dass in den Rathäusern Atemschutzmasken zur Verfügung gestellt wurden; als Fremde müsste sie allerdings eine kaufen. Während sie aß, ließ sie den Wirt das Holz im Anhänger auffüllen. Das passierte ihr nicht noch einmal, dass sie mangels Brennstoff irgendwo stehen blieb.
Als sie das Wirtshaus verließ, klang Hufschlag vom Dorfeingang. Es gab also doch noch Tiere hier.
Sie füllte den Brenner nach und kurbelte den Motor an; mit einem satten Geräusch stieß er eine dunkle Rauchwolke aus. Die Mundwinkel zornig zusammengepresst, verfolgte sie deren Weg, als sie sich bis zur Wiese auf der anderen Seite der Straße ausbreitete.
Der Hufschlag kam näher. Armes Pferd! Auch sie trug mit dem Renault zu dem Dreck bei, den sie alle einatmeten. Sie wandte sich dem Reiter zu.
Und schnappte überrascht nach Luft: Maurice.
Eine unerklärliche Freude breitete sich in ihr aus. »So ein Zufall!« Sie stemmte die linke Faust in die Hüfte und lachte ihm entgegen.
Er schwang ein Bein über den Pferdehals und sprang ab. »Wieso Zufall? Hatte ich mich nicht als Reisebegleitung angeboten, da wir den gleichen Weg haben?«
Er hatte rotgeränderte Augen und sein Pferd atmete keuchend. Sie deutete auf das Tier. »Wie könnt Ihr Esprit diesem Dreck aussetzen?«
Er seufzte. »Habe ich eine Wahl?«
»Vermutlich nicht.«
»Es war nur ein kurzes Stück des Wegs wirklich schlimm.« Er wischte sich mit dem Ärmel über die Augen, deutlich darauf bedacht, die Entzündung nicht durch Reiben schlimmer zu machen.
»Ich habe erfahren, dass man in den Rathäusern Atemschutzmasken kaufen kann. Aber ich nehme an, nur für Menschen.«
Er betrachtete Esprit. »Das denke ich mir.«
Sie hob die Hand und wedelte ihm einen Gruß zu; dann stieg sie in ihr Auto. Sie hatte es schon viel zu lange nutzlos vor sich hin tuckern lassen. »Das Essen ist gut hier!«
Als sie dann die Anlegestelle vor sich sah, stand der blutrote Ball der untergehenden Sonne im Rückspiegel ihres Renaults. Die Saône schwappte schwarz und bedrohlich vor ihr ans Ufer. Die Fähre war ein Stück aufs Land gezogen, als rechne der Schiffer mit einer plötzlichen Flut in der Nacht. Für diesen Tag gab es keine Überfahrt mehr und sie brauchte einen Platz zum Schlafen.
Verfolgt oder nicht: Sie lenkte den Renault auf die Straße nach Villefranche und suchte nach einem Wirtshaus, in dem sie übernachten konnte.
***
Maurice blickte Céline hinterher, bis das Auto hinter der nächsten Biegung verschwunden war. Also hatte er richtig geraten: Sie wollte mit der Fähre übersetzen, weil sie annahm, dass jeder Verfolger damit rechnete, dass sie die Brücke benutzte.
Er nahm die Zügel kürzer und führte Esprit an den Trog neben dem Wirtshaus. Das Pferd soff und soff und er pumpte den Trog noch zwei Mal voll. Schließlich atmete Esprit wieder einigermaßen normal. Céline hatte zweifellos recht: Wenn er ihn nicht umbringen wollte, durfte er ihn nicht mehr lange dieser Dreckluft aussetzen. Er würde ihn in den Wäldern auf der anderen Seite der Saône zurücklassen, wo die Luft hoffentlich wieder ähnlich sauber war wie in der Auvergne.
Und dann? Er blickte noch einmal die Straße hinunter. Morgen würde er Céline wiederfinden, gleich, ob sie noch mit der Fähre übersetzen konnte oder gezwungen würde, die Brücke zu benutzen. Sie hatte Mitleid mit Esprit. Wie lange würde es dauern, bis sie ihm vorschlug, das Pferd zurückzulassen und die Reise mit ihr fortzusetzen?
Eine dunkelhaarige Schönheit mit grünen Augen und einem aufreizenden Lächeln begrüßte ihn, als er die Schankstube betrat. Heute Nacht würde Céline ihm seine Bettgefährtin nicht verschrecken.
Als ihm die junge Frau Wein, Brot und einen Teller Kohlsuppe brachte, blieb sie so dicht vor ihm stehen, dass ihm ihr Duft in die Nase stieg. Lavendel, vermischt mit Küchengeruch. Und mit dem Geruch nach Frau und Sex.
Maurice schüttelte sich unwillkürlich: Hatte sie sich nicht gewaschen nach dem letzten Gast? Der Gedanke brachte die Erinnerung an Célines zitronenfrischen Duft, den Schwefel und Qualm nicht gänzlich überdeckt hatten. Plötzlich war ihm der Gedanke zuwider, die Dunkelhaarige mit sich aufs Zimmer zu nehmen.
Genau genommen behagte ihm nicht einmal der Gedanke, hier zu übernachten. Er sollte den Abstand zu Céline nicht zu groß werden lassen. Nachdem er gegessen hatte, trank er sein Glas leer, stand auf und warf einen Franc auf den Tisch.
Esprit schnaubte unwillig, als er ihn wieder sattelte, und stieß ihm sein Maul ins Gesicht.
»Was hältst du von einer grünen Wiese heute Nacht, mein Bester?«
Der Mistral war noch stärker geworden und hatte auch die Regenwolken vertrieben. Nachdem die Sonne untergegangen war, hatte Maurice einen sternenklaren Himmel über sich. So konnte er Esprit ohne Bedenken laufen lassen.
Als dann der Mond aufging, spiegelte er sich in der Saône und ein kurzes Stück voraus stand das Fährhaus in seinem Schein.
Hinter dem Fährhaus summte leise ein Quantengenerator und sorgte für Licht und vielleicht noch mehr. Maurice stieg ab und klopfte sacht an das erleuchtete Fenster.
Die Tür ging auf und ein knorriger Mann mit halblangen grauen Haaren streckte seinen Kopf heraus. »Was wollt Ihr, Monsieur?« Der rüde Ton war eindeutig: An diesem Abend bekam er keine Überfahrt mehr.
Maurice nahm die Zügel länger und ging auf ihn zu. »Mir ist klar, dass Ihr nicht in der Dunkelheit fahrt. Ein verantwortungsvoller Schiffer setzt das Leben seiner Passagiere nicht aufs Spiel.«
Der Mann verzog seine Lippen zu etwas Ähnlichem wie einem Lächeln. »Was also, Monsieur?«
»Eine Auskunft bitte.«
Die Miene des Fährmanns verfinsterte sich -- bis Maurice ihm eine Semeuse zuwarf. Gottseidank hatte ihn der Geheime Rath mit ausreichend Geld versorgt.
»Habt Ihr heute Abend eine junge Frau in einem Dampfwagen hinübergebracht?«
»Warum wollt Ihr das wissen, Monsieur?«
Maurice seufzte. »Weil wir uns am Treffpunkt verpasst haben. Ich dachte, mein Pferd wäre schneller, aber in dieser Dreckluft ...« Er breitete die Arme aus. »Und nun weiß ich nicht, ob Céline die Brücke genommen oder hier den Weg abgekürzt hat.«
»Die Demoiselle hat gewiss die Brücke genommen. Meine Fähre ist für Dampfwagen ... nicht geeignet.«
Das war Unfug, was der Mann da sagte. Die Dampfwagen waren auch nicht schwerer – oder länger – als ein voll beladenes Ochsengespann. Dieser Unsinn und der summende Generator hinter dem Haus – der Schiffer war ein Gegner der Dampfmagier. Sympathischer Mann.
Der Weg über die Fähre war der kürzere. Egal, wie weit Céline noch gefahren war an diesem Abend; er würde sie in Villefranche abfangen. Maurice rieb sich das Kinn, als dächte er nach. »Könnt Ihr mir raten, wo ich heute die Nacht verbringen kann?«
»Ich habe eine Kammer. Ihr seid nicht der erste späte Reisende.« Er öffnete die Tür ganz. »Es ist für alle von Vorteil.«
Natürlich; wer hier übernachten konnte, machte sich nicht auf den Weg zur Brücke und der Fährmann behielt sein Geschäft. Maurice sattelte Esprit ab und band ihn mit einem langen Strick an einen Holm neben der Haustür, sodass er genug Bewegungsfreiheit zum Grasen hatte.
Der Quantengenerator sorgte nicht nur für Licht, sondern heizte das Fährhaus auch besser – und vor allem bequemer –, als ein Kamin es konnte. Auch der Kochherd kam ohne Holz aus, denn es stand weder eine Kiste daneben noch hatte er einen Schornstein.
»Ihr seid ein sehr achtsamer Mann, Monsieur.« Maurice nickte anerkennend. »Nicht mehr Dreck als unbedingt nötig.«
Der Fährmann seufzte. »Es ist viel zu wenig, was ich als Einzelner tun kann.«
»Aber viele Einzelne so wie Ihr ... Das würde sehr wohl helfen.«
»Habt Ihr gegessen, Monsieur?« Ohne seine Antwort abzuwarten, legte der Fährmann Brot und eine Ecke Käse auf den Tisch.
So viel Gastfreundlichkeit einem Wildfremden gegenüber war ein wenig verwunderlich. Gäbe es nicht den Quantengenerator hinter dem Haus, würde er es verdächtig finden. So durfte er wohl davon ausgehen, dass er den Fährmann für sich eingenommen hatte.
Maurice setzte sich an den Tisch und zog sein Messer aus dem Gürtel, um ein Stück vom Brot abzuschneiden. Derweilen stellte der Fährmann zwei Holzbecher hin und holte einen Krug Weißwein aus einem Nebengelass.
Maurice schenkte sich ein. »Wie heißt Ihr, mein Freund?«
»Bernard. Ich habe die Fähre von meinem Vater übernommen.«
»Dann habt Ihr immer hier gelebt?«
Es wurde ein entspanntes Gespräch, in dessen Verlauf sie nach diesem Krug noch einen zweiten leerten, bevor Bernard ihm seinen Schlafplatz zeigte. Von der Küche führte eine Treppe nach oben zu den Schlafräumen.
Es war kalt in der ungeheizten Kammer. Trotzdem öffnete Maurice das Fenster und ließ sich dann vom Plätschern der Saône und dem leisen Summen des Generators in den Schlaf singen.
5
Esprit weckte Maurice mit aufgeregtem Wiehern. Gleich darauf klopfte es heftig an die Haustür und er stürzte ans Fenster.
Es war noch nicht ganz hell, aber Bernard kam nur Augenblicke später fertig angezogen aus dem Haus. Draußen standen ein Mann und eine Frau und ein Ochsengespann rumpelte gerade auf die Fähre.
Maurice fluchte und stieg eilig in seine Stiefel. Wenn sie ohne ihn ablegten, würde er ewig auf Bernards Rückkehr warten müssen.
Er lehnte sich aus dem Fenster. »Bernard!«
Der Fährmann sah zu ihm hoch und winkte. »Keine Eile, Monsieur.«
Er zog sich trotzdem in Windeseile fertig an und rannte nach draußen, um Esprit zu satteln. Bernard mochte ja bereit sein, auf ihn zu warten, aber wenn seine Passagiere ihn drängten ...
Als er Esprit das Zaumzeug überzog, kam Bernard mit seinen Passagieren vom Anleger hoch und sie gingen in die Hütte. Maurice folgte ihnen.
Das Paar mochte Vater und Tochter sein. Sie hatte sich auf einen der Stühle gesetzt und er stand hinter ihr, als wolle er sie beschützen. Vor dem jungen Bauern vielleicht, der kaum den Blick von ihr abwenden konnte. Dabei war sie keine große Schönheit: ein rundes Gesicht mit zu groß geratener Nase, stumpfes braunes Haar. Aber wie ihr Begleiter war sie teuer gekleidet: feine Wollstoffe, Spitzenaufschläge an den Ärmeln, blank polierte Messingschließen an den Schuhen.
Sie hatte einen neugierigen Blick für Maurice, dann nahm sie Bernard den Kaffee ab, den er ihr entgegenhielt.
Maurice holte sich eine Tasse aus dem Regal. »Serviert Ihr Euren Reisegästen immer Frühstück?«
»Nur, wenn ich selber noch keinen Kaffee hatte.« Bernard grinste fröhlich. »Auf diese Weise behalten sie die Geduld.«
Der Mann lachte. »Als ob wir eine Wahl hätten.«
»Wie lange dauert die Überfahrt?« Die Frau sah ein bisschen furchtsam aus.
»Du kannst doch schwimmen, Kind.«
Sie sah noch furchtsamer aus als zuvor. Der Mann war entweder ungeschickt oder ungezogen. »Gibt es ... viele Unfälle, Herr Fährmann?«
»Das Wetter ist gut.« Bernard furchte die Stirn und trank seinen Kaffee. »Jedenfalls, so weit man das Wetter überhaupt sehen kann. Und wir haben kein Hochwasser.« Als ob er dann ablegen würde.
Maurice lächelte sie an. »Ihr seht, Mademoiselle, Ihr braucht Euch nicht zu fürchten.«
»Madame, bitte.« Sie klang genervt.
Überrascht sah Maurice zu dem Mann hinter ihr.
»Meine Schwägerin, Madame Cavour.« Schwägerin? Er mochte es nicht recht glauben; die beiden wirkten so vertraut miteinander. Aber was ging es ihn an!
Der Mann streckte ihm seine Hand über dem Tisch entgegen. »Ich bin Gaspard de Loireaux, Comte de Redon. Ich hoffe, mein Titel stört Euch nicht, Monsieur.«
Maurice zuckte die Achseln. Nach der Überfahrt würde er die beiden gewiss nie wieder sehen.
Esprit wieherte.
»Mir scheint, Ihr bekommt noch mehr Fahrgäste heute morgen.«
Bernard nickte. »Die erste Fahrt am Tag. Und in Mâcon beginnt heute die Messe.«
Maurice unterdrückte einen Fluch. Er hatte darauf gezählt, Céline jenseits der Saône wiederzufinden, indem er parallel zu ihr nach Villefranche ritt. Sie musste ja den Weg über die Brücke einschlagen, da sie die Fähre nicht genommen hatte. Aber falls sie wegen der Messe in keinem der Wirtshäuser unterwegs einen Platz gefunden hatte, war sie am Ende schon am Abend über Villefranche hinaus gereist, Er hätte ihr direkt folgen und wie am Vorabend im gleichen Wirtshaus wie sie übernachten sollen.
Esprit wieherte noch einmal und dieses Mal antwortete ein anderes Pferd.
»Wie viel Platz habt Ihr eigentlich auf Eurer Fähre, Bernard?«
»Keine Sorge, Monsieur. Wer zuerst da war, setzt zuerst über.« Da würde der Fährmann sicher so manches Mal Ärger in Kauf nehmen müssen, wenn er sich nicht bestechen oder von einem Rang beeindrucken ließ. Der Mann wurde ihm immer sympathischer.
Der neue Fahrgast war ein Kaiserlicher Kurier. So viel zu »Wer zuerst da war ...«; dem müsste sich der Fährmann beugen. Aber der Mann schien ein anderes Ansinnen zu haben. »Wen habt Ihr gestern übergesetzt, Bernard?«
Bernard kratzte sich über die Bartstoppeln und blickte mit einem merkwürdigen Ausdruck in den Augen zu Maurice, bevor er antwortete. Dachte er daran, dass er ihn gestern nach Céline gefragt hatte? »Lasst sehen!« Bernard begann, seine Passagiere an den Fingern abzuzählen. »Da war zuerst Aline, die zu ihrer Tante in Parcieux wollte. Dann ...« Er zählte drei Dutzend Leute auf. Erstaunlich angesichts der doch recht nahen Brücke, dass so viele noch immer die Fähre benutzten. Vermutlich war die Fähre billiger als der Brückenzoll; und obendrein steckten den die Preußen ein.
»Ist das normal, dass die Reisenden kontrolliert werden?«, fragte Maurice den Kurier.
»Mittlerweile ...« Er zuckte die Achseln. »Die Zeiten ändern sich.«
»Und wieso ist das Eure Aufgabe und nicht die der Gendarmerie?«
»Ihr stellt zu viele Fragen. Wer seid Ihr?«
Maurice griff in die Jackentasche und zog seinen Pass hervor. War der Mann hinter Céline her oder nicht? Plötzlich sah er sich in der Situation, sie decken zu müssen. Wenn die Kaiserlichen sie festnahmen, würde er nicht erfahren, wohin sie gewollt hatte. Geschweige denn, wer ihr Kontakt war. Die Geheimpolizei gab nicht preis, was sie von ihren Gefangenen erfuhr.
Der Kurier sah seinen Pass so beiläufig an, als betrachte er die Kontrolle als Formsache. Genauso verfuhr er dann mit den Pässen des Bauern und des Comtes. Aber für das Dokument der Madame Cavour nahm er sich ausnehmend viel Zeit. Er suchte also nach einer Frau. Als er den Pass gegen das Fenster ins Licht hielt, war klar, dass er dessen Echtheit in Zweifel zog. Madame Cavour warf ihrem Begleiter einen besorgten Blick zu. Umso besser; wenn sie verdächtig war, würde sie den Kaiserlichen eine Weile aufhalten.
»Es ist hell, Bernard. Können wir aufbrechen?« Maurice wandte sich zur Tür. »Ich bringe Esprit auf die Fähre.«
Als er dort stand, kamen Bernard und der Bauer zum Anleger.