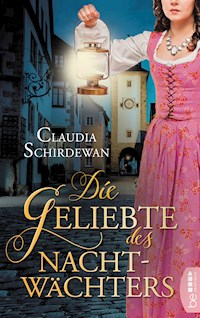4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Historische Küsten-Romane von Claudia Schirdewan
- Sprache: Deutsch
Samland im Jahr 1235: Mila lebt mit ihrer Familie an der Bernsteinküste nahe Königsberg. Ihre Mutter, eine Verfechterin des alten Glaubens, ist als Heilkundige hoch angesehen. Doch eines Tages wird ihr Dorf von Rittern des Deutschen Ordens überfallen. Sie zwingen die Bewohner, Christen zu werden - notfalls mit Gewalt. Bei dem Versuch zu fliehen, sterben Milas Schwester und ihr Vater. In letzter Sekunde rettet der Ritter Johan jedoch Milas Leben und auch ihre Mutter kann den Angreifern entkommen ... Während ihre Mutter auf Rache sinnt, fühlt Mila sich zunehmend zu Johan hingezogen und kämpft für ein Leben ohne Hass und Krieg - und der kostbare Bernstein ihrer Heimat soll ihr helfen, diesen Traum zu verwirklichen!
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 517
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Cover
Grußwort des Verlags
Über dieses Buch
Titel
Prolog
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Epilog
Nachwort
Über die Autorin
Weitere Titel der Autorin
Impressum
Leseprobe
Liebe Leserin, lieber Leser,
herzlichen Dank, dass du dich für ein Buch von beHEARTBEAT entschieden hast. Die Bücher in unserem Programm haben wir mit viel Liebe ausgewählt und mit Leidenschaft lektoriert. Denn wir möchten, dass du bei jedem beHEARTBEAT-Buch dieses unbeschreibliche Herzklopfen verspürst.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beHEARTBEAT-Community werden möchtest und deine Liebe fürs Lesen mit uns und anderen Leserinnen und Lesern teilst. Du findest uns unter be-heartbeat.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich für unseren kostenlosen Newsletter an:be-heartbeat.de/newsletter
Viel Freude beim Lesen und Verlieben!
Dein beHEARTBEAT-Team
Über dieses Buch
Samland im Jahr 1235: Mila lebt mit ihrer Familie an der Bernsteinküste nahe Königsberg. Ihre Mutter, eine Verfechterin des alten Glaubens, ist als Heilkundige hoch angesehen. Doch eines Tages wird ihr Dorf von Rittern des Deutschen Ordens überfallen. Sie zwingen die Bewohner, Christen zu werden – notfalls mit Gewalt. Bei dem Versuch zu fliehen, sterben Milas Schwester und ihr Vater. In letzter Sekunde rettet der Ritter Johan jedoch Milas Leben und auch ihre Mutter kann den Angreifern entkommen ... Während ihre Mutter auf Rache sinnt, fühlt Mila sich zunehmend zu Johan hingezogen und kämpft für ein Leben ohne Hass und Krieg – und der kostbare Bernstein ihrer Heimat soll ihr helfen, diesen Traum zu verwirklichen!
Historischer Roman
Prolog
Venedig, Herbst 1232
Der Sturm tobte seit Stunden durch die Kanäle. Unbarmherzig rüttelte er an den Fensterläden, als wollte er jedes Haus auseinanderreißen, in jede Luke eindringen. Dem Priester schauderte, als er in den wolkenverhangenen Himmel hochsah. War es über der Lagune je so finster gewesen? Was, wenn der Herrgott ihm tatsächlich zürnte? Wenn die Brüder recht hatten und er all die Jahre unter dem Bann des Satans gestanden hatte?
Sein Blick wanderte zum Tisch. Da saßen die beiden. Sie hatten nichts Böses an sich, im Gegenteil. Ein Geschenk Gottes waren sie, und wenn der Sturm, der durch die Gassen wütete, irgendetwas zu bedeuten hatte, dann war er ein Zeichen, dass seine Brüder beim Herrn in Ungnade gefallen waren – nicht er. Er zog die dünnen Lederfetzen wieder vor die Fensteröffnung und hielt dabei die Luft an. Doch der Gestank schien sogar durch die Ritzen des Mauerwerks zu ziehen. Es waren die Ausdünstungen von Angst, Krankheit und Elend, die in diesem Viertel allgegenwärtig waren und an die er sich dennoch nicht gewöhnen konnte. Der Priester runzelte die Stirn und bemerkte gar nicht, dass seine Finger das Kreuz, das an einer Schnur um seinen Hals baumelte, umfassten.
Ein Hämmern an der Tür riss ihn aus seinen Gedanken. Laute Stimmen drangen an seine Ohren, in denen es auf einmal rauschte. Er hörte den Triumph in ihren Worten. Es war so weit! Auch der ungestüme Wind, ob vom Herrn gesandt oder nicht, hatte sie nicht aufhalten können. Mit zitternden Fingern bedeutete er der Frau und dem jungen Mann, die ihn flehentlich ansahen, still zu sein.
»Leise! Bitte!«, flüsterte er.
»Mach auf!«, tönte es von draußen. Die Tür schien bereits nachgeben zu wollen, schwankte in ihrem Rahmen wie eine Gondel auf dem Kanal. »Wir wissen, dass sie bei dir sind.«
Kurz schloss er die Augen. Seine Knie wurden schwach. Mühsam setzte er einen Fuß vor den anderen. Er musste öffnen. Sie würden nicht zögern, die Tür einzutreten!
»Mach auf!«, erscholl es erneut.
Er warf Maria einen Blick zu. Sie stand dicht an die Wand gepresst, als hoffte sie sehnlichst, dass das Mauerwerk sich auftun und sie verschlingen würde. Ihre Brust hob und senkte sich so schnell, als wollte ihr das Herz aus dem Leib springen. Sie umklammerte die rechte Hand des Jungen, der neben ihr stand und ihr über die schwarzen Locken strich, in denen sich einige graue Strähnen zeigten. Er raunte seiner Mutter einige tröstende Worte zu, und der Priester lauschte beinahe erstaunt. Wann war Lorenzos Stimme so tief geworden? Seit wann überragte er Maria um Haupteslänge? Für ihn war der Siebzehnjährige immer noch das Kind, das barfuß durch die Gassen tollte. Sein Sohn, den er so gern noch begleitet hätte. Sollte dies das letzte Mal sein, dass er den Blick der braunen Augen auffing, die den seinen so sehr glichen?
Hätte er sie nur aus der Stadt geschafft! Aber Maria hatte sich geweigert, wieder und wieder. Und er hatte in seiner Eitelkeit geglaubt, an diesem Ort wären sie sicher. Wer sollte sie hier finden, in den hintersten Winkeln der Stadt, wo der Mief der Kanäle den Menschen die Sinne vernebelte und sich Gauner und Dirnen herumtrieben?
»Gott unser Herr und Hirte wird euch beschützen!«, sagte der Priester leise und hoffte, dass sie die Zweifel in seiner Stimme nicht hörten. Dann bekreuzigte er sich, löste den Riegel und öffnete die Tür.
Schwere Stiefel stampften über den Boden, schwarze Mäntel verdunkelten den Raum. Nur die Kruzifixe, die sie alle um den Hals trugen, reflektierten einen Rest des Tageslichts.
»Da ist sie! Mit dem Jungen!«
Giorgio. Der Priester hätte die dunkle Stimme des Wortführers überall erkannt. In seinen jungen Jahren hatte er selbst an seinen Lippen gehangen, Giorgios Predigten gebannt gelauscht und sich gewünscht, er wäre wie er. Bedeutend, ein großer Kämpfer für die göttliche Botschaft.
Er stieß einen Schrei aus und stürmte vorwärts, doch ein ausgestrecktes Bein brachte ihn sofort zu Fall. Er sank auf die Knie. Spürte Tritte in seinem Rücken. Sah, wie sie Maria von Lorenzo wegzerrten. Jemand hieb mit einem Stock auf den Jungen ein, der wütend aufheulte. Er beobachtete, wie Lorenzos Hemd zerfetzt wurde. Wie das weiße Leinen sich rot färbte. Dann waren sie fort.
Zwei Männer griffen ihn unter den Achseln und zogen ihn hoch. Giorgio wartete neben der Fensterluke auf ihn und riss den ledernen Vorhang herab. Sie drückten seinen Kopf durch die Luke. Ein eiserner Griff in seinem Nacken. Ihm schwindelte. Was sollte das? Was wollten sie ihm zeigen? Wo waren Maria und Lorenzo?
Giorgio beugte sich zu seinem Ohr. Er legte ihm die Hand auf die Schulter. Beinahe, als wären sie alte Freunde. Etwas Saures stieg in seinem Hals hoch, doch er schluckte es herunter.
»Mein lieber Bruder«, hörte er Giorgios Stimme wie von weit her, »es tut mir leid für deine Seele, dass du diesen Irrweg gegangen bist. Doch lobe den Tag, denn der Herr gewährt dir durch mich die Umkehr.«
Der Priester starrte aus der Fensterluke. Maria und Lorenzo stolperten, bedrängt von den Männern, die steinernen Stufen auf die Gasse hinunter. Leute eilten herbei, Rufe wurden laut. Für einen Moment keimte Hoffnung in ihm auf. Das waren Nachbarn, die er kannte. Leute, mit denen er manchmal geplaudert und denen Maria häufig einen Kanten Brot zugesteckt hatte. Freunde! Gewiss würden sie helfen.
Doch dann wurde der erste Stein geworfen. Er traf Marias Rippen, und sie gab ein Heulen von sich. Der Priester versuchte verzweifelt, sich zu befreien. Einer der Männer versetzte ihm einen Tritt in die Kniekehle, und er brüllte auf.
»Lasst sie! Lasst meine Frau in Ruhe!«
Doch die Menge war in Aufruhr. Nun trafen die Steine auch Lorenzo, und die Rufe wurden lauter und lauter.
»Sünder! Aus der Stadt mit ihnen!«
»Verschwindet! Teufelsbrut!«
Es wollte ihm das Herz zerreißen. Wieso ließen die Leute, die er für Freunde gehalten hatte, zu, dass Maria und Lorenzo wie Verbrecher durch die Gasse getrieben wurden? Mehr noch, sie selbst hetzten die beiden vor sich her. Wie Vieh!
Giorgio riss ihn zurück.
»Und nun zu dir!«
Er bedeutete zwei Männern, den Priester festzuhalten, und baute sich mit vor der Brust verschränkten Armen vor ihm auf.
»Was passiert mit ihnen?« Die Stimme des Priesters drohte zu brechen. »Was macht ihr mit meiner Frau, mit meinem Sohn?«
»Sie werden außer Landes geschickt«, entgegnete Giorgio mit hochgezogenen Brauen. Er bemühte sich offenkundig um einen mitleidigen Gesichtsausdruck, doch der Spott in seinen Augen entging dem Priester nicht, als er flüsternd antwortete: »Möge der Herr ihnen vergeben. Wie auch dir.«
»Du, mein Bruder, wirst einen anderen Weg einschlagen«, verkündete Giorgio mit einer salbungsvollen Stimme, die erneut Übelkeit in dem Priester aufsteigen ließ. Er schluckte die Galle herunter. Er würde Giorgio nicht die Genugtuung verschaffen, vor ihm die Fassung zu verlieren.
»Wir geben dich in gute Obhut, auf dass du zurück zum Herrn und deiner Tugend findest.«
Dem Priester wurde wieder schwindlig. Er ahnte, was Giorgio mit ihm vorhatte. Die Angst legte sich wie ein Gürtel aus Eis um sein Herz.
Giorgio bekreuzigte sich. Eine nachlässige Geste, jedoch eine, die das Schicksal einer Familie besiegelte.
1.
An der Ostsee, Ende September 1235
Mila fiel neben ihrer Mutter auf die Knie in den weißen Sand, der von der Mittagssonne angenehm warm war. Nur die Algen und Holzstückchen, die allenthalben herumlagen, verrieten noch, dass in der letzten Nacht ein Unwetter über die Küste getobt war. Stunde um Stunde hatte die Familie in ihrer Hütte ausgeharrt und dem Heulen des Windes, dem Donner und dem Prasseln des nicht enden wollenden Regens gelauscht. Sie konnten von Glück sagen, dass das Dach standgehalten hatte.
Sanjas Finger fuhren andächtig durch den Sand, der an der Oberfläche schon wieder getrocknet war. In feinen Rinnsalen ließ sie die Körner durch ihre Finger gleiten. Sie stand auf, klopfte ihren Rock sauber und breitete lächelnd die Arme aus.
»Antrimpus war uns gnädig«, pries sie den Meeresgott, und die siebzehnjährige Mila nickte zustimmend.
»Komm, meine Tochter. Wir schauen, was wir finden. Nach dem Sturm von gestern müsste die Ausbeute gut sein.«
Sanja raffte ihren Rock, griff nach dem grob geflochtenen Weidenkorb und eilte barfuß in Richtung Wasser. Mila warf noch einen Blick zurück. Oberhalb der weißen Felsen, die steil zum Wasser abfielen, konnte sie zwischen den Birken einige Hütten ausmachen. Traurig bemerkte sie, dass mehrere Bäume gegen den Wind nicht hatten bestehen können. Die weißen Stämme lagen da wie gefallene Soldaten.
»Komm, Mila!«
Das Mädchen seufzte. Sanja würde sie heute noch mehr als sonst zur Eile antreiben. In den letzten Wochen waren ihre Funde nur spärlich gewesen, und spätestens in ein paar Stunden würde die halbe Siedlung auf dem Weg zum Strand sein, um es ihnen gleichzutun.
»Beeil dich endlich!«, rief Sanja. »Noch sind wir allein!«
Mila folgte ihr und staunte einmal mehr, wie jung ihre Mutter trotz ihrer achtunddreißig Sommer wirkte, wenn sie reichlich Meeresgold zu entdecken hoffte. Auch Mila hielt die blauen Augen auf den Boden gerichtet. Von Kindesbeinen an begleitete sie die Mutter regelmäßig zum Strand und half ihr bei der Suche nach dem honigbraunen Stein. Geduld brauchte man. Nur den Gelassenen offenbart Antrimpus seine Schätze, betonte Sanja stets, und Mila fiel es meist leicht, geduldig zu sein. Es gab für sie nichts Wertvolleres als diese Stunden am Strand. Die See, deren Wellen mit dem immer gleichen Geräusch auf den Sand schlugen. Die Sonne, deren Strahlen sich im weißen Sand beinahe zu spiegeln schienen. Möwen, die hoch über ihnen ihre Kreise zogen und kreischend von ihren Abenteuern erzählten.
Was konnte es Schöneres geben? Vor allem, wenn man daran dachte, was die Menschen im Dorf sich erzählten. Wenn es stimmte, drohte ihrem Volk, den Samländern, Unheil und ... ... nein. Mila zwang sich, nicht daran zu denken. Die Götter würden auf ihren Stamm achtgeben, wie sie es seit jeher für alle Prussen getan hatten. Was hatte ihre Familie schon mit den Wandlungen der Welt zu schaffen? Das alles war unendlich weit weg.
Sie strich sich eine dunkelblonde Locke aus dem Gesicht und sah sich nach ihrer Mutter um. Sanja watete nun durch das flache Wasser und zog ein Netz hinter sich her. Immer wieder blieb sie stehen, um zu prüfen, was sich darin gesammelt hatte. Ihre Stirn war vor Konzentration gerunzelt, und Mila wagte nicht zu fragen, ob sie schon etwas gefunden hatte.
Wenn Sanja nach Bernstein suchte, schien sie der Welt entrückt zu sein. Mila wusste, dass sie in Gedanken Kontakt mit den Göttern aufnahm und sie bat, die Gaben der Natur freizugeben. Als sie noch ein kleines Mädchen war, hatte sie sich so manche Ohrfeige eingefangen, wenn sie in diesen Momenten um die Mutter herumgetollt war oder an ihrem Rockzipfel gezogen hatte. Und doch hatte Sanja sie fast immer mitgenommen, denn Mila besaß ein ebenso gutes Auge für den Bernstein wie sie selbst.
Mila ging ein paar Schritte weit ins Wasser, bis die Wellen ihre nackten Zehen umspülten. Dann zog sie den wollenen Rock über die Knie hoch, ging in die Hocke und versenkte ihre Hände im Schlick. Sie schloss die Augen und verließ sich allein auf ihren Tastsinn. Spürte Holz, das vom Spiel des Meeres nass und glitschig war. Algen, die sich um ihre Finger winden wollten. Da! Ein Stein. Sie öffnete die Augen. Nein, dieser war grau. Den konnte sie nicht gebrauchen. Mit einem Seufzen ließ sie den Kiesel zurück ins Wasser fallen.
»Hast du schon etwas?« Sanja klang ungeduldig.
»Leider nicht.« Mila legte eine Hand an die Stirn, um ihre Augen vor der Sonne zu schützen, während sie ihre Mutter beobachtete, die kopfschüttelnd auf ihren Korb deutete.
»Ich habe schon zwei. Gib dir mehr Mühe! Ich will nicht den ganzen Tag hier verbringen.«
»Ja, Mutter.«
»Geh ein Stück weiter ins Wasser. Da vorn habe ich doch längst gesucht.«
Sanja machte eine Handbewegung, als würde sie Hühner in den Verschlag scheuchen. Mila gehorchte. Sie wollte Sanja nicht verärgern, sonst würde es bald Ohrfeigen hageln. Wenn Mutter wütete, ging ihr selbst der Vater aus dem Weg. Mila fuhr sich mit den Händen durch das Gesicht. Der feuchte Sand, der noch an ihren Fingern klebte, scheuerte über ihre Haut und hinterließ dort eine Spur. Das Meer glitzerte in der Sonne, und obwohl es aussah, als leuchteten tausend Perlen auf den Wellen, schmerzte diese Schönheit in ihren Augen. Wieder versenkte sie ihre Finger im Schlick, ließ die feuchte Erde durch die Hände gleiten, bis sie endlich etwas Hartes ertastete. Vorsichtig hob sie ihren Fund auf. Der Stein war daumengroß, das Meer hatte seine Kanten glattgeschliffen. Besser, als jeder Handwerker es vermocht hätte. Von hellbraun bis abendsonnenrot gefärbt, schien er die Sonnenstrahlen förmlich anzuziehen, damit sie ihn zum Leuchten brachten.
Mila hielt für einen Moment die Luft an. Sie liebte Bernstein ohnehin, aber dieser war ein auffallend schönes Exemplar. Vorsichtig strich sie mit den Fingerkuppen über die Ränder des Steins. Es war, als würde er ihre Haut liebkosen. Wann hatte sie zuletzt so einen Stein gesehen? Er war perfekt. Zierrat sollte man aus ihm machen, dachte Mila.
Sie wusste jedoch, dass Sanja den Stein verbrennen würde, ohne mit der Wimper zu zucken, und dieser Gedanke erschien ihr beinahe unerträglich. Natürlich, die alte Ludica im Dorf war bettlägerig und wartete schon darauf, dass man ihr den heilbringenden Rauch, der beim Verbrennen des Bernsteins entstand, brachte. Doch dieses Wunderwerk in Flammen aufgehen lassen? Nein, das war nicht recht. Milas Herz schlug schneller, als sie den Stein in einen kleinen Beutel steckte, den sie unter ihrem Rockbund trug. Dann bückte sie sich, um rasch weiterzusuchen, ehe Sanja etwas bemerkte. Da ertönte eine Stimme hinter ihr.
*
»Mila!« Sanja stemmte die Hände in die Hüften und beobachtete, wie ihre Tochter sich langsam zu ihr umdrehte. »Was versteckst du da?«
Sie runzelte die Stirn, während sie zusah, wie die Wangen des Mädchens rot anliefen. Die großen blauen Augen waren vor Angst geweitet, stellte Sanja mit Genugtuung fest.
»Nichts, Mutter.«
Das Zittern in Milas Stimme verriet, dass sie log. Wie konnte sie es wagen? Sanja ging mit eiligen Schritten auf sie zu, ohne darauf zu achten, dass ihr Rock vom Salzwasser durchtränkt wurde. Mila blieb stocksteif stehen. Sanja holte aus und versetzte ihr eine Ohrfeige.
»Lüg mich nicht an!« Sie zerrte am Arm der Tochter. »Du hast einen Stein eingepackt, nicht wahr? Was fällt dir ein! Gib ihn her, sofort!«
Mila reagierte nicht. Stumm stand sie da und starrte Sanja an wie eine Statue. Dieses dumme Mädchen! Wie konnte sie es wagen, die Götter zu erzürnen? Einfach zu stehlen, was sie ihnen dargeboten hatten! Am liebsten hätte Sanja noch einmal zugeschlagen, ihr die Unverfrorenheit aus den Knochen geprügelt. Stattdessen zog sie ihrer Tochter das Hemd aus dem Rock. Mila gab einen erschrockenen Laut von sich, als Sanjas Fingernägel über ihre Haut kratzten und ein Tropfen Blut hervortrat. Recht geschah es ihr! Sanja langte in den Beutel, und Augenblicke später hielt sie in die Höhe, was Mila versteckt hatte.
»Es tut mir leid«, flüsterte das Mädchen. Sanja sah, dass Tränen in ihren Augen schwammen, und war versucht, tröstend die Hand nach der Tochter auszustrecken. Dann jedoch musste sie an Ludica denken. Ihre alte Freundin, die seit Jahr und Tag in der Hütte neben ihnen lebte und ohne Murren half, wenn eine zusätzliche Hand gebraucht wurde. Seit Wochen lag sie schon darnieder, das Fieber wollte nicht sinken, obwohl Sanja tat, was sie konnte. Von Tag zu Tag schienen Ludicas Augen sich tiefer in die Höhlen zurückzuziehen. Sanja flehte die Götter jeden Abend an, ihr die nötige Kraft zu verleihen, um die Freundin zu retten, doch bislang waren ihre Bitten nicht erhört worden. Nun fand Mila einen Bernstein, der vor Energie und Macht nur so zu strotzen schien – und wollte ihn für sich behalten? Hatte sie ihre Tochter wirklich so erzogen?
»Ich habe nicht an Ludica gedacht«, fuhr Mila leise fort, als hätte sie die Gedanken ihrer Mutter erraten. »Verzeih mir.«
Sanja seufzte, als sie sich abwandte und den Bernstein zu ihren eigenen Fundstücken in den Korb legte. Vielleicht war es an der Zeit, Mila in die Obhut eines Mannes zu geben. Aras redete schon lange davon. Sanja würde ungern auf Milas helfende Hand verzichten, aber womöglich hatte Aras recht. Ihr fiel Helger ein, der Junge, der ihnen für einen Korb voll Essen oft bei der Arbeit half. Ein fleißiger Bursche, hochgewachsen und kräftig. Sicher, mit der mehrfach bei Keilereien gebrochenen Nase und dem hängenden Augenlid unter den feuerroten Haaren bot er keinen hübschen Anblick, aber das zählte nicht. Er war tüchtig, und vor allem ließ er sich nichts gefallen. Ein Mann wie Helger würde nicht dulden, dass Mila sich dem Tand hingab. Sanja bemerkte, dass ihre Tochter sie nachdenklich musterte, als ahnte das Mädchen, was ihr im Kopf herumging. Sie setzte ein Lächeln auf und hoffte, es würde unbeschwert wirken.
»Komm, wir gehen. Du kannst mir helfen, alles für Ludica vorzubereiten. Wir müssen das heilende Feuer anzünden.«
*
Mila folgte ihrer Mutter schweigend und vermochte ihren Blick kaum von deren Weidenkorb abzuwenden. Der Stein darin gehörte doch ihr. Sie hätte ihn zu gern näher untersucht. Vielleicht sogar versucht, ihn noch besser zu glätten und rund zu schleifen. Einfach nur, weil er so schön war. Nun würde er in Flammen aufgehen. Für nichts.
Mila mochte Ludica und wünschte ihr von Herzen, dass sie Heilung fand. Aber dazu würden die Opfer, die Sanja den Göttern darbrachte, nichts beitragen. Mila hätte diesen Gedanken niemals laut ausgesprochen. Mit Schimpf und Schande würde man sie aus der Siedlung jagen, wenn jemand auch nur ahnte, was ihr durch den Kopf ging. Sie schämte sich selbst dafür, und doch ertappte sie sich immer häufiger bei solchen Überlegungen.
Wenn die Götter helfen konnten, warum griffen sie nicht endlich ein? Mutter flehte Auschauts, den Gott der Kranken und Gesunden, seit Wochen um Beistand an, ohne dass es Ludica besser ging. Wollte er der Nachbarin womöglich gar nicht helfen? Mila schluckte. So sollte sie nicht denken. Oft genug schien Auschauts Sanjas Bitten schließlich erhört zu haben.
Ihre Mutter war eine bekannte Heilerin und betonte immer, dass sie ohne das Wirken der Götter nichts vermochte. Und doch! Bei Ludica handelte es sich um eine alte Frau, die seit Jahren müder und müder wurde. Vielleicht war es einfach an der Zeit für sie, die Augen zu schließen? Wie oft hatte sie schon geklagt, dass ihr die Tage zu lang wurden und die Arbeit zu schwer?
Die Frauen schwiegen, während sie den schmalen Pfad von der Küste erklommen, der aus nichts als platt getretenem Sand bestand, und den dicht stehenden Laubwald passierten. Endlich erreichten sie die Siedlung, wenn man die kleine Ansammlung von Hütten so bezeichnen wollte, die weit verstreut auf einer großen Lichtung standen.
Ein Mädchen mit zerzausten braunen Haaren und leuchtend grünen Augen, die denen Sanjas glichen, stürmte auf sie zu und lachte übermütig.
»Da seid ihr ja.« Neugierig lugte die Kleine in den Korb, der an Sanjas Arm baumelte, doch die schob ihre jüngste Tochter sanft ein Stück zurück.
»Vorsicht, Lubina«, mahnte sie. »Die Ausbeute war nicht besonders gut, und wir brauchen alles für Ludica.«
»Ist sie immer noch krank?« Lubina zog eine Schnute. »Sie soll gesund werden.«
»Das wünschen wir uns alle. So, nun aber rasch.«
Sanja steuerte Ludicas Hütte an. Mila ergriff die Hand ihrer elfjährigen Schwester, bevor sie der Mutter folgte.
»Darf ich dabei sein?«, flüsterte Lubina, und Mila bemerkte das aufgeregte Glitzern in den Augen des Kindes.
»Ich glaube nicht.« Mila zuckte die Schultern und strich der Schwester tröstend über das Haar. »Mutter braucht Ruhe, wenn sie den Bernstein verbrennt. Sie muss all ihre Kräfte bündeln, damit der heilende Rauch wirken kann, weißt du.«
Lubina nickte.
»Irgendwann will ich auch eine Heilerin sein.«
»Das schaffst du bestimmt.« Mila sah sich um und entdeckte ein anderes Mädchen in Lubinas Alter, das verlegen an seinem Hemd nestelte und zu ihnen herübersah.
»Schau mal, dort ist Dana. Vielleicht hat sie Zeit zum Spielen.« Mila zwinkerte ihrer Schwester zu. »Jetzt ist eine gute Gelegenheit, sonst fällt Mutter bestimmt eine Arbeit für dich ein.«
Lubina stellte sich auf die Zehenspitzen und drückte Mila einen Kuss auf die Wange.
»Danke. Du bist die allerbeste Schwester!«
Hüpfend vor Freude lief sie auf die Spielkameradin zu, und Augenblicke später waren die Mädchen kichernd zwischen den Bäumen verschwunden.
»Mila!«, erklang die ungeduldige Stimme ihrer Mutter aus dem Inneren von Ludicas Hütte.
»Ich komme schon!«
Mila eilte zu ihr, um die Mutter nicht noch mehr zu erzürnen. Durch den offen stehenden Türspalt schlüpfte Mila hinein. Sanja stand an der Feuerstelle, und die Flammen züngelten bereits in die Höhe.
Sie griff nach einem Ast und begann, in der Glut zu stochern.
Mila beobachtete einen Augenblick lang die geschickten Handgriffe ihrer Mutter, dann wandte sie sich zu Ludica um, die auf einem Strohlager in der Mitte der Hütte lag. Zögernden Schrittes ging Mila auf sie zu.
»Ludica? Ich bin's, Mila.«
Sie streckte die Hand aus und legte sie auf die Stirn der alten Frau. Nass und kalt fühlte die Haut sich an und dünn wie Pergament.
»Wie geht es dir?« Sie zog die Wolldecke, unter der Ludica lag, ein Stück höher. War sie noch dünner geworden? Ihre grauen Augen blickten ohne jeden Glanz zu Mila auf. Sah sie das Mädchen überhaupt? War sie der Welt nicht schon halb entrückt? Mila streichelte über Ludicas Wange. Sie durfte jetzt nicht daran denken, wie energisch die alte Frau früher gewesen war. Wie sie Ziegen gemolken und unwillige Hühner zusammengescheucht hatte. Wie sie nicht gezögert hatte, es mit jedem Mann aufzunehmen, wenn es sein musste. Ludica hatte immer gern den Becher gehoben und sich von nichts und niemandem etwas gefallen lassen. Und nun lag sie da, nur noch ein Schatten ihrer selbst.
Die Alte öffnete die Lippen, die eingefallen waren und rau aussahen. Ihre Stimme, die früher quer durch die Wälder getönt hatte, war nur noch ein heiseres Krächzen.
»Mila? Ist deine Mutter ... ...?« Sie hustete. Mila drückte ihre Hand.
»Ja, Mutter ist hier. Wir haben heute Bernstein gesammelt. Sie verbrennt die Steine. Gleich wirst du den Rauch riechen, dann geht es dir bestimmt besser.«
Ludica schüttelte den Kopf.
»Sie soll nicht ... zu spät. Ich will ...«
Wieder schüttelte ein Hustenanfall die Frau, und sie verzog unter der Anstrengung schmerzhaft das Gesicht.
»Schlafen, Mila. Bitte lasst mich einfach schlafen. Es ist nun gut.«
Sie brach ab und schloss die Augen, als hätten die wenigen Worte sie unendlich viel Kraft gekostet. Mila strich der alten Frau über das Haar und versuchte, den Kloß in ihrem Hals herunterzuschlucken. Ludica wollte nicht mehr leben. Warum durfte sie nicht einfach gehen? Wenn man jemanden liebte, musste man dann nicht auch seine Wünsche achten? Selbst wenn sie einen schmerzten?
»Bring mir eine Schale, Mila«, unterbrach Sanja ihre Gedanken.
Mit einem Seufzen ließ Mila Ludicas Hand los. Sie griff nach einem Gefäß, das in dem Regal neben dem Lager der alten Frau stand, und ging zurück zu ihrer Mutter, die das Feuer inzwischen noch weiter angeheizt hatte. Die Schwaden tanzten nun hoch an die Decke, und der Rauch kratzte in Milas Hals, als sie neben Sanja trat und ihr den Kessel hinhielt. Ohne Mila anzusehen, nahm Sanja ihn entgegen und legte den Stein, den sie bereits in der Hand hielt, hinein. Milas Stein!
Mila spürte, wie ihr Herzschlag sich beschleunigte. Ihr wunderschöner Stein. Er hätte alles werden können, eine Zierde. Mit Fingerfertigkeit und etwas Werkzeug hätte sie ihn verwandelt. In etwas, das bis in alle Ewigkeit überdauert und Menschen noch Freude bereitet hätte, wenn sie alle längst nicht mehr hier waren. Nun aber würde er zerstört werden, in dem verzweifelten Versuch, eine Frau zu retten, die dem Tod näher stand als dem Leben. Die gar nicht mehr hier sein wollte! Mila starrte auf den Stein. Wie schön er im Sonnenlicht gefunkelt hatte. Und nun sollte er in grauen Rauch aufgehen.
»Mutter«, nahm sie all ihren Mut zusammen. »Ich glaube, wir sollten das nicht tun. Ludica möchte ...«
»Schweig!«
Sanja fuhr herum. Und Mila wusste, dass sie einen Fehler begangen hatte.
*
Was war nur mit Mila los? Sanja biss sich auf die Unterlippe. Dies war nicht der rechte Augenblick, um dem Mädchen eine Lektion zu erteilen. Das würde warten müssen, aber dann würde sie ihr diese Flausen austreiben. Mit aller Macht! Zunächst jedoch galt es, Ludica zu retten. Wenn ihr noch etwas helfen konnte, dann war es der heilende Rauch. Wie konnte es sein, dass Mila das nicht verstand? Mit spitzen Fingern hob Sanja den Bernstein hoch, den ihre Tochter am Strand gefunden hatte, und musterte ihn noch einmal. Ein großes Stück war es, schön geformt von den Wellen. Wenn sie mit dem Nagel darüber kratzte, blieben Rillen zurück. Er würde gut brennen, dachte sie. Besser als jene, die sie selbst am Morgen gefunden hatte. Aus dem Augenwinkel warf sie ihrer Tochter einen Blick zu. Da stand Mila, mit hängenden Schultern. Als würde sie einen echten Verlust beweinen wollen. Erneut spürte Sanja, wie Wut in ihr aufstieg. Am liebsten hätte sie die Hand gehoben und Mila diesen Unsinn aus dem Kopf geprügelt. Einen Stein dem Leben einer Freundin vorzuziehen!
Sie packte Mila am Arm und zog sie zu den Flammen. Vielleicht war es an der Zeit, das Mädchen auf die Probe zu stellen.
»Sieh hinein«, forderte sie die Tochter auf. »Was erkennst du? Sprechen die Götter zu dir, zeigen sie dir etwas?« Gespannt beobachtete sie, wie Mila die Augen ein Stück zusammenkniff und in das Feuer schaute. Sie spürte, dass das Mädchen einen Schritt zurücktreten wollte, als die Hitze in ihrem Gesicht schmerzte, doch Sanja hielt sie fest.
»Nicht«, mahnte sie. »Bleib stehen. Sieh in die Flammen!« Sanja spürte, wie ihr Herz schneller schlug. Mila war ihr eine große Hilfe, wenn es um den Bernstein ging, und würde eine gute Heilerin sein, wenn die Götter ihr beistanden. War das der Fall? Sprachen sie durch das Feuer zu ihr, wie sie es zu Sanja taten? Mila rührte sich nicht, doch Sanja meinte, einen unwilligen Zug um ihren Mund zu erkennen, und hätte sie am liebsten geohrfeigt. Sie war kurz davor, die Geduld zu verlieren, als Mila endlich sprach.
»Ich ...« Sie zögerte und kniff die Augen noch etwas weiter zusammen, als könnte sie so die Bilder, die das Feuer ihr zeigte, deutlicher sehen.
»Was?«, zischte Sanja und packte Mila noch fester am Arm.
»Ein Pferd«, stieß Mila hervor, und ihre Stimme klang heiser. »Ein weißes Pferd.«
»Tatsächlich?«
»Ja. Es sieht friedlich aus. Edel und wunderschön.« Ein Lächeln umspielte die Lippen der jungen Frau, die beinahe verträumt in die Flammen blickte. Sanja beäugte sie misstrauisch, doch Mila sah nicht aus, als erlaube sie sich einen Spaß. Sie wirkte eher verwundert darüber, dass sie tatsächlich etwas erkannt hatte.
Sanja beugte sich vor und starrte nun ebenfalls in die Flammen. War dort wirklich ein Schimmel zu sehen, ein heiliges Tier? Falls ja, was bedeutete das für ihre Tochter? Dann stehen die Götter fest an ihrer Seite, dachte sie. Dann würde Mila Großes widerfahren. Doch als Sanja in die Flammen sah, veränderte sich nichts. Rot loderten die Flammen, Funken sprühten, und das Holz knackte, als es sich dem Feuer ergab. Da war nichts. Gar nichts. Mila hatte sie zum Narren gehalten. Sie hatte es gewusst. Ungeduldig verpasste sie der Tochter einen Stoß.
»Geh zur Seite. Gar nichts hast du gesehen! Unfug!«
Sanja selbst schloss nun die Augen, ohne Mila weiter zu beachten, schluckte ihre Wut herunter und wandte sich innerlich an die Götter. Eure treue Dienerin Sanja fleht euch an: Rettet Ludica. Nehmt dieses Opfer an, und verleiht dem Rauch eure heilende Kraft. Dann ließ sie den Bernstein in die Flammen fallen und sah zu, wie er in der Glut versank, wie die Flammen um ihn züngelten, ihn einhüllten und verwandelten, während ein harziger Geruch aus dem Feuer aufstieg. Ihr wurde schwindlig, und sie öffnete die Augen. Das Feuer tanzte vor ihren Augen, Funken sprühten. Weiter und weiter flogen sie. Kleine Glutnester, die Licht in die Dunkelheit brachten. Doch was war das? Sie meinte, etwas zu erkennen. Sanja kniff die Augen zusammen.
Da! Inmitten der Flammen zeichnete sich etwas ab. Es sah aus wie ... Sanja sog scharf die Luft ein. Ein Kreuz! Sie hatte ein Kreuz in den Flammen gesehen. Das Symbol der Christen! Sie taumelte nach hinten. Was hatte das zu bedeuten?
»Eine Warnung«, flüsterte sie tonlos. Gänsehaut kroch ihr über die Unterarme. Sanja fröstelte, obwohl sie direkt neben dem Feuer stand.
»Mutter?« Sie spürte Milas Hand an ihrem Ellbogen, als sie ins Wanken geriet. »Mutter, geht es dir gut?«
Es kam ihr vor, als käme die Stimme ihrer Tochter von weit weg, aus der anderen Welt. Sanja schüttelte den Kopf, und alles Blut wich ihr aus den Wangen.
»Ein Kreuz«, wiederholte sie und starrte ihre Tochter aus geweiteten Augen an. »Da war ein Kreuz. Sie kommen! Sie kommen, um uns zu holen.«
2.
Johan ließ den Blick über die Zelte wandern, die sich dicht gedrängt vor ihm auftürmten. Weiße Stoffbahnen, so weit das Auge reichte. Es war, als läge eine Stadt aus Schnee vor ihm.
»Brr.« Er zog die Zügel an, und sein braver Schimmel blieb stehen. Johan schwang sich aus dem Sattel, holte einen Apfel aus seinem Beutel und reichte ihn Wanja. Der Hengst kaute mit Appetit, während Johan ihn locker am Zügel hielt und die schneeweiße Mähne streichelte.
»Wie soll ich mich hier jemals zurechtfinden?«, murmelte der Zwanzigjährige, den Blick weiterhin auf die Zeltstadt gerichtet, und pustete eine Strähne seiner schwarzen Haare aus der Stirn. Er hörte die Geräusche aus dem Lager bis hierhin. Metall, das auf Metall schlug. Rufe und Pfiffe. Dumpfes Gelächter. Der Wind trug eine Mischung aus Bratenduft, Ruß und Pferdedung zu ihm.
Johan dachte an das kleine Holzhaus zurück, das er mit seiner Mutter in Dänemark bewohnt hatte. Mutters Schwester Anna war Jahre vor ihnen dorthin gezogen, denn ihr Mann Mads hatte eine dänische Mutter und war in Westjütland aufgewachsen. Er war früher Kaufmann gewesen und hatte sich auf einer Handelsreise Hals über Kopf in die junge Anna verliebt. Johans Mutter hatte immer wieder mit einer Mischung aus Schmunzeln und Schaudern erzählt, wie viel Streit es in der Familie zunächst wegen dieser Verbindung gegeben hatte, bis ihr Vater Mads schließlich akzeptiert hatte. Auf einer Düne am Meer, ganz in der Nähe der beiden, hatten sie gelebt. Das Seegras wuchs bis zu ihrer Tür. Wenn er im Sommer barfuß nach draußen ging, kitzelte es sanft auf der Haut, als wollte es ihn daran erinnern, wie gesegnet er war, weil ihn morgens die Weite des Strandes und das Blau der Nordsee begrüßten. Wenn Mutter ihre Kleidung zum Trocknen aufgehängt hatte, rochen die Stoffe hernach nach dem Salz des Meeres. Nach Freiheit! Behaglich und warm war es in ihrem Häuschen gewesen, mit einer Feuerstelle, auf der zu fast jeder Tageszeit ein Kessel stand, aus dem es nach Gemüse duftete.
Mit einem Seufzer tätschelte er Wanjas Hals und zwang sich, kein Heimweh aufkommen zu lassen. Im Grunde war er Onkel Mads dankbar, dass er seine Beziehungen hatte spielen lassen. Mads selbst war nie im Orden gewesen, aber sein Vater Peter hatte im Heiligen Land im Dienst der Brüder vom Deutschen Haus St. Mariens in Jerusalem gestanden. Lange bevor aus der Hospitalbruderschaft ein Ritterorden wurde, war Peter dort als Zimmermann beschäftigt gewesen, und Johan hatte das Glück gehabt, den alten Mann noch kennenlernen zu dürfen, ehe ihn im letzten Winter ein Fieber dahingerafft hatte. Peter hatte ihm gezeigt, wie man ein Dach anständig deckte, wie man eine Hütte wetterfest machte und wie man Möbel herstellte, wenn man kaum mehr als ein morsches Stück Holz zur Verfügung hatte.
»Im Orden habe ich alles gelernt, was es über das Bauen zu wissen gibt«, hatte er immer wieder voller Stolz erzählt. »Sie werden Burgen bauen, mein Junge, größer, als du dir überhaupt vorstellen kannst. Und darin wird es Platz geben für die Kranken und Leidenden, um die sie sich kümmern werden.«
Johan wusste noch, wie er regelrecht an Peters Lippen gehangen hatte, während er davon träumte, dabei zu sein, wenn eine solche Festung aus dem Nichts entstand. Ohne Peter wäre Johan nicht, wo er jetzt war. Er war es auch gewesen, der ihm gegen Mutters Widerstand zur Seite gesprungen war. Sie hatte nicht gewollt, dass er in den Orden ging. Auch Johan selbst hatte Zweifel gehabt, doch Peters Erzählungen hatten seinen Wunsch immer stärker werden lassen.
»Es ist nicht der richtige Platz für dich«, war alles, was Mutter dazu gesagt hatte. Johan wusste noch, wie sie dabei ihre Lippen zusammengekniffen und in die Ferne gestarrt hatte. Wenn Peter ihr nicht mit Engelszungen wieder und wieder beteuert hätte, dass sie dem Traum ihres Sohnes nicht im Weg stehen dürfe und dass es ihm im Orden gut ergehen würde, wäre Johan heute nicht hier. Er richtete sich auf und atmete tief durch.
»Ich schaffe das«, sprach er sich selbst Mut zu.
»Da bin ich sicher!«
Johan fuhr herum. Wer hatte da gesprochen? Sein Herz schlug schneller, und seine Hand fuhr an den Gürtel, in den er einen Dolch gesteckt hatte, um sich gegen Angreifer zu verteidigen. Bisher war er auf seiner weiten Reise von Überfällen verschont geblieben. Sollte sich das nun ändern? So kurz vor dem Ziel?
Ein Mann trat zwischen den Eichen hervor. Er hob die Hände, ohne Johans Dolch aus den Augen zu lassen.
»Steck ihn weg«, rief er unaufgeregt. »Ich habe nicht die Absicht, dich zu überfallen. Ich müsste verrückt sein – so dicht vor dem Lager des Ordens.«
Er lachte dröhnend und kam Schritt für Schritt auf Johan zu, der zögerlich seine Waffe sinken ließ. Der Fremde erinnerte ihn an einen Bären. Hochgewachsen und kräftig, marschierte er auf ihn zu. Die braunen Haare waren ungewöhnlich kurz geschnitten und bildeten einen Kontrast zu seinem buschigen Bart, der nur die Oberlippe frei ließ. Seine blauen Augen blitzten, als fände er die Situation erheiternd. Als er näher kam, bemerkte Johan überrascht, wie jung der Mann war – kaum älter als er selbst.
»Wer bist du?«, rief er ihm entgegen und bemühte sich, seine Anspannung nicht zu zeigen. Betont gelassen tätschelte er noch einmal Wanjas Hals. Der Hengst tänzelte und merkte sehr wohl, dass Johan auf der Hut war.
»Friedrich«, antwortete der Fremde und blieb wenige Schritte vor Johan stehen. Er verschränkte die Arme vor der Brust und grinste.
»Und ich weiß, wer du bist. Johan, nicht wahr?«
Der Angesprochene hob fragend die Augenbrauen.
Friedrich schmunzelte.
»Einer unserer Späher hat dich entdeckt. Du bist im Moment der einzige Neuankömmling, den wir erwarten. Wie war deine Reise?«
Johan begriff und spürte, wie Erleichterung ihn durchflutete.
»Du gehörst zum Deutschen Orden?«
»Stets zu Diensten.« Friedrich deutete eine schelmische Verbeugung an, dann richtete er sich auf und schlug Johan auf die Schulter. »Ich gestehe, ich bin gerade ohne meine Ordenskleidung unterwegs. Das wird nicht gern gesehen, aber nachdem mein nicht allzu treues Pferd mich heute schon recht unsanft in einen Tümpel geworfen hat, mussten meine Sachen gewaschen werden.«
Er zwinkerte Johan zu. »Komm mit. Du brauchst ein Bad, wenn ich das so sagen darf. Du riechst schlimmer als ein Fuder Pferdeäpfel. Ich schätze, zu einem Krug Bier und etwas Eintopf würdest du auch nicht nein sagen, oder?«
»Da hast du recht. Mein Magen knurrt seit Stunden.«
»Wie heißt dein Pferd? Sieht nach einem soliden, gesunden Ross aus.«
»Das ist Wanja.« Johan drehte sich zu seinem Pferd um und strich sanft über die Mähne des Hengstes. Friedrich nickte anerkennend. »Er wird dir in den Schlachten ein guter Begleiter sein, denke ich.«
»Das hoffe ich.« Johan überlegte einen Moment. »Seid ihr derzeit in viele Kämpfe verwickelt?«
Friedrich schüttelte den Kopf, doch Johan bemerkte, dass sich ein Schatten über die eben noch heiteren Züge des Ordensritters legte.
»Wir nicht. Bei den Brüdern ein wenig weiter im Westen sieht es anders aus. Da steht das Land in Flammen, und das ist nicht übertrieben. Die Prussen sind keine einfachen Gegner. Wir hoffen, dass wir sie überzeugen können. Es ist immer besser, wenn die Schwerter schweigen. Allerdings scheinen sie an ihren Götzen zu hängen und sind nicht begeistert von der Aussicht, in den Schoß des Herrn aufgenommen zu werden. Sagen wir es so, sie begrüßen uns nicht gerade mit lauten Halleluja-Rufen.«
Er warf Johan einen Blick zu. »Wie sieht es mit dir aus? Bist du einer von denen, die es kaum erwarten können, blutbesudelt aus einer Schlacht zurückzukommen?«
»Nein.« Johan schüttelte den Kopf. »Beileibe nicht. Ich bin einer von denen, die gekommen sind, um Leid zu lindern, wo immer es geht.«
»Aber du willst Ritter werden? Kein Priesterbruder?«
»Richtig.« Johan runzelte die Stirn. »Wieso fragst du? Ist die Hilfe am Nächsten allein den Priestern vorbehalten?«
»Das bezweifle ich. Aber du siehst drahtig aus. Wie ein Kämpfer.«
»Ich bin im Schwertkampf durchaus geübt«, entgegnete Johan bescheiden und unterdrückte ein Lächeln. Er wusste nichts von Friedrich und würde ihm nicht auf die Nase binden, dass er das Schwert zu führen wusste wie kaum ein Zweiter. Die letzten Monate, wenn nicht Jahre, hatte er Tag für Tag mit Onkel Mads geübt. Sie hatten die Schwerter geschwungen, bis manchmal Blut und fast immer Schweiß und Tränen geflossen waren. Ja, Johan konnte kämpfen. Doch das war nicht der Grund, aus dem er hier war.
»Mich hat seit jeher fasziniert, wie gut die Krankenpflege des Ordens ist«, erklärte er Friedrich, »und ich bin selbst nicht ungeschickt im Handwerk. Hast du die Hütten der Prussen gesehen? Ich denke, da könnte man vieles verbessern. Und ich könnte den Orden darin unterstützen, gute Lazarette zu bauen. Für die Versorgung der Verwundeten und Kranken!«
Friedrich musterte ihn zweifelnd. »Wenn sie dich lassen. Sowohl unsere Leute als auch die Prussen. Komm jetzt, mein Freund, ich zeige dir das Lager.«
Als sie nur Minuten später durch die Gassen der Zeltstadt ritten, bemühte Johan sich, sein Erstaunen zu verbergen, damit sein Begleiter ihn nicht für einen dummen Jungen hielt. Die weißen Zelte standen dicht an dicht in ordentlichen Reihen. Allenthalben waren Flaggen gehisst, die ein schwarzes Kreuz auf weißem Tuch zeigten. Es gab großzügige Bereiche für die Pferde, die geschützt in der Mitte des Lagers untergebracht waren. Hier und dort wurde gehämmert oder gesägt. Man hörte Metall auf Metall schlagen, wo einige Ritter sich vermutlich mit dem Schwert übten, und ein aromatischer Geruch nach gebratenem Fleisch stieg ihm in die Nase. Es war, als sei er in eine richtige Stadt und nicht in ein Zeltlager gezogen. Zum ersten Mal seit seiner Abreise aus Dänemark wurde ihm bewusst, dass ihn eine völlig neue Welt erwartete. Johan schluckte. Würde er an diesem Ort bestehen?
Friedrich warf ihm einen Blick von der Seite zu.
»Bist du bereit für all das?«, stellte er die Frage, die Johan selbst gerade durch den Kopf ging. »Kämpfe, Verletzte. Und nicht zu vergessen Keuschheit, Armut und Gehorsam. Gerade die Keuschheit ist ja nun nicht jeden Mannes Sache.«
Er zwinkerte, als Johan rot anlief, und lachte schließlich lauthals. Dann beugte er sich zu Johans Ohr.
»Ich versichere dir, damit nehmen es viele nicht so genau. Auch meine Lenden sind viel zu großzügig ausgestattet, als dass ich sie den Weibern vorenthalten wollte.«
Er schlug Johan auf die Schulter, doch der fiel nicht in das Gelächter ein. Vielleicht wollte Friedrich ihn nur auf die Probe stellen?
»Die Gelübde machen mir wenig Sorgen«, wich er aus und drückte den Rücken durch. Nur wenige Stunden trennten ihn noch von seinem Schwur. Er würde seine Bestimmung im Orden finden. Seinen eigenen Weg gehen. Hier kannte ihn niemand, und es war, als könnte er sein Leben ganz von vorn beginnen. Alles war möglich! Mit neuem Mut erwiderte er Friedrichs Lächeln.
»Ich bin hier, um meinem Ruf zu folgen. Und genau das werde ich tun.«
*
Ludica hatte in den frühen Morgenstunden die Augen geschlossen. Der Rauch, aus Milas Bernstein gewonnen, hatte ihr keine Rettung mehr gebracht. Sanja war wütend aus der Hütte gestürmt, als Ludica ihr Leben ausgehaucht hatte, und hatte die Aufbahrung der Verstorbenen den anderen Frauen überlassen. Von den Männern scherte sich keiner darum; sie zögerten aber nicht, Ludicas Hütte Stück für Stück auseinanderzunehmen, um nach Dingen zu suchen, die für sie vielleicht von Nutzen sein konnten.
Mila schluckte ihren Ärger hinunter, wohl wissend, dass sie gegen die Männer des Dorfes nichts ausrichten konnte. Die Stimme einer Frau würde bei ihnen kein Gehör finden. Sie warf einen letzten Blick auf die Tote, hauchte ihr einen Kuss auf die Stirn und zog sich hinter die Hütte ihrer Eltern zurück. Sie hatte gehofft, dort allein sein zu können, doch ihr Bruder Kajus hatte sich dort auf einem Baumstumpf niedergelassen und schnitzte an einem Stück Holz.
»Eine neue Schale?«, fragte Mila beiläufig, und Kajus nickte.
Seine Finger bewegten sich schneller, als Mila sich ihm gegenüber auf den Boden setzte. Auf und ab ließ er das Messer tanzen, mit aller Kraft. Als könnte das Holz etwas dafür, dass Ludica gestorben war. Mila wusste, dass er an der alten Frau gehangen hatte, auch wenn er es sich nie eingestehen würde. Sie hatte stets eine Leckerei für ihn gehabt, und als kleiner Junge hatte er manche Stunde auf ihrem Schoß gesessen und sich alte Geschichten erzählen lassen. Genau wie Mila selbst. Sie schluckte die Tränen herunter, die ihr in die Augen steigen wollten.
»Wieso hat der Rauch nicht geholfen?«, fragte sie Kajus leise. »Warum hat Mutter nichts ausrichten können?«
Kajus blickte zu ihr auf und wirkte auf einmal viel älter als seine vierzehn Jahre.
»Ludica war alt und sehr krank, Mila. Irgendwann ist der Augenblick gekommen. Wir dürfen den Göttern nicht zürnen. Mutter sagt das auch.«
Mila wollte etwas erwidern, doch da trat ihr Vater zwischen den Bäumen hervor. Aras' von grauen Strähnen durchzogene, braune Haare waren schweißnass von der Arbeit, und die krustigen Flecken auf seinem Hemd verrieten, dass er auf den Feldern gewesen sein musste. Womöglich wusste er noch gar nichts von Ludicas Ableben? Aras und Helger, der zwanzigjährige Sohn eines Nachbarn, trugen einen Eimer mit Stutenmilch zwischen sich. Er war so prall gefüllt, dass einige Tropfen über den Rand liefen und im Boden versickerten.
»Hier, in die Sonne«, wies Aras den jungen Mann an. »Da wird am schnellsten der feine Trank daraus, der uns gut munden wird.«
Mit einem Stöhnen stellten die Männer das Gefäß ab. Aras rieb sich, offenbar voller Vorfreude auf die Wirkung der vergorenen Milch, die Hände, doch Mila wich unwillkürlich einen Schritt zurück, als Helgers Blick sie traf. Sie mochte es nicht, wie er sie ansah. Die Gier in seinen Augen jagte ihr einen Schauer über den Rücken, und sie widerstand nur mit Mühe dem Drang, die Arme schützend um ihren Oberkörper zu schlingen. Mutter sagte immer, dass die Männer nicht merken durften, wenn man Angst hatte. Das würde sie nur noch mehr anstacheln.
»Mila«, richtete Helger mit seiner dröhnenden Stimme das Wort an sie und kam auf sie zu. Mila zwang sich, stehen zu bleiben. Der Wind stand in seinem Rücken und trug den Duft von Milch und Heu zu ihr. Aber da lag noch etwas anderes in seinem Geruch. Saurer Schweiß. Lust. Mila spürte, wie die Härchen an ihren Unterarmen sich aufstellten. Dennoch sah sie ihm fest in die Augen.
»Helger. Wie geht es dir?«
»Gut. Viel Arbeit, wie immer. Eine helfende Hand in meiner Hütte wäre nicht schlecht. Und die Nächte werden auch bald wieder kälter.«
Er beugte sich vor, damit niemand außer Mila seine nächsten Worte hörte. »Wer wird mir im kommenden Winter wohl das Lager wärmen?«
Ein Speicheltropfen traf Mila am Ohr, den sie mit ihrem Handrücken wegwischte. Helger erinnerte sie an einen Hund, der beim Anblick eines Stücks Fleisch zu sabbern begann. Angewidert rümpfte sie die Nase, doch Helger schien davon wenig beeindruckt. Er ließ noch einmal seinen Blick über ihren Leib streifen, wobei er an ihrer Brust innehielt, und wandte sich dann ab.
»Ich muss los. Das Vieh wartet auf mich. Ich komme gern später auf einen guten Tropfen vorbei, Aras. Wenn ich darf?«
»Immer gern, mein Junge.«
Aras winkte Helger nach, als der pfeifend zwischen den Bäumen verschwand, und ließ sich dann neben Kajus nieder. Mila öffnete den Mund, um ihrem Vater von Ludicas Tod zu berichten, doch er kam ihr zuvor.
»Ich denke, wir sollten die Sache mit Helger fest vereinbaren«, sagte er beiläufig. Mila fuhr zusammen.
»Was soll das heißen?«
Der tadelnde Blick des Vaters sagte ihr, dass ihr Tonfall zu scharf war, aber sie entschuldigte sich nicht. Sie wollte eine Antwort. Er würde doch nicht wirklich daran denken, sie Helger zur Frau zu geben?
»Du bist alt genug. Und Helger hätte dich gern zum Weib«, entgegnete Aras jedoch. Mila fröstelte bei seinen Worten. Sie wusste, dass ihr Vater kein Nein akzeptieren würde. Sie war die Tochter. Sie hatte zu folgen. Dennoch musste sie versuchen, ihn umzustimmen!
»Mutter sagt, sie braucht mich«, warf sie daher zaghaft ein. Doch Aras winkte ab.
»Zum einen schafft deine Mutter ihr Tagwerk auch allein, zum anderen wüsste ich nicht, warum du ihr nicht weiterhin helfen solltest. Es ist ja nicht so, als hätte Helger vor, uns zu verlassen. Wo sollte er auch hin? Nach Westen?« Er lachte, doch es klang bitter. »Dorthin, wo der Orden gerade das Land mit Feuer und Schwert überzieht? Wir können froh sein, dass es hier noch ruhig ist.«
Seine Augen schienen sich zu verdunkeln, und auf einmal wirkte er, als wäre er ganz weit weg.
»Solange es noch ruhig ist«, wiederholte er seine Worte, und Mila, die es nicht gewohnt war, in der Stimme ihres Vaters ein solches Zittern zu vernehmen, schloss die Augen. Helger, die Soldaten ... Kam es ihr nur so vor oder drohte ihr bisher friedvolles Leben Stück für Stück auseinanderzubrechen?
*
Bruder Lothar war ein älterer Geistlicher. Mit seiner hochgewachsenen Gestalt und den schlohweißen Haaren, die seine Tonsur umrahmten, gab er eine eindrucksvolle Erscheinung ab, obwohl er längst die fünfzig überschritten hatte. Er trug die übliche Ordenskleidung, die auch Johan bereits übergeben worden war. Ein langes Hemd, Beinlinge und einen langen Tagesrock, darüber den weißen Mantel mit dem schwarzen Kreuz. Die flache schwarze Filzkappe hatte er auf dem Tisch abgelegt, der neben dem Eingang des Zeltes stand. Auch Johan würde sich später so einkleiden, doch zunächst sollte ihm die Rüstung angepasst werden.
Johan spürte den Blick des Priesterbruders in seinem Rücken, während er die Arme nach hinten streckte, um sich in den gepolsterten Waffenrock helfen zu lassen.
»Der schützt gegen Schläge«, erklärte Friedrich, der sich bereiterklärt hatte, Johan bei der Anprobe zur Seite zu stehen, und verknotete die Bänder.
»Er ist sogar recht bequem«, fand Johan, doch Friedrich schnaubte.
»Das wirst du nicht mehr sagen, wenn du den Rest anhast. Albrecht!«, wandte er sich an den Knappen, der mit großen Augen neben ihm stand und dessen Gesicht noch kindliche Züge hatte. »Bring das Kettenhemd.«
»Natürlich.« Der Junge eilte zu dem Tisch am Rand des Kapellenzeltes, in das Bruder Lothar sie eingeladen hatte, um den neuen Ritter persönlich in Augenschein zu nehmen. Obwohl er kein Waffenträger war, wurde Johan das Gefühl nicht los, dass der Bruder im Orden eine wichtige Rolle spielte, und er war sich nicht sicher, ob ihm das gefiel. Die Augen Lothars erinnerten ihn an einen Habicht. Wachsam und undurchsichtig lag sein Blick auf ihm. Johan hätte zu gern gewusst, was der Mann dachte.
»Hier.«
»Himmel, ist das schwer.« Johan unterdrückte ein Stöhnen, als Friedrich mit Albrechts Hilfe das Kettenhemd, an dem zudem eine schwere Haube befestigt war, über seinen Kopf zog und im nächsten Moment noch den Helm daraufsetzte.
»Das hält dein Köpfchen schon aus«, meinte Friedrich und zwinkerte ihm zu. »Besser als einen Hieb mit dem Schwert allemal!«
»Da wirst du recht haben.« Johan drehte den Kopf vorsichtig nach links und rechts. »Fühlt sich an, als würde ich einen Haufen Steine schleppen. Wie kann man damit in der Schlacht noch wendig genug sein?«
»Du gewöhnst dich daran. Das musst du üben.«
Friedrich schlug ihm auf die Schulter.
»Glaub mir, diese Ausrüstung ist der beste Weg, nicht in Einzelteilen aus dem Kampf zurückzukehren.«
Johan schluckte. Er wollte nicht feige wirken, aber eigentlich war er aus einem anderen Grund hier. Ob er es wagen konnte, nachzufragen? Friedrich stellte sich vor ihn, die Hände in die Hüften gestemmt. Er nickte, offenbar zufrieden mit seinem Werk.
»So sieht ein echter Ritter aus, Johan.«
»Haltet inne.«
Johan wandte sich um und sah, dass Lothar sich von seinem Stuhl erhoben hatte. Er öffnete eine Truhe, die unter dem kleinen Altar stand, der die Mitte des Zeltes bildete, und holte etwas heraus.
»Es fehlt noch etwas.«
Er entfaltete einen weißen Mantel, auf dem ein großes, schwarzes Kreuz prangte.
»Komm her«, forderte er Johan auf, und zögernd trat dieser auf den Priester zu, der ihm daraufhin mit feierlicher Geste den Mantel umlegte.
»Auch über der Rüstung solltest du deinen Mantel tragen. Jetzt siehst du wirklich wie ein Ritter unseres Ordens aus.«
Lothar nickte, als wollte er seinen eigenen Worten Nachdruck verleihen, und schien auf einmal beinahe gerührt. Johan stand kerzengerade und versuchte zu ergründen, wie die Rüstung sich anfühlte. In Gedanken sah er sich selbst, wie er zu Hause in Dänemark am Strand entlanglief. Ein weites Hemd, Hosen, die nackten Füße im Sand. Das war vorbei. Er war ein Ritter. Ein Hauch von Stolz durchflutete ihn, doch gleichzeitig fühlte er sich fremd in seiner eigenen Haut.
Lothar schien Johans Verunsicherung nicht zu bemerken. Sein Blick wurde leicht glasig, während er fortfuhr.
»Ein Mann, der für seinen Herrn, unsern Gott, in die Welt ziehen wird. Ein Mann, der sein Leben dem Herrn weiht und alles tun wird, um Sein Wort und Seine Botschaft zu verbreiten. Der bereit ist, das Schwert zu führen und sein Leben zu lassen, wenn es der Kampf für den wahren Glauben erfordert. Fürwahr, das ist eine große Bestimmung.« Er legte Johan eine Hand auf die Schulter.
»Es wird Zeit für deinen Schwur.«
Johan schluckte. Er war kein Feigling, aber er war nicht hier, um zu kämpfen. Genauso wenig war es sein Ansinnen, jemandem seine Religion aufzuzwingen. Er wollte helfen, Leid zu lindern. Den Leuten ein solides Dach über dem Kopf geben. Er wollte aufbauen, nicht abreißen. Und auf einmal hatte er das Gefühl, die Kettenhaube wog viel zu schwer auf seinen Schultern. Der Helm erdrückte ihn, der weiße Mantel schnürte ihm die Luft ab. Er musste hier raus!
3.
Das Zelt, in dem Antonius entgegen der üblichen Gepflogenheiten allein untergebracht war, stand am Rand des Lagers. Wenn sie angegriffen würden, wäre der Fünfzigjährige der Erste, der starb. Aber das war wohl auch gewollt. Wegen ihm würde hier niemand Trauer tragen. Gleichzeitig war er gut bewacht. Rund um die Grenzen der Zeltstadt marschierten ständig Wachen. Hier gab es kein Entkommen. Auch wenn sie es nicht sagten, Antonius war klar, dass er im Grunde ein Gefangener war. Einer, der tat, was man ihm auftrug.
Antonius tastete nach dem Säcklein, das er sorgsam in dem Beutel unter seinem Hemd aufbewahrte. Prall gefüllt war es inzwischen. Wie gut, dass er ein geschicktes Händchen beim Wetten hatte. Auch wenn es verboten war, ließen einige Männer es sich nicht nehmen, insgeheim zu würfeln, obwohl nur Brettspiele erlaubt waren, und er hatte so manche Münze gewonnen. Antonius schmunzelte in sich hinein. Eigentlich müsste es bald reichen. Den Rest würde er unterwegs verdienen.
Er schob den Vorhang beiseite, der sein Zelt von der Gasse abtrennte, und trat ins Freie. Die Sonne ging unter, und schon jetzt war die Sichel eines Halbmondes am Himmel zu sehen. Nicht ein Wölkchen war zu entdecken; es würde eine sternenklare Nacht werden. Antonius atmete tief ein. Der wohlbekannte Geruch des Lagers stieg ihm in die Nase. Wein, Fleisch, Pferde und Feuer. Nein, das würde er nicht vermissen. Wenn alles klappte, wäre er bald auf einem Schiff. Dann würde stattdessen das Salz des Meeres in seiner Nase kitzeln und wäre der ungezügelte Wind, der über die Ostsee pfiff, sein Reisebegleiter. Ein paar Münzen wollte er noch ansparen, dann würde er gehen.
»Antonius!«
Er fuhr herum. Diese Stimme hätte er überall erkannt.
»Lothar. Guten Abend.«
»Was machst du hier draußen? Ich kann mich nicht erinnern, dir eine Arbeit aufgetragen zu haben, wegen der du dein Zelt verlassen müsstest.«
Misstrauisch beäugte der Priester Antonius, der seinen Mantel schnell so drapierte, dass Lothar der prall gefüllte Beutel nicht auffallen würde.
»Ich wollte nur an die Luft. Und mich einmal umsehen. Vielleicht werde ich irgendwo gebraucht?«
»Du solltest dich vorsehen.« Lothar trat näher an ihn heran, und Antonius wich unwillkürlich ein Stück zurück.
»Dein Seelenheil ist dir noch immer nicht viel wert, was?« Er schnalzte mit der Zunge. Antonius öffnete den Mund, um sich zu verteidigen, doch Lothar hob warnend einen Zeigefinger.
»Es reicht nicht, der Messe beizuwohnen. Es reicht auch nicht, mir bei der Beichte Lügengeschichten zu erzählen. Du bist voll sündiger Gedanken. Und ich glaube, du solltest nicht hier sein. Du bist zu nah an der Quelle des Bösen.«
Antonius lief ein Schauer über den Rücken. Was wusste Lothar? Ahnte er, dass Antonius aus dem Orden fliehen wollte? Hatte er sich durch irgendeine Dummheit verraten? Er beschloss vorzupreschen.
»Ich soll gehen? Mein Bündel packen und von dannen ziehen?« Antonius' braune Augen blitzten auf. Er gab sich Mühe, nicht hoffnungsvoll zu klingen. Wenn sie ihn einfach verjagen würden ... wäre das nicht das Beste? Der Weg durch die Gebiete der Prussen könnte gefährlich werden, vor allem, wenn sie in ihm einen Christen erkannten, aber mit Gottes Hilfe würde er es schaffen. Doch ehe zu viel Zuversicht in ihm aufkeimen konnte, unterbrach Lothars salbungsvolle Stimme seine Gedanken.
»Je näher am Schoß des Vaters du bist, desto besser. Wir erwarten eine Delegation aus der heiligen Stadt. Auf dem Rückweg darfst du dich ihnen anschließen.«
Antonius schwindelte. Rom! So weit weg! Das durfte nicht geschehen. Wenn sie ihn nach Rom schickten, war alles umsonst gewesen. Dann würde er es niemals schaffen! Er setzte eine andächtige Miene auf, obwohl er Lothar am liebsten die Faust ins Gesicht gerammt hätte. Auge um Auge. Dann deutete er eine Verbeugung an und faltete die Hände.
»Ich danke dir für die Hilfe bei meiner langen Buße.«
Lothar nickte und setzte seinen Weg fort, drehte sich aber noch einmal um.
»Übe dich in Selbstbeherrschung«, ermahnte er Antonius. »Und vergiss nicht, unsere Wachen sind achtsam.«
Antonius fuhr zusammen. Lothar traute ihm nicht! Das hatte er schon befürchtet.
Antonius schluckte schwer. Seine Finger tasteten nach dem Kreuz, das er um den Hals trug, und sein Blick glitt zum Himmel. Egal, was Lothar sagte. Antonius spürte, dass der Herr auf seiner Seite stand. Dass er sich nichts vorzuwerfen hatte, außer dass er ein Geschenk angenommen hatte, das Gott selbst ihm gesandt hatte. Auf keinen Fall würde er darauf verzichten. Auf keinen Fall würde er sich nach Rom bringen lassen!
»Oh Herr, steh mir bei«, flüsterte er und schloss die Augen. Atmete tief durch. Beruhigte seinen Herzschlag. Die Zeit war gekommen. Er musste fliehen. Heute Nacht.
*
Das Gespräch mit Aras ging Mila noch lange im Kopf herum. Wann immer sie in den nächsten Tagen mit ihm oder Sanja allein war, schlug ihr Herz schneller, und mehr als einmal verbarg sie ihre zitternden Hände im Schoß, wenn die Eltern unvermittelt das Wort an sie richteten, doch Helger wurde nicht erwähnt. In Sicherheit wähnte Mila sich dennoch nicht. Sie bemühte sich, fleißig zu sein und keinesfalls den Ärger ihrer Eltern auf sich zu ziehen. Vielleicht würden sie den Plan, sie mit ihm zu verheiraten, dann vergessen? Dass die Mutter ihren Bernstein vergebens verbrannt hatte, sprach Mila ebenfalls nicht mehr an. Auf keinen Fall wollte sie ihr Anlass für einen Wutausbruch geben, wenn die Strafe dafür die Vermählung mit Helger sein konnte. Auch an diesem Abend hatte Mila sich aus freien Stücken um das Essen gekümmert.
Es dämmerte bereits, und ein Gewitter schien in der Luft zu liegen. Der Schweiß auf ihrer Haut zog Mücken an, die sie mit ihrem eintönigen Sirren schläfrig machten, bevor sie zustachen. Mila kratzte an einem Stich und unterdrückte ein Gähnen, während sie sich mit der Familie vor der Hütte um das Feuer setzte und Stutenmilch und Hühnerfleisch, das sie mit Kräutern und etwas Honig gewürzt hatte, an alle austeilte. Sie füllte Aras gerade den Becher, als sich eilige Schritte näherten.
»Sanja! Sanja, bist du da?«
Mila sprang beinahe ebenso schnell auf wie ihre Mutter. Aus dem Halbdunkel der Bäume, die schon einen Großteil ihres Laubs abgeworfen hatten, rannte eine Gestalt auf sie zu. Eine schlanke, junge Frau, in der Mila Jurga erkannte. Mit ihr hatte sie eine Freundschaft verbunden, bis Jurga sich mit Tibas vermählt hatte. Seither bestimmte der wesentlich ältere Mann, wie Jurga ihren Tag zu gestalten hatte, und das bedeutete, dass sie entweder hart arbeitete oder ihm zu Willen war. Zeit für eine Plauderei unter Mädchen blieb nicht mehr. Mila bemerkte, wie eingefallen Jurgas Wangen aussahen, und selbst in der Dämmerung erkannte sie, dass ihre grünen Augen rot geädert waren.
»Jurga!« Sie lief der Freundin, die von der Anstrengung außer Atem war und nach Luft schnappte, entgegen und legte ihr eine Hand auf die Schulter. »Was ist geschehen? Geht es dir gut? Ist etwas mit Tibas?«
Jurga winkte, noch immer keuchend, ab.
»Es ist die Alba. Sie kommt nieder.«
»Oh.«
Mila ließ die Hand sinken. Alba ... sie war Tibas' erste Frau und sogar ein paar Sommer älter als Sanja. Es grenzte an ein Wunder, dass sie noch einmal ein Kind in sich trug. Sie hatte Tibas nie einen Sohn, dafür aber zwei Töchter geschenkt, die längst erwachsen waren. Alba klagte seit Wochen über Pein im Rücken, und ihre Beine waren so geschwollen, dass man sie bei den wenigen Gelegenheiten, zu denen sie ihr Lager überhaupt noch verlassen hatte, nur barfuß angetroffen hatte.
»Sie braucht deine Mutter. Und dich! Bitte, Mila. Beeilt euch.«
Jurgas Stimme überschlug sich vor Aufregung.
»Natürlich. Wir kommen.«
Sanja klang gelassen, als sie zu ihnen trat, einen Korb mit Utensilien, der für Geburten immer bereitstand, schon in der Hand.
Schweigend, aber schnellen Schrittes machten die Frauen sich auf den Weg durch den Wald. Tibas wohnte mit seinen Frauen etwas außerhalb auf einer Lichtung. Mila musterte Jurga von der Seite. Sie war blass und sah aus, als würde sie jeden Moment in Tränen ausbrechen. Mila griff nach der Hand der Freundin und drückte sie.
»Ich weiß, was du denkst. Aber bitte, hab keine Angst. Meine Mutter wird ihr helfen«, flüsterte sie so leise, dass nicht einmal Sanja sie verstehen würde.
Jurgas Augen flackerten.
»Sie ist alles, was zwischen ihm und mir steht. Immer wieder schafft sie es, ihn von mir abzulenken«, bestätigte sie kaum vernehmbar, was Mila längst geahnt hatte. »Sie ist wie eine große Schwester für mich, Mila. Ich kann nicht ohne sie bei Tibas sein. Ich kann nicht!«