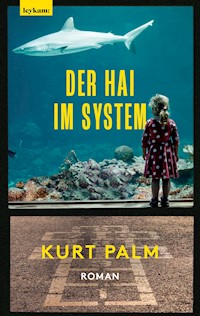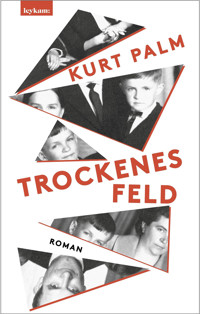Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Residenz
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sie sind überall. Und niemand weiß, woher sie kommen ... Der Journalist Martin Koller liegt im Krankenhaus und kann nicht schlafen. Er wird von merkwürdigen Ohrgeräuschen gepeinigt, die ihn in eine tiefe Depression stürzen. Dass seine Frau um jeden Preis ein Kind von ihm will und ihm ein junger ehrgeiziger Kollege in seine Recherchen im rechtsextremen Milieu hineinpfuscht, macht es nicht besser. Da erfährt er, dass seine Mutter im Sterben liegt. Er rafft sich auf und macht sich auf den Weg zurück in den Ort seiner Kindheit. Ein paar Tage ist er mit seiner Mutter allein. Dann kommen sie, die Besucher, und nehmen das ganze Haus in Beschlag. Sie sind überall: im Keller, in den Zimmern, auf dem Dachboden. Niemand weiß, woher sie kommen, niemand weiß, was sie wollen. Eine Ärztin, die Martin noch aus Jugendtagen kennt, ruft ihn an sie hat eine rätselhafte Entdeckung gemacht. Ein Alptraum beginnt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 319
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kurt Palm Die Besucher
Kurt Palm
Die Besucher
Roman
Residenz Verlag
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek:Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in derDeutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografischeDaten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
www.residenzverlag.at
© 2012 Residenz Verlagim Niederösterreichischen PressehausDruck- und Verlagsgesellschaft mbSt. Pölten – Salzburg – Wien
Alle Urheber- und Leistungsschutzrechte vorbehalten.Keine unerlaubte Vervielfältigung!
ISBN ePub:978-3-7017-4273-8
ISBN Printausgabe:978-3-7017-1587-9
Für Anna, Stefan, Zula, Zwillek, Sphinx und Dworschak.
Und die siebzehn magischen Weintrauben. Und Miguelita.
Inhalt
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Was ist das Leben? Ein Schlag ins Gesicht mit einem nassen Handtuch.
Joan Aiken, »Die Kristallkrähe«
I
I’m lost in the confusion.R.E.M., »Hope«
Martin Koller konnte nicht schlafen. Seit Stunden wälzte er sich im Bett hin und her und versuchte krampfhaft, eine halbwegs bequeme Schlafposition zu finden. Aber es nützte alles nichts. Das Rauschen in seinem linken Ohr wurde immer lauter, und er hatte das Gefühl, als würde jeden Augenblick sein Schädel explodieren. Sieben Tage und Nächte ging das jetzt schon so, und Martin spürte, wie ihn langsam seine Kräfte verließen. Die Digitalanzeige auf der abgegriffenen Konsole, die in einer Vorrichtung neben seinem Bett steckte, leuchtete schwach. Martin sah, dass es erst halb neun war. Zwei Stunden zuvor hatte ihm die Nachtschwester Schlaftabletten gegeben, aber trotz der erhöhten Dosis schaffte er es nicht, die Lärmmauer in seinem Ohr zu durchbrechen und in ruhigere Zonen seines Gehirns vorzudringen.
Wenn das so weitergeht, werde ich noch verrückt, dachte er. Martin spürte, wie sein Herz vor Angst schneller zu schlagen begann. Er schaltete das Licht über seinem Bett ein und griff nach dem kleinen Fläschchen auf dem Nachttisch. Sonia, eine der indischen Krankenschwestern auf der Station, hatte ihm dieses Öl gegeben und gemeint, dass es bei Panikattacken beruhigend wirken würde. Sie hatte Martin erzählt, dass sich ihr Mann, der unter schweren Herzrhythmusstörungen litt, damit immer die Brust einrieb, sobald sich bei ihm ein neuer Anfall ankündigte. Sonia und ihr Mann Harideo stammten aus dem Bundesstaat Rajasthan. Harideo arbeitete ebenfalls im Krankenhaus, und zwar »tief unten in der Wäscherei«, wie sie sich ausgedrückt hatte. Ein wenig gewundert hatte sich Martin, dass er dieses Öl – es unterstützt die Selbstheilungskräfte des Organismus und fördert damit die Gesundung von Körper, Geist und Seele – von einer Krankenschwester bekommen hatte und nicht von einem Arzt. Andererseits hatte ihm am Vortag Schwester Grazyna einen Madonnenanhänger samt einer Broschüre über Die Wunder Unserer Lieben Frau von der Heiligen Linde im polnischen Marienwallfahrtsort Święta Lipka geschenkt. Offenbar war man auf der HNO-Station des Krankenhauses alternativen Heilmethoden gegenüber also durchaus aufgeschlossen.
Martin knöpfte seine Pyjamajacke auf und massierte das Öl unterhalb der linken Brust in die Haut ein. Er bezweifelte zwar, dass es etwas half, aber in seinem gegenwärtigen Zustand hätte er sich wahrscheinlich sogar einer Geistheilerin anvertraut. Er drückte die Hand gegen die Brust und spürte die pochenden Schläge seines Herzens. Sofort machte sich wieder die Angst in ihm breit, dass sich sein Zustand nicht mehr bessern würde. Er erinnerte sich, dass der Arzt bei der letzten Visite etwas von einem Infarkt im Innenohr gesagt hatte, und überlegte, was das bedeuten könnte. Ein Infarkt ist ja schließlich keine Kleinigkeit. Also kann es durchaus sein, dass es länger dauert, bis sich die ganze Sache wieder normalisiert hat. Er versuchte sich zu beruhigen, was ihm aber nicht gelang. Er griff nach dem Menüzettel, der neben dem leeren Geschirr auf dem Tablett lag, und fragte sich, in welchem Stadium der Zersetzung sich die vier Gänge seines Abendessens bereits befanden:
1 Scheibe Leberkäse1 Erdäpfelpüree1 Bummerlsalat1 Joghurtdressing614 KCal.
Er drehte den Zettel um und schrieb auf die Rückseite: 10. November: Mein neues Leben: Nie wieder Stille. Eine Horrorvorstellung. Gefangen im Labyrinth der Angst und des Erdäpfelpürees. Scheiße, Amen!
Am Nachmittag hatte er im Aufenthaltsraum neben dem Schwesternstützpunkt ein zerfleddertes Buch gefunden, in dem die schematische Darstellung eines Innenohrs abgebildet war. Merkwürdigerweise war in der entsprechenden Erläuterung ebenfalls von einem Labyrinth die Rede: Das Innenohr ist ein komplex gestalteter Hohlraum im Felsenbein, der als knöchernes Labyrinth (Labyrinthus osseus) bezeichnet wird. Es ist von einem Knochenmaterial umgeben, das nach dem Zahnschmelz das härteste Material im menschlichen Körper ist.
Martin hatte zwar keine Ahnung, worum es hier im Detail ging, aber das mit dem Labyrinth leuchtete ihm irgendwie ein. Wahrscheinlich war ein Fremdkörper in das Labyrinth seines Innenohrs gelangt und fand nicht mehr hinaus. Wie dieses Ding aber dort hineingekommen war und was es dort suchte, war ihm freilich ein Rätsel.
Über die Ursache seines schweren Hörsturzes hatten sich die Ärzte bisher in Schweigen gehüllt. Die häufigste Antwort, die er auf seine diesbezüglichen Fragen erhielt, lautete: Stress. Ein Assistenzarzt, den er gleich am ersten Tag auf dem Gang angesprochen hatte, meinte allerdings, dass Stress eine doch eher unspezifische Diagnose sei. Eine Einschätzung, die Martin Koller durchaus teilte.
Natürlich hatte er Stress. Wer hatte den nicht? Die serbische Putzfrau, die jeden Tag um sechs Uhr in der Früh sein Zimmer putzte – was er ihr aber meistens verbot, weil er den Lärm, den sie dabei machte, nicht aushielt -, hatte wahrscheinlich genauso viel Stress wie die indische Nachtschwester mit dem herzkranken Mann. Und der pakistanische Zeitungsverkäufer, der vormittags die Zimmer abklapperte, hatte sicher nicht weniger Stress als der österreichische Assistenzarzt, der oft sechsunddreißig Stunden ohne Unterbrechung arbeitete. Martin vermutete, dass Stress für die behandelnden Ärzte deshalb die naheliegendste Diagnose war, weil er als Journalist einen Beruf ausübte, der landläufig mit Stress in Verbindung gebracht wurde.
Er drückte den Knorpel seines linken Ohrs gegen den Gehörkanal. Es war, als wäre sein Ohr nicht nur betäubt, sondern auch mit Watte vollgestopft. Dazu kamen dieser unerträgliche Druck und das Rauschen, durch das er alles nur noch verzerrt wahrnahm. Das war auch der Grund, weshalb er sein Zimmer nicht mehr verlassen wollte. Die Ärzte hatten ihm zwar geraten, »zur Entspannung« nach unten in eine dieser deprimierenden Cafeterias zu gehen, aber Martin war froh, wenn er alleine sein konnte.
Zwei Tage zuvor hatte er einen Test gemacht und war ins Erdgeschoß gefahren, um am Geldautomaten im Foyer seinen Kontostand zu überprüfen. Es war die Hölle gewesen. Nicht nur, dass er seine eigenen Schritte asynchron hörte, verwirrten ihn die vielen unterschiedlichen Geräusche derart, dass er das Gefühl hatte, von seiner Umwelt komplett abgeschnitten zu sein. Es war, als würde er sich in einem eigenen Lärmuniversum bewegen. Als er dann am Bankomaten einen jungen Mann sah, dessen linker Arm amputiert worden war, dachte er: Wenn ich könnte, würde ich meinen Hörsturz gegen seinen amputierten Arm tauschen. Dass dem jungen Mann die Bankomatkarte ständig zu Boden fiel und dass er beinahe in Tränen ausbrach, weil ihm die einfachsten Handgriffe Probleme bereiteten, war Martin gar nicht aufgefallen.
Draußen flog ein Rettungshubschrauber vorbei. Obwohl die Fenster geschlossen waren, war das Motorengeräusch unerträglich laut, und Martin war froh, als der Hubschrauber wieder im Nebel verschwand. Er dachte an den Mann mit dem amputierten Arm und fragte sich, ob man ihn wohl auch mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht hatte. Martin betrachtete nachdenklich seinen Arm.
Er ging zum Fenster und sah hinaus auf die nächtliche Dachlandschaft. Vom fünfzehnten Stockwerk erinnerte das nebelverhangene Dachgewirr an die Kulisse eines Horrorfilms aus den zwanziger Jahren. Das monotone Geräusch des niederprasselnden Regens war für Martin einigermaßen erträglich. Sobald er sich allerdings das gesunde Ohr zuhielt, hörte er keinen Regen mehr, sondern nur noch ein bedrohliches Rauschen. Das linke Ohr war tot. Tot wie sein Spiegelbild im Fenster. Mit den schwarzen Bartstoppeln und den wirr abstehenden Haaren sah er aus wie ein Obdachloser. Seit er hier war, hatte er nicht mehr geduscht und die Körperpflege auf ein Minimum reduziert. In seinem gegenwärtigen Zustand hätte er weder das Brummen des Rasierapparats noch das Plätschern der Dusche ausgehalten. Auch die Klospülung betätigte er nur nach dem Scheißen. Aus diesem Grund roch es im WC auch immer leicht nach Urin. Unter anderen Umständen wäre ihm das wegen der Putzfrauen peinlich gewesen, aber jetzt war ihm das gleichgültig.
Durch sein Spiegelbild hindurch sah Martin auf die Häuser der Stadt, und er beneidete die Menschen, die zufrieden in ihren Wohnungen saßen und keine Ahnung von Hörstürzen hatten. Allerdings wunderte er sich, dass nur in ganz wenigen Fenstern Licht war. Das Bild erinnerte ihn an die Oper Die tote Stadt, die er einige Wochen zuvor gesehen hatte. Paula hatte ihn mitgeschleppt, und er war peinlich berührt gewesen, als er bei der Arie Glück, das mir verblieb eine Gänsehaut bekam.
Musst du einmal von mir gehn,glaub, es gibt ein Auferstehn.
In der Ferne hörte er die Folgetonhörner von Feuerwehrautos und die Sirenen von Polizeifahrzeugen. Er dachte an die jüngsten Brandanschläge, verdrängte den Gedanken aber gleich wieder.
Martin setzte sich auf die Bettkante und stierte auf den grauen Boden aus Linoleum. Das kann doch nicht sein, dass ich mit meinen zweiundvierzig Jahren bereits am Ende angelangt bin. Er spürte, wie sich sein Magen zusammenzog. Bleib ruhig und reiß dich zusammen, du darfst jetzt nicht hysterisch werden. Er stand auf und ging im Zimmer auf und ab. Vor dem Kreuz über der Tür kniete er sich nieder und faltete die Hände. »Oh Gott, hilf mir«, murmelte er. Er hoffte, dass nirgendwo im Zimmer eine Kamera installiert war.
Im Bad wusch er sich das Gesicht mit eiskaltem Wasser. Er sah in den Spiegel und betrachtete sein linkes Ohr, das von außen ganz normal aussah. Vielleicht sollte ich mir dieses verdammte Ohr einfach abschneiden und es einem Hund zum Fraß vorwerfen.
Er ging zurück in das Zimmer und nahm ein Buch aus der Lade seines Nachttischchens. Satanische Fausthiebe hieß das Werk, das von einem gewissen Franz Pigarella stammte. Der Titel bezog sich auf einen Brief Martin Luthers, in dem dieser von einer schweren Hörsturz-Attacke berichtete, die er mit satanischen Fausthieben verglich. Auch hinter den damit verbundenen quälenden Ohrgeräuschen vermutete Luther den schwarzen, zottigen Gesellen aus der Hölle.
Für einen HNO-Patienten war Pigarellas Buch alles andere als ermutigend. Daran änderte auch die Tatsache nichts, dass der Autor immer wieder versuchte, einen optimistischen Ton anzuschlagen. Aber irgendwie schien Pigarella selbst nicht zu glauben, was er über die Heilungschancen bei Tinnitus, Drehschwindel und Hörsturz schrieb. Halbherzige Versuche in diese Richtung wurden sofort zunichte gemacht durch Schilderungen wie jener Jean-Jacques Rousseaus, der über seinen ersten Hörsturz schrieb: Als ich eines Morgens, an dem es mir schlechter ging als sonst, eine kleine Tischplatte auf ihrem Fuße richtete, fühlte ich in meinem ganzen Leibe einen plötzlichen, fast unvorstellbaren Aufruhr. Ich kann es nur mit einer Art Sturm vergleichen, der sich in meinem Inneren erhob und im selben Augenblick durch alle Glieder tobte. Meine Arterien begannen derart heftig zu schlagen, daß ich das Klopfen nicht mehr fühlte, sondern sogar hörte, vor allem die Kopfschlagader. Dazu ein starkes Ohrenbrausen, so daß es wie ein drei- und vierfacher Lärm war, nämlich ein tiefes, dumpfes Sausen, ein helleres Rauschen wie von fließendem Wasser, ein schrilles Pfeifen und das geschilderte Pochen, dessen Schläge ich leicht zählen konnte, ohne mir den Puls zu fühlen oder meinen Körper mit den Händen zu berühren. Dieser innere Lärm war so groß, daß er mir mein bisher gutes Gehör raubte und mich zwar nicht ganz taub, aber so schwerhörig machte, wie ich es seither bin. Man kann sich meine Überraschung und meinen Schrecken denken!
Bei Martin war es kein Sturm im Inneren gewesen, sondern ein unbestimmtes Angstgefühl, das ihn erfasst hatte, als er am 3. November spät in der Nacht vor dem Fernseher saß und sich Raging Bull von Martin Scorsese ansah. Wie üblich hatte er nach der Arbeit ein Bier getrunken und später beim Abendessen mit Paula die Weißweinflasche fast im Alleingang geleert. Im Laufe der Jahre hatte es sich irgendwie ergeben, dass Martin beim Essen mindestens doppelt so viel trank wie seine Frau. Obwohl Paula und er das wussten, vermieden sie es tunlichst, über dieses Thema zu sprechen. In den letzten Jahren hatte sich Martin zwar ab und zu gefragt, ob er Alkoholiker sei, die Frage aber stets verneint. Auch beim Aufnahmegespräch im Krankenhaus hatte er gelogen und gesagt, dass er nur »gelegentlich« Alkohol trinke. Dabei konnte sich Martin gar nicht mehr an den Tag erinnern, an dem er zuletzt keinen Alkohol getrunken hatte.
Aber das spielte alles keine Rolle mehr, denn das Einzige, was Martin seit einer Woche beschäftigte, war das quälende Geräusch in seinem Ohr und die damit verbundene Angst, dass alles noch schlimmer werden könnte. Ihn interessierte weder, was in der Redaktion vor sich ging, noch, ob Bayern München verloren hatte – worauf er jedes Wochenende ohnehin meist vergeblich hoffte. Nicht einmal Sex interessierte ihn.
Als ihm bewusst wurde, dass er in all den Tagen kein einziges Mal an seine schwer kranke Mutter gedacht hatte, erschrak er und schaltete schuldbewusst sein iPhone ein. Er wählte die Nummer seiner Schwester und schickte ihr eine SMS. wie geht es mama? lg martin.
Sofort schaltete er sein Handy wieder aus. Es reicht ja, wenn ich morgen einen Blick in die E-Mails werfe, dachte er, und er hoffte, dass ihm keiner seiner Arbeitskollegen oder Freunde eine SMS geschickt hatte. Paula hatte er bereits am ersten Tag seines Krankenhausaufenthalts gebeten, allen zu sagen, dass er auf keinen Fall besucht werden wolle.
Martin saß auf dem Bett und starrte auf die gegenüberliegende Wand. Sie lag im Halbdunkel und starrte zurück. Neben dem Rauschen in seinem linken Ohr hörte er leicht verzerrt das monotone Brummen der Klimaanlage und das Prasseln des Regens. Seitdem er das Licht über dem Bett eingeschaltet hatte, waren gerade einmal zwanzig Minuten vergangen. Er fragte sich, wie er die nächsten Stunden überstehen sollte, ohne durchzudrehen. Die Nachtschwester hatte ihm auf seine Bitte hin zwar eine stärkere Schlaftablette gegeben, aber selbst diese zeigte keine Wirkung. Fernsehen konnte er nicht, weil ihm der Ton Schmerzen bereitete. Und lesen wollte er nicht, weil er sich nicht konzentrieren konnte.
Er musste an einen Satz denken, über den er sich zwei oder drei Wochen zuvor mit Paula unterhalten hatte. Paula, die an einem Gymnasium Deutsch und Musik unterrichtete, hatte ihn beim Abendessen gefragt, ob er je etwas von Theodor Fontane gelesen habe. Martin hatte verneint. Er erinnerte sich zwar vage an eine Verfilmung von Effi Briest, aber das war alles, was er von Fontane kannte. Paula sprach über den Roman Der Stechlin und zitierte irgendwann einen Satz, an den Martin jetzt denken musste: Das Leben ist kurz, aber die Stunde ist lang. Martin rechnete sich aus, dass bis zum morgendlichen Besuch der Putzfrau noch neun Stunden vergehen mussten. In neun Stunden konnte man von Wien nach New York fliegen oder in einem Bett im fünfzehnten Stockwerk eines Krankenhauses liegen, an die Wand starren und dabei langsam verrückt werden.
Martin schob die Pyjamahose hinunter und massierte seinen Pimmel. Früher, als er noch alleine gelebt hatte, funktionierte die Onanietherapie bei Schlaflosigkeit meist ganz gut. Seitdem er aber mit Paula zusammenwohnte, musste er notgedrungen auf diese Einschlafhilfe verzichten. Stattdessen trank er einfach mehr Alkohol. Jetzt spürte er allerdings überhaupt nichts, wenn er seinen Pimmel berührte. Ach, du heilige Scheiße, bin ich jetzt auch noch impotent geworden? Martin warf einen verunsicherten Blick auf sein runzeliges Ding und zog sofort wieder die Hose hinauf. Er überlegte, ob er sich auf seinem iPhone Pornos ansehen sollte, aber selbst dazu fehlte ihm die Lust. Zwei Tage zuvor hatte er es einmal versucht, war aber immer nur auf Schmuddelseiten gelandet, wo durchgeknallte Hausfrauen zwischen zwanzig und sechzig ihre Mosen in irgendwelche Billigkameras hielten. Es war einfach nur erbärmlich.
Einer der Assistenzärzte hat doch gestern gesagt, dass die Infusionen auch noch später wirken könnten. Martin versuchte sich zu beruhigen und griff nach dem Blatt Papier, auf dem er sich zuvor bereits ein paar Notizen gemacht hatte: 21 Uhr 07: Worauf ich hoffe: Selbstheilungskräfte; Akupunktur. Er dachte angestrengt nach, aber mehr fiel ihm dazu nicht ein. Er strich die beiden Wörter wieder durch und schrieb darunter: Schas im Wald.
In dem Buch von Pigarella stand, dass es bei Hörsturz und Tinnitus zunächst einmal darum gehe, die tieferen Ursachen dieser Erkrankung herauszufinden: Diese Zeiten schwerster innerer Not können eine Chance sein, unerledigte Angelegenheiten aufzuarbeiten. Die Krankheit als »Scheinlösung« erzwingt das notwendige Herausreißen aus gefährlichen Situationen.
Martin musste die Passage zweimal lesen, um sie zu verstehen, und fragte sich, was der Autor mit unerledigten Angelegenheiten und gefährlichen Situationen meinte. Er griff nach dem Zettel, der dem Mittagessen beigelegt gewesen war -
1 italienische Gemüsesuppe1 Sauce Concassée mit Reibkäse1 gebr. Knacker1 Bummerlsalat1 French-Dressing1 Marillenobersroulade1058 KCal.
- und schrieb auf die Rückseite in Großbuchstaben UNERLEDIGTE ANGELEGENHEITEN. Dann dachte er nach und notierte:
• Versöhnung mit dem Bruder• Mama besuchen und mit ihr reden• Neues Auto kaufen• Fensterdichtungen auswechseln
Aber Martin merkte, dass er sich nicht konzentrieren konnte. Der Druck im Ohr und das Rauschen quälten ihn so sehr, dass er Zettel und Kugelschreiber erschöpft zur Seite legte. Er atmete tief durch und überlegte, ob er sich von der Nachtschwester noch eine Schlaftablette geben lassen sollte. Ohne Rücksprache mit dem diensthabenden Arzt würde sie ihm aber keine aushändigen, und da der Arzt wahrscheinlich bereits schlief, standen seine Chancen schlecht. Vor ein paar Tagen hatte Martin die indische Nachtschwester Anandita so lange um eine stärkere Schlaftablette angebettelt, bis sie schließlich den Arzt weckte. Der hatte Martin aber nur angeschnauzt, dass er kein Theater machen und sich gefälligst wieder hinlegen solle.
Die Krankheit als »Scheinlösung« erzwingt das notwendige Herausreißen aus gefährlichen Situationen. Das würde also heißen, sinnierte Martin, dass mich die Krankheit vor einer Gefahr gerettet hätte? Das ist doch absoluter Schwachsinn. Okay, ich bin nicht besonders glücklich mit meinem Leben, aber wer ist das schon? Deshalb aber von einer gefährlichen Situation zu sprechen, ist doch absurd. Ich kapiere das alles nicht. Wenn der Hörsturz tatsächlich die logische Folge meines bisherigen Lebens wäre, müsste jeder in meiner Umgebung einen Hörsturz haben. Am meisten irritierte Martin, dass die Ärzte bisher keine organische Ursache für seine Leiden gefunden hatten. Sie hatten seinen Kopf in die Röhre gesteckt, hatten seine Halsschlagadern mit Ultraschall untersucht, hatten ihm Blut abgenommen – und immer hieß es: »Alles ist in bester Ordnung.« Aber Martin wusste, dass nichts in Ordnung war, schon gar nicht in bester Ordnung.
Wieder stieg die Angst in ihm auf, und er fragte sich, ob er die restlichen vierzig Jahre seines Lebens in diesem Zustand würde verbringen müssen. Martin zwang sich, an etwas Schönes zu denken. Er stellte sich vor, dass er auf der kleinen griechischen Insel Kasos mit einer Flasche Retsina am Strand saß und den Sonnenuntergang beobachtete. Er versuchte zu lächeln, aber es gelang ihm nicht. Es gelang ihm nicht, weil er wusste, dass er mit diesem Geräusch im Ohr nie mehr einen Sonnenuntergang würde genießen können. Überhaupt würde er nichts mehr in seinem Leben genießen können. You can run, but you can’t hide.
Eine fette Fliege flog auf das Fenster zu und stieß gegen das Glas. Sie wollte nicht wahrhaben, dass sie nicht mehr weiterkonnte, und blieb irgendwann einfach sitzen. Martin hatte keine Ahnung, woher die Fliege gekommen war. Er stand auf, griff nach ihr und fragte sich, ob auch Fliegen einen Hörsturz bekommen können. Dann kippte er das Fenster und entließ sie in die regnerische Nacht. Wahrscheinlich würde sie vom nächsten schweren Tropfen erschlagen werden.
Er ging im Zimmer auf und ab und spürte, wie sich pure Verzweiflung in ihm breit machte. Er nahm einen Kugelschreiber und schrieb in Großbuchstaben KEINE ANGST! auf seinen linken Unterarm. Er betrachtete die beiden Worte, aber er hätte genausogut GUTEN APPETIT! schreiben können.
Das erste Gefühl, an das ich mich erinnere, war Angst. Angst, dass die Eltern sterben könnten, Angst, alleingelassen zu werden, Angst, nicht geliebt zu werden. Angst, Angst, Angst. Martin dachte nach. Sind das die unerledigten Angelegenheiten, die Franz Pigarella in seinem Buch meinte? Er ging ins Bad und wusch sich die beiden Worte mit Seife herunter. Das ist doch alles Schwachsinn. Ich habe ein ganz normales Leben geführt, wie jeder andere Mensch auch, und die anderen haben auch keinen Hörsturz bekommen. Verdammte Scheiße noch einmal!
Martin setzte sich auf die Bettkante und schloss die Augen. Das Geräusch in seinem Ohr war jetzt so laut, dass er am liebsten mit dem Kopf gegen die Wand gerannt wäre. Er konnte verstehen, warum sich Vincent van Gogh aus Verzweiflung über seinen Tinnitus das rechte Ohr abgeschnitten hatte. Oder war es das linke gewesen? Wie auch immer. Genützt hatte es ihm bekanntlich nichts, denn eineinhalb Jahre später schoss er sich eine Kugel in die Brust.
Als langjähriger Ministrant und Mitglied der Katholischen Jungschar war Martin mit dem Neuen Testament einigermaßen vertraut. Er erinnerte sich vage an ein Evangelium, in dem die Rede davon war, dass man sich lieber eine Hand oder einen Fuß abhacken oder ein Auge ausreißen solle, bevor man mit ihnen eine Sünde begehe. Jetzt erst fiel Martin auf, dass in diesem Evangelium das Ohr nicht erwähnt wurde. Auch hieß es im Alten Testament ausdrücklich Aug um Aug, Zahn um Zahn und nicht Aug um Aug, Ohr um Ohr.
Vor einer Woche war sein Leben noch in normalen Bahnen verlaufen. Plötzlich, von einer Minute auf die andere, war es damit vorbei gewesen. Wie und warum das alles passiert war, war Martin ein Rätsel. Und zwar ein großes Rätsel. Irgendeinen Auslöser für diesen Infarkt des Innenohrs musste es doch gegeben haben. Mit seinen Ohren hatte er noch nie größere Probleme gehabt. Er konnte sich nicht einmal erinnern, ob er als Kind die obligaten Mittelohrentzündungen gehabt hatte. Und selbst wenn, würde das längst nicht erklären, weshalb er jetzt hier saß und sklavisch dazu verdammt war, auf dieses Geräusch in seinem Ohr zu hören.
Martin ließ den Abend des 3. November noch einmal Revue passieren. Nach der Arbeit war er mit seinem Kollegen, dem Fotografen Clemens Berndorfer, noch auf ein Bier gegangen. Eigentlich waren es zwei gewesen, aber das war ja nichts Ungewöhnliches. Zu Hause hatte er mit Paula dann Lasagne gegessen und dazu den größten Teil einer Flasche Weißwein getrunken. Auch das war nichts Ungewöhnliches. Anschließend hatte sich Paula in ihr Arbeitszimmer zurückgezogen, und Martin hatte sich mit einer Flasche Bier vor den Fernsehapparat gesetzt. Die Sendungen auf ORF 1 (Willkommen Österreich – Idioten ist nichts verboten) und ORF 2 (Der Bergdoktor – Das Drama in der Gletscherspalte) bewiesen einmal mehr, dass die Fernsehlandschaft in Österreich längst einer Wüste auf einem öden Planeten glich.
Martin hatte von einem Sender zum anderen geschaltet und war schließlich bei Raging Bull hängen geblieben. In der Mitte des Films hatte er das Gefühl bekommen, dass mit seinem linken Ohr etwas nicht stimmte. Es fühlte sich an, als wäre es verstopft. Er gähnte ein paar Mal, was aber nichts nützte. Dann kam ein Rauschen dazu, und Martin wurde ein wenig nervös. Er stand auf und hüpfte von einem Fuß auf den anderen, so, wie er es als Kind nach dem Baden getan hatte, wenn Wasser in die Ohren gekommen war. Wie Rumpelstilzchen, das ums Feuer tanzte. Paula kam aus ihrem Arbeitszimmer und fragte, was los sei. »Nichts«, antwortete Martin, »ich gehe jetzt ins Bett, ich bin müde.«
In der Nacht wurde ihm dann allmählich klar, dass in seinem Kopf etwas Eigenartiges vor sich ging. Was es war, wusste er nicht. Am nächsten Morgen blieb er im Bett liegen, bis Paula die Wohnung verlassen hatte. Er überlegte, ob er sofort ins Krankenhaus fahren sollte, entschied sich dann aber doch für die Redaktion. Während der morgendlichen Sitzung sah er ständig auf die Uhr und hörte nur mit einem Ohr zu. Aus diesem Grund bekam er auch nur am Rande mit, dass in seinem Ressort ein neuer Volontär eingestellt werden sollte. Nach der Sitzung bat er einen Kollegen, seinen Artikel fertigzuschreiben, und fuhr direkt ins Krankenhaus.
Wegen des Regens war die U-Bahn komplett überfüllt. Obwohl es erst kurz nach elf war, sahen die meisten Menschen abgekämpft und erschöpft aus. Diejenigen, die nicht telefonierten oder eine Gratiszeitung lasen, starrten ins Leere. Einige husteten, ohne sich die Hand vor den Mund zu halten. Die feuchte Luft im Waggon verstärkte den Geruch nach Zigaretten, Schweiß und abgestandenem Essen. Martin hoffte inständig, diesen deprimierenden Ort bald verlassen zu können.
Wenig später saß er in der Notaufnahme auf einem harten Plastikstuhl. Er brauchte einige Zeit, um sich in dem Durcheinander zurechtzufinden. Vor der Urologie krümmte sich ein Mann im Rollstuhl, ohne dass jemand Notiz von ihm genommen hätte. An der Wand neben der Gynäkologie lehnte eine schwangere Frau, die mit den Tränen kämpfte. Auf der Bank neben der Orthopädie saß ein nach vorne gebeugter Mann, der in einem fort »Bosche Moi« stöhnte. Vor der Augenabteilung wartete ein junger Bursche in einer blauen Arbeitsmontur, dessen rechtes Auge mit einer blutdurchtränkten Bandage verbunden war. Und neben Martin saß ein vielleicht fünfjähriger türkischer Junge, der aus dem linken Ohr blutete und vor Schmerzen brüllte. Die Beruhigungsversuche seiner Mutter halfen da nicht viel.
Eine Putzfrau schob stoisch ihren Wagen durch den Gang und wischte mit ihrem Mopp den von den nassen Straßenschuhen verdreckten Boden auf. Durch das ständige Kommen und Gehen wurde der feuchte Boden aber nur noch dreckiger. Als sie um Martins Füße herumwischte, konnte er auf dem Namensschild ihrer grünen Uniform den Namen Slavenka Rukavina lesen.
Martin fühlte sich elend und fragte sich, ob es nicht besser gewesen wäre, einfach nach Hause zu gehen. Aber wegen der Angst, die in ihm aufstieg, entschied er sich, weiter zu warten. Nach drei nervenaufreibenden Stunden wurde schließlich sein Name aufgerufen.
Martin wurde gebeten, auf einem Behandlungsstuhl Platz zu nehmen. Eine Krankenschwester lehnte mit verschränkten Armen am Tisch und wartete auf Anweisungen. Die behandelnde Ärztin war nicht älter als dreißig und hieß laut Namensschild Dr. Franziska Krommer. Sie warf einen kurzen Blick in die Patientenmappe und stellte routinemäßig ein paar Fragen.
»Seit gestern Abend hören Sie also schlecht auf dem linken Ohr und haben ein starkes Rauschen. Ist das plötzlich gekommen oder haben Sie das schon länger?« Die Ärztin griff nach einer Stimmgabel.
»Nein, nein, das ist ganz plötzlich gekommen, beim Fernsehen, und ich habe keine Ahnung, was das überhaupt sein könnte. Aber für mich –«
»In Ordnung«, sagte Doktor Krommer und schlug mit der Stimmgabel gegen ihr Knie. Sie hielt die Gabel zuerst an Martins rechtes, dann an sein linkes Ohr. »Und, was hören Sie?«
»Na ja.« Martin war verunsichert. »Rechts höre ich diesen Ton normal, aber links habe ich gar nichts gehört.«
Die Ärztin schaltete ihre Stirnlampe ein und schaute Martin in den Mund, die Nase und die Ohren. »Da kann ich nichts erkennen. Haben Sie als Journalist viel Stress im Beruf?«
Martin zuckte mit den Schultern. »Schwer zu sagen, wahrscheinlich schon, ich weiß nicht.«
Doktor Krommer klopfte mit einem winzigen Gummihammer auf die Knochen hinter Martins linkem und rechtem Ohr. »Und?«
»Rechts höre ich etwas, aber links höre ich nichts.«
»Sie machen jetzt bitte einen Hörtest und kommen dann wieder zu mir. Wahrscheinlich haben Sie einen Hörsturz. Außerdem sehen Sie so aus, als ob Sie ein Burnout hätten.« Die Ärztin stand auf und überreichte der Krankenschwester die Mappe.
Eine halbe Stunde später studierte Doktor Krommer das Audiogramm, das ihr die Krankenschwester gegeben hatte. »Ja, wie ich vermutet habe. Fünfzig dB im Tieftonbereich, das sieht nach einem schweren Hörsturz aus. Schwester, fahren Sie bitte mit Herrn Koller auf die Station. Ich rufe oben an, dass für Sie ein Bett hergerichtet wird.«
»Entschuldigen Sie, aber was heißt das?« Martin war verwirrt. »Sie meinen, dass ich hierbleiben muss? Aber ich weiß ja gar nicht, was ein Hörsturz ist. Was passiert denn jetzt mit mir? Außerdem muss ich ja zurück in die Redaktion. Ich habe schließlich einen Job, der –«
»Herr Koller«, sagte die Ärztin, während sie sich die Hände wusch, »so wie ich das sehe, haben Sie einen schweren Hörsturz, verbunden mit einem Burnout. Es ist gut, dass Sie gleich zu uns gekommen sind, aber die Details müssen Sie mit den Kollegen auf der Station besprechen. Wir sehen uns morgen bei der Visite. Jetzt muss ich mich um die anderen Notfälle kümmern. Alles Gute.«
Beim Aufnahmegespräch auf der Station hatte sich wenig später herausgestellt, dass bis auf ein Einzelzimmer alle Betten belegt waren. Für Martin, der keine Zusatzversicherung hatte und demnach in einem Dreibettzimmer hätte liegen müssen, war das ein Glücksfall gewesen. Das Röcheln und Schnarchen der frisch Operierten hätte er in seinem Zustand wahrscheinlich nicht ertragen.
Martin starrte an die Wand und stellte sich die drei Patienten vor, die im Nebenzimmer in ihren Betten lagen und litten. Wann immer er sein Zimmer verließ, um sich Tee oder Mineralwasser zu holen, stieß er auf Männer und Frauen, denen irgendwelche Kanülen aus dem Kehlkopf hingen oder deren Ohren einbandagiert waren. Die meisten von ihnen trugen die blau gestreiften Pyjamas oder Nachthemden des Krankenhauses und sahen darin aus wie Insassen eines Gefängnisses. Und gewissermaßen waren sie ja auch Gefangene, Gefangene ihrer Krankheiten. Obwohl Martin bereits seit einer Woche auf der Station lag, hatte er es bisher vermieden, sich mit diesen Patienten zu unterhalten. Ihre Geschichten hätten ihn nur noch mehr deprimiert.
Die digitale Uhr auf der Konsole neben seinem Bett zeigte an, dass es noch nicht einmal halb zehn war. In den letzten sieben Nächten hatte er es jeweils auf durchschnittlich zwei Stunden Schlaf gebracht, und er fragte sich, wie lange er es noch aushalten würde, ohne durchzudrehen. Martin schloss die Augen und versuchte, sich auf etwas anderes zu konzentrieren. Er stellte sich vor, dass die junge Krankenschwester mit den langen, roten Haaren hereinkam und sich vor ihm auszog. Aber jedes Mal, wenn sie begann, die Knöpfe ihrer weißen Schwesterntracht zu öffnen, wurde das Rauschen in seinem Ohr so laut, dass es seine ganze Aufmerksamkeit auf sich zog. Nach mehreren Versuchen gab Martin frustriert auf und ging ins Bad.
Er wusch sich mit kaltem Wasser das Gesicht und starrte in den Spiegel. Die tiefliegenden Augen erinnerten ihn an seinen Vater, der an seiner Stelle wahrscheinlich nicht einmal zum Arzt gegangen wäre. Der hätte die Zähne zusammengebissen und so getan, als wäre nichts geschehen.
Martin wurde wütend, als er daran dachte, dass sein Vater sich in den vierzig Jahren, die er Vorarbeiter im Eternitwerk in Rodt gewesen war, seine Lungen ruiniert hatte. Dass er schließlich an einem kleinzelligen Lungenkarzinom gestorben war, war für einen Arbeiter der Eternitwerke nichts Außergewöhnliches. Der Primar der Lungenstation, auf der sein Vater behandelt wurde, hatte zwar gemeint, dass Asbest als Ursache des Krebses mit hoher Wahrscheinlichkeit in Frage komme, wollte aber nicht ausschließen, dass auch der jahrzehntelange Zigarettenkonsum seines Vaters Auslöser der Krankheit hätte sein können. Das war auch der Grund, weshalb im Totenbeschauschein als Todesursache nicht die Berufskrankheit Asbestose, sondern multiples Organversagen stand. Dieser auf den ersten Blick unbedeutende Eintrag führte in weiterer Folge dazu, dass Martins Mutter keine Zusatzpension bekam.
Martins Vater war im Sommer 2001 im fünfundsechzigsten Lebensjahr gestorben, und während Martin mit einer gewissen Abscheu sein Spiegelbild betrachtete, fragte er sich, ob er sich bei seinem Vater je für das bedankt hatte, was der für ihn getan hatte. Aber Martin musste nicht lange nachdenken, um zu wissen, wie die Antwort auf diese Frage ausfallen würde. Als er 1999 um Weihnachten herum erfahren hatte, dass sein Vater an Krebs erkrankt war, war Martin dreißig und sein Verhältnis zu seiner Familie alles andere als gut gewesen. Den Familienkonflikten wich er aus, indem er so selten wie möglich nach Hause fuhr. Auf diese Weise ersparte er sich auch die zermürbenden Auseinandersetzungen um sein abgebrochenes Studium. Trotz der ständigen Ermahnungen seiner Eltern, etwas »Ordentliches« zu studieren oder gleich einen »ordentlichen Beruf« zu ergreifen, hatte sich Martin – wohl auch aus Protest – für das völlig sinnlose Studium der Publizistik und Politikwissenschaft entschieden. Dass er schließlich bei einer Tageszeitung doch noch einen Job als Innenpolitikredakteur bekam, hatte sein Vater nicht mehr erlebt. Sollte er die Schuldgefühle seinem toten Vater gegenüber ebenfalls auf die Liste mit den UNERLEDIGTEN ANGELEGENHEITEN setzen? Laienpsychologische Scheiße, dachte Martin. Das darf doch alles nicht wahr sein! Bin ich jetzt schon vollkommen bescheuert?
Martin setzte sich auf einen Stuhl in der Ecke des Zimmers und betrachtete seine Hausschuhe aus Schafwolle. Paula hatte sie ihm bereits bei ihrem ersten Besuch mitgebracht. Samt Pyjama, Toilettetasche und einem Buch mit dem Titel Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte. Paula hatte ihm das Buch kommentarlos überreicht, und Martin hatte sich gefragt, ob sie ihm damit etwas sagen wolle. Da er das Buch aber bisher nicht einmal aufgeschlagen hatte, würde er das wohl erst später erfahren. Oder auch nie.
Nachdem ihn die Betrachtung seiner Patschen auch nicht weiterbrachte, überlegte er, was er machen würde, wenn alles wieder so wäre wie vor einer Woche. Ich würde vor Freude einen Luftsprung machen, mich anziehen, die Nachtschwester umarmen und mit dem Taxi nach Hause fahren. Dann würde ich die beste Flasche Rotwein öffnen, zwei Pizzen bestellen und mit Paula bis in die frühen Morgenstunden trinken und reden. Und vielleicht würden wir ja sogar wieder einmal miteinander vögeln.
Ein hoher Pfeifton riss Martin aus seinen Gedanken. Es klang so, als wäre das Ventil eines Heizkörpers verstopft. Da es in seinem Zimmer aber gar keinen Heizkörper gab, ging er ins Bad, fand aber auch dort nichts, was als Quelle für dieses unangenehme Pfeifen in Frage gekommen wäre. Im Bad wurde Martin schlagartig bewusst, dass sich die Lautstärke des Tons nicht verändert hatte. Er hielt sich das linke Ohr zu und brach in Panik aus. Der hohe Ton kam aus seinem Inneren. Martin begann am ganzen Körper zu zittern und setzte sich auf die Klomuschel. Dann ging er zurück ins Zimmer und trank aus der Mineralwasserflasche, so viel er konnte. Er stellte sich vor, dass das Wasser die negativen Energien aus seinem Körper herauswaschen würde. Er legte sich hin und vergrub seinen Kopf unter dem Polster mit der billigen Schaumstofffüllung, aber dadurch wurde alles nur noch schlimmer.
Martin hatte das Gefühl, als hätte sich eine Ratte in seinem Ohr eingenistet. Eine Ratte, die ihn nach und nach von innen auffraß. Aber gleichzeitig wusste er, dass dieses Bild falsch war, denn eine Ratte würde irgendwann einmal mit dem Fressen aufhören oder einfach platzen. Nein, nein, das, was er gerade durchmachte, war schlimmer als eine Ratte im Ohr: Es waren Grüße aus dem Vorhof der Hölle.
Die Sumpflandschaft, die Martin nur schemenhaft wahrnahm, erinnerte ihn an das Moor in der Nähe seines Heimatortes Schwarzmoos. Er wusste zwar nicht, vor wem er flüchtete, aber er spürte mit jeder Faser seines Körpers, dass er sich in einer lebensbedrohlichen Situation befand. Er lief, so schnell er konnte, aber jeder Schritt, den er im sumpfigen Boden machte, kostete ihn enorm viel Kraft. Zu seinem Schrecken musste er schließlich feststellen, dass er nicht nur immer langsamer wurde, sondern auch keine Luft mehr bekam. Sein Mund war voll Sand, den er trotz verzweifelter Versuche nicht ausspucken konnte. Als er hinter sich eine dunkle Gestalt erblickte, die ihre Hände nach ihm ausstreckte, stieß er einen lauten Schrei aus.
Martin stand in der Mitte des Krankenzimmers und zitterte am ganzen Körper. Er atmete schwer und wimmerte wie ein kleines Kind. Wenig später öffnete sich die Tür und die Nachtschwester schaltete das Licht ein.
»Herr Koller, was ist denn los mit Ihnen?« Schwester Anandita nahm ihn am Arm und führte ihn zu seinem Bett.
Martin sah die indische Nachtschwester entgeistert an, und erst als er auf der Bettkante saß, wurde ihm klar, wo er sich befand. Automatisch griff er sich an sein linkes Ohr, in dem die Terrormaschine auf Hochtouren lief.
Schwester Anandita reichte ihm ein Glas Wasser. »Hier, trinken Sie, das wird Sie ein wenig beruhigen.«
Er leerte das Glas in einem Zug. Die Nachtschwester schenkte nach.
»Haben Sie schlecht geträumt?«, fragte sie und schüttelte die Bettdecke aus. »Kommen Sie, legen Sie sich hin.«
Martin stellte das Glas ab und lehnte sich an das Betthaupt. Im Rücken spürte er die kalten Metallstangen. »Ich halte das nicht mehr aus«, murmelte er und ließ den Kopf auf die Brust sinken. »Ich glaube, ich drehe bald durch.«
Schwester Anandita knöpfte Martins Pyjamajacke auf und griff nach dem Fläschchen mit dem Schmerzöl. »Ich werde Sie damit ein bisschen einreiben. Schwester Sonia sagt, dass dieses Öl bei ihrem Mann wahre Wunder wirkt.«
Martin spürte, wie Schwester Anandita das Öl mit langsamen Bewegungen unterhalb seiner linken Brust in die Haut einmassierte. Er schloss die Augen und hatte seit Langem wieder einmal das Gefühl, dass ihm etwas gut tat. Er hörte den gleichmäßigen Atem der Nachtschwester und hoffte, dass sie bei ihm blieb. Sie war zwar mindestens zehn oder fünzehn Jahre älter als er, trotzdem hätte er gerne ihr Gesicht gestreichelt oder ihre schönen schwarzen Haare berührt, die zu einem langen Zopf geflochten waren.
Nach einigen Minuten stand Schwester Anandita auf und blieb am Fußende des Bettes stehen. »Wenn Sie möchten, kann ich Herrn Doktor Hittmayer bitten, dass er Ihnen einen Arzt von der Neurologie vorbeischickt. Vielleicht kann der Ihnen ja etwas zur Beruhigung geben. Was meinen Sie?«
Martin sah, dass es noch nicht einmal dreiundzwanzig Uhr war. »Ich bezweifle zwar, dass das etwas hilft, aber von mir aus«, sagte er müde.
»In Indien gibt es ein Sprichwort, Herr Koller: Der Zweifel ist das Wartezimmer der Erkenntnis.« Schwester Anandita lächelte und schloss leise die Tür hinter sich.
In Martins Kopf herrschte ein viel zu großes Durcheinander, als dass er den Sinn dieses Sprichworts auch nur ansatzweise verstanden hätte. Zweifel? Wartezimmer? Erkenntnis? Er stand auf, ging ins Bad und pinkelte in die Klomuschel. Wie seine Haut roch auch sein Urin unangenehm nach Kortison. Es war ein bitterer, leicht stechender Geruch, der ihn selbst beim Wasserlassen daran erinnerte, dass er krank war. Er ersparte sich den Blick in den Spiegel und ging, ohne sich die Hände zu waschen, zurück ins Zimmer.
Wäre er bei Kräften gewesen, hätte er sich in Erwartung des Neurologen wenigstens die Zähne geputzt, aber in seinem momentanen Zustand war es ihm vollkommen egal, ob er wie ein kranker Hund aus dem Mund stank. Martin zog den Vorhang zur Seite und blickte hinaus in die regnerische Nacht. Nur vereinzelt waren erleuchtete Fenster zu erkennen. Die meisten Fenster waren tot. Auf der Spitze eines Krans blinkte müde eine Signallampe, deren Lichtschein vom Nebel fast verschluckt wurde. Martin wollte den Vorhang gerade schließen, als plötzlich ein riesiger Schwärm Krähen direkt vor seinem Fenster vorbeiflog. Es mussten hunderte Vögel sein, die von zwei Seiten kamen und sich zu einer eigenartigen Formation vereinigten, ehe sie wieder aus seinem Blickfeld verschwanden. Er wunderte sich, dass Krähen um diese Zeit überhaupt noch unterwegs waren, aber vielleicht waren sie ja auch nur auf der Suche nach einem trockenen Schlafplatz.