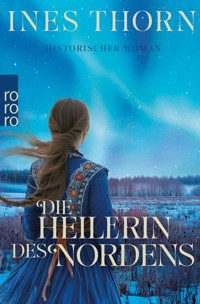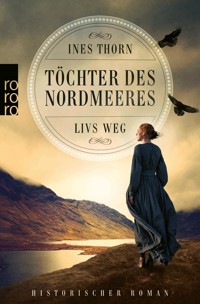12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Zeit, die uns trennt.
Mit Leidenschaft hat die Familie Lindemann das Kino „Die Schauburg“ in Leipzig betrieben. Bis sie nach dem Krieg enteignet wird. Besonders Mutter Ursula fällt es schwer, sich an die Vorgaben der neuen Machthaber zu halten. Ihr Mann Gerhard kommr versehrt von der Front zurück und versucht mühsam, wieder ins Leben zu finden. Auch ihre Tochter Sigrid, die sich kaum an Friedenszeiten erinnern kann, ist verunsichert. Ob die Ausbildung zur Lehrerin das Richtige für sie ist? Nur Stefan, der Sohn, hält an seinem alten Traum fest. Und um Filme machen zu können, beschließt er sogar, die Heimat hinter sich zu lassen und nach West-Berlin zu gehen. Schon bald merken die Lindemanns, wie schwer es ist, familiäre Bande aufrechtzuerhalten, wenn man getrennt ist durch den Eisernen Vorhang ...
Authentisch und hochemotional: ein großes Familienepos während der deutschen Teilung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Über Ines Thorn
Ines Thorn wurde 1964 in Leipzig geboren. Nach einer Lehre als Buchhändlerin studierte sie Germanistik, Slawistik und Kulturphilosophie. Sie lebt und arbeitet in Frankfurt am Main.
Im Aufbau Taschenbuch sind lieferbar: »Die Walfängerin«, »Die Strandräuberin« sowie »Ein Stern über Sylt«.
Bei Rütten & Loening sind zudem erschienen »Ein Weihnachtslicht über Sylt« und »Der Horizont der Freiheit«.
Informationen zum Buch
Die Zeit, die uns trennt.
Mit Leidenschaft hat die Familie Lindemann das Kino »Die Schauburg« in Leipzig betrieben. Bis sie nach dem Krieg enteignet wird. Besonders Mutter Ursula fällt es schwer, sich an die Vorgaben der neuen Machthaber zu halten. Ihr Mann Gerhard kommr versehrt von der Front zurück und versucht mühsam, wieder ins Leben zu finden. Auch ihre Tochter Sigrid, die sich kaum an Friedenszeiten erinnern kann, ist verunsichert. Ob die Ausbildung zur Lehrerin das Richtige für sie ist? Nur Stefan, der Sohn, hält an seinem alten Traum fest. Und um Filme machen zu können, beschließt er sogar, die Heimat hinter sich zu lassen und nach West-Berlin zu gehen. Schon bald merken die Lindemanns, wie schwer es ist, familiäre Bande aufrechtzuerhalten, wenn man getrennt ist durch den Eisernen Vorhang.
Authentisch und hochemotional: ein großes Familienepos während der deutschen Teilung
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Ines Thorn
Die Bilder unseres Lebens
Inhaltsübersicht
Über Ines Thorn
Informationen zum Buch
Newsletter
Teil I: Eine neue Zeit – Die vierziger Jahre
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Teil II: Aufbrüche – Die fünfziger Jahre
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Teil III: Umbrüche – Die sechziger Jahre
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Teil IV: Enttäuschung – Die siebziger Jahre
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Teil V: Alles ändert sich – Die achtziger Jahre
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Danksagung
Anhang
Impressum
Für Susanne
Teil I Eine neue Zeit Die vierziger Jahre
Kapitel 1
Am Morgen hatte die Nachbarin ihr erzählt, dass es in Gutjahrs Lebensmittelladen Eier geben sollte, und Sigrid war sofort losgelaufen.
Frau Gutjahr hatte ihren trotz des Hungers überall wohl genährten Bauch unter der Schürze gestreichelt und dabei gesagt: »Die Amerikaner sind da. Sie haben die letzten Volksstürmer verhaftet und das Völkerschlachtdenkmal besetzt. Der Bürgermeister, der olle Freyberg, und noch ein paar von denen da oben haben sich umgebracht. Geschieht ihnen ganz recht. Wir kleinen Leute von der Straße waren denen immer egal.« Ihre Stimme klang selbstzufrieden, als wäre die Welt nun ein bisschen mehr nach ihrem Geschmack.
»Du musst aufpassen, Sigrid, euer Willi, der rannte noch vorgestern in der Uniform rum und hat vor dem Gasthaus Adler Reden ans Volk gehalten. Den müsst ihr in der Wohnung einsperren. Und das ganze Nazizeug vernichten. Und beeilen müsst ihr euch«, ergänzte sie, während sie drei Eier in Zeitungspapier wickelte. »Ich wette, in den meisten Häusern glühen gerade die Kachel- und Küchenöfen. Ich habe ja schon vor zwei Jahren gesagt, dass der Krieg verloren ist, damals nach der Pleite von Stalingrad. Wollte keiner hören. Sogar die Gestapo ist deshalb gekommen, mitgenommen hätten sie mich, wenn unser Laden nicht kriegswichtig gewesen wäre.« Ihr Kleinbürgerstolz füllte den ganzen Laden, legte sich in die leeren Regale, hockte auf der Kasse.
Sigrid vergaß die Eier und hetzte durch die Trümmer nach Hause. Die halbe Stadt war bei dem Bombenangriff vom 4. Dezember 1943 zerstört worden, doch in der Antonienstraße standen die meisten Häuser noch. Sigrid wusste nicht, ob sie froh oder erschrocken sein sollte. Der Krieg war vorüber, und sie konnte es einfach nicht glauben. Keine nächtlichen Bombenangriffe mehr, keine Verdunkelungen und vielleicht sogar bald kein Hunger mehr? Unvorstellbar nach sechs Jahren Krieg. Aber was kam nun?
Eilig ging sie die Stufen nach oben in den ersten Stock, riss die Tür auf. Ihr Großvater Willi saß in seiner SA-Uniform auf dem Küchensofa und erzählte seiner Frau, was ihm gerade durch den Kopf ging – wirres Zeug, wie schon seit Monaten, denn Willi war senil geworden. »Der Führer, du wirst es erleben, Wilma, der schenkt uns allen so ein Volksauto. Und dann fahren wir durchs Deutsche Reich bis ins Baltikum. Mit dem Volksauto.«
»Opa, du musst dich ausziehen!«, unterbrach Sigrid ihn. »Warum soll der Opa sich ausziehen?«, fragte Großmutter Wilma, die am Herd stand und in einem Topf rührte. »Gib mir mal die Eier, die sollen hier mit rein.«
»Bis ins Baltikum«, krächzte ihr Mann.
»Sigrid, die Eier!« Wilma wandte sich ungeduldig um. Früher war sie eine sanfte Frau gewesen mit einem ewigen Lächeln auf den Lippen. Der Krieg hatte sie hart gemacht, er ließ keine Zeit für Sanftmut und Lächeln und Höflichkeit. Die meisten Männer sprachen in knappen, schnarrenden Sätzen miteinander, und den Frauen waren die Worte vergangen. Dafür seufzten sie. Aber Wilma konnte nicht schweigen. Sie hatte noch einiges zu sagen. Gestern und jetzt und später.
»Ich hab keine Eier. Die Amerikaner sind da, sind schon am Völkerschlachtdenkmal.«
Mit ein paar Schritten war sie am Sofa und riss das Hitlerbild von der Wand. »Wir müssen alles vernichten«, rief sie, die Aufregung hatte ihre Stimme ganz hell gefärbt. »Opa muss die Uniform ausziehen. Und das Jesuskreuz, das früher hier hing, muss wieder her. Wo ist es?«
Jetzt kam Bewegung in Wilma. »Das Kreuz ist im Schlafzimmer unter dem Bett. Willi, zieh dich aus.«
»Mit dem Volksauto bis ins Baltikum. Der Führer hat’s gesagt.«
»Die Uniform, Opa.«
»Halt ihn fest«, sagte Wilma bestimmt, dann öffnete sie ihrem Mann die Hose und zog mit einem so kräftigen Ruck daran, dass Willi beinahe vom Sofa gerutscht wäre. Als Sigrid versuchte, die Arme aus der Uniformjacke zu ziehen, krallte ihr Opa sich fest. »Mit der Uniform ins Baltikum«, sagte er und schlug mit der freien Hand nach Sigrid.
»Halt jetzt die Gusche«, schimpfte Wilma, zerrte die Hose über die dünnen, blau geäderten Beine und half Sigrid dann mit der Jacke.
»Wir verbrennen das Zeug im Küchenofen. Schneide die Uniform klein.«
Sigrid holte die große Schneiderschere und hielt immer wieder lauschend inne. »Ich denk jeden Moment, sie kommen«, flüsterte sie.
»Unfug. Das Völkerschlachtdenkmal ist am anderen Ende der Stadt. Das dauert noch. Aber beeilen müssen wir uns trotzdem.« Wilma beträufelte die Uniformfetzten mit Öl und schob sie in den Ofen. »Hol deinen BDM-Rock, die weiße Bluse lass da, die ist unverfänglich, aber dein schwarzes Halstuch bring her und hol Opas Ausweis, das muss alles verbrannt werden.«
Wenige Minuten später brannte es im Ofen lichterloh. Ihr Opa hockte zusammengesunken auf dem Sofa, die dürren Arme um den dürren Brustkorb geschlungen.
»Ich friere an die Knewwerzchen«, schrie der Opa. »Ich hab schon Hühnerhaut.«
»Gänsehaut«, verbesserte Sigrid. Sie hielt Willis Stiefel in der Hand. »Was machen wir damit?«
Ihre Oma richtete sich auf, schob eine graue Haarsträhne aus der Stirn und beschmierte sich dabei mit Ruß. »Nee, die verbrennen wir nicht. Die können wir noch brauchen. Die Amis werden uns bestimmt keine neuen schenken. Wir verstecken sie unten, in der Waschküche. Zur Not können wir dann sagen, dass sie uns nicht gehören.«
»Meine Knewwerzchen sind ganz kalt«, jammerte der Opa wieder.
»Mein Gott, Willi. Wir haben jetzt andere Sorgen als deine kalten Arme und Beine.« Ungeduldig warf sie ihm die Decke, die über der Sofalehne gehangen hatte, zu. Dann wandte sie sich wieder an Sigrid. »Hol die Hakenkreuzfahne und wirf sie in den Ofen. Dann mach ein weißes Bettlaken an die Stange und häng sie aus dem Fenster, die Amis sollen gleich sehen, dass wir keine Feinde sind. Und die Sachen von deiner Mutter, die guckst du durch, ob es da was Verräterisches gibt. Wenn sie aus dem Lazarett heimkommt, muss alles weg sein.«
Als Sigrid fertig war, holte sie eine weiche Flanellhose und ein kariertes Hemd für den Opa aus dem großen Kleiderschrank im Schlafzimmer.
»Ich will meine Uniform«, krakeelte er, aber Wilma verlor allmählich die Geduld. »Das ist jetzt deine neue Uniform. Und wenn die Amis kommen, dann hältst du den Rand. Nichts mehr mit Volksauto und Führer und Baltikum, hast du verstanden?«
Willi nickte, aber Sigrid wusste, dass er nichts verstanden hatte. Er war vergesslich und hin und wieder sogar verwirrt, erkannte an manchen Tagen nicht einmal Frau und Tochter, von der Enkelin ganz zu schweigen. Sie mussten einfach aufpassen, dass er nicht mehr raus auf die Straße ging.
***
Und dann kamen sie, die Amis. Sie fuhren in offenen Jeeps, und Sigrid blickte staunend aus dem Fenster. Sie hatte noch nie einen Schwarzen gesehen. Ihr erster Eindruck war, dass sie unglaublich laut waren. Sie sprachen laut, sie lachten laut, fuhren ihre Jeeps mit quietschenden Reifen. Sigrid hatte immer gedacht, dass die Eroberer leiser sein würden. Der Krieg war laut gewesen, furchtbar laut. Er klang noch immer in ihrem Inneren, mit den Sirenen, dem Flakfeuer, den Bombern am Himmel. Der Frieden, hatte sie gedacht, der Frieden sei leise. Friedlicher eben. Aber die Sieger hatten natürlich keinen Grund, leise zu sein. Nur die Verlierer waren still.
Sigrid beugte sich aus dem Fenster. Auf der Straße waren keine Fußgänger zu sehen, bloß die amerikanischen Jeeps. Aber hinter den Fenstern erkannte sie schemenhaft die Nachbarn. Mit angstbleichen Gesichtern äugten sie auf die Straße. Dort, wo vor wenigen Tagen noch Hakenkreuzfahnen gehangen hatten, flatterten jetzt helle Betttücher.
Einer der Jeeps hielt nun vor der Schauburg, dem Kino, das den Lindemanns, Sigrids Familie, gehörte und dem Wohnhaus genau gegenüber lag. Zwei Amerikaner sprangen heraus, starrten auf die Schaukästen, in denen noch die Anzeigen der letzten Filme hingen. Heinz Rühmann schwang seinen Hut, darunter standen die Zeiten, in denen der Film gespielt wurde.
In den letzten Monaten hatte ihre Mutter nur noch Die Feuerzangenbowle mit Heinz Rühmann, Der Weg zum Glück und Heimatfilme und Komödien gezeigt. Donnerstagabend und manchmal noch am Sonntag eine Vorstellung, wenn sie nicht ins Lazarett musste. Die Deutsche Wochenschau musste natürlich gezeigt werden, der Verleiher konnte da auch nichts machen. Wenn Vorstellung war, hatte Sigrid immer die Karten verkauft, während die Mutter die schweren Rollen in den Vorführapparat legte. Früher hatten sie noch einen Musiker gehabt, einen Pianisten, aber der war schon lange an der Ostfront gefallen. Dann hatte Wilma Klavier gespielt, aber seit es mit ihrem Opa so schlimm geworden war, seit er jede Gelegenheit nutzte, um aus der Wohnung abzuhauen, gab es kein Klavierspiel mehr in der Schauburg.
Jetzt hatte einer der Männer sie am Fenster entdeckt. Er lachte breit, winkte ihr zu. »Frowllein«, rief er. »Frowllein Frieden!«
Zaghaft winkte sie zurück.
Dann fuhr der Jeep weiter, und die Straße war wieder leer.
»Sind sie weg?«, fragte Wilma.
Sigrid nickte.
»Gott sei Dank.«
Sigrid drehte sich um. »Und jetzt?«
»Was jetzt?«
»Wie geht es weiter?«
Wilma zuckte mit den Achseln. »Wir warten einfach ab. Irgendwer wird uns schon sagen, was wir zu tun und zu lassen haben. Es hat immer irgendwen gegeben, der uns das gesagt hat. Zuerst der Kaiser, dann der Ebert und der Hindenburg und am Schluss der Hitler.«
***
Zwei Wochen später begannen sie damit, die Trümmer wegzuräumen. Die Amis hatten die Anweisung gegeben, dass alle Frauen, die eine Position beim Bund Deutscher Mädel oder bei der NS-Frauenschaft innegehabt hatten oder vor 1939 eingetreten waren, die Trümmer beseitigen mussten. Zur Strafe, zur Wiedergutmachung. Als ob sich irgendetwas wiedergutmachen ließe. Als ob es wieder gut werden würde, wenn man nur die Steine zur Seite räumte. Ursula war 1938 in die NS-Frauenschaft eingetreten. Zur selben Zeit, wie ihr Mann Gerhard in die NSDAP. Es war keine freiwillige Entscheidung gewesen, der Druck war größer geworden und man hatte gedroht, ihnen das Kino wegzunehmen.
Ursula hatte sich nie für Politik interessiert. Warum auch? Die Politik interessierte sich schließlich auch nicht für sie. Ursula hatte die meisten Filme, die der Verleih anbot, welcher der Reichsfilmkammer unterstand, ziemlich dürr gefunden. Seit die Juden nicht mehr bei der UFA waren, waren die Filme grottenschlecht. Und die ewige Propaganda in der Wochenschau ging Ursula auf die Nerven. Die Leute wollten sich im Kino amüsieren, nicht belehrt werden. Ja, in der ersten Zeit, vor dem Krieg, da hatte es noch Filme gegeben! Viktor und Viktoria, Komposition in Blau! Da kamen die Leute gerannt, da wurde gelacht und geweint im Kino, da wurde mitgefiebert und mitgelitten.
Später hatte Ursula bei jedem neuen Film des Verleihs regelrecht gelitten. Hitlerjunge Quex, SA-Mann Brand, Riefenstahls Triumph des Willens und dann noch der Kulturfilm Ewiger Wald, grauenvoll kitschig und voller Klischees. Später, als der Krieg ausgebrochen war, wurden die Filme noch schlimmer. Jud Süß war sicher ein Film nach dem Geschmack der Regierung, aber Ursula fand ihn regelrecht blödsinnig. Sie hatte den Roman von Lion Feuchtwanger gelesen, der so ganz anders war als der Film. Es ging um die historische Figur des Joseph Süß Oppenheimer, und die Nazis stellten Oppenheimer als Vergewaltiger, Intriganten, geldgeilen Betrüger und Manipulator dar. Sie hatte nicht gewusst, ob sie lachen oder weinen sollte, als sie den Film zum ersten Mal gesehen hatte. Früher war das Kino ein Ort der Unterhaltung gewesen. Die Leute hatten ihre Alltagssorgen vergessen können. Und dümmer waren sie früher auch nicht geworden. Jetzt schon.
Trotzdem spielte sie den Film.
Und nun räumten sie also Trümmer. 600 Millionen Kubikmeter Schutt galt es zu beseitigen. Loren und Kleinloks fuhren durch die Stadt, sammelten den Schutt ein, brachten ihn ins Johannistal, auf den Fockeberg oder auf ein großes Gelände im Westen neben dem Fluss Elster.
Ursula trug eine graue Schürze über ihrem dunkelblauen Kleid, an den Füßen Opa Willis Stiefel, die sie vorn mit Zeitung ausgestopft hatte, und ein Kopftuch, damit der Staub ihr nicht gar so sehr die Haare ruinierte. Staub. Überall war Staub. Die Straßen waren von grauem Staub bedeckt, die Bäume, die Sträucher, die Menschen. Alles war grau, alles schmeckte nach Staub. Und Staub schmeckte, dachte sie, wie Asche. Sie hatte den Mund voll Asche. War es das, was die Besatzer wollten? Ein Volk in Sack und Asche? Still und demütig. Voller Schuld und Scham.
Dankbar sollten sie sein für die Befreiung, und Ursula war auch froh und dankbar für den Frieden. Aber der Alltag war noch immer düster. Hatte man nicht auch ihr das Leben gestohlen und das Lachen? Den Mann und die Liebe?
Gerhard war an der Front. Er hatte dort in einem mobilen Kino Filme vorgeführt. Hatte er zumindest gesagt, als er das letzte Mal auf Heimaturlaub gewesen war. Aber ob sie ihm glauben konnte? Alle Männer auf Heimaturlaub erzählten, sie wären nur Köche oder Funker oder Sanitäter oder Fahrer. Keiner von ihnen hatte je ein Gewehr in der Hand gehabt oder geschossen. Als ob niemand Krieg geführt hätte. Wo Gerhard jetzt war, wusste sie nicht. Das Einzige, was sie wusste, war, dass sie ihn jeden einzelnen Tag vermisste. Herrgott, was hatten sie früher für Spaß zusammen gehabt! Ihr fröhlicher Gerhard, der das Leben in vollen Zügen genoss. Der gern aß und trank und lachte und sang. Sie erinnerte sich noch gut an die Feier zum fünfundzwanzigsten Jubiläum der Schauburg. Das war 1939 gewesen, und Gerhard hatte vorgeschlagen, daraus einen Filmball zu machen. Über hundert Gäste waren gekommen, und alle verkleidet. Gerhard war als Charlie Chaplin gegangen und sie als Mata Hari. Wilma hatte Klavier gespielt und jeder, allen voran Gerhard, hatte aus vollem Hals Mein kleiner grüner Kaktus gesungen. Und dann hatte er sie hochgehoben, hatte sie herumgeschwenkt. Vor aller Ohren hatte er sie »mein Herzensweib« genannt, und jeder hatte sehen können, wie gut sie es zusammen hatten.
Ach, Gerhard, wo bist du bloß? Ich mache mir solche Sorgen. Hoffentlich geht es dir gut, dachte sie, richtete sich auf, stemmte eine Hand in den schmerzenden Rücken und sah sich um. Sigrid arbeitete neben ihr, wortlos riss sie einen Ziegelstein nach dem anderen aus den Trümmern und stapelte ihn am Rand der Straße auf.
»Los, duck dich!«, rief Ursula, und Sigrid hob den Kopf. »Duck dich.«
Sigrid tat es. »Was ist los?«, flüsterte sie.
»Die Gutjahr!«
Sigrid wandte sich um. Die Lebensmittelhändlerin kam in Begleitung einer anderen Frau auf sie zu. Mit abfälligem Grinsen blieb sie vor ihnen stehen. »Ja, ja, die ganze Zeit habt ihr die Nase hochgetragen, habt auf unsereins herabgeblickt, habt gedacht, ihr seid was Bessres, ihr mit eurem Kino. Jetzt könnt ihr sehen, was ihr davon habt. Jetzt wühlt ihr im Dreck wie die Schweine. Verdient habt ihr es!«
Damit ging sie weiter.
Ursula seufzte. »Jeden Tag dasselbe. Im Krieg haben sie das Maul gehalten, haben nur leise geseufzt, und jetzt besteht die halbe Nachbarschaft plötzlich aus Widerständlern. Dabei war die Gutjahr auch im Turnverein der Deutschen Frauen. Und jetzt erzählt sie allen, wie sie den Juden noch nach der sogenannten Kristallnacht Lebensmittel verkauft hat. Ja, das stimmt zwar, aber sie hat ihnen den doppelten Preis abverlangt.«
Ursula war ganz rot vor Ärger.
»Mama, nicht so laut. Die anderen können uns hören.«
Ursula richtete sich wieder auf. »Na, und? Sollen sie doch. Wenn mich der Krieg eines gelehrt hat, dann, dass ich ab sofort sage, was ich denke. Freiheit haben uns die Amis gebracht. Und ich nehme mir die Freiheit einer eigenen Meinung.«
Sigrid hätte es wissen müssen. Ihre Mutter hatte ein ziemliches Temperament und noch dazu eine »Leipziger Schnauze«. Sie konnte fluchen wie ein Fischweib, und sie tat es auch, sobald sie einen Anlass dazu hatte. Nur im Kino, da war sie anders. Da lächelte sie die ganze Zeit und nickte und stimmte den Gästen zu, auch wenn sie insgeheim anderer Meinung war.
Sigrid mochte die Unternehmer-Mutter nicht. Die, mit dem zahnigen Lachen, die mit dem süßen Buttermilchstimmchen. Zwar mochte sie es auch nicht, wenn die Mutter fluchte, doch da war sie wenigstens echt.
Sigrid seufzte. Sie war immer ein ruhiges Kind gewesen. Ganz anders als Stefan, ihr Bruder, von dem sie seit Monaten nichts mehr gehört hatten. Sein letzter Brief war aus Belgien gekommen, im Sommer 1944. Aber es war auch keine Todesnachricht gekommen, und an diese Hoffnung klammerten sie sich.
Aber jetzt würde alles anders werden. Eine neue Zeit würde beginnen.
Nur im Kino liefen noch die alten Filme.
Kapitel 2
Am 2. Juli 1945, einem Montag, verließen die Amerikaner Leipzig, und die Russen unter General Nikolai Iwanowitsch Trufanow übernahmen das Kommando. Der Tag war warm, die Sonne schien, und die ganze Stadt atmete den Sommer.
Waren die Amerikaner in Jeeps gekommen, stolz und als Sieger, wirkten die Russen eher wie Vertriebene. Sie kamen in ramponierten hölzernen Wagen, vor die sie ausgemergelte Pferde gespannt hatten. Ihre Uniformen waren verblichen, die Stiefel derb und löchrig und die Käppis trugen sie komisch schief auf dem Hinterkopf. Sie rauchten stinkende Zigaretten und lachten mit schlechten Zähnen.
Aber so abgerissen sie auch waren, machte Ursula doch nicht den Fehler vieler anderer, sie nicht ernst zu nehmen. Denn sie machten Ernst. Innerhalb kürzester Zeit verstaatlichten sie über 100 Betriebe, woraufhin viele Unternehmer in die amerikanisch besetzte Zone flohen – mitsamt ihrer Maschinen, Patente und Forschungsunterlagen.
Gerüchte gingen um. Immer wieder wurde erzählt, einige der Russen würden sich wie Tiere verhalten. Viele Frauen schnitten sich die Haare ab, rasierten sich eine Glatze, zogen die Klamotten ihrer Männer an und beschmierten sich das Gesicht mit Ruß.
Ursula tat nichts dergleichen.
»Mama, wir müssen uns verbergen«, drängte Sigrid sie, aber Ursula schüttelte den Kopf. »Das werden wir nicht tun. Ganz im Gegenteil. Wir werden zu diesem Trufanow gehen. Wir ziehen unsere schönsten Kleider an. Wir werden ihn um die Lizenz bitten, die Schauburg wieder betreiben zu dürfen. Wir werden sagen, dass die Sieger Spaß haben wollen, dass wir den Leipzigern Filme aus Russland zeigen wollen. Die Oper ist wieder in Betrieb, das Gewandhausorchester hat im Capitol-Lichtspieltheater sein erstes Konzert gegeben. Wir müssen handeln, müssen unser Kino in vorderste Stellung bringen.« Sie merkte nicht, dass ihr Kopf noch voller Kriegsvokabeln steckte.
Sigrid presste eine Hand vor den Mund.
»Was ist?«, wollte Ursula wissen.
»Die Russen, es heißt, sie vergewaltigen alle Frauen.«
Großmutter Wilma nickte. »Hab ich auch gehört. Und auf Uhren sind sie ganz scharf. Manche tragen gleich mehrere am Handgelenk.« Sie schüttelte den Kopf. »Gab es in Russland keine Uhren? Und was haben die da für Frauen, wenn sie unsere alle vergewaltigen wollen?«
Ursula reckte sich ein wenig. »Na ja, wir werden sehen.« Sie zog sich ihr bestes Kleid an, viel zu warm für die Jahreszeit, trug Lippenstift auf, ordnete ihr Haar.
Wilma stellte sich vor ihre Enkelin und verzog drohend den Mund. »Wenn du gehst, ist das deine Sache. Aber Sigrid geht nicht. Sie ist gerade mal 16. Am liebsten würde ich sie sowieso wegschicken. Aufs Land am besten. Oder in die amerikanische Zone.«
»Wir kennen niemanden in der amerikanischen Zone und auch nicht in der englischen oder französischen. Aber ich wollte ohnehin allein gehen. Oder hast du etwa gedacht, ich nehme Sigrid zu so etwas mit? Meinst du, es macht mir Spaß? Aber schließlich müssen wir ja von irgendwas leben.«
Und dann schlug die Tür hinter ihr zu.
Wilma seufzte und wischte sich die Augen: »Was ist das für ein Leben, in dem eine Mutter ihre Tochter nicht vor so was schützen kann?« Dass Ursula ihre Schwiegertochter war, spielte in diesem Augenblick keine Rolle.
Sigrid stand unruhig am Fenster. Sie dachte an ihre Mutter, konnte an nichts anderes denken. Was würde mit ihr geschehen? Ihr Herz schlug hart und schnell, und die Angst kroch ihr wie ein kalter Finger über den Rücken.
Und dann warteten sie. Es wurde Abend, es wurde Nacht, es wurde Morgen, Mittag, wieder Abend und Nacht und erst am nächsten Mittag kam Ursula die Treppen hinauf. Sigrid hatte sie vom Fenster aus kommen sehen. Sie rannte die Treppe hinunter, rannte der Mutter entgegen. Zwei Schritte vor ihr blieb sie stehen.
Ursula schlich, als täte ihr jeder Schritt weh. Das Kleid war zerrissen, unter ihrem linken Auge blühte ein Veilchen. Sie war voller Staub und Dreck, ein Schuh fehlte, die Handtasche auch. Sie wirkte, als hätte sie eine schreckliche Aufgabe erledigt, noch benommen und beschädigt, aber nicht gebrochen.
Sigrid wusste nicht, was sie sagen sollte, was sie tun sollte. Schließlich reichte sie der Mutter den Arm. Gemeinsam schleppten sie sich die restlichen Treppen nach oben.
In der Küche kramte die Mutter in ihrem Büstenhalter, zog ein amtliches Schreiben hervor und hielt es hoch. »Hier ist die Lizenz. Ab Montag spielen wir wieder.«
Wilma nickte. Sie fragte nichts und sagte nichts, stellte nur einen Topf mit Wasser auf den Herd. »Wirst baden wollen«, sagte sie, und Ursula nickte. Dann ließ sie sich auf einen Küchenstuhl sinken, barg den Kopf in den Händen und rührte sich nicht, bis die Zinkwanne mit heißem Wasser gefüllt war. Sie schrubbte ihre Haut, bis sie rot war. Dann trocknete sie sich ab und beschloss, ihre Erlebnisse zu verdrängen. Nie wieder daran zu denken. Sie in eine imaginäre Kiste zu sperren und die Kiste wegzuwerfen.
***
Am 1. Oktober 1945 begann der Schulbetrieb wieder. Sigrid war 16 Jahre alt, hatte ihr Abschlusszeugnis schon erhalten.
»Willst du Abitur machen?«, fragte Ursula.
Sigrid zuckte mit den Schultern. »Wieso auf einmal? Du hast gesagt, Mädchen brauchen kein Abitur. Sie heiraten und bekommen Kinder. Arbeiten kann ich auch im Kino, kann meinen Vorführschein machen. Und jetzt redest du von Abitur?«
»Warum nicht?«, fragte Ursula. »Der Krieg hat uns doch bewiesen, dass Frauen alles ebenso gut können wie die Männer! Wir haben Steine geschleppt. Wir beide haben zusammen die Elektrik im Kino geflickt. Ich habe gelernt, Auto zu fahren, habe mit dem Lkw die Verwundeten eingesammelt und ins Lazarett gebracht. Es gibt nichts, das ich mir nicht zutraue. Ein Dach decken? Gut. Ich schaue, wie es die anderen machen und dann tue ich es. Ich soll einen Betrieb leiten? In Ordnung. Ich lese mir die Geschäftsbücher durch und weiß, was ich zu tun habe. Wir haben viel gelernt im Krieg. Wir haben gelernt, dass wir alles, was Männer können, auch können. Warum sollen wir das jetzt verstecken? Wenn du Abitur machen willst, dann tue es.«
»Ich weiß nicht, was ich werden will. Ich habe also auch keine Ahnung, ob ich ein Abitur brauchen werde.«
»Du könntest studieren.«
Sigrid breitete die Arme aus. »Was denn, Mama? Was soll ich studieren? Was soll ich lernen? Ich weiß es nicht. Ich habe nie darüber nachgedacht, wie mein Leben einmal aussehen soll. Wie auch? Es war Krieg. Ich war froh, den Tag zu überleben. Und jetzt? Jetzt denke ich, dass es gut wäre, in einem Lebensmittelgeschäft zu arbeiten, weil ich ständig Hunger habe. Aber was ich sein will, wenn der Hunger vorbei ist? Keine Ahnung.«
Ursula legte eine Hand auf Sigrids Unterarm. »Ich verstehe dich. Du hast kein Vertrauen in die Zukunft. Woher auch? Ich denke, du solltest wieder zur Schule gehen. Du hattest immer gute Noten. Und zu lernen gäbe dir Zeit, um im Leben anzukommen. So, wie wir alle. Nur, dass mein Leben schon zur Hälfte vorbei ist. Nimm die zwei Abiturjahre als Geschenk. Als Zeit, in der du herauskriegen kannst, wie deine Zukunft aussehen soll.«
Sie betrachtete ihre Tochter, das mittelgroße, sehr schlanke Mädchen mit den aschfarbenen Haaren, den grauen Augen und dem vollen Mund. Sie betrachtete ihr Kind, das nur so kurz hatte Kind sein dürfen, und Sigrids Anblick tat ihr in der Seele weh.
»Für dich, Sigrid, beginnt jetzt eine neue Zeit, eine Zeit des Friedens. Eine Zeit, in der du wichtig bist. Und jetzt komm mit rüber ins Kino. Wir zeigen heute Abend Berlin, einen russischen Dokumentarfilm.«
Kapitel 3
Im Mai 1946 – Erich Zeigner war inzwischen Oberbürgermeister von Leipzig – kam Gerhard zurück. Eines Abends stand er plötzlich einfach in der Wohnung. Oder das, was von ihm übrig geblieben war. Willi, Wilma, Ursula und Sigrid saßen gerade beim Abendbrot. Oder dem, was früher Abendbrot geheißen hatte. Es gab für jeden eine Scheibe Graubrot, die nach Holzabfällen schmeckte, und eine heiße Kartoffel, die Ursula beim Hamstern ergattert hatte. Früher war er stattlich gewesen, mit dunklem dicken Haar und einem Bauch, der über dem Hosenbund hing. Aber jetzt, wie er aussah! Bevor Ursula noch aufstehen konnte, um ihn zu umarmen, riss er einfach seiner Tochter die heiße Kartoffel aus der Hand und stopfte sie sich in den Mund. Er kaute kaum, er schluckte die Kartoffel beinah im Ganzen. Dann blickte er mit leeren Augen auf den Tisch. Ursula stand auf, in der Hand ihre Kartoffel, pustete darauf, dann reichte sie sie ihrem Mann. Und dann erhob sich Wilma, pustete ebenfalls auf ihre Kartoffel und hielt sie ihrem Sohn hin. Nur Willi betrachtete die Szene argwöhnisch und aß weiter. Hilflos standen sie sich gegenüber, keiner wusste, was zu tun war.
»Gerhard!«, sagte Wilma schließlich leise. »Gerhard, mein lieber Junge.« Sie drückte ihn an ihre Brust, und Gerhard weinte ohne Tränen. Er schluchzte und bebte am ganzen Körper, und Wilma hielt ihn fest, während Ursula ihm hilflos über den Rücken strich.
Und später, im Bett, da hielt sie ihn umschlungen wie ein Kind, wiegte ihn, strich über sein ungewohnt dünnes, graues Haar und sagte kein Wort, so wie auch er nicht sprach.
Am nächsten Morgen gab sie ihm ihre Scheibe Graubrot. »Du musst dich melden«, sagte sie dann. »Anmelden wie alle Heimkehrer. Damit du eine Lebensmittelkarte bekommst. Nicht gleich heute, aber bald.« Sie lächelte dem Mann mit dem grauen Gesicht und den leeren, tief umschatteten Augen zu, aber er blickte nur auf seinen Teller und nickte. Nach dem Essen bereitete ihm Wilma ein Bad. Ursula wickelte die Lappen von seinen Füßen und schrie auf. Blutige Klumpen, blutiges, pochendes, eiterndes Fleisch. Schwarz unterlaufene Nägel. Der Anblick allein tat weh. Doch sie nahm seinen rechten Fuß in ihre Hand und strich sanft darüber.
***
Zwei Wochen lang sprach Gerhard nicht. Einmal strich er Sigrid staunend über das weiche Haar, dann berührte er zaghaft die Hand seiner Mutter, die Schulter seiner Frau. Seine ersten Worte waren: »Wo ist Stefan?« Er warf die Worte einfach in die Küche, seine Stimme klang rau und brüchig, und er blickte niemanden an dabei. Und keiner antwortete ihm.
»Wo ist mein Sohn?«
Ursula trat zu ihm, legte ihm die Hand auf den Unterarm. »Wir wissen es nicht. Im letzten Sommer war er in Belgien. Seither haben wir nichts von ihm gehört.«
Da nickte Gerhard und schwieg. Aber später zog er sich an, eine dunkle Hose und ein weißes Hemd, die seinen Körper umschlackerten. Wilma nahm Willi seine Hauspantoffeln aus grauem Filz ab und zog sie ihrem Sohn an die kaputten, schmerzenden Füße. Dann begleitete Ursula ihn aufs Amt, beantragte seine Lebensmittelkarte und war dabei, als ein Major der sowjetischen Besatzer ihn einen Fragebogen ausfüllen ließ.
»Waren Sie Mitglied der NSDAP?«
»Wenn ja, seit wann?«
»Waren Sie Mitglied der SS oder Waffen-SS?«
»An welchen Fronten haben Sie gekämpft?«
»Was war Ihre Aufgabe?«
»Haben Sie jemanden getötet?«
»Wie viele Menschen haben Sie getötet?«
»Welchen militärischen Rang hatten Sie?«
Gerhard saß vor den Blättern, einen Bleistift in der Hand und starrte darauf, als könnte er nicht lesen.
»Können wir die Fragen mit nach Hause nehmen? Mein Mann ist gerade erst heimgekehrt. Er ist noch nicht wieder der Alte.«
Der Russe zündete sich eine Zigarette an und schüttelte den Kopf. »Njet!« Dann verließ er den Raum.
Ursula nahm Gerhard den Stift aus der Hand und füllte den Bogen aus. Kurz überlegte sie, ob sie die Zeitangabe von Gerhards Eintritt in die NSDAP fälschen sollte, doch dann fiel ihr ein, dass die Amerikaner die Mitgliederlisten beschlagnahmt und bestimmt an die Russen weitergegeben hatten. Also blieb sie bei der Wahrheit. Auch, wenn das nicht gut war für Gerhard. Alle, die vor 1939 in die Partei gegangen waren, galten als richtige Nazis. Die danach waren Mitläufer. Schlimm, aber nicht so schlimm wie die Parteigenossen vor 1939.
Sie fragte ihren Mann, wo er gekämpft hatte.
»Oradour-sur-Glane«, flüsterte er. »Waffen-SS. Massaker.«
Dann fiel er wieder in Schweigen.
Ursula hatte noch nie von Oradour-sur-Glane gehört, doch die Worte »Waffen-SS« und »Massaker« ließen sie aufhorchen. Doch jetzt war keine Zeit, Fragen zu stellen. Sie trug stattdessen den letzten Ort ein, aus dem sie Post von Stefan bekommen hatte, machte ihren Mann überdies zum Gefreiten der Wehrmacht – seinen wirklichen Dienstgrad kannte sie nicht – und dachte, damit wäre alles erledigt.
Der Offizier kam wieder herein, las den Bogen. »Kinovorführer an der belgischen Front«, sagte er in gebrochenem Deutsch. »Können Sie das beweisen?«
Da endlich erwachte Gerhard aus seiner Starre. Er hob den Kopf, blickte dem Russen fest in die Augen. »Nein, das kann ich nicht beweisen. Das nicht und vieles andere auch nicht. Aber ich kann beweisen, dass ich aus dem Krieg gelernt habe. Ich möchte Mitglied der neuen Partei, der SED werden.«
Der Russe betrachtete ihn eine ganze Weile, dann nickte er, stand auf und kam mit einem jungen Mann zurück, der aussah wie ein Lehrer.
»Sie möchten Mitglied unserer Partei werden?«, fragte er und sah auf Gerhards Fragebogen. »Sie waren auch Mitglied der NSDAP. Freiwillig sogar.«
»Ich war im Krieg«, sagte Gerhard. »Und jetzt will ich nichts mehr als Frieden. Was ich dazu beitragen kann, möchte ich beitragen. Lassen Sie mich in die neue Partei. Lassen Sie mich mithelfen, ein friedliches Deutschland aufzubauen.«
Der junge Mann nickte. »Gut. Füllen Sie den Antrag aus und dann wird man sehen, ob man sie als Kandidat der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands aufnehmen kann.«
Er nickte dem Russen zu, dann verließ er das Zimmer. Ursula stand im ungläubigen Staunen daneben. Ihr Mann hatte gesprochen. Klare, deutliche Sätze. Er hatte gesagt, worüber er zuvor nachgedacht hatte.
***
In der Nacht hörte sie ihn weinen. Sie legte einen Arm um seine Schulter, und tröstete ihn, als wäre er ein kleiner Junge. Und dann fragte sie, was sie den ganzen Tag schon hatte fragen wollen. »Oradour-sur-Glane. Was ist das?«
»Ein Dorf in der Nähe von Limoges. Unsere Einheit umstellte den Ort. Dann befahl unser Divisionskommandeur Diekmann dem Bürgermeister des Dorfes, dreißig Bewohner als Geiseln zu bestimmen und sie gegen den von der Résistance gefangen genommenen Bataillonskommandeur Helmut Kämpfe auszutauschen. Der Bürgermeister bot sich selbst und seine zwei Söhne als Geiseln an, doch Diekmann ließ uns den Ort niederbrennen und alle Bewohner töten.«
Er schluchzte auf, und Ursula strich ihm über das Gesicht.
»Die Dorfbewohner wurden auf dem Marktplatz zusammengetrieben.« Gerhard brach ab, seine Stimme hatte bei den letzten Worten gezittert.
»Du warst dabei, nicht wahr?«, fragte Ursula leise und strich über seinen Rücken. »Auch du hast die Leute aus ihren Häusern getrieben.«
»Ja«, flüsterte Gerhard. Und nach einer Weile: »Was hätte ich denn sonst machen sollen? Sie hätten mich erschossen, wenn ich nicht gehorcht hätte.«
»Und dann?«
»Wir haben die Männer von ihren Frauen und Kindern getrennt. Die Frauen und Kinder wurden in die Kirche gesperrt. Dann zündeten wir die Kirche an. Ich höre sie in meinen Träumen schreien. Jede Nacht, jede einzelne Nacht.« Ursula fühlte, wie sein Leib bebte, sich in Qualen wand. Qualen, die noch lange nicht ausgestanden waren, vielleicht nie vergehen würden.
»Ein Mädchen war unter ihnen. Sie sah aus wie unsere Sigrid. Sie hat mich angeblickt. Nicht flehend, sondern ungläubig. Nichts war schlimmer als dieser Blick.«
»Du Armer«, sagte Ursula und es kam ihr nicht komisch vor, dass sie ihren Mann für bemitleidenswert hielt und nicht die Toten von Oradour-sur-Glane. Es gibt Schlimmeres als den Tod, dachte sie in diesem Augenblick. Für Gerhard wäre der Tod wahrscheinlich leichter gewesen. Das Leben ist manchmal schlimmer als der Tod. Und Gerhard weiß das.
»Und die Männer?«, fragte sie.
»Wir haben sie erschossen. Und ich empfand es als einen Akt der Gnade.«
Er blickte Ursula an. »Denn wie soll man weiterleben, wenn man es nicht geschafft hat, Frau und Kinder zu beschützen? Wie soll man je etwas anderes hören als ihre Schreie? Ich wünschte, ich wäre damals auch gestorben.«
»Hast du geschossen?«
Gerhard schwieg eine Weile. Seine Schultern zuckten. Dann sagte er so leise, dass Ursula es kaum verstand: »Ich habe noch Schlimmeres gemacht.«
Schlimmer als schießen? Was kann schlimmer sein, als einem anderen das Leben zu nehmen?, dachte Ursula, doch sie sagte nichts.
Es dauerte, bis Gerhard endlich weitersprach. »Ich habe einen Nervenzusammenbruch bekommen. Ich habe gezittert und geweint, konnte nicht mehr stehen, nicht mehr gehen. Auch sprechen konnte ich nicht mehr. Ein Offizier schrie mich an, stieß mit dem Gewehrkolben nach mir, aber ich konnte nichts als weinen und zittern. Ich lag zwischen ihnen, verstehst du? Vor mir die Männer aus dem Dorf, hinter mir die Kameraden. Sie haben über mich weggeschossen. Doch das habe ich nicht einmal wahrgenommen.«
Ursula hielt die Luft an. Mein Gott, was haben wir uns selbst angetan?, fragte sie sich. Was haben wir aus unseren Männern und Söhnen gemacht? Sie hatte nie den Eindruck gehabt, dass Politik irgendetwas mit ihr selbst zu tun hatte, aber sie hatte die Nachrichten verfolgt, weil sie immer Radio hörte, wenn sie in der Küche war. Sie hatte sogar manchmal heimlich BBC gehört, und natürlich hatte sie von den Konzentrationslagern gewusst. Jeder, der wollte, hätte davon wissen können. Es gab ein Außenlager von Buchenwald am Rande der Stadt. Nicht versteckt im Wald, sondern so, dass jeder, der vorüber kam, wenigstens ahnen konnte, was hier vor sich ging. Kurz vor Kriegsende, Anfang April, da hatte die SS das Lager aufgelöst. Die Männer in den schwarzen Uniformen hatten die Gefangenen in den gestreiften Anzügen durch das Land getrieben. Gestalten, bei deren Anblick einem das Heulen kam. Ausgezehrte Gestalten mit riesigen Augen, die doch leer wie stillgelegte Brunnen waren. Männer, die sich kaum auf den Beinen halten konnten und es nicht einmal wagten, den Blick zu heben. Keine Menschen mehr, sondern Wesen, denen man alles genommen hatte. Und dazu die Aufseher, die brüllten und mit den Gewehrkolben nach den schwankenden, taumelnden, stürzenden Männern schlugen.
Ursula hatte schnell weggeschaut. Sie wollte das nicht sehen, sie konnte damit nicht umgehen. Wer konnte das denn überhaupt?
Oder Frau Gutjahrs Neffe Erwin. Er war mongoloid gewesen, geistig behindert. Ihn hatten sie auch abgeholt und nach Dösen in die Irrenanstalt gebracht. Angeblich, um die Familien zu entlasten. Und dann hatten sie einen Brief bekommen, in dem stand, dass der Erwin einen Herzfehler gehabt hatte und daran gestorben war, aber das hatte niemand geglaubt. Erwin war immer kerngesund gewesen.
»Und dann?«, flüsterte sie also. »Was ist dann passiert mit dir?« Eigentlich wollte sie nichts hören, nichts wissen. Die Ungeheuerlichkeiten dieses Krieges waren zu groß für sie, sie konnte sie nicht begreifen, hätte sich am liebsten davor versteckt. Aber das ging nicht, denn es ging um Gerhard.
»Der Offizier hat mir das Bandenkampf-Abzeichen in Bronze, das wir alle kurz vorher verliehen bekommen hatten und an der linken Brustseite trugen, von der Uniform gerissen und in den Dreck geschleudert. Dann spuckte er vor mir aus. ›Sie wollen ein deutscher Mann sein? Ein Kämpfer für den Führer? Ein Waschlappen sind Sie, ein jämmerlicher Waschlappen.‹ Alle haben es gehört.«
Gerhard schluchzte auf. »Ich habe meine Kameraden im Stich gelassen«, flüsterte er. »Und ich habe nichts für die Männer aus dem Dorf getan.« Er wand sich aus Ursulas Arm, sah ihr in die Augen. »Verstehst du? Der Offizier hatte recht. Ich bin ein Waschlappen.«
»Und wenn du geschossen hättest, würde es dir jetzt besser gehen?«, wollte Ursula wissen.
»Nein. Es ist das eine, den Feind in einer Kampfhandlung zu töten. Und es ist das andere, wehrlose Männer zu erschießen. Das eine ist Krieg, das andere ist Mord.«
»Und weiter?«
»Ich bin in ein Lazarett gekommen. In Frankreich. Und dort bin ich geblieben, bis die Amerikaner kamen. Ich war dann in einem der Kriegsgefangenenlager.«
»Warum hast du uns nicht geschrieben?«
Gerhard seufzte. »Was hätte ich schreiben sollen? Dass ich ein Waschlappen bin?«
»Und warum bist du dann zurückgekommen? Ich habe mich so um dich gesorgt. Wir alle haben uns gesorgt.«
»Weil ich nicht wusste, wohin ich sonst hätte gehen können. Ich schäme mich so. Schäme mich vor allem vor Stefan. Er hat das Eiserne Kreuz zweiter Klasse erkämpft. Er war tapfer.«
Wieder schwieg er eine Weile, schließlich sagte er: »Ich möchte wirklich Mitglied in der Partei werden. Nie wieder Krieg. Verstehst du? Im Lager, da war einer, der war Kommunist. Er hat Vorträge gehalten über das Leben in der Sowjetunion. Es ist ein gutes Leben, Ursula. Vielleicht nicht das Schlaraffenland. Aber ein Leben ohne Angst und Krieg. Das ist es, was ich für Sigrid und Stefan will. Das ist es, was ich in Oradour-sur-Glane gelernt habe.«
»Gerhard, wir werden nie wieder über das Massaker sprechen. Hörst du, nie wieder! Du wirst es keinem erzählen. Besonders Stefan und Sigrid nicht.«
Gerhard lachte dunkel auf. »Du willst den Kindern ersparen, ihren Vater so zu sehen.«
»Der Krieg ist jetzt vorbei. Du musst vergessen, was du erlebt hast, wenn du weiterleben willst. Deshalb werden wir nie wieder darüber sprechen. Versprichst du mir das?«
»Ich weiß nicht, ob ich das kann, Ursula.«
»Du willst dich entschulden, willst deine Schuld loswerden, indem du anderen davon erzählst.« Sie konnte nicht verhindern, dass ihre Stimme ärgerlich klang. Und sie war auch verärgert. Sie hatte nicht wissen wollen, was passiert war, woher Gerhards graue Haare und sein leerer Blick stammten. Sie hatte ihren Vorkriegsmann zurückhaben wollen, den etwas dicklichen, fröhlichen und lauten Kinobetreiber Gerhard Lindemann. Sie hatte so schwere Jahre gehabt. Auch sie wollte sich ausruhen, wollte die Verantwortung für Sigrid und Wilma und Willi teilen. Sie brauchte eine Stütze im Leben, keinen fast verloschenen Ehemann und dessen Dämonen.
»Niemand will hören, was du getan hast. Wir haben alle Schreckliches erlebt. Wir müssen nach vorne schauen. Das ist das Einzige, was wir tun müssen.«
»Und du meinst, so einfach ist das? Alles vergessen und weitermachen, als ob nichts geschehen wäre?«
Ursula seufzte. Sie hatte keine Ahnung, was sie sagen sollte. Also schwieg sie, strich ihrem Mann über den Rücken. Sie war froh, dass er nicht auf die Männer in Oradour-sur-Glane geschossen hatte. Ich werde die Starke sein müssen, erkannte sie. Ich werde die Familie führen und dabei so tun müssen, als hätte Gerhard das Sagen. Für unsere Ehe beginnt jetzt eine neue Zeit.
Und morgen spielen wir im Kino noch ein letztes Mal Münchhausen mit Hans Albers.
Kapitel 4
Im Dezember kam Stefan zurück. Es war ein harter Winter. Schon im November hatte es den ersten Schnee gegeben. Schnee und Eis, aber nichts zum Heizen. Ursula schickte Sigrid jeden Tag nach der Schule mit dem Fahrrad in den Wald, um Holz zu sammeln. Aber bald gab es nichts mehr zum Sammeln. Sogar die Rinde war schon von den Bäumen geschält worden. Parkbankgerippe ohne Holz standen an den Wegen, manche holten sich getrocknete Kuhscheiße von den Bauern, um damit zu heizen, erzählte die Gutjahr. »Lieber erstunken als erfroren«, sagte sie. Und dann nahm sie die Lebensmittelkarten und schnitt einen Abschnitt fort. »Milch habe ich nicht«, sagte sie. »Ich kann euch gerade mal ein Beutelchen Haferflocken und drei Pfund Brot geben.«
»Aber wir haben ein Anrecht auf die Lebensmittel«, beschwerte sich Sigrid. »1300 Kilokalorien für jeden pro Tag.«
Die Gutjahr hob die Schultern. »Wo du nicht bist, Herr Jesus Christ.«
Aber Sigrid hatte die schweren Milchkannen gesehen, auch das Butterfass und die Tüten mit Zucker.
»Da steht doch alles voll«, sagte sie und zeigte in den Hinterraum.
»Wenn ihr mir ein paar Briketts bringt oder dickes, gutes Holz, dann habe ich auch Milch und Butter für euch. Ich muss schließlich auch leben.«
Sigrid spürte, wie die Wut heiß in ihr hochkochte. Da stand die dicke Gutjahr satt und zufrieden in ihrem Laden, während andere hungerten und froren. War deren Gier eigentlich nie befriedigt? Sigrid wollte auf den Tisch hauen, wollte über die Ladentheke springen, wollte die Säcke mit dem Zucker aufreißen, das Butterfass öffnen und dann alles an die Kunden verteilen. Aber sie tat es nicht. So war sie nicht. Und so konnte sie auch nicht sein, denn dann hätten sie erst recht nichts mehr bei Frau Gutjahr bekommen. Also ging Sigrid und holte die Mutter.
Ursula riss die Tür des Ladens auf, sagte sehr laut: »Wenn wir nicht bekommen, was uns zusteht, dann werde ich Sie melden. Bei den Russen.« Sie warf zwei Kinokarten auf den Verkaufstresen. »Das ist alles, was wir Ihnen bieten können.«
»Nun mal langsam, Frau Lindemann. Immer ruhig. Ich gebe euch ein Stückchen Butter und einen halben Liter Milch. Das ist mehr als die anderen kriegen. Und jetzt schreit mir hier nicht den ganzen Laden zusammen.«
Sie schnitt noch zwei Abschnitte von den Karten, füllte die dünne Milch in eine Kanne, klatschte ein apfelgroßes Butterstück auf einen alten Bogen Zeitungspapier. Dann sagte sie: »Denken Sie bloß nicht, dass ich mich von Ihnen einschüchtern lasse. Es ist nur so, dass ich den Stefan gesehen habe. Die Butter ist sozusagen mein Willkommensgeschenk für ihn.«
Ursula klappte der Mund auf. »Unseren Stefan?«
Die Gutjahr nickte. »Die halbe Nacht hat er vor eurem Haus gestanden und nach oben gestarrt.«
»Warum ist er denn nicht hochgekommen?«
»Weiß ich’s?« Die Gutjahr zuckte mit den Schultern. »Sicher war die Haustür abgeschlossen. Zur Schule ist er dann gegangen. In die Turnhalle, glaube ich. Vielleicht ist er ja noch da.«
Die 50. Volksschule. Sie war vom Lindemann’schen Wohnhaus nur durch die schmale Wachsmuthstraße getrennt. Die Mutter packte die Butter und die Milch in einen Beutel, dann verließ sie grußlos den Laden und eilte hinüber zur Schule. Ihr Herz schlug rasend schnell und sie presste eine Hand darauf, als könnte sie es so beruhigen. Sie konnte vor Freude kaum atmen, aber in dieser Freude steckte auch Angst. Wie würde ihr Junge sein? War er gesund? Wie stand es um seine Seele?
Jetzt, in diesem bitterkalten Winter, in dem am Morgen sogar das Wasser im Teekessel gefroren war, wurde die Turnhalle nicht benutzt, um Kohlen zu sparen, während der übrige Unterricht in vollem Gange war.
Sie öffnete die Tür zur Turnhalle, erblickte ganz hinten einen Stapel alter Matten, und darauf Stefan. Er lag da, in einen dünnen Mantel gehüllt, und schlief. Leise setzte sich Ursula neben ihren Sohn, betrachtete sein schlafendes Gesicht. Blass war er. Nein. Bleich. Und unrasiert. Die Haare so kurz, wie es nur die Männer hatten, die aus russischer Kriegsgefangenschaft nach Hause kamen. Oder die Läuse gehabt hatten in den anderen Lagern.
Sie blieb neben ihm sitzen, das Herz voller Liebe und Verzweiflung für ihren jungen, schlafenden Sohn, der gerade 19 Jahre alt war. Sie wusste nicht, wie lange sie dort so gesessen hatte. Ihre Füße wurden kalt und kälter und dann spürte sie den Frost in den Knochen, ihre Hände wurden weiß, dann blau, aber Ursula kümmerte sich nicht darum. Jetzt endlich begriff sie, dass der Krieg verloren war. Dass sie alle, die ganze Familie, Verlierer waren und es auch immer bleiben würden. Der Rest der Welt würde sie nicht einfach so davonkommen lassen. Der Rest der Welt hatte begonnen, sich für diesen Krieg zu rächen. Ein Land ohne Männer. Ein Land, das nur aus Versehrten bestand. Denn die, die heimgekommen waren ohne Krücken oder Augenklappen, die waren trotzdem versehrt, hatten oft ihre Seele verloren in den kalten russischen Wintern. Ursula hatte den Krieg nicht gewollt. Und nicht die KZs und auch die Kristallnacht nicht.
Endlich erwachte Stefan. Er griff nach der Hand seiner Mutter und küsste sie, presste sie gegen seine Wange.
»Komm nach Hause, Stefan«, sagte Ursula leise. »Komm mit nach Hause. Warum bist du nicht gleich zu uns gekommen?«
»Ich wusste nicht, was mich erwartet«, sagte er leise, und Ursula verstand. Er hatte sich verändert, und hatte nun Angst, dass auch sein Zuhause, seine Familie verändert, dass sie einander nicht wiedererkannten, füreinander verloren waren. Während der gesamten Kriegszeit war da die Hoffnung auf die Familie gewesen, darauf, dass wenigstens zu Hause noch alles so war wie immer. Zuhause, das war das Einzige, das Stefan noch hatte. Wie groß muss seine Angst gewesen sein, auch das vielleicht noch zu verlieren, dachte Ursula. Sie umarmte ihren Sohn, presste ihn an sich, als wäre er noch ein kleiner Junge. »Wir können gehen«, sagte sie dann. »Bei uns ist alles in Ordnung, alles so wie immer.«
Und dann waren sie zu Hause. Stefan saß am Tisch, und Ursula stellte fest, dass er versehrt war, aber nicht erloschen wie Gerhard. Da nahm sie ihren Ehering, ging zum Schwarzmarkt hinter dem Hauptbahnhof, tauschte das Gold gegen Mehl und Eier und dann lief sie nach Hause und backte einen Kuchen, während Stefan badete, sich rasierte und zivile Kleidung anzog. Kurz überlegte sie, warum sie bei Gerhards Heimkehr nicht auf die Idee gekommen war, ihm einen Kuchen zu backen, aber dann verwarf sie den Gedanken wieder. Überhaupt vermied sie es, über Gerhard nachzudenken. Über ihren Mann. Sie hatte sich so nach Zärtlichkeit und, ja, Sex, gesehnt, aber Gerhard konnte sie nur streicheln und küssen. Früher hatte er nicht genug von ihr bekommen können. Sie hatten sich oft geliebt, und Ursula hatte es genossen, von ihm so begehrt zu werden.
Und so fühlte sich Ursula ein weiteres Mal betrogen. Sie hatte Verständnis für Gerhard. Es war ja nicht seine Schuld. Aber Herrgott, sie war 38 Jahre alt. Sie hatte Bedürfnisse! Aber sie sprach nicht darüber. Nur einmal hatte sich Ursula ihrer Freundin Anni offenbart. Und Anni hatte sie mit großen Augen angesehen. »Dein Mann ist wenigstens wieder da. Meiner ist gefallen. Glaub mir, ich würde sofort mit dir tauschen.«
Da war Ursula still geworden. Vielleicht hatte sie ja doch Glück gehabt mit Gerhard, Und vielleicht würde er ja eines Tages wieder so sein wie früher.
Aber jetzt war Stefan zurückgekommen. Und während der duftende Kuchen abkühlte, gingen sie hinüber ins Kino.
Wilma schrubbte schon seit Wochen die Polster der Sessel, sie wollte den Krieg aus ihnen herausschrubben. Gerhard war dabei, die Wände abzukehren und das Dach abzudichten. Es hatte Monate gedauert, bis es ihm gelungen war, Dachpappe aufzutreiben. Am Abend würde endlich ein neuer Film laufen. Die Mörder sind unter uns mit Hildegard Knef und Ernst Wilhelm Borchert. Und davor der Augenzeuge. Das war Pflicht, aber für Ursulas Geschmack war er nicht besser als die Wochenschau.
Sie hatte den Sujetplan des Augenzeugen gelesen und geseufzt:
1. Punkt: Kinder suchen ihre Eltern.Bisher haben 378 Kinder durch den Augenzeugen ihre Eltern wiedergefunden. Alle Auskünfte durch die Redaktion.
2. Punkt: Aussichtsreiche Berufe, dritte Folge.
3. Punkt: 28Jahre Komsomol. Bericht von der Feierstunde aus Moskau.
4. Punkt: Schwefelsäure und Zellwolle. Der landeseigene Betrieb Schwarza in Thüringen hat seinen Plan bereits erfüllt.
5. Punkt: Eine Siedlung entsteht auf abgebranntem Wald. Neubauerndörfer im Märkischen Land.
6. Punkt: Woche des Friedens, veranstaltet vom Kulturbund Berlin im Reichsbahnausbesserungswerk Schöneweide.
Früher hatte Ursula dem Donnerstag, an dem die neuen Filme herauskamen, immer entgegengefiebert. Seit dem Krieg nicht mehr. Die Filme, die jetzt vom Filmverleih kamen, steckten voller Propaganda oder erinnerten an den Krieg, hinderten sie daran, zu vergessen.
Aber sie würde sich den Film trotzdem ansehen. Immerhin spielte die Knef mit, und es war nun einmal der erste deutsche Trümmerfilm. Sie wusste, dass es um die Überlebende eines Konzentrationslagers ging und um einen Militärarzt, der sein Leben im Alkohol ersäufen wollte. Sie kannte solche Geschichten. Jeder kannte sie. Frau Gutjahr wahrscheinlich zehn Mal so viele wie sie.
Gemeinsam betraten sie das Foyer, das früher golden geglänzt hatte, jetzt aber war das Gold abgeblättert und an manchen Stellen schaute der nackte Putz hervor.
Sie griff nach Stefans Hand. »Vater wird Augen machen. Und Oma Wilma erst«, sagte sie und hoffte inständig, dass es auch so sein würde. »Wir holen sie ab und dann gehen wir alle nach Hause und essen Kuchen.«
Sie öffnete die Tür zum Saal, rief nach ihrem Mann, nach ihrer Schwiegermutter. Es roch nach dem Essig, den Wilma ins Putzwasser gegeben hatte, nach Staub und den Ausdünstungen der Menschen.
Stefan blieb stehen, sein Blick fiel auf den roten Samtvorhang vor der Leinwand.
»Wir haben ihn gewaschen. Oma und ich. In Etappen, weißt du? Wir haben im Herbst die große Zinkwanne in den Hof gestellt und Stück für Stück gewaschen. Schön ist er nicht mehr, aber dafür wenigstens sauber.«
Stefan stand einfach nur da und starrte.
Ursula rief wieder nach Wilma und Gerhard. »Stefan ist da! So kommt doch!«
»Stefan?« Ein Aufschrei, und dann kam Wilma aus der Damentoilette gerannt, stieß den Eimer mit dem frischen Putzwasser um und rannte weiter, riss ihren Enkel in die Arme und drückte ihn, während ihr die Tränen über die Wangen liefen. »Endlich«, schluchzte sie. »Endlich sind wir alle wieder beisammen.«