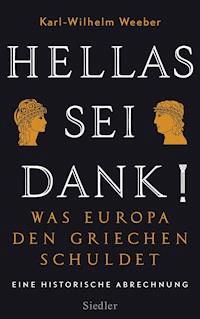7,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Reclam Verlag
- Kategorie: Poesie und Drama
- Serie: Reclams Universal-Bibliothek
- Sprache: Deutsch
Geizhälse, Schnorrer, Hochstapler und Voyeure: Sie konnten sich im alten Rom warm anziehen, denn Martials Seitenhiebe haben es in sich. Anders als die Äußerungen heutiger Satiriker sind sie jedoch in brillante Verse gefasst. Karl-Wilhelm Weeber stellt die eindrücklichsten Epigramme des gefeierten römischen Dichters vor, beleuchtet den Hintergrund und zeichnet ein farbiges Bild der damaligen Gesellschaft – gehören doch auch all die wenig erfreulichen Typen, die hier mit spitzer Feder verewigt sind, zur Kulturgeschichte der Ewigen Stadt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 180
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Karl-Wilhelm Weeber
Die bissigsten Spottgedichte Martials
Reclam
RECLAMS UNIVERSAL-BIBLIOTHEK Nr. 962167
2023 Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Covergestaltung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH
Coverabbildung: Mosaik mit zwei Theatermasken aus der Villa Hadriana, 2. Jh. (© akg-images/Nimatallah)
Gesamtherstellung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Made in Germany 2023
RECLAM, UNIVERSAL-BIBLIOTHEK und RECLAMS UNIVERSAL-BIBLIOTHEK sind eingetragene Marken der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
ISBN978-3-15-962167-8
ISBN der Buchausgabe 978-3-15-014427-5
www.reclam.de
Inhalt
Einleitung
1 Gegen fiese Gastgeber
2 Gegen Mahlzeitenschnorrer
3 Gegen Geschenkejäger
4 Gegen Erbschleicher
5 Gegen Reiche
6 Gegen Geizhälse
7 Gegen Neidhammel
8 Gegen Angeber, Blender und Möchtegerne
9 Gegen Heuchler
10 Gegen Stümper, Versager und Dilettanten
11 Gegen Voyeure, Kletten und Ferkel
12 Gegen Trinker
13 Gegen Ärgernisse im öffentlichen Raum
14 Gegen gesellschaftliche Minderheiten und vom Schicksal hart Getroffene
Literaturhinweise
Verzeichnis der enthaltenen Epigramme
Einleitung
Vom großen Caesar haben Sie eine Menge gehört, von Augustus, dem Begründer des römischen Kaisertums, auch so einiges, der schwerreiche Crassus ist Ihnen ein Begriff und ebenso der eloquente und selbstverliebte Cicero? Von Seneca, Neros Prinzenerzieher und ›Ober-Stoiker‹ seiner Zeit, haben Sie das eine oder andere gelesen, und der knorrige alte Karthago-Hasser Cato (ceterum censeo … – »im Übrigen bin ich der Meinung …«) erscheint Ihnen als bekannter Repräsentant des römischen Imperialismus? Mit Neros faszinierenden ›Verrücktheiten‹ sind Sie vertraut, und Lucullus als kompromissloser Vertreter nicht nur luxuriöser Esskultur verkörpert für Sie die gesellschaftliche Elite Roms? Dann ist Ihnen auch das entsprechende Ambiente nicht fremd. Zu diesen ›großen‹ Gestalten gehören die prächtigen Tempel und marmornen Säulenhallen, das legendäre Forum Romanum, die Redeschlachten im – nicht immer ganz so ehrwürdigen – Senat und die dicken Buchrollen mit den bedeutenden Werken der lateinischen Literatur. Kurz gesagt: Das monumentale, strahlende klassische Rom ist Ihnen vertraut.
Aber kennen Sie auch Ligurinus, den Tafeltyrannen, dessen Rezitationen sich derart in die Länge ziehen, dass der Wildschweinbraten zu vergammeln droht? Oder den Geschenkeschnorrer Clytus, der achtmal im Jahr Geburtstag feiert und seine Bekannten auf diese Weise nach Strich und Faden abzockt? Oder Phileros, der – seinem sprechenden Namen »Liebesfreund« gemäß oder zum Trotz – bereits sieben Ehefrauen unter die Erde gebracht und entsprechend üppig geerbt hat? Oder den Geizkragen Gellius, der seinen Freunden nie Geld leihen kann, weil er »ständig am Bauen ist«? Den Angeber Mamurra, der lange Verkaufsverhandlungen in Luxusboutiquen führt, um am Ende mit zwei billigen Bechern nach Hause zu gehen? Oder den nervtötenden Latrinenschreck Vacerra, der sich den lieben langen Tag in öffentlichen Toilettenanlagen herumtreibt, um ein Opfer zu finden, das ihn zum Gastmahl bittet?
Das vorliegende Bändchen lädt Sie dazu ein, diese und manche anderen merkwürdigen Typen etwas besser kennenzulernen – Zelebritäten des Alltags, wenn man so will, und damit ein Stück normaler Kulturgeschichte, wie sie beim isolierten Blick auf die ›Großen‹ nicht selten zu kurz kommt. Gewiss, das sind, wie Sie an den Beispielen schon gemerkt haben werden, nicht unbedingt Begegnungen mit angenehmen Zeitgenossen des Alten Roms. Aber sie sind in jedem Fall vergnüglich und in einen erstklassigen literarisch-ästhetischen Rahmen gekleidet. Sie werden schmunzeln, lachen, sich an Kabinettstückchen scharfzüngigen und scharfsinnigen Humors erfreuen, sich über bösen und böswilligen Spott wundern und auf offene Sottisen und versteckte Pointen stoßen. Martials Humor kommt nicht immer fair daher, sondern oft genug maliziös und verletzend, aber stets mit einem spöttisch-epigrammatischen Biss von großer Virtuosität.
Aber wer ist dieser Garant unserer lustvollen anderen Kulturgeschichte Roms? Von der Biographie des Dichters Marcus Valerius Martialis, kurz Martial, wissen wir nur sehr wenig. Um 40 n. Chr. im spanischen Bilbilis geboren, kam er in Neros Regierungszeit um das Jahr 64 nach Rom. Zwischen 85 und 102 veröffentlichte er zwölf Bücher Spottepigramme, dazu noch ein Buch spectacula (Schauspiele) mit Kurzgedichten unter anderem zu Shows anlässlich der Einweihung des Colosseums sowie zwei Bücher Xenia und Apophoreta, meist Zweizeiler mit Vorschlägen zu Gast- und Tafelgeschenken. Wenige Jahre vor seinem Tod, wohl um das Jahr 98/99, kehrte Martial in seine spanische Heimat zurück. Dort ist er um das Jahr 104 herum gestorben – »ein talentierter, geistreicher, treffsicherer Mann, der in seinen Schriften eine Menge Witz und Galle und auch nicht weniger Aufrichtigkeit unter Beweis stellte«. Mit diesen Worten würdigte ihn der Jüngere Plinius, der damals mit ihm, wie er betont, einen Freund verlor (EpistulaeIII21,1 f.).
Sal et fel, »Witz und Galle«, war in der Tat das höchst erfolgreiche Rezept, mit dem Martial in den literarisch interessierten Kreisen der Hauptstadt bestens ankam. »Ganz Rom lobt, liebt und singt unsere Büchlein«, frohlockt er – und dabei ist es ihm völlig gleich, ob manch einer, wenn er seine Epigramme liest, »rot oder bleich wird, stutzt, den Mund aufsperrt und in Hass ausbricht«. Diese Provokationen sind Programm: »Das will ich, jetzt gefallen mir meine Gedichte so recht« (EpigrammVI60).
Die freundliche Aufnahme von Martials Epigrammen bei einem Publikum, das die Kombination von ›böser Zunge‹ mit Zeit- und Sittenkritik und literarischer Brillanz zu schätzen wusste: Es dürfte sie tatsächlich gegeben haben. Und damit auch die Förderung, der sich der erfolgreiche Epigrammatiker seitens großzügiger Mäzene erfreute. Jedenfalls verfügte Martial über ein kleines Stadthaus in Rom, ein Landgut in der näheren Umgebung der Hauptstadt, ein paar Sklaven und genügend begüterte Freunde, an die er sich wenden konnte, wenn es bei ihm finanziell knapp zu werden drohte. Dazu kam es aber offensichtlich nicht, auch wenn Martial sich in mehreren Gedichten als pauper poeta stilisiert und als Klient auftritt, der von der mangelnden Großzügigkeit mancher Patrone enttäuscht und frustriert zu sein vorgibt.
Freilich ist der pauper poeta ein Klischee, das im Deutschen durch ein falsches Verständnis von pauper noch verstärkt wird. Entgegen den Angaben in Vokabelverzeichnissen von Lateinlehrbüchern heißt pauper nämlich nicht »arm« (das wäre im Lateinischen egens oder inops), sondern »unbegütert«. Im Unterschied zu den Herren ›von Stand‹ verfügte der pauper nicht über Einkünfte aus Großgrundbesitz, die ihm ein arbeitsfreies Leben ohne Existenzsorgen ermöglichten. Wer pauper war, nagte nicht am Hungertuch, musste sich aber – vor allem durch Erwerbsarbeit – darum kümmern, seinen Lebensunterhalt und den seiner Familie zu sichern.
Wenn Martial sich in manchen Gedichten als »Klient« bezeichnet, der wirklich reiche Gönner um Geschenke bittet, so geschieht das vor dem Hintergrund, dass man auch als gefeierter Dichter finanziell nicht abgesichert war. Die Antike kannte kein Recht auf geistiges Eigentum, das zu Buchtantiemen geführt hätte. Jeder konnte Gedichte und andere schriftstellerische Produkte kopieren oder kopieren lassen, ohne dem Urheber oder dem ›Originalverlag‹ für das Copyright etwas bezahlen zu müssen.
Martial war indes kein ›armer Poet‹. Er gehörte dem Ritterstand an, und das setzte einen Besitz von 400 000 Sesterzen voraus. Aber er hatte, wie Walter Kißel kürzlich gezeigt hat, so gut wie keine festen Einkünfte und zählte damit im Rahmen seines Standes zu den Minderbemittelten, zu einem ritterlichen Prekariat, wenn man so will, das aber von wirklicher Armut im heutigen und erst recht im antiken Sinn weit entfernt war.
Ob Martials Selbstaussagen in jedem Fall »schlüssig« sind, wie Kißel meint, mag man bezweifeln. Der Dichter schlüpft schon hier und da in ein poetisches Ich, das mit dem biographischen Ich nicht identisch ist. Dass man aber, wie ein Großteil der Martial-Philologie vor Kißel sicher angenommen hat, sämtliche Selbstaussagen einer rein fiktiven Sprecher-persona zuschreiben müsse, scheint mir von Kißel klar widerlegt zu sein – nicht zuletzt durch die grundsätzliche Feststellung, dass die Antike selbst keinerlei Theorie zur autorunabhängigen Ich-persona entwickelt hat.
Insofern steht auch die These auf sehr wackligen Beinen, dass es sich bei Martials Rom um eine rein literarische ›Kunststadt‹ handle und sich in den Epigrammen nicht die Lebensrealität des antiken Rom spiegle. Das war immer schon eine recht fragwürdige Behauptung: Wenn Satire Wirkung entfalten will, baut sie natürlich auf den Wiedererkennungseffekt bei den Zeitgenossen – was die reale Lebenswelt angeht, aber auch die porträtierten Gestalten und Typen, die sich in ihr tummeln. Natürlich steht außer Frage, dass Satire einschließlich des Spottepigramms vergröbert und zuspitzt, dass sie nicht abwägt und differenziert, sondern um der Pointe und der moralischen ›Botschaft‹ willen die Realität verzerrt. Ebenso wenig wie das Kabarett in unserer Zeit ein 1 : 1-Spiegel der Wirklichkeit ist, handelt es sich beim Rom der Spottgedichte Martials um ein detailgetreues Abbild des Alltagslebens, wie man es von einem Historiker erwarten würde. Ob beispielsweise wirklich so viele Mahlzeitenjäger in den Bädern und Latrinen Roms auf der Lauer lagen, wie es die Häufigkeit des Motivs bei Martial andeutet, ist durchaus fraglich. Nicht aber, dass es sie gab und dass unsere Kenntnisse vom Leben im Alten Rom deutlich eingeschränkter wären, wenn wir Martial und andere Satiriker nicht als Quellen zur Verfügung hätten.
Wie sieht es mit Martials ›Opfern‹ aus? Sind das reale Individuen oder fiktive Personen, die eher als Typen denn als identifizierbare Zeitgenossen daherkommen? Kißel glaubt nachweisen zu können, dass Martial in der Regel mit Klarnamen arbeitete. Das mag in manchen Fällen so sein, doch dürfte es sich in der Mehrzahl um verschleiernde Pseudonyme handeln. Zum einen bekennt sich Martial selbst programmatisch zu dem Prinzip parcere personis, dicere de vitiis, »Personen schonen, aber über menschliche Schwächen sprechen« (X33,10). Zum anderen will er es den ›Trägern‹ menschlicher Schwächen nicht zu leicht machen: Ist es eine reale Caelia, über deren Liebschaften er herfällt, ist es ein realer Charinus, dessen ›deviantes‹ Sexualleben er karikiert, so können sich alle anderen entspannt zurücklehnen: Sie sind ja offensichtlich nicht gemeint. Ganz anders, wenn Caelia und Charinus als nicht näher zu bestimmende Typoi für bestimmte vitia vorgeführt werden. Dann dürfen und müssen sich auch diejenigen ertappt fühlen, die sich in Caelia und Charinus wiedererkennen.
Ist der Dichter, der über seine Zeitgenossen und Zeitgenossinnen herzieht, stets der ›Gute‹? Der moralisch Überlegene gar? Die poetische Virtuosität, mit der er sich diese Position erobert, mag leicht darüber hinwegtäuschen, dass er moralische Maßstäbe anlegt, die seine eigenen sind, die aber keineswegs immer der Mehrheitsmeinung entsprechen. Und die auch nicht frei von Selbstgerechtigkeit und Überheblichkeit sind, von politischer Korrektheit im heutigen Sinn ganz zu schweigen. Um es anschaulich zu formulieren: Martials Biss trifft keineswegs nur die, die es aufgrund ihres fragwürdigen Verhaltens verdienen. Der Dichter teilt auch kräftig gegen die Schwachen aus, die nichts dafür können, dass sie einer Gruppe angehören, die zu – manchmal auch billigem – Spott einlädt: Bettler und Obdachlose, Behinderte und Angehörige sexueller Minderheiten, Alte und Ausgebeutete. Da tritt der Satiriker nicht im Wächteramt auf, sondern als illiberaler Populist, der nach der Devise vorgeht, nicht einmal einen Freund zu schonen, wenn dabei nur ein ordentliches Gelächter herauskommt (frei nach Horaz, SaturaeI4,34 f.). Vor allem in den – in dieser Sammlung allerdings nicht berücksichtigten – Epigrammen zu den Schaukämpfen von Mensch und Tier in der Arena verspielt Martial in den Augen heutiger Leserinnen und Leser eine Menge moralischen Kredit.
Das soll uns indes nicht daran hindern, ihn auf seinen satirischen Streifzügen durch das antike Rom zu begleiten und mit den vielen Alltagstypen Bekanntschaft zu machen, die diese Zivilisation mindestens ebenso prägten wie der große Feldherr Caesar, der große Moralist Seneca und der große kaiserliche Entertainer Nero. Die Rahmentexte leuchten sachliche historische Hintergründe aus und geben philologische Fingerzeige zu den literarisch ausgefeilten Gedichten, die Martials Ruhm als »eigentlicher Schöpfer und hervorragendster Vertreter des römischen Epigramms« (H. Szelest) begründen. Damit einzelne Kapitel in sich abgeschlossen sind, wurden einige wenige Überschneidungen und Wiederholungen in Kauf genommen.
Sollten Sie, verehrte Leserinnen und Leser, bei dem einen oder anderen Epigramm daran zweifeln, dass da vom alten Rom die Rede ist, und auf Typen und Verhaltensweisen zu stoßen glauben, die Ihnen bekannt vorkommen, so sehen Sie sich als Opfer einer Sinnestäuschung oder als mit der Antike allzu vertrauter Mensch an. Denn den Geizkragen Gellius, den Partytyrannen Ligurinus, den Angeber Mamurra oder den Erbschleicher Phileros – sie alle gibt es heutzutage nicht mehr. Was man ja schon an den fremden Namen erkennt.
1
Gegen fiese Gastgeber
Gastmähler, convivia, waren ein zentraler Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens in der römischen Oberschicht. Man lud einander ständig zu solchen Partys ein und nutzte sie auch weidlich dazu, den eigenen Wohlstand zu demonstrieren: ein prächtiges Haus, eine geschmackvolle Ausstattung mit griechischer Kunst, großer Bibliothek – Bücher waren teuer, da sie einzeln durch Kopisten hergestellt wurden – und kostbaren Möbeln, dazu schweres, möglichst altes Tischsilber, hübsche Bediensklaven und natürlich erlesene Speisen und Weine. Das alles diente dem Renommee, und in den ›besten‹ Kreisen kam es zu einem Überbietungswettbewerb, der das Gastmahl vielfach zu einem nicht mehr ganz so unterhaltsamen Schauplatz sozialer Distinktionsallüren werden ließ. Die legere Kleidung der Teilnehmer – man legte die steife Toga ab und griff stattdessen zur bequemen, kurzen, oft auch farbigen synthesis – konnte nicht über die latente Konkurrenzsituation hinwegtäuschen, und auch nicht das kräftige Pokulieren, wenn das convivium in eine comissatio, einen »Trinkabend«, überging.
In diesem Umfeld gab es reichlich Möglichkeiten, sich als zugewandter, großzügiger Gastgeber zu profilieren und bei aller Selbstinszenierung genussvolle Partys auszurichten, an die sich die Gäste gern erinnerten. Für Satiriker waren indes diejenigen Gastgeber ein ertragreicheres Feld, die sich in der einen oder anderen Weise danebenbenahmen und blamierten. Der Klassiker ist dabei die Schilderung der cena Trimalchionis durch Petron. Trimalchio, ein neureicher Freigelassener, eifert den convivia der vornehmen Gesellschaft nach, aber er erweist sich als tyrannischer, manipulativer Gastgeber, der in pausenloser Selbstdarstellung gar nicht merkt, in welche Fülle von Fettnäpfchen er tritt. Es spricht einiges dafür, dass Petron mit der vergnüglichen Schilderung der peinlichen Fauxpas dieses Möchtegern-Aristokraten indirekt auch an den convivium-Allüren mancher tatsächlicher Aristokraten und anderer Oberschicht-Angehöriger Kritik üben wollte, indem er ihnen einen Zerrspiegel vorhielt, der aber eben durchaus noch ein Spiegel war. Andere Satiriker übten diese Kritik direkter. So auch Martial in seinen humorvollen Kurzporträts kleingeistiger Tafel-Tyrannen. Wie hoch der Prozentsatz dieser fiesen Gastgeber war, wissen wir nicht. Aber dass es diese Typen gab und dass sie nicht allzu selten anzutreffen waren, steht außer Frage.
Ziemlich plump geht ein Fabullus vor, der seinen Gästen angeblich überhaupt nichts zu essen reichen lässt. Ob das glaubwürdig ist? Vielleicht hat Martial zugunsten der Pointe ein ziemlich karges Mahl unterschlagen oder das Fehlen von Fleisch mit nihil, »nichts«, gleichgesetzt. Auf jeden Fall hat Fabullus ziemlich merkwürdige Prioritäten gesetzt:
Unguentum, fateor, bonum dedisti
convivis here, sed nihil scidisti.
Res salsa est bene olere et esurire.
Qui non cenat et unguitur, Fabulle,
hic vere mihi mortuus videtur. (III 12)
Du hast, das gebe ich gern zu, gutes Salböl
gestern deinen Gästen spendiert, aber du hast nichts zerschneiden lassen.
Es ist schon eine komische Sache, gut zu riechen, aber hungrig zu sein.
Wer nicht ordentlich speist, aber gesalbt wird, Fabullus,
der scheint mir wahrhaftig tot zu sein.
Das Salben der Gäste mit Parfüms und wohlriechendem Öl gehörte zum convivium dazu; unguenta, »Salböle«, galten geradezu als Inbegriff von Freizeit und Wohlleben. Dafür gab es indes auch einen ganz praktischen Grund: Auf den Speisesofas lagen in der Regel drei Personen, und dadurch wurde es dort ziemlich eng; mit zunehmender Erhitzung durch Weinkonsum nahmen die körperlichen Ausdünstungen zu – der Gastgeber hatte ebenso wie seine Gäste ein Interesse daran, dass die überdeckt wurden. Fabullus hat sich in dieser Hinsicht nicht lumpen lassen. Er hat kein billiges Zeug von seinen Sklaven verteilen lassen, sondern qualitativ hochwertige Essenzen: unguentum bonum, »gutes Salböl«, wie der Dichter auch unumwunden zugibt. Umso unangenehmer fiel die ›lukullische‹ Bewirtung der Gäste dagegen ab. »Nichts zu schneiden« weist darauf hin, dass kein Fleisch gereicht wurde. Das war indes der Clou einer elaborierten Tischkultur. Bei den einfachen Leuten kam Fleisch bei nur wenigen Gelegenheiten auf den Tisch, aber in Martials gehobenen Kreisen – das war, auch wenn er sich als pauper poeta, »armer Dichter«, stilisiert, seine Welt – war es ungewöhnlich und galt als Ausdruck extremer Knauserigkeit, wenn Fleischgerichte fehlten. Der Effekt, das esurire, »hungern«, sollte man cum grano salis verstehen: Die Teilnehmer an Fabullus’ convivium brauchten wohl kaum Kohldampf zu schieben, aber bei teuren oder gar exquisiten Speisen hieß es Fehlanzeige. Der Ärger darüber war groß – und er entlud sich in einer ingeniösen Pointe. Martial fällt eine ›schlagende‹ Parallele ein: Wer roch – außer den enttäuschten Gästen des Fabullus – noch gut, kriegte aber nichts zu essen? Tote. Die wurden in Familien, die sich das leisten konnten, von Bestattern aufwendig ›hergerichtet‹ und mit schweren Ölen und Parfüms reichlich übergossen, was den Verwesungsgeruch überdecken sollte. Und so entgleiste die ›lahme‹, freudlose Party bei Fabullus eher zu einem Treffen von »Toten«. Von »Toten«, die immerhin gut rochen.
Der nächste Gastgeber scheint ein spendabler zu sein, der mit gutem, altem Wein verwöhnt:
Potavi modo consulare vinum.
Quaeris, quam vetus atque liberale?
Ipso consule conditum; sed ipse,
qui ponebat, erat, Severe, consul. (VII 79)
Jüngst trank ich Konsul-Wein.
Du fragst, wie alt er war und wie edel?
Er wurde unter dem Konsul selbst gelagert. Allerdings
war der, der ihn vorsetzte, Severus, selbst Konsul.
Konsul-Wein oder konsularischer Wein – das klingt nach einem guten Jahrgang aus alter Zeit. Und es weckt die Neugierde des Severus. So wie Weinkenner heute gern aufs Etikett schauen, um dann mit Anerkennung nicht zu geizen, will er Näheres wissen. Der erste Teil der Antwort hört sich noch ganz verheißungsvoll an, wenngleich er wenig Konkretes preisgibt. Der zweite Teil macht dann mit der Schlusspointe consul deutlich, dass es sich gewissermaßen um Heurigen handelte. Der Jahrgang war der des aktuellen Konsuls. Ein Spiel mit der ›aufgeladenen‹, geradezu aufgeblasenen Bedeutung von consularis, aus der Martial sozusagen die Luft lässt. Zu viel erwartet! Aber ohne unterschwelliges »ätsch!« Denn der eigentliche Leidtragende ist er selbst, und Neid, der mit dem ersten Vers vielleicht aufkommen könnte, ist denkbar unangebracht.
Betraf die ›Sparaktion‹ mit dem ziemlich jungen »konsularischen« Wein alle Gäste des findigen Konsuls, so verlegten sich andere Gastgeber auf eine differenzierte, aber auch stark differenzierende, um nicht zu sagen stigmatisierende Sparmethode: Sie ließen Weine und Speisen von unterschiedlicher Qualität servieren. Wichtige Leute und enge Freunde des Gastgebers bekamen Vorzügliches hingestellt, gesellschaftlich niedriger Stehende wie einfache Bürger, Freigelassene und Klienten durften zwar auf den Speisesofas liegen, nahmen kulinarisch aber sozusagen am Katzentisch Platz.
Eine Unart, fand der Jüngere Plinius. Er warnt vor »dieser modischen Verbindung von Luxusgehabe und schmutzigem Geiz« (EpistulaeII 6,7). Moderne Beobachter hauen nur zu gern in diese Kerbe einer ›perversen‹ Ungleichheit beim convivium. Manche weisen auf die Etymologie des Wortes hin, die ein con-vivere, »gemeinsames Leben«, beschreibe und deshalb für Ungleichbehandlungen eigentlich keinen Platz lasse. Tatsächlich aber war das convivium alles andere als ein ›demokratisches‹ Zusammentreffen insofern gleichberechtigter Personen. Die Hierarchie der römischen Gesellschaft wurde zum einen durch die Anordnung der Plätze abgebildet – da gab es ›Ehrenplätze‹ und geradezu eine Rangordnung innerhalb der klassischen neun Plätze –, zum anderen in der Gesprächsführung. Wer politisch wenig zu sagen hatte, hatte auch bei der Party wenig zu sagen, und insofern entsprach eine Ungleichbehandlung der Gäste durchaus dem römischen System. Das gesellschaftlich nivellierende Zusammenleben von Angehörigen unterschiedlicher Schichten war jedenfalls beim römischen convivium eher die Ausnahme; der etymologische Anspruch entsprach keineswegs der convivialen Realität.
Trotzdem gab es einen allgemeinen Konsens, die sozialen Unterschiede nicht durch eine diskriminierende Bewirtung auch noch zu betonen. Ganz sicher hat sich die große Mehrheit der Gastgeber diesem Comment gebeugt. Umso mehr ließ sich ein Abweichen von dieser Praxis skandalisieren – für den Satiriker Martial eine willkommene Gelegenheit, um entsprechend unsensible Gastgeber als »eigensüchtig«, »fies« und »unfair« zu attackieren. Dabei verfahren die einschlägig ›Verdächtigen‹ ganz unterschiedlich: Ein gewisser Ponticus gönnt nur sich selbst Gutes, versucht aber, die Diskriminierung zu tarnen. Doch Martial durchschaut ihn:
Nos bibimus vitro, tu murra, Pontice, quare?
Prodat perspicuus ne duo vina calix. (IV 85)
Wir trinken aus Glas, du aus Flussspatgläsern, Ponticus. Weshalb?
Damit der durchsichtige Becher nicht verrät, dass zwei Weine im Spiel sind.
Myrrhinische Gefäße, die angeblich den Duft von Myrrhe ausstrahlten, waren das Nonplusultra im römischen Gläserluxus. Sie kosteten Unsummen und waren beliebte Luxusaccessoires, mit denen sich renommieren ließ. Dass der Gastgeber nur einen dieser Schätze besaß und ihn für sich selbst reservierte, war nachvollziehbar und verständlich. Aber Martial kommt ihm auf die Schliche: Ponticus setzt seinen myrrhinischen Becher auch noch taktisch ein, um sich selbst einen edleren Tropfen zu genehmigen als seinen Gästen. Die Farbe des Weins, den sie zu trinken bekommen, schimmert durch die Glasbecher; bei Ponticus bleibt sie diskret hinter der opaken, von farbigen Adern durchzogenen Außenhaut des Edelpokals – maculosa, »gesprenkelt«, sagt Martial an anderer Stelle (X 80,1) – verborgen. Damit entspricht Ponticus’ Verhalten exakt der von Plinius gerüffelten Kombination von Luxus und Geiz. Irgendwie müssen die Kosten für das nächste myrrhinische Gefäß ja eingespart werden …
Was Ponticus mit den Getränken macht, macht Caecilian mit den Speisen – allerdings ohne es zu tarnen. Die Gäste schauen fassungslos zu:
Dic mihi, quis furor est? Turba spectante vocata
solus boletos, Caeciliane, voras.
Quid dignum tanto tibi ventre gulaque precabor?
Boletum, qualem Claudius edit, edas. (I 20)
Sag mir: Was ist das für ein Wahnsinn? Die Schar deiner geladenen Gäste schaut zu,
während du, Caecilian, als Einziger Edelpilze verschlingst.
Was soll ich dir wünschen, das für einen so gewaltigen Magen und Mund passt?
Einen Pilz, wie Claudius ihn aß, den iss auch du!
Das Epigramm gliedert sich in zwei gleich lange Teile. Im ersten wird das Verhalten des Caecilian skizziert, im zweiten die Reaktion des dichterischen Ichs darauf beschrieben. Das kann seine Empörung allerdings nicht zügeln, sondern macht gleich zu Anfang deutlich, dass es den Gastgeber für einen Verrückten hält: Furor ist das Substantiv zu furere, »toben«, »wüten«, »außer sich sein«. Ins Umgangssprachliche übersetzt, heißt die einleitende Frage: »Sag mal, hast du sie eigentlich noch alle?« Die Leser sind auf eine Ungeheuerlichkeit eingestimmt. Sie wird im nächsten Satz erläutert: Caecilian lässt sich selbst edle Pilze servieren – und seine Gäste dabei zugucken. Turba, die »Schar«, und solus, »allein«, bilden einen starken Kontrast, und auch die Tätigkeiten stehen in scharfer Opposition zueinander: Die einen schauen zu, sind also nur passiv beteiligt, Caecilian aber schaufelt sehr aktiv die leckere Vorspeise in sich hinein;