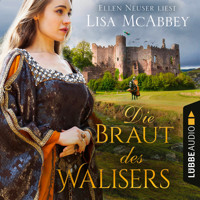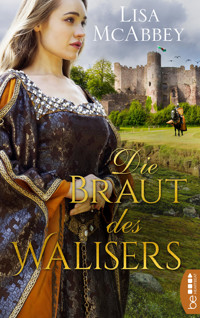
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Furchtlose Frauen und verführerische Rebellen
- Sprache: Deutsch
England 1485: Cecily ist die Tochter des Earl von Arundel, einem Getreuen des Königs aus dem Hause York. Gegen ihren Willen wird sie mit dem walisischen Hauptmann Sir Rhys Penndreic verheiratet. Zu ihrer eigenen Überraschung verhält Rhys sich äußerst zuvorkommend und allmählich entwickelt Cecily leidenschaftliche Gefühle für ihn ... Was Cecily nicht ahnt: Rhys hat ein dunkles Geheimnis, das nicht nur ihr Leben, sondern das Schicksal ganz Englands für immer verändern wird ...
Die Historischen Liebesromane von Lisa McAbbey sind in sich abgeschlossen, können unabhängig voneinander gelesen werden und sind in folgender Reihenfolge erschienen:
Die Eroberung des Normannen
Der Spion mit dem Strumpfband
Die Schmugglerlady
Lady ohne Furcht und Tadel
Die englische Lady und der Rebell
Die Braut des Walisers
beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 545
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Cover
Weitere Titel der Autorin
Über dieses Buch / Über die Autorin
Titel
Impressum
Prolog
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Weitere Titel der Autorin
Die Eroberung des Normannen
Der Spion mit dem Strumpfband
Die Schmugglerlady
Lady ohne Furcht und Tadel
Die englische Lady und der Rebell
Über dieses Buch
England 1485: Cecily ist die Tochter des Earls von Arundel, einem Getreuen des Königs aus dem Hause York. Gegen ihren Willen wird sie mit dem walisischen Hauptmann Sir Rhys Penndreic verheiratet. Zu ihrer eigenen Überraschung verhält Rhys sich äußerst zuvorkommend und allmählich entwickelt Cecily leidenschaftliche Gefühle für ihn ... Was Cecily nicht ahnt: Rhys hat ein dunkles Geheimnis, das nicht nur ihr Leben, sondern das Schicksal ganz Englands für immer verändern wird ...
Über die Autorin
Lisa McAbbey hat Rechtswissenschaften studiert und interessiert sich als Großbritannien-Fan schon seit vielen Jahren für englische, walisische und schottische Geschichte. Sie lebt in Wien und ist für einen internationalen Konzern tätig.
Lisa McAbbey
Originalausgabe
»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Copyright © 2022 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Heike Rosbach
Lektorat/Projektmanagement: Rebecca Schaarschmidt
Covergestaltung: Manuela Städele-Monverde unter Verwendung von Motiven © shutterstock.com: ian woolcock | Slawomir Fajer | ANGUK | © Richard Jenkins Photography
eBook-Erstellung: 3w+p GmbH, Rimpar (www.3wplusp.de)
ISBN 978-3-7517-0449-6
be-ebooks.de
lesejury.de
Prolog
In einer Mittwinternacht im zehnten Jahrhundert nach Christus, Kapelle von Dolgynwal im Norden von Wales
Die feierliche Stimme des Dewin hallte von den Mauern wider, von einem goldenen Zeitalter für das walisische Volk kündend. Der Rauch von glosenden Wacholderzweigen, harzig und frisch, waberte zur Kuppel der Apsis hoch, einen neuen Anfang verheißend. Der Flammenschein der Kerzen, angeordnet im Zeichen des Drachen, durchbrach die Schwärze dieser Winternacht, der dunkelsten des Jahres. So wie von nun an die Länge der Tage wuchs, so wuchs die Hoffnung auf Befreiung von den Unterdrückern. So wie das Licht zurückkehren und den Kampf gegen die Finsternis gewinnen würde, so würde Cadwaladr, der letzte König seines Volkes, zurückkehren und die Angelsachsen vertreiben. Er und die Seinen würden den verhassten Feinden den Thron entreißen.
Ausgestreckt wie der Gekreuzigte lag der junge Krieger mit gebeugtem Haupt vor dem Altar, nackt wie bei seiner Geburt. Seine Glieder waren steif vor Kälte, der Steinboden unter ihm eisig wie der Schnee, der draußen das Land überzog. Gleichzeitig standen ihm Schweißtropfen auf der Stirn. Sein Rücken brannte, übersät von den Malen, rot und schwarz, die er heute von der Hand des Bendragon empfangen hatte. Frost und Feuer, Schmerz und Pein – all das und Unsägliches mehr würde er erdulden müssen in dem Kampf, dem er in dieser Winternacht sein Leben weihte. Dem Kampf um die Freiheit seines Volkes. Zusammen mit den zwölf Gefährten, die, in lange schwarze Umhänge gehüllt, in einem Kreis um ihn herum Aufstellung genommen hatten, würde er Cadwaladrs Wiederkehr vorbereiten. Die Bruderschaft würde nicht innehalten, ehe nicht dessen Standarte, der rote Drache, wieder über Britanniens Erde wehte. Um dieses heilige Ziel zu erreichen, würde er von nun an alles andere hintanstellen.
»Wir preisen den Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat«, sang der Alte jene verheißungsvollen Worte, die von Taliesin, dem weisesten aller Dewin, höchstselbst niedergeschrieben worden waren. »Möge der heilige Davydd die Brüder führen und geleiten, möge sich Merddins Weissagung erfüllen.«
»Niemals weichen wir«, sprach daraufhin der neu Auserwählte voller Stolz den Schwur der Bruderschaft des roten Drachen, »niemals geben wir auf, niemals lassen wir nach. Wir vernichten die Feinde, die unser Scheitern erstreben. Trotz Folter und Qual beugen wir uns nicht. Unser Herz kennt kein Bangen, kein Rasten noch Ruhen bis zu jenem Tag, an dem Cadwaladrs Erbe seinen rechtmäßigen, vorherbestimmten Platz einnimmt. Das schwöre ich bei meinem Leben. Amen.«
Erstes Kapitel
Dieser ist kurz, jener ist lang;
einer ist bärtig und alt,
der and're jung und übel gestalt';
dieser ist mager und schmal,
der da ist feist, jener kahl.
Hugo von Trimberg über den Hochmut der Maiden
Festtag der Apostel Philippus und Jakobus im zweiten Herrschaftsjahr König Richards III., königliche Burg von Dover, Grafschaft Kent, an der südenglischen Küste
»Mylady, Mylady, ein Unglück! Ein fürchterliches Unglück!«
Die aufgeregte Stimme des Mundschenks war schon von Weitem zu hören, selbst über all das Getöse hinweg, das hier im Küchenhaus von Dover Castle herrschte. Zischen und Brutzeln, Hacken und Klopfen, das Klappern von Töpfen und Pfannen, das Stampfen von Stößeln, Gefluche, Gekreische, Gelächter. Dutzende Köche, Knechte und Mägde hantierten seit dem Morgengrauen, um die vierhundert Gäste zu beköstigen, die der Earl von Arundel zum Turnier geladen hatte, wie jedes Jahr am Maienbeginn. Fleischbrater, Fischgarer, Pastetenbäcker, Suppenköche und Soßenmacher bis hin zu Abwäschern, Feuerschürern, Geflügelrupfern und Bratspießdrehern – alle unter der gestrengen Aufsicht von Maître Antoine, dem gräflichen Küchenmeister aus dem Artois.
»Was ist denn geschehen, Esmond?« Cecily gab dem Flamen den Löffel zurück, mit dem sie eben von dessen Soße Camelyne hatte kosten wollen, und wandte sich an den Mundschenk, der sich keuchend an die Brust fasste, als er vor ihr stehen blieb. Nach seinem rasselnden Atem zu schließen, schien er nicht nur das langgestreckte Küchengewölbe, sondern auch die beiden Burghöfe im Laufschritt durchquert zu haben.
»Richard Whityngton, der Kaufmann aus London, hat Nachricht geschickt«, berichtete der kahlköpfige Ministeriale außer sich. »Auf dem Weg hierher ist eine Achse seines Fuhrwerks gebrochen, woraufhin der Karren umgestürzt und die gesamte Ladung eine Böschung hinabgerollt ist. Alle fünf Fässer sind zerborsten, Mylady! Alle fünf!«
»O nein!«, rief Cecily. Whityngton, des Earls bevorzugter Weinhändler, war beauftragt, den gesamten für das dreitägige Turnier benötigten Vorrat an Burgunder und Rheinischem zu liefern. Seine Ankunft war schon sehnlichst erwartet worden.
»Er ist untröstlich und hat bereits eine neue Fuhre auf den Weg geschickt. Die wird aber nicht vor morgen Mittag eintreffen. Was soll ich dann nur heute Abend beim Bankett auftragen lassen? Nichts als Ale?«
Bei dieser Aussicht rümpfte der Küchenmeister abfällig die Nase, und auch Cecily schüttelte den Kopf. »Nein, das ist unmöglich! Ein Festmahl ohne Wein – damit machten wir uns zum Gespött des gesamten Königreichs.« Adelige Damen und Herren aus den bedeutendsten Familien des Landes hatten sich angesagt. Ihnen eine Feierlichkeit zu bieten, die weniger als vollkommen war, war ausgeschlossen. Immerhin hatten die Arundels einen Ruf zu verlieren!
Nun war guter Rat teuer. Cecily biss sich auf die Unterlippe, während sie vor einer der Feuerstellen auf und ab lief und fieberhaft nach einem Ausweg suchte. Dabei strich sie eine blonde Strähne aus dem Gesicht, die feucht an ihrer Schläfe klebte. Nicht nur die Haare, auch die Kleider schienen ihr auf den Leib gekleistert. Trotz der weit offen stehenden Türen hing der Dunst, warm und dampfig, in dicken Schwaden über ihren Köpfen. Der Geruch von frisch Gebratenem, von Gegartem und Gesottenem, von Kräutern und Gewürzen kitzelte die Nase.
»Vielleischt findet sisch in einem der alten Keller unter dem donjon noch das eine oder andere barrique«, schlug Maître Antoine in dem unverkennbaren Akzent seiner Heimat vor. »Hast du gründlisch nachsehen lassen?«
»Natürlich«, funkelte Esmond Butler den Küchenmeister an. »Willst du mir unterstellen, meine Pflichten als Mundschenk nicht ernst zu nehmen?« Es folgten weitere Sticheleien, die der Flame nicht unerwidert ließ.
Dies war nicht das erste Scharmützel zwischen den beiden Dienstmannen, die einander spinnefeind waren, doch heute hatte Cecily keine Zeit, schlichtend einzuschreiten. »Esmond«, befahl sie, ohne das Gekeife der beiden zu beachten, »begib dich mit ein paar Knechten zur Probstei Sankt Martin, und bitte Master Tutbury, uns sämtliche Weinvorräte zu überlassen. Wenn morgen die neue Lieferung aus London kommt, werden er und seine Mönche reichlich Entschädigung erhalten.«
Daraufhin leuchtete das Gesicht des Mundschenks hoffnungsfroh auf. »Sehr wohl, Mylady!«, strahlte er und eilte mit einer tiefen Verbeugung davon.
Indes führte der Küchenmeister Cecily in jene Ecke, wo er das Schaugericht für den Abschluss des heutigen Banketts aufgebaut hatte.
»Ich hoffe, das entremet findet Myladys Gefallen«, gurrte er, und Cecily nickte beeindruckt. Vor ihr erhob sich, so hoch wie ein halber Mann, eine Nachbildung des Dover Castle samt Turnierplatz und grüner Wiese, auf der, wie lebendig, ein Pfau mit ausgebreiteten Flügeln hockte; die schillernden Schwanzfedern hingen weit über die Tischkante hinab. Es gab Bäume mit goldenen Äpfeln, violette Veilchen im Gras, und von den Zinnen wehten Banner mit dem Löwen von Arundel.
»Die Ritter und Pferde sind aus Fleisch geformt«, erklärte der Küchenmeister, »wie auch die Früchte. In dem Pfau versteckt sich eine gebratene Gans, die ich in das blaue Federkleid eingenäht habe. Der Vogel hockt neben einem Brunnen, aus dem Rosenwasser und Weißwein fließen werden. Und in den Türmen sind Fackeln angebracht, die entzündet werden, wenn das entremet in die große Halle getragen wird.«
Eben wollte Cecily zu einer ausgiebigen Lobrede ansetzen, doch zu mehr als »Du bist ein wahrer Meister deines Fachs, Antoine!« kam sie nicht. Denn abermals waren laute Rufe zu vernehmen – dieses Mal war es Alice, ihre drittälteste Schwester, die in ihrer schwarzen Äbtissinnentracht durch die Küchenhalle auf sie zusegelte. Da Alice selten die Wirtschaftsgebäude betrat, musste es sich wohl um eine dringliche Angelegenheit handeln.
»Ach, hier steckst du, Cecily«, begann die fünf Jahre ältere Schwester sogleich in vorwurfsvollem Ton. »Ich habe dich schon überall gesucht. Die Turmkammer, die mir der Seneschall zugeteilt hat, ist völlig ungeeignet. Ich bestehe darauf, in meinem früheren Schlafgemach untergebracht zu werden. Aber dieser ... dieser Walter Steward weigert sich, meinen Wunsch zu befolgen. Du musst etwas unternehmen, Cecily, jetzt sofort!« Und ehe sie sichs versah, packte Alice ihren Arm und zog sie hinter sich her, aus der Küche hinaus. »So komm schon!«
Ach herrje, das fehlte ihr noch, eine zickende Schwester! Als gäbe es heute nicht schon genug, worum sie sich zu kümmern hatte. »So warte doch, Alice«, gebot Cecily der Älteren Einhalt und riss sich etwas unsanft los. »Das Gemach, das du bei deinen Aufenthalten hier zu benutzen pflegst, habe ich Margaret und ihrer Familie überlassen.« Dieses Gemach befand sich in der einst von König Henry III. erbauten neuen Halle und war nicht nur weitaus geräumiger, sondern auch über weniger Stufen zu erreichen als die ungemütlichen Kemenaten im Great Tower. Diese wurden nur benutzt, wenn die Burg wie gerade jetzt wegen zu vieler Gäste aus allen Nähten platzte. Ihrer ältesten Schwester Margaret, die im siebten Monat schwanger und zudem samt Ehemann und vierjährigem Sohn angereist war, konnte – so fand Cecily – keine der alten Turmkammern zugemutet werden. Alice dagegen war allein und besaß ausreichend Saft und Kraft, um die steile Wendeltreppe im Great Tower mehrmals täglich zu bewältigen.
»Die Stube mit dem grünen Himmelbett habe immer ich bewohnt, das weißt du so gut wie ich, Cecily, und ich bestehe darauf ...«
»Ojeee«, fiel ihr Cecily rasch ins Wort, ehe Alice sich in einer endlosen Lamentation verlor, wie es oft genug geschah, »ich dachte, ich würde dir eine Freude bereiten! Hoch oben in der Turmkammer, so meinte ich, littest du nicht am Lärm und Gestank des Burghofs und wärst ganz ungestört. Deine heilige Ruhe schätzt du doch über alles, nicht wahr?«
»Ja, gewiss, das tue ich«, gab die Schwester zu, »ich habe ja meine Gebete zu verrichten, mehrmals am Tag. Dennoch ...«
»Siehst du«, unterbrach Cecily sie einmal mehr, »das dachte ich mir. Deshalb habe ich auch das Livre d'heures unserer verstorbenen Mutter in deine Kammer bringen lassen, damit du darin lesen kannst. Obwohl ich damals nur ein kleines Mädchen war, kann ich mich erinnern, wie du das Stundenbuch oftmals von Mutters Kniestuhl stibitzt hast.«
»Die wunderschönen Malereien haben mich als Kind sehr beeindruckt«, gestand Alice, und ein gerührter, vielleicht gar wehmütiger Ausdruck trat in ihre Augen. »Auch heute noch bewundere ich die Kunstfertigkeit der Buchmaler und freue mich darauf, durch Mutters Horarium zu blättern – es ist ein besonders schönes Werk. Ich danke dir, dass du daran gedacht hast.«
»Du musst mir nicht danken, Alice, das gehört doch zu meinen Pflichten als Burgherrin«, erwiderte Cecily, was ihrer Schwester ein Lächeln entlockte.
»Nun, dann will ich mich dem Wunsch der Burgherrin beugen und mich nicht länger gegen das Turmzimmer wehren«, lenkte sie ein.
»Aus dir spricht wahrer Edelmut«, lobte Cecily und drückte der Älteren einen Kuss auf die Wange. »Sollte es dir an etwas fehlen, möge es noch so gering sein, lass es mich wissen, ich werde mich umgehend darum kümmern.« Erleichtert winkte sie Alice hinterher, als diese sich auf den Weg zur Burgkapelle machte, um vor dem Turnierbeginn noch zu meditieren. Sie selbst begab sich zuerst hinüber zur Backstube, danach sah sie im Brauhaus und in der Schlachterei vorbei, um sich zu vergewissern, dass es keine neuen Schreckensnachrichten gab, derer sie sich annehmen musste. Aber nein, überall summte es emsig wie in einem Bienenstock!
Gerade eilte sie über den inneren Burghof zurück – es wurde höchste Zeit, sich zurechtzumachen –, als Agnes, ihre Leibmagd, herbeigelaufen kam. Gleichzeitig steuerte von der Schreibstube der Seneschall, einen großen Lederband unter dem Arm, auf sie zu.
»Wo bleibt Ihr nur, Mylady?«, rief die sommersprossige Dienerin und warf verzweifelt die Hände in die Höhe. »Das Badewasser wird schon kalt. Und welches Kleid soll ich denn nun für Euch herrichten?«
»Lady Cecily, ich habe alle Beschaffungen für das Maienfest eingetragen«, verkündete Walter Steward und klopfte auf das Haushaltsbuch. »Mit Eurer Erlaubnis werde ich die Händler und Bauern auszahlen.«
Nun, die Burg glich wohl eher einem wild brummenden Hummelnest als einem summenden Bienenstock, berichtigte Cecily ihre frühere Feststellung. »Ich komme gleich«, beschied sie Agnes, »ich werde das neue rosenfarbene Kleid tragen und abends beim Bankett das karmesinrote mit den Silberborten.«
Dann folgte sie dem Seneschall in dessen Schreibstube, wo er den Lederband aufschlug und die fein säuberlich verfasste Aufstellung vorlas: »Einhundertzwanzig Ochsen, einhundertfünfzig Schafe, Schweine an der gleichen Zahl, einhundertdreißig Gänse, sechzig Kapaune, fünfundzwanzig Schwäne, ein Pfau, achthundert Vögel verschiedener Art – die einzelnen Arten habe ich hier angeführt: unter anderem Reiher, Kraniche, Kormorane, Störche und Stare – sowie achttausend Eier.« Dazu kamen noch Ausgaben für Brot, Butter, Fisch, Gemüse, Früchte, Honig, Essig, Spezereien und Blattgold – alles in gewaltigen Mengen. Nur das Wildbret stammte aus des Earls eigenen Wäldern. Cecily prüfte jeden einzelnen Eintrag, stellte Fragen und wies schließlich die Bezahlung der Lieferer an. Nun, jetzt fehlte nur noch der Wein für ein gelungenes Fest! Hoffentlich war Esmond derweil bei den Mönchen von Sankt Martin erfolgreich gewesen, sonst war sie wahrlich am Ende ihres Lateins.
***
William Arundel, der sechzehnte Earl von Arundel, ließ sich ächzend in einen gepolsterten Lehnstuhl fallen. Nach siebenundsechzig Wintern, das war nicht zu leugnen, machten ihm seine alten Knochen mehr zu schaffen, als ihm lieb war. Mit einem Wedeln seiner Hand scheuchte er den Diener hinaus und wandte sich dann den drei Männern zu, die ihm bis zum Beginn des ersten Lanzengangs hier in seiner privaten Wohnstube Gesellschaft leisteten.
»Welche Nachrichten bringst du aus London, John?«, fragte er seinen Schwiegersohn. »Wie ergeht es dem König in seiner Trauer?«
Der junge Earl von Lincoln, des Königs ältester Neffe, gehörte zu Richards engsten Vertrauten und wusste üblicherweise über alles, was an dessen Hof vorging, bestens Bescheid. Trotz seiner fünfundzwanzig Jahre hatte der vielversprechende Bursche bereits einen klugen Kopf wie auch – was William besonders schätzte – unerschütterliche Treue zu seinem Onkel und dem Haus York bewiesen. Wohl aus diesem Grund hatte Richard nach dem betrüblichen Hinscheiden seines einzigen Sohnes, des zehnjährigen Prinzen von Wales, vor einem Jahr mehrere von dessen Ämtern an John de la Pole übertragen. So hatte er seinen Neffen zum Lieutenant of Ireland ernannt wie auch zum Vorsitzenden des bedeutenden Council in the North. Nicht wenige, darunter auch William selbst, vermuteten deshalb, Richard habe Lincoln zu seinem Thronerben ausersehen, auch wenn er ihn dazu niemals förmlich bestimmt hatte. Immerhin war der König jung genug, weitere Söhne zu zeugen.
Wie auch immer, der Earl von Lincoln würde jedenfalls eine gewichtige Rolle im Königreich einnehmen, und William beglückwünschte sich nicht zum ersten Mal zu jenem Tag, an dem er die Heirat seiner Ältesten, Margaret, mit dem königlichen Neffen zuwege gebracht hatte. Seit sein Vorfahr Alan fitz Flaad, ein bretonischer Ritter, vor vierhundert Jahren in die Dienste König Henrys I. getreten war, hatten die Arundels ihre Stellung, ihre Titel und ihre Ländereien beständig ausgebaut und reihten sich nun unter die angesehensten und vermögendsten Familien Englands ein, worauf William überaus stolz war. Doch wäre es gleichsam die Krönung ihrer Bemühungen, säße eines Tages ein Arundel-Spross auf dem Thron dieses Landes.
»Der Kummer um Anne verzehrt meinen Onkel«, berichtete John, der einige Tage im Palast von Westminster zugebracht hatte, ehe er mit seiner Familie nach Dover gekommen war. »Er ist ein Schatten seiner selbst. Er zieht sich stundenlang zum Gebet zurück und meidet es, wenn immer möglich, öffentlich zu erscheinen.«
»Nun«, meldete sich Williams eigener Neffe und Erbe zu Wort, »deshalb hat er mich gebeten, an seiner Statt den Feierlichkeiten zum Sankt Georgstag in Windsor Castle vorzustehen.« Dabei blähte er stolz die Brust, was in dem engen Wams, das er trug, wohl kein leichtes Unterfangen war. Obwohl er bereits in der Mitte seines vierten Lebensjahrzehnts stand, kleidete sich Thomas Arundel, Baron Maltravers, mit Vorliebe wie ein junger Geck. »Gewiss hätte er dir selbst, liebster Onkel«, dabei beugte er sein Haupt in Williams Richtung hin, »diese ehrenvolle Aufgabe übertragen, wenn es deine Gesundheit denn erlaubte. Doch springe ich natürlich gern in die Bresche, für meinen König wie auch meinen Oheim.«
William nickte seinem Erben mit einem dünnen Lächeln zu, dabei entgingen ihm weder die zuckenden Mundwinkel seines jüngsten Bruders noch der Grund dafür. Obschon ebenfalls dessen Onkel, wurde Humphrey von ihrer beidem Neffen mit weitaus weniger Gewese bedacht, hatte er doch keinen Grafentitel zu vererben und überdies drei eigene Söhne. Nun ja, daran gab es nichts zu beschönigen: Wenn es um seinen Vorteil ging – da kam er ganz nach seinem verstorbenen Vater –, neigte Thomas zur Arschleckerei. Darauf wies Cecily, Williams Jüngste, ihn oft genug hin, doch musste er Thomas auch zugutehalten, dass dieser stets die Belange der Familie Arundel im Sinn hatte – wenn auch nicht jedes einzelnen Mitglieds.
»Man kann es Richard wahrlich nicht verdenken«, überging Humphrey Thomas' lässliche Rede. »Bei Gott, den einzigen Sohn wie auch sein Weib binnen eines Jahres zu verlieren ist ein harter Schlag, der jeden Mann ins Wanken geraten ließe. Und es ist gerade einen Monat her, dass wir Anne zu Grabe getragen haben.«
»Ja«, stimmte William zu, »die gute Seele ist viel zu früh von uns gegangen! Dabei war sie uns allen ein Vorbild an Güte und Demut. Ohne Murren und Klagen hat sie die neuen Pflichten auf sich genommen, die das Schicksal ihr auferlegt hat, damals vor zwei Jahren, als nach König Edwards plötzlichem Tod die Krone unerwartet an dessen jüngsten Bruder Richard fiel.« Weder Richard, seinerzeit Herzog von Gloucester, noch Anne noch sonst jemand in England – wohl mit Ausnahme des Bischofs von Bath – hatte zuvor mit einem solchen Lauf der Ereignisse gerechnet, doch im Nachhinein betrachtet konnte William sich kein besseres Königspaar vorstellen als Richard Plantagenet und Anne Neville. »Ich bete jeden Tag für Richard«, fuhr er mit sorgenvoll umwölkter Stirn fort, »der Allmächtige möge ihm Kraft und Mut schenken in dieser schweren Zeit. Nur zu gut kann ich nachfühlen, wie es ihm jetzt ergeht. Als meine Joan vor vierzehn Jahren im Kindbett starb, samt dem Neugeborenen, war ich untröstlich.« So sehr, dass William – obschon Joan ihm fünf Töchter, jedoch keinen Stammhalter geschenkt hatte – niemals wieder geheiratet hatte. Weshalb auch? Dank seiner beiden jüngeren Brüder, die genügend Söhne gezeugt hatten, war der Fortbestand der Arundels in der männlichen Linie nicht gefährdet. William selbst hatte den Grafentitel ja auch nur nach seinem älteren Bruder und dessen Sohn geerbt. Und dank seiner Töchter, zuerst Margaret und nun Cecily, die ihm seit Joans Tod den Haushalt führten, hatte er auch in dieser Hinsicht niemals eines zweiten Eheweibes bedurft.
Richard aber, das war ihm einsichtig, konnte sich eine solche Freiheit nicht erlauben. Als König ohne rechtmäßige Nachkommen musste er nach einer neuen Gemahlin Ausschau halten, um die Thronfolge für das Haus York zu sichern. Mit zweiunddreißig Jahren, gesund und kraftstrotzend, war es dafür gewiss noch nicht zu spät, doch duldete die Angelegenheit auch keinen Aufschub. »Was hat Richard denn nun vor?«, wollte er von seinem Schwiegersohn wissen.
John deutete seine Frage richtig. »Wenngleich es ihm jetzt schwerfällt, so weiß mein Onkel um seine Verantwortung, daher hat er bereits mehrere Brautwerber ausgeschickt. All seine Ratgeber, so auch ich, empfehlen ihm die Heirat einer Prinzessin eines fremden Königshofes. Erwählte er eine englische Edeldame zur Frau, würde er damit eine der hiesigen Familien bevorzugen, was nach all den Jahren des Zwists und Streits zu neuen Unruhen führen könnte.«
»Das klingt sehr vernünftig«, stimmte William zu.
»In den vergangenen Wochen hat er ein Bildnis von sich anfertigen lassen«, berichtete John weiter, »wiewohl der Zeitpunkt ungünstig ist. Der traurige Ausdruck in seinen Augen lässt sich nicht verbergen.«
»Davon wird sich wohl keine Anwärterin abschrecken lassen«, warf Humphrey ein. »Selbst mit blassem Gesicht ist der König von England ein begehrter Fang.«
John verzog den Mund. »Da gebe ich dir recht«, entgegnete er und wandte sich dann an William. »Wenn wir gerade vom Freien sprechen: Hat meine Schwägerin endlich einen Bräutigam auserkoren?«
Da schürzte William verdrießlich die Lippen. »Ha, ich wünschte, es wäre so! Meine Jüngste weiß an jedem, wahrlich an jedem etwas auszusetzen, dabei gebe ich seit fünf Jahren Fest um Fest, um ihr passende Bewerber vorzuführen. Doch es ist zum Verzweifeln: Ihre Antwort ist stets ein Nein! Allmählich bereue ich es, ihr dazumals das Versprechen gegeben zu haben, sich ihren Ehemann selbst wählen zu dürfen.«
Das war an Cecilys vierzehntem Geburtstag gewesen. Sein Röslein hatte immer einen besonderen Platz in seinem Herzen eingenommen, vielleicht weil von all seinen Töchtern sie ihn am meisten an Joan erinnerte. Jedenfalls war es ihm so gut wie unmöglich, ihr etwas abzuschlagen, weshalb er ihr ihren Wunsch zum damaligen Geburtstag freudig gewährt hatte. Seine übrigen vier Töchter hatte er allesamt sehr vorteilhaft unter die Haube – oder den Klosterschleier – gebracht, daher wäre nicht viel verloren, sollte sich seine Fünfte für einen wenig bedeutsamen Burschen entscheiden. Williams einzige Vorgabe – die aber war nicht verhandelbar – bestand darin, dass sein neuer Schwiegersohn aus guter Familie stammte und durch und durch königstreu war. Ein Anhänger des Hauses Lancaster käme ihm ganz gewiss nicht ins Haus.
»Meine Base feiert bald ihren neunzehnten Geburtstag«, betonte sein Neffe einen Umstand, der William zugegebenermaßen zunehmend den Schlaf raubte. »In diesem Alter sind die meisten Edeljungfern längst verheiratet.«
Damit hatte Thomas gewisslich recht. Was die Angelegenheit aber tatsächlich immer dringlicher machte, war William selbst: Er war ein alter Mann, seine Tage hier auf Erden gezählt. Wenn er dereinst seinen Abschied nahm, um vor seinen Schöpfer zu treten, wollte er keine seiner Töchter unversorgt zurücklassen, am allerwenigsten Cecily.
»Meiner Base hätte schon vor Jahren ein Ehemann verpasst gehört«, schnaubte Thomas, »ob es ihr nun gefällt oder nicht. Den meisten Weibern, und Cecily zählt zweifellos dazu, fehlt es an der nötigen Einsicht, was das Beste für sie ist. Deshalb hat der Herrgott es ja so eingerichtet, dass wir Männer die Entscheidungen für das schwache Geschlecht treffen.«
Es war kein Geheimnis, dass Thomas und Cecily einander wie Hund und Katz waren und sein Neffe deshalb bestrebt, Cecily baldtunlichst aus dem Haus zu haben. Wenn es darum ging, war selbst seine Speichelleckerei vergessen. Noch allerdings war dieses Haus Williams Haus, und er war nicht gewillt, das Zepter vorzeitig aus der Hand zu geben. Ein Weilchen musste sich sein Erbe schon noch gedulden!
»Cecily soll ihre Wahl haben«, wies er Thomas zurecht, »so wie ich es ihr versprochen habe. Gewiss, ich hätte sie mehr drängen können, doch gestehe ich ein, dass es mir nur zu gut gefällt, mein Röslein um mich zu haben. Sie ist eine ausgezeichnete Burgherrin, kümmert sich liebevoll um mich, und so vieles an ihr, ihr Lachen, ihre blauen Augen, ihre goldenen Locken erinnern mich an meine Joan. So ist es, als wäre ein Teil von ihr immer noch bei mir.«
»Es lag mir fern, dich zu tadeln, Onkel«, versuchte Thomas sogleich, die Scharte auszuwetzen, und William war geneigt, es ihm nachzusehen.
»Auch wenn ich mir wünsche«, gab er zu, »dass alles so bleibt, wie es ist, weiß ich doch, es ist unmöglich. Deshalb habe ich auch dieses Jahr wieder alle königstreuen Junggesellen zum Maienturnier eingeladen, und ich bin wohlgemut, dass Cecily dieses Mal eine Entscheidung treffen wird.«
»Nun, dann wollen wir hoffen«, lachte John, »dass einer der Herren sie ausreichend beeindrucken kann.«
In dem Moment war ein forsches Klopfen an der Tür zu hören, und gleich darauf betrat Williams Hauptmann die Stube.
»Mylord, der tägliche Bericht von der königlichen Flotte ist eingetroffen«, vermeldete Sir Rhys mit einer Verbeugung und überreichte William dann eine schmale Pergamentrolle. »So wie der Bote schildert, ist weiterhin alles ruhig.«
»Danke, Penndreic«, erwiderte William und brach das Siegel. Als Constable von Dover Castle und Lord Warden of the Cinque Ports, beides Ämter, die William von König Richard verliehen worden waren, war er, der Earl von Arundel, für die Aufrechterhaltung des Friedens hier im Südosten des Reiches verantwortlich. Nachdem er die wenigen Zeilen des Kommandeurs überflogen hatte, bestätigte er: »Ja, zum Glück keine Vorkommnisse. Keine feindlichen Schiffe in Sicht, keine Anzeichen von ungewöhnlichen Bewegungen. Was mir nur recht ist, so kann das Turnier ungestört vonstattengehen.«
Nachdem die königlichen Spione vor wenigen Wochen Kunde von einem bald bevorstehenden Angriff aus Frankreich gebracht hatten, hatte Richard mehrere bewaffnete Schiffe unter dem Befehl seines Vetters Sir George Neville in den Süden entsandt, um die Küste zu bewachen.
»Habt Ihr Befehle für mich, Euer Lordschaft?«, erkundigte sich Sir Rhys beflissen, und William schüttelte den Kopf.
»Nichts, was wir nicht schon besprochen hätten. Ich verlasse mich auf Euch, Hauptmann, und weiß, Ihr enttäuscht mich nicht.«
»Sehr wohl, Mylord«, erwiderte Sir Rhys, und William sah dem jungen Söldner, der vor bald zwei Jahren in seine Dienste getreten war, wohlwollend hinterher, als dieser sich mit einer weiteren Verbeugung unauffällig zurückzog. Obschon kaum älter als Lincoln, hatte sich der walisische Ritter in Burgund und Flandern, aber auch auf Richards Feldzug gegen Schottland bereits den Ruf eines wackeren Recken und umsichtigen Befehlshabers erworben. Und ihm war es auch, zu keinem geringen Teil, zu verdanken, dass der Earl von Arundel hoch wie nie in der Gunst seines Monarchen stand. Unter Penndreics Kommando hatten Arundel-Truppen mitgeholfen, Buckinghams Rebellion hier in Kent niederzuschlagen, und erst vor wenigen Wochen hatten er und seine Männer den Hochverräter Roger Clifford im Hafen von Southampton aufgegriffen. In diesen Zeiten war es überlebensnotwendig, den König seiner unverbrüchlichen Treue zu versichern. Und William war stolz, Richard und dem Hause York, dem einzig wahren Königshaus, zu dienen.
***
»Ah, da bist du ja, mein Röslein!«
Mit würdevoll erhobenem Haupt, wie es einer Grafentochter gebührte, nahm Cecily auf der Galerie, die für die vornehmen Zuschauer auf der Längsseite der Turnierwiese errichtet worden war, neben ihrem Vater Platz. Die Sonne brannte heute ungewöhnlich heiß vom Himmel, doch dank der langen Zeltbahnen, die sie wie einen Baldachin über die Balken der Tribüne hatte spannen lassen, war es hier angenehm schattig. Überdies kühlte vom Meer her eine frische Brise, die die bunten Wimpel und Fähnlein fröhlich flattern ließ.
Cecily beugte sich zu ihrem Vater, um einen Kuss auf seine faltige Wange zu drücken, ehe sie mehreren Bekannten zuwinkte und dem Prior von Sankt Martin, den sie einige Köpfe weiter entdeckte, ein freundliches Lächeln schenkte. »Für das Bankett ist nun alles bereit«, raunte sie ihrem Vater zu, »Master Tutbury hat uns sechs Hogsheads Wein überlassen.«
»Sehr gut«, lobte er, »da hast du wieder ein wahres Wunder vollbracht, Röslein. Ich werde Master Tutbury nachher meine Erkenntlichkeit aussprechen.« Zufrieden brummend wandte er sich dem Geschehen auf der Turnierwiese zu, und Cecily folgte seinem Beispiel. Mit mäßigem Vergnügen – das ritterliche Kräftemessen war ihr immer schon wie eitle Hahnenkämpfe vorgekommen – beobachtete sie die beiden Recken, die eben ihr Können zur Schau stellten. Den Wettstreit mit den Lanzen hatten sie wohl schon hinter sich gebracht, denn die zwei Ritter waren von ihren Rössern abgesessen und hieben nun mit ihren mächtigen Schwertern aufeinander ein. Dumpf hallten die Schläge wider, wenn die schweren Klingen gegen den Holzschild des Gegners krachten. Metallisches Klirren erfüllte die Luft, manchmal begleitet von sprühendem Funkenschlag, wenn die stählernen Schneiden auf die Rüstung oder Waffe des Kontrahenten trafen. Aus den Rängen der Zuschauer hörte man Anfeuerungen, Schmähungen und oftmals das Ausstoßen angehaltenen Atems.
Einer der beiden Recken, ein Bär von einem Mann, dessen Wappenhemd ihn als John Radcliffe FitzWalter von Attleborough auswies, schwankte bereits gefährlich. Der Erbe der FitzWalter-Baronie mit Besitzungen in Essex, Anglia und Cumberland, mit gut dreißig Jahren noch im besten Mannesalter, war einer von Cecilys hartnäckigsten Verehrern. Alas, erst gestern Abend, als sie ihn an der Seite ihres Vaters auf Dover Castle willkommen geheißen hatte, hatte er ihr so tief in die Augen geblickt, dass sie schon befürchtet hatte, er würde vornüberkippen.
Trotz des geschlossenen Helmvisiers war FitzWalters angestrengtes Keuchen deutlich zu vernehmen. Die Schläge seines Schwertes verloren an Stärke, reichten aber immer noch aus, um Holz und Knochen zu zerschmettern, sollten sie erfolgreich ihr Ziel treffen. Sein Gegner, beinahe einen Kopf kleiner und von schlanker Gestalt, in einer schmucklosen Rüstung ohne Abzeichen, schien mit dem Riesen zu spielen wie die Katze mit der Maus. Obwohl der Wettkampf der beiden Männer sicherlich schon geraume Zeit andauerte, waren seine Bewegungen geradezu leichtfüßig, ja anmutig, und zeugten von ungebrochener Kraft.
»Der gute FitzWalter«, stellte der Earl von Arundel verdrossen fest, »spricht Braten und Ale gar übermäßig zu, anstatt seinen Leib durch Übung an den Waffen zu ertüchtigen. Sein Wanst macht ihn täppisch und raubt ihm den Atem. Er wird dem Waliser unterliegen, wenn er sich nicht schnell etwas einfallen lässt.«
Bei den letzten Worten warf Cecily ihrem Vater einen überraschten Blick zu. »Der Waliser?«, fragte sie mit einer Mischung aus Neugier und Entsetzen. »Du hast dem Waliser erlaubt, am Turnier teilzunehmen und sich mit den Herren von edlem Geblüt zu messen? Er ist doch bloß ein gemeiner Söldner!«
Ein ungehobelter, vorlauter, zwielichtiger Söldner, fügte sie in Gedanken hinzu, hütete sich aber, diese laut zu äußern. Ihr Vater ließ nichts auf seinen hochgeschätzten Hauptmann kommen, mochte sie auch noch so viele Bedenken ins Feld führen – was sie bei mehr als einer Gelegenheit getan hatte. Anders als der Earl misstraute Cecily dem dahergelaufenen Kerl, der wie aus dem Nichts eines Tages vor zwei Jahren, kurz nachdem ihr Vater zum Constable von Dover Castle ernannt worden war, zusammen mit seiner Dutzendschar von walisischen Spießgesellen aufgetaucht war und dem Earl seine Dienste angeboten hatte. Irgendetwas, Cecily konnte es nicht benennen, hatte sie von Anfang an an der Aufrichtigkeit dieses Mannes zweifeln lassen. Irgendetwas stimmte nicht mit ihm. Aber was immer es auch war, sie hatte es bisher nicht herausfinden können. Daher beschränkte sie sich darauf, um den Waliser und dessen Gefolgsleute einen weiten Bogen zu machen, was nicht immer einfach war, denn ihr Vater schien regelrecht einen Narren an dem Kerl gefressen zu haben. Statt auf ihren vernünftigen Rat zu hören und Vorsicht walten zu lassen, hatte er den Mann, der sich seinen Lebensunterhalt damit verdingte, seinen Schwertarm an den Meistbietenden zu verkaufen – und einen Furz auf die Gesinnung! –, bald zum Hauptmann der Garnison ernannt, womit ihm sämtliche Soldaten des Earls von Arundel unterstanden. Immerhin einhundertfünfzig Mann.
Der Graf nahm einen Schluck Wein aus dem silbernen Kelch, den ein Diener ihm reichte, ehe er antwortete: »Er mag kein Mann von edlem Geblüt sein, Röslein, aber er hat sich seine Sporen redlich verdient. Er ist vom Burgunderherzog für seine Tapferkeit zum Ritter geschlagen worden, bei der Belagerung der kurkölnischen Stadt Neuss, und das ist nur eine seiner vielen Ruhmestaten.«
Sie musste schwer an sich halten, um nicht die Lippen abfällig zu kräuseln. Des Walisers Ruhmestaten, wie ihr Vater sie nannte, waren schon an so vielen Abenden in der großen Halle erklungen, dass Cecily sie nicht mehr hören konnte. Im Gegensatz zu den Rittern, Soldaten und dem Gesinde, die, wie es schien, gar nicht genug davon bekamen. Einer von Penndreics Männern, ein großgewachsener Kerl mit einer Silbersträhne in den dunklen Haaren, hatte sogar Lieder darüber gedichtet, die er auf seiner Harfe vortrug. Pah! Wer auch immer all das glauben mochte, sie tat es nicht. Cecily bezweifelte, dass auch nur die Hälfte davon der Wahrheit entsprach. Wer nahm schon für bare Münze, dass der Hauptmann einen feindlichen Streitkolben abgewehrt hatte, als der habsburgische Kaisersohn Maximilian im Schlachtgetümmel seinen Helm verloren hatte? Dass er im Hennegau inmitten eines Schneesturms einen Überfall auf einen zahlenmäßig weit überlegenen französischen Armeetrupp angeführt hatte? Oder dass er gar eine aufständische Stadt in der Grafschaft Holland eingenommen hatte mithilfe einer List, worin zwei mit Reisigbündeln beladene Schiffe, darunter versteckte Soldaten und unbekümmerte Bürger, vorkamen, die die Schiffe ohne Bedenken in ihren Hafen einfahren ließen? Nein, diese Wagestücke, davon war sie überzeugt, waren nichts als Flunkereien! Und da sich die meisten dieser vorgeblichen Ereignisse außerhalb Englands zugetragen hatten, gab es kaum jemanden hier, der sie bezeugen konnte. Da war es doch ein Leichtes, ein paar Abenteuer zu ersinnen und großzügig auszuschmücken. Treu wie Sir Gawaine, listig wie Odysseus und furchtlos wie der heilige Georg!
»Dennoch«, versuchte Cecily es erneut, »dass du den Waliser gegen einen Edelmann antreten lässt, ist nicht klug.«
Ihr Vater schmunzelte. »Ach, mein Röslein, mach dir nicht so viele Sorgen. FitzWalter hat darum gebeten, ha, das heißt, geradezu angefleht hat er mich, gegen meinen Hauptmann kämpfen zu dürfen.«
Cecilys fein geschwungene Augenbrauen zogen sich düster zusammen. War nun also auch der Herr von Attleborough in den Bann des undurchsichtigen Walisers geraten? Dieser Umstand sprach nicht gerade für einen weitsichtigen Verstand, befand sie, und auch wenn sie den täppischen Bären niemals ernsthaft als Bewerber um ihre Hand in Erwägung gezogen hatte, so hatte er mit dieser Erkenntnis seine Chancen doch zur Gänze vertan.
»Es verhälfe FitzWalter zu großem Ruhm«, klärte ihr Vater sie auf, »wenn er einen Sieg erränge über jenen Mann, der dem künftigen deutschen Kaiser das Leben gerettet hat.« Dann raunte er ihr in verschwörerischem Ton zu: »Aber um dich zu beruhigen, ich habe den Hauptmann einen Eid auf sein Schwert leisten lassen, den Turniertag nicht zu gewinnen. Das ginge dann doch zu weit.«
Es war, als hätte der Waliser die Worte ihres Vaters vernommen und machte sich sogleich daran zu gehorchen. Mit vor Staunen großen Augen verfolgte Cecily – und alle anderen –, wie der heftig schwankende FitzWalter einen Ausfallschritt nach vorne machte und dabei beinahe sein Gleichgewicht verlor. Der Hieb war so schlecht ausgeführt, dass es für den Hauptmann ein Leichtes gewesen wäre auszuweichen. Doch der sprang nicht zur Seite. Im Gegenteil, es hatte den Anschein, als werfe er sich geradezu in den Weg der gegnerischen Waffe. FitzWalters Klinge landete mit der Breitseite laut krachend auf dem Helm des Walisers, der hörbar röchelnd zu Boden ging, wo er rücklings, ausgestreckt in voller Länge, reglos liegen blieb.
Durch die Reihen der Zuschauer ging ein überraschtes Raunen. Sichtlich hatte niemand mit einem solchen Ausgang des Zweikampfs gerechnet, der zugunsten des Hauptmanns so gut wie entschieden schien. Selbst John Radcliffe FitzWalter nicht, der nun das Visier nach oben schob und seinen Gegner verdutzt musterte. Mit misstrauischer Miene rammte er einen Fuß in die gepanzerte Seite des Gestürzten, ehe er – als dieser keinen Mucks von sich gab – die Arme in die Höhe riss und einen gewaltigen Triumphschrei ausstieß: »Huzza! Huzza! Huzza!«
Ob er in seinem Siegestaumel den Chor erschrockener Entsetzensrufe vernahm, sobald der Waliser wie ein nasser Sack zu Boden gegangen war, war nicht auszumachen. Cecily aber knirschte verärgert mit den Zähnen, denn es waren vornehmlich weibliche Kehlen – die ihrer vier Schwestern inbegriffen –, aus denen all die Bekundungen besorgten Mitgefühls erschallten. Bei der heiligen Lucia, wer konnte das verstehen? Aus ihr unerfindlichen Gründen war der Waliser der Schwarm so gut wie aller Frauen der Burg, und wie es ihr manchmal schien, der gesamten Grafschaft. Einerlei, ob Edelfrauen, Mägde oder Bürgerstöchter, alle himmelten sie den Kerl an, als wäre er Prinz Tausendschön.
Dabei war der Mann keineswegs ansehnlich. Er hatte die dunkle Gesichtsfarbe eines Bauern, eine zumindest einmal gebrochene Habichtsnase und stechend grüne Augen, die sie bei den seltenen Gelegenheiten, wo Cecily mit ihm zusammentraf, so durchdringend musterten, als wollte er bis in den tiefsten Winkel ihres Herzens blicken. Die rabenschwarzen Haare trug er kurz geschoren statt in schulterlangen Locken, wie es der gängigen Mode entsprach, und er kleidete sich stets in unauffälligen, schlichten Gewändern. Immerhin war er von geradem Wuchs und – so weit man sehen konnte – ohne Entstellungen. Was ihn all den Frauenzimmern so gefällig machte, mutmaßte Cecily, war wohl sein keckes Mundwerk. Er schäkerte mit einer jeden, scherzte, neckte, flattierte, brachte sie zum Lachen – gleich ob jung oder alt, hässlich oder hübsch. Mehr war, so schien es, nicht nötig, um die Herzen des holden Geschlechts zu gewinnen. Cecily wunderte sich über den Unverstand der Frauen: Man konnte es den Männern schlecht vorwerfen, die Weiber ihrer Unterlegenheit wegen zu belächeln, wenn sich diese wie strohköpfige Gänse benahmen!
***
»Rhys, Rhys! Hat es dich schlimm erwischt?«
Rhys stöhnte laut und versuchte, das Gesicht zu erkennen, das über ihn gebeugt war. Durch den schmalen Schlitz seines Visiers war das kein leichtes Unterfangen, zudem war sein Helm durch FitzWalters Schwerthieb verrutscht.
Er stöhnte neuerlich. In seinem Schädel dröhnte es, als wäre der unter einen Amboss gebettet, auf den ein zentnerschwerer Hammer niedersauste. Vermaledeit, er wünschte, er hätte seinem Dienstherrn nicht sein Wort gegeben, dem fetten Herrn von Attleborough den Sieg zu überlassen.
»Rhys, kannst du dich bewegen? Bist du verwundet? Sag doch etwas, Herrgott!«
Er erkannte nun die Stimme, die wie aus weiter Ferne zu ihm drang, als die seines besten Freundes, Siôn Pilstwn – oder wie dieser sich unter den Engländern nannte, John Puleston. Er und Siôn waren am Hof Sir Rhosier Fychans, einem Halbbruder des früheren Earls von Pembroke, auf Castell Tretŵr, zu Knappen erzogen worden. Als Rhys vor zwölf Jahren zusammen mit elf weiteren Gefährten aus der Heimat aufgebrochen war, hatte Siôn sich ihnen angeschlossen. Sie waren in die Welt hinausgezogen und hatten sich ihren Lebensunterhalt mit ihrem Waffengeschick und ihrem Kampfesmut verdient. Wer immer einen guten Preis zahlte, hatte die dreizehn wackeren Waliser auf seiner Seite.
»Ja«, ächzte Rhys, »ich kann mich bewegen.« Zum Beweis hob er seinen Arm, um das Visier hinaufzuschieben, doch es klemmte und rührte sich keinen Fingerbreit. FitzWalter musste den Helm ja ordentlich demoliert haben.
Und dann war auch Gwilym neben ihm. »Lasst mich sehen«, befahl er in seiner ruhigen Art und löste die Riemen, ehe er den eingeschlagenen Schaller vorsichtig von Rhys' Kopf zog. Der drahtige Gwilym war nicht nur der beste Bogenschütze in ihrem Trupp, sondern auch bei einem Wundarzt in die Lehre gegangen und flickte jeden von ihnen zusammen, wann immer Bedarf war.
Als Rhys endlich von dem engen Helm befreit war, setzte er sich auf und sog die frische Luft tief in die Lungen. O welch Wohltat! »Ich glaube, es sind nur blaue Flecken und ein paar Kratzer«, presste er matt hervor. »Und ein so gewaltiger Brummschädel, als hätte ich eine Woche lang durchgesoffen.«
Gwilym holte einen Schwamm aus seinem Beutel und saugte damit Schweiß und Blut auf, dann tastete er mit geübten Fingern Rhys' Kopf ab. Derweil kamen Gruffudd und Davydd mit einer Tragbahre gelaufen, außerdem Evan Goch, Maredudd und Huw Dinbych, drei weitere ihrer walisischen Waffenbrüder. Sie alle atmeten erleichtert auf, als Gwilym verkündete, dass Rhys nichts Schlimmeres widerfahren war als eine Wunde an der Schläfe und ein dröhnender Schädel. Mit einem ölgetränkten Leinentüchlein, das nach Rosen duftete, betupfte er dann die wunde Stelle und erklärte dabei jeden Handgriff: »Ich verwende Leinöl, es ist von allen Ölen das beste, mit Rosenblüten versetzt.« Anschließend strich er aus einem Tiegel eine rötlich-braune Masse darauf. »Die rote Heilsalbe aus Honigseim, Staubmehl, Butter und Armenischem Ton verhindert Eiter und zieht Eisenteile heraus, sollten noch welche in der Wunde stecken.« Zum Schluss reichte er Rhys ein Fläschchen. »Gebranntes Beinwellwasser hemmt den Blutfluss und beugt Schwären vor.«
Kaum hatte Rhys es leergetrunken, da kündigten Trompetenstöße die Ehrung der Kämpfer an, und Siôn, Gruffudd und Davydd hievten Rhys – die Trage verweigerte er – zu dritt in die Höhe. Sobald er aufrecht stand, wurde ihm schwarz vor den Augen, und er begann zu taumeln, so war er recht froh, dass seine Gefährten ihn in ihre Mitte nahmen, um ihn über die Turnierwiese zu schleppen, hin zur Tribüne, wo der Earl von Arundel mit seiner Familie saß. Als Rhys neben den anderen Recken davor Aufstellung nahm, warf er seinem Dienstherrn einen kurzen Blick zu. Der hob seinen Weinkelch zum Salut, eine stumme Anerkennung von Rhys' Worttreue, ehe er den Herold herbeiwinkte. Derweil – Rhys konnte nicht widerstehen – streiften seine Augen über die Jungfrau, die stolz wie eine Königin zur Linken ihres Vaters thronte, in ein prachtvolles, rosenfarbenes Kleid gehüllt. Er ertappte sich bei dem Gedanken, der Sehnsucht vielmehr, dass sie sich, sobald sie ihn sah, voller Sorge erheben und zu ihm eilen würde. Dass sich ihre Hand sanft an seine Wange legte und ihre blauen Augen, die ihn immer an die walisische See erinnerten, in seinen verloren. Dass sich ihre langen, weichen Locken, Locken, die im Sonnenlicht wie pures Gold glänzten, über seine Brust breiteten. Dass diese rosigen, so herrlich verlockenden Lippen, nach denen er sich verzehrte, seit er ihrer zum ersten Mal ansichtig geworden war, sich auf seinen hungrigen Mund senkten und von ihm kosteten. Zart und süß, und mit dem Versprechen von mehr ...
Als hätte sie seine Träumereien erahnt, kam für einen kurzen Moment ihr Blick auf ihm zu ruhen, und die Verachtung darin war selbst für einen Blinden zu lesen. Kaum merklich verzog er den Mund. Von Anfang an, seit seiner Ankunft auf Dover Castle, war ihm die schöne Grafentochter mit Argwohn und Herablassung begegnet. Er verstand nicht, warum das so war, denn üblicherweise kam er mit dem holden Geschlecht, gleich welchen Standes oder Alters, vortrefflich aus. Er war galant, respektvoll und zuvorkommend, ein – wie Davydd ihn aufzuziehen pflegte – Ritter der schönen Minne. Doch die jüngste Tochter des Earls von Arundel behandelte ihn bestenfalls wie Luft.
Dabei war er, Gott sei seiner Seele gnädig, bereits bei seiner ersten Begegnung mit Lady Cecily Arundel in wilder Liebe zu ihr entbrannt. Er hätte das bis dahin niemals für möglich gehalten: Wie ein mächtiger Blitz war die Liebe in ihn gefahren und hatte sein Herz entzündet. Seither brannte es nur für sie, für sie ganz allein.
Rhys hatte aufgehört zu zählen, wie viele hunderte, tausende Male er versucht hatte, dieses nie gekannte Sehnen niederzuringen. In seinem Herzen war kein Platz für ein Weib, es gehörte ganz allein dem heiligen Gelübde, dem er sein Leben geweiht hatte. Und hätte ihm nicht ebendieses Gelübde befohlen, hier auf Dover Castle auszuharren, hätte er den Earl längst um die Entlassung aus seinen Diensten gebeten. Herrgott, kein anderes Frauenzimmer hatte jemals solch unbändige Leidenschaft in ihm geweckt – und dann ausgerechnet eine adelige Jungfer? Eine hochmütige, schnippische Engländerin? Noch dazu jetzt, wo endlich zur Vollendung zu kommen schien, worauf er, sie alle seit unzähligen Jahren hinarbeiteten?
Doch all sein Hadern und Zürnen hatte nichts geholfen. In mancher Nacht hatte er Dewi Sant, den Schutzheiligen aller Waliser, angefleht, ihn von dieser Pein zu erlösen. Aber das Feuer der Liebe brannte weiter in ihm, lodernd und hell – und unauslöschbar. Sein einziger Trost war die Gewissheit, dass seine Zeit auf Dover Castle – so wie die Dinge sich entwickelten – bald zu einem Ende kam. Der Tag, an dem sich ihr aller Schicksal erfüllte, war nicht mehr fern.
Da erklangen die Trompeten erneut, und laute »Hurra«-Rufe erschollen, als FitzWalter, der Sieger dieses ersten Tages, mit emporgereckten Armen herbeistolzierte. Nun trat der Herold vor, angetan mit einem Tappert, auf dem Arundels Abzeichen, ein silbernes Ross mit Eichenreis, prangte, und verkündete die Heldentaten jedes Ritters, eines nach dem anderen. Rhys biss die Zähne zusammen und pflanzte die Beine weit auseinander, um nicht ins Wanken zu geraten – es schien eine Ewigkeit zu dauern, bis er als Vorletzter an die Reihe kam. Und dann hörte er nur mit halbem Ohr hin, als der Herold die Meriten von Sir Rhys Penndreic, dem edlen Ritter aus dem wilden Wales, pries. Nachdem er mit Rhys' Beteiligung am Kriegszug des Herzogs von Gloucester, des jetzigen Königs, in die schottischen Marken, der Besetzung Edinburghs und der Eroberung Berwicks geschlossen hatte, klopfte der Heroldsstab ein letztes Mal auf den Bretterboden. Es folgte eine Hymne auf den Sieger und des Earls Danksagung, und schließlich band Lady Cecily dem Triumphator – mit einem, wie es Rhys schien, aufgesetzten Lächeln – ein Sträußchen Maiblümlein an dessen Brust.
John Radcliffe FitzWalter schwelgte in den Huldigungen der Zuschauer, er tänzelte vor der Menge auf und ab und warf den Damen Küsse zu. Dazwischen beugte er sich zu Rhys und raunte in dessen Ohr: »Ha, es war leichter als gedacht, den Champion der Burgunder zu bezwingen!«
***
O wie herrlich! Cecily hielt das Gesicht in den Wind, sie schmeckte die salzige Meeresluft, spürte die Strahlen der Frühlingssonne warm auf ihrer Haut. Sie ließ den Blick in die Ferne schweifen, hinaus aufs Meer. An klaren Tagen wie diesen konnte man vom Dover Castle bis hinüber zur Küste Frankreichs sehen. Ihre Augen folgten den Schiffen, die vom Hafen unterhalb der Klippen ausliefen. Selbst hier vom Ausguck des Bergfrieds waren die Rufe der Matrosen zu hören und die Schreie der Möwen, die über den Masten kreisten. Ach, wie sehr wünschte sie, einmal mit ihnen zu segeln, die engen Grenzen ihrer kleinen Welt zu verlassen. Wie sehr wünschte sie, mit eigenen Augen all die wundersamen Orte zu entdecken, von denen sie bisher nur aus Erzählungen ihres Vaters und ihrer Onkel, von Kaufleuten, fahrenden Händlern und Pilgern gehört hatte: von Paris und Rouen, den flandrischen Städten, von Burgund und der heiligen Stadt Rom. Sie selbst hatte diesen südlichen Flecken Englands niemals verlassen, weiter als bis nach London war sie nie gekommen. Ihr Vater erlaubte es nicht.
Seufzend stieß sie sich von der steinernen Brüstung ab. Es wurde Zeit, zu ihren Pflichten zurückzukehren. Sie war nur hier heraufgekommen, um dem Trubel des Turniers für ein Weilchen zu entfliehen – und auch manch lästigem Gast. Gerade wollte sie sich zum Gehen wenden, da drang die Stimme ihrer ältesten Schwester aus dem Inneren des Turms herauf, keuchend und atemlos: »Cecily? Bist du dort oben?«
»Ja, ich bin hier«, rief Cecily, und gleich darauf erschien Margarets hochroter Kopf am Ende der Wendeltreppe. »In deinem Zustand hättest du dir den Aufstieg nicht zumuten sollen«, tadelte Cecily und musterte die Schwester besorgt.
»Ich wollte mich ... bei dir ... bedanken.« Die Worte kamen nur abgehackt aus Margarets Mund, als sie mit einer Hand unter ihrem geschwollenen Bauch zu Cecily watschelte. »Alice hat mir ... vorhin erklärt, dass die ... Turmkammern für meine Familie und mich völlig ... ungeeignet wären, weshalb sie uns überaus gern ... ihr eigenes Gemach überlässt. Aber ich ... habe meine Zweifel, dass dieser Großmut ... ihrem eigenen Herzen entspringt.«
»Du hast doch gewiss nicht zweihundert Stufen erklommen, um mir das zu erzählen«, bemerkte Cecily mit hochgezogenen Brauen.
»Nein«, zwinkerte Margaret, »ich wollte mit dir sprechen. Ungestört.« Allmählich ging ihr Atem wieder ruhiger. »Unten«, dabei beugte sie sich ein Stück über die Brüstung, »findet man kein stilles Plätzchen.« Bei ihren nächsten Worten zogen sich Cecilys Augenbrauen düster zusammen. »Was sagst du zu den Bewerbern in diesem Jahr? Gibt es einen, der dir gefällt?«
Die verhasste Frage hatte sie schon unzählige Male gehört, ihr Vater stellte sie jedes Jahr aufs Neue. Auch heute hatte er sich bereits erkundigt, wie übrigens auch ihr Vetter Thomas, ihr Schwager John und einige andere Verwandte. Hatten sie Margaret nun auf ihre Seite gezogen?
»Nein, es gibt keinen«, schnaubte Cecily verächtlich und beileibe nicht zum ersten Mal. »Ich will nicht heiraten.«
»Aber wovon willst du denn leben, wenn Vater einmal nicht mehr ist?«, wollte die stets praktisch denkende Margaret wissen, und der besorgte Unterton in ihrer Stimme war nicht zu überhören. »Arundel Castle und all seine übrigen Besitzungen werden an unseren Vetter Thomas fallen. Und ich fürchte, eine seiner ersten Taten als neuer Graf wird es sein, dich vor die Tür zu setzen.«
Wenig beeindruckt zuckte Cecily mit den Schultern. Sie teilte Margarets Einschätzung. »Ich werde nach Waeced Castle ziehen«, antwortete Cecily leichthin. Die Pläne für ihre Zukunft hatte sie sich längst zurechtgelegt, auch wenn sie ihre Familie noch nicht eingeweiht hatte. »Das kleine Gut in Somerset hat Großmutter mir vererbt. Da sie Countess von Salisbury aus eigenem Recht war, gehört Waeced rechtmäßig mir, selbst der habgierige Thomas kann es mir nicht entreißen.«
Nun war es an Margaret, abfällig zu schnauben. »Waeced ist eine windumpeitschte Meeresklippe am Rande des Exmoors. Zu Großmutters Lebzeiten wurde das halbe Dorf samt Hafen von einer Sturmflut weggerissen. Das Haus ist verfallen, und die umliegenden Felder wenig ertragreich. Eine einzige Missernte, und du nagst am Hungertuch.«
»Ich werde es herrichten und zu einem rentablen Anwesen machen«, hielt Cecily dagegen, nicht gewillt, sich ihr wohlüberlegtes Vorhaben schlechtreden zu lassen. »Ich werde einen Weg finden.«
Margaret musterte sie eindringlich. »Wäre es nicht einfacher, einen Ehemann zu nehmen? Du hast das große Glück, dass Vater dir die Wahl überlässt. Seine Geduld währt aber nicht ewiglich. Es wird Zeit, dich zu entscheiden, sonst läufst du Gefahr, dass es jemand anderes für dich tut.«
»Hat Vater dich beauftragt, mir das auszurichten?«, wollte Cecily, mit einem Mal beunruhigt, wissen.
»Nein«, schüttelte Margaret den Kopf, und Cecily atmete erleichtert auf. Für einen Augenblick, einen kurzen Moment, hatte sie der bange Gedanke durchzuckt, ihr Vater könnte das Versprechen, das sie ihm an ihrem vierzehnten Geburtstag abgerungen hatte, brechen wollen.
Indes waren von unten vielstimmige Hurra-Rufe zu vernehmen, gefolgt von lautem Beifall. Obwohl die Turnierkämpfe für heute beendet waren, schienen einige Ritter noch nicht genug zu haben. Zwei davon, in voller Rüstung, ritten gerade mit den Lanzen gegeneinander.
»Sieh nur, das ist doch John le Zouche«, deutete Margaret auf einen der beiden. »Stellt sich der Baron beim Tjost nicht ausnehmend geschickt an? Zudem hat er ein hübsches Gesicht.«
Himmelherrgott, warum konnte Margaret das leidige Thema nicht ruhen lassen? Nur mit Mühe unterdrückte Cecily das verärgerte Knurren, das ihr in der Kehle steckte. Den Auserkorenen würdigte sie keines Blickes. »Lord Zouche hat eine Vorliebe für grellfarbene Kleidung«, entgegnete sie schroff, woraufhin Margarets Gesicht ungläubige Fassungslosigkeit widerspiegelte.
»Sein Modegeschmack missfällt dir dermaßen«, fragte sie verblüfft, »dass du ihn nicht als Gatten erwägen magst? Ist das dein Ernst?«
Cecily nickte. »Ja, das ist mein Ernst. Der Baron gewandet sich wie ein bunter Pfau. Ich bin mir sicher, ein solches Gehabe ist der Ausdruck einer eitlen Wesensart. Ein ganz und gar nicht hinnehmbarer Makel, da wirst du mir gewiss zustimmen.«
Für ein paar Momente schwieg Margaret – als hätte es ihr die Rede verschlagen –, doch dann hatte sie einen neuen Kandidaten ausfindig gemacht. »Wie wäre es mit Sir Henry Wentworth?«, schlug sie vor und zeigte auf eine dunkle Gestalt, die etwas abseits am Rande der Turnierwiese stand. »Wentworth ist ein braver, rechtschaffener Mann, dem jede Art von Eitelkeit fremd ist. Er war schon einmal verheiratet, und es heißt, er habe seine Frau gut behandelt.«
»Ja, das heißt es«, stimmte Cecily ihr zu. »Und es heißt auch, er spreche jeden Tag mit ihr und habe dem Gesinde verboten, ihre Sachen wegzuräumen. Und er hat sein Trauergewand nicht abgelegt, obgleich seit dem Tod seiner Frau mehr als drei Jahren vergangen sind. Der Herr sei ihrer Seele gnädig.«
Bei diesen Worten war ein sehnsuchtsvolles Glänzen in Margarets Augen getreten. »Er hat sie eben sehr geliebt«, erwiderte sie sanft. »Das ist doch etwas Wunderbares.«
»Und er wird sie weiter lieben«, verkündete Cecily. »Wenn er eine neue Frau nimmt, dann nur aus dem einen Grund, seinen sechs Kindern eine Mutter zu verschaffen.« Angewidert rümpfte sie die Nase. »Ich will nicht das Bett gleichzeitig mit einem Mann als auch einem Geist teilen. Ich will nicht, dass er ihren Namen stöhnt, wenn er bei mir liegt.«
»Cecily!«, rief Margaret erschrocken. »Eine unbedarfte Jungfrau sollte nicht solche Worte in den Mund nehmen, das weißt du.«
Da schmiegte Cecily sich an ihre Schwester, einen Arm um ihre Schultern gelegt. »Ach, Margaret, sei mir nicht gram, ich meine es doch nicht böse! Alles, was ich mir wünsche, ist, über mein Leben frei zu bestimmen. Ich glaube, ich könnte es nicht ertragen, an jemandes Seite auszuharren, den ich nicht leiden mag.«
Da breitete sich zu Cecilys Erleichterung ein Schmunzeln auf Margarets Gesicht aus. »Oh, mein Herz«, lachte sie schließlich und drückte Cecilys Hand, »wie sehr wünsche ich dir, dass dir das gelingen möge! Ich will heute auch nicht weiter auf dich einreden, aber versprich mir, dass du dieses Turnier dazu nutzen wirst, dich unter all den unverheirateten Mannspersonen umzusehen. Es sind genügend darunter, die auf deine Gunst hoffen.«
Eine Weile zupfte Cecily an den Enden ihres goldfarbenen Gürtels, ehe sie zustimmend nickte. Sie hatte keineswegs vor, einem dieser edlen Herren ihre – wie Margaret es ausdrückte – Gunst zu schenken. Doch weigerte sie sich, würde Margaret ihr die nächsten Tage unablässig in den Ohren liegen. Sie kannte ihre älteste Schwester nur zu gut. Also wollte Cecily lieber gute Miene machen und so tun, als würde sie die anwesenden Recken in Augenschein nehmen. Auch wenn sie nur allzu gut wusste, dass kein einziger unter ihnen war, dem nach mehr verlangte als ihrer üppigen Mitgift und ihrem hübschen Lärvchen. Keiner von ihnen scherte sich einen Deut um ihre Sehnsüchte, ihre Wünsche, ihre Vorlieben. Keiner hatte jemals gefragt, woran sie Freude fand, wovor sie Angst hatte, was ihr Herz jubeln ließ und was es bedrückte. Wenn die edlen Herren ihre begehrlichen Blicke über Cecilys hochgewachsene, schlanke Gestalt streifen ließen, sahen sie in ihr bloß eine prächtige Zierde für ihre häusliche Tafel. Einen schönen Aufputz an ihrer Seite, um den jeder andere Mann sie beneidete. Ein Goldvögelchen, das ihre Geldsorgen milderte und ihr Leben versüßte. Dabei war es ihnen einerlei, was das Vögelchen dachte oder fühlte oder ob es ihm gefiel, von ihnen besessen zu werden.
Manchmal haderte Cecily mit dem Schöpfer, der sie mit solch übermäßiger Fülle an Schönheit ausgestattet hatte. Ihr lag nichts daran, als Rose von Arundel besungen zu werden, wie es einmal ein vorbeiziehender Troubadour getan hatte, der sie mit Simonetta Cattaneo Vespucci verglichen hatte, die als die schönste Frau von Florenz galt. Edelmänner hatten der hübschen Florentinerin, so hieß es, zu Füßen gelegen, Turnierkämpfer Standarten mit ihrem Abbild getragen, und Maler versahen – auch Jahre nach ihrem Tod – Madonnen, Nymphen und Göttinnen mit ihrem Antlitz.
»Ja gut, ich verspreche es«, erwiderte Cecily schließlich, woraufhin Margaret zufrieden lächelte.
***
Später, am Abend jenes Tages, Rhys stand mit Sir Eustace und zwei anderen Rittern des gräflichen Haushalts in der großen Halle beisammen und rekapitulierte die heutigen Turnierkämpfe, winkte sein Dienstherr ihn zu sich. Ohne zu zögern, bahnte Rhys sich einen Weg durch das Gewühl der Gäste und verbeugte sich vor dem Earl, der in ein Gespräch mit seinem Bruder Humphrey, seinem Neffen Maltravers sowie dem Baron Scrope von Bolton, einem langgedienten Heerführer und Gesandten des Hauses York, vertieft war.
»Mein guter Hauptmann«, unterbrach der Earl die Unterredung, »mein Schwiegersohn Lincoln hat heute Nachricht aus London gebracht: Roger Clifford ist zum Tode verurteilt worden, morgen soll ihm am Tower Hill der Kopf abgeschlagen werden. Ein würdiges Ende für diesen schäbigen Verräter, will ich meinen!« Dabei sah er in die Runde der Herren, die ihn umringten, und alle nickten zustimmend. »Ihr werdet Euch freuen zu hören«, fuhr er an Rhys gewandt fort, »dass der König mir seinen besonderen Dank für die Ergreifung des feigen Aufrührers ausgesprochen hat.«
Arundels Erbe schürzte verächtlich den Mund. »So wie viele andere Lancaster-Anhänger hatte Clifford vor, ins Exil nach Frankreich zu flüchten«, klärte er Rhys über etwas auf, das dieser bereits wusste. Sie hatten den Mitstreiter Buckinghams auf der Planke einer Kaufmannskogge mit Kurs auf die Bretagne abgefangen.
»Ein Aufständischer weniger«, resümierte Rhys und setzte ein Lächeln auf, das er nicht empfand. Lancaster hin, York her, im Kampf um den Thron waren bereits viel zu viele Männer gestorben, und jeder weitere war seiner Ansicht nach einer zu viel.
»Ja, ganz recht«, gluckste der Earl und klopfte Rhys auf die Schulter, »ein Rebell weniger, noch dazu einer, dessen Bruder des Königs Vater, den Herzog von York, auf dem Schlachtfeld erschlagen und Richards Bruder Edmund, einen Jüngling von nicht einmal zwanzig Jahren, kaltblütig ermordet hat. Die abgeschlagenen Köpfe hatte John Clifford, dieser Frevler, über dem Stadttor von York auf Pfähle aufspießen lassen. Der Gerechtigkeit wird nun endlich Genüge getan, und Ihr, Sir Rhys, habt Euch dabei rühmlich hervorgetan. Ihr könnt wahrlich stolz auf Euch sein!«
Da gesellte sich Lord Ferrers zu ihnen, ein weiterer Veteran der jahrzehntelangen Schlachten um die Vorherrschaft im Königreich, womit Rhys auch schon wieder entlassen war. Leider. Er hätte dem Gespräch gern weiter beigewohnt, um vielleicht das eine oder andere zu erlauschen.
So begab er sich ans untere Ende der langen Banketttafel, wo einige seiner Männer schmausten und tranken, und setzte sich zu ihnen. Was das Ausrichten des Festmahls anbelangte, ließ der Earl von Arundel sich nicht lumpen. Selbst draußen im Burghof waren Tische aufgestellt worden, für das Gesinde, die Soldaten und die Bewohner der Stadt. Auf den eisernen Spießen über den im Freien errichteten Feuerstellen drehten sich, zum Wohlgefallen des ausgelassen zechenden Volkes, Gänse, Ferkel und sogar drei ganze Ochsen. Bier und Met flossen in Strömen.
Hier in der Halle ging es dagegen vornehmer zu: Auf silbernen Platten türmten sich mit Datteln gestopfte Kapaune, gebratene Schnepfen, alle Arten von Wildbret, geschmorte Hammelkeulen, gesülzte Lampreten, mit Nelken gespickte Ochsenzungen und vieles mehr. Die anspruchsvollen Gaumen wurden mit teuren Gewürzen verwöhnt, mit Safran, Muskat, Zimt, Kümmel und schwarzem Pfeffer, dazu kredenzte der Mundschenk Weine aus dem Burgund und dem Rheinland sowie frisch gebrautes Ale. Als Krönung des Banketts schließlich war vorhin von vier Dienern und angeführt von Maître Antoine, des Grafen Küchenmeister, eine essbare Nachbildung des Dover Castle hereingetragen worden, samt lebensgroßem Pfau, Turnierwiese und Rittern hoch zu Ross.
Für all das war Lady Cecily verantwortlich. Sie führte ihrem verwitweten Vater den Haushalt, wozu auch das Ausrichten von Festen gehörte. Und wenn Rhys sich umsah, dann meisterte die Grafentochter ihre Aufgabe – das musste man ihr neidlos zugestehen – ganz vorzüglich. Die Halle war prächtig herausgeputzt und von teuren Bienenwachskerzen erhellt, der Boden von wohlriechendem Laubwerk bedeckt. Gaukler boten den Gästen allerlei Kunststücke dar, Musikanten spielten fröhliche Weisen, zu denen etliche Pärchen tanzten.
Während Rhys von einem glasierten Honigküchlein biss, wanderte sein Blick zur hohen Tafel hin, dort, wo die Familie des Grafen speiste. Dort, wo Lady Cecily inmitten ihrer Verwandten saß. Sie unterhielt sich mit einer ihrer Schwestern, der Äbtissin mit dem spitzen Kinn, dabei zerlegte sie mit eleganten Bewegungen einen Fasanenflügel und schob winzige Stücke davon zwischen ihre rosenroten Lippen. Rhys hätte sich noch für eine ganze Weile in ihrem Anblick verlieren können, hätte ihn da nicht sein Vetter Evan in die Seite gerempelt.
»Sieh nur, dort«, schmatzte der um etwa zehn Jahre ältere Clanbruder, der wegen seines feuerroten Haarschopfs den walisischen Beinamen Goch trug. »Ein neuer Bewerber. Ich wette zehn Half Groats, er holt sich gleich eine Abfuhr.« Dabei deutete er mit dem Kopf in Richtung eines reich gekleideten Jünglings, der sich dem Tisch der Gastgeber näherte.
»Der schmale Lümmel ist ja kaum dem Knabenalter entwachsen«, schnaubte Rhys abfällig, was seinen Vetter nachdenklich brummen ließ.
»Hm, ja, der einzige Grund, ihn zu erhören, wäre wohl Mitleid. Womit Ihre Ladyschaft wahrlich nicht gesegnet ist.«
»Da tust du ihr unrecht«, eilte Rhys zu ihrer Verteidigung. »Bei jedem Kirchgang teilt sie Almosen aus, sie besucht die Armen und Kranken und lässt alle Reste aus der Burgküche nach St Bartholomew bringen, das Aussätzigenhaus außerhalb der Stadt. Sieben Mal im Jahr richtet sie eine Speisung für die Bedürftigen im Maison Dieu aus, aus ihrer eigenen Börse. Das kann man beileibe nicht von jeder adeligen Dame in England behaupten.«
Augenzwinkernd steckte Evan eine Handvoll kandierte Korinthen in den Mund. »Schon gut, Rhys, ich hab ja eher ihren Umgang mit den Freiern gemeint. Die macht sie liebend gern zur Sau.«
Nun, damit hatte sein Vetter nicht unrecht. Lady Cecily Arundel hatte bereits so viele Verehrer zum Teufel geschickt, dass deren Namen ein ganzes Buch füllen würden. Heute Abend schien die Dame jedoch milde gestimmt, denn sie beantwortete das Begehr des blassen Jünglings, was immer es war, mit nicht mehr als einem ablehnenden Kopfschütteln, woraufhin der Abgewiesene mit hochrotem Kopf von dannen zog.