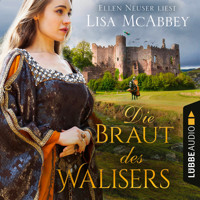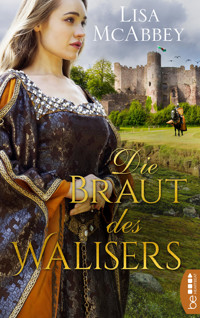4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Furchtlose Frauen und verführerische Rebellen
- Sprache: Deutsch
England 1784: Nach dem unerwarteten Tod ihres Vaters Lord Farlay steht die junge Lysia vor einer großen Herausforderung: Während ihre Schwestern damit beschäftigt sind, geeignete Ehemänner zu finden, muss sie den geheimen Schmugglerring ihres Vaters fortführen, um den Lebensunterhalt ihrer Familie zu sichern
Doch in die Fußstapfen ihres Vaters zu treten, ist gar nicht so einfach. Umso glücklicher ist sie, als sie mit Jack Ryder einen tatkräftigen neuen Schmuggler an ihrer Seite hat. Zudem ist der Neue gutaussehend und charmant und lässt Lysias Herz trotz des Standesunterschieds höher schlagen. Doch als der Earl of Darrington auftaucht, scheint auf einmal alles in Gefahr - der hat nämlich den Auftrag, dem Schmuggel in der Gegend einen Riegel vorzuschieben ...
Nach außen eine Lady, im Herzen eine Schmugglerin: Große Gefühle treffen auf abenteuerliche Schmuggeleien.
Die Historischen Liebesromane von Lisa McAbbey sind in sich abgeschlossen, können unabhängig voneinander gelesen werden und sind in folgender Reihenfolge erschienen:
Die Eroberung des Normannen
Der Spion mit dem Strumpfband
Die Schmugglerlady
Lady ohne Furcht und Tadel
Die englische Lady und der Rebell
Die Braut des Walisers
beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 398
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Yorkshire Dialekt
PROLOG: Goostree's Club, London, März 1784
ERSTES KAPITEL: Hastings, Sussex, an einem Nachmittag Mitte Juni 1784
ZWEITES KAPITEL: Fairlight Hall, Fairlight, Sussex, am folgenden Sonntag
DRITTES KAPITEL: Fairlight Hall, Fairlight, Sussex, am nächsten Tag
VIERTES KAPITEL: High Weald, Kent, am selben Tag
FÜNFTES KAPITEL: In der Nähe von Rye, Sussex, am nächsten Morgen
SECHSTES KAPITEL: Assembly Rooms, Swan Inn, Hastings, Sussex, Samstag 10. Juli 1784
SIEBENTES KAPITEL: Am Strand von Hastings, Sussex, Montag 26. Juli 1784
ACHTES KAPITEL: Fairlight Hall, Fairlight, Sussex, drei Tage später
NEUNTES KAPITEL: Beauport Park, Hollington, Sussex, Donnerstag 5. August 1784
ZEHNTES KAPITEL: Fairlight Hall, Fairlight, Sussex, vier Tage später
NACHWORT
Über dieses Buch
England im Jahr 1784: Während ihre Schwestern alles daransetzen, eine gute Partie zu machen, übernimmt die junge Lysia den Schmugglerring ihres verstorbenen Vaters, um den Lebensunterhalt ihrer Familie zu sichern. Glücklicherweise hat sie mit Jack Ryder einen tatkräftigen neuen Schmuggler an ihrer Seite. Zudem ist der Neue gutaussehend und charmant und lässt Lysias Herz trotz des Standesunterschieds höherschlagen. Doch als der Earl of Darrington auftaucht, scheint auf einmal alles in Gefahr, was sie sich so mühsam erkämpft hat – der Earl hat nämlich den Auftrag, dem Schmuggel in der Gegend einen Riegel vorzuschieben …
Über die Autorin
Lisa McAbbey hat Rechtswissenschaften studiert und interessiert sich als Großbritannien-Fan schon seit vielen Jahren für englische und schottische Geschichte. Sie lebt in Wien und ist für einen internationalen Konzern tätig.
Lisa McAbbey
beHEARTBEAT
Digitale Originalausgabe
»be« – Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Copyright © 2017 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Beke Ritgen
Lektorat/Projektmanagement: Rebecca Schaarschmidt
Covergestaltung: Kirstin Osenau unter Verwendung von Motiven von © Richard Jenkins und © shutterstock: Petrov Stanislav | James Steidl | PhuuchaayHYBRID | Evgeny Karandaev | Nejdet Duzen
eBook-Erstellung: 3w+p GmbH, Ochsenfurt
ISBN 978-3-7325-4281-9
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Yorkshire Dialekt
Aye – ja, immer
Bonny – hübsch, gutaussehend
Lass – Mädchen
Maister – Meister, Boss
Nay – nein
Sithee – Auf Wiedersehen, Adieu
Tyke – Person aus Yorkshire
PROLOG
Goostree's Club, London, März 1784
»Das Übel muss an der Wurzel gepackt werden, Sir, das ist ganz unzweifelhaft. Einem Bauern, der das Unkraut in seinem Acker solcherart bekämpft, dass er die Stängel und Blätter mit einer Sichel – und mag dieses Werkzeug auch noch so scharf sein – abschneidet, wird niemals dauerhafter Erfolg beschieden sein. Nur wenige Wochen später wird das bösartige Kraut aufs Neue austreiben, wuchern und um sich greifen.«
Mr Twining, seines Zeichens Teehändler und Inhaber eines bereits in der dritten Generation geführten Tee- und Kaffeehauses am Londoner The Strand, nippte an seinem Glas und blickte dem ihm gegenübersitzenden Gentleman eindringlich in dessen aufmerksame blaue Augen. Er ließ seinen Worten Zeit, ihre Wirkung zu entfalten, gleich frisch aufgebrühten Teeblättern, ehe er mit gewichtiger Miene fortfuhr:
»Ganz genauso ist es mit dem Schmuggel, Sir. Diese Plage, die in unserem Land schon seit Menschengedenken wütet, hat sich in den letzten Jahren zu einem kaum noch zu bezwingenden Ungeheuer ausgewachsen. Um es zu bekämpfen, haben Ihre Vorgänger hin und wieder bewaffnete Soldaten in die Küstengegenden geschickt und eine Handvoll Patrouillenschiffe in den größeren Häfen stationiert. Doch was hat das bewirkt? So gut wie nichts, sage ich Ihnen!«
Mit einer brüsken Handbewegung suchte er eine lästige Fliege zu verscheuchen – oder auch mögliche Einwände gleich vorab beiseitezuwischen.
»Ja gewiss, hie und da hat man einzelne Halunken auf frischer Tat ertappt, wie zuletzt, Anfang des Jahres, den Schmuggelkutter vor Portsmouth. Dessen Ladung – Tee, Branntwein, Seide und feinste Spitzen – war, so hieß es, mehr als dreißigtausend Pfund wert! Keine Frage, Captain Ellis und seiner Orestes ist da ein wahrhaft kapitaler Fang geglückt, doch erlauben Sie mir festzustellen – und es liegt mir fern, Seiner Majestät Verwaltungsapparat zu kritisieren – von solchen Erfolgen hört man viel zu selten. Das Gros der Schmuggler geht seinen Geschäften ganz ungeniert nach und richtet damit Tag für Tag unermesslichen Schaden an. Wenn nicht bald etwas geschieht, ehrenwerter Herr Kanzler, werden sehr viele redliche Leute in den Ruin getrieben.«
Mr Twining, ein Mann in der Mitte seines vierten Lebensjahrzehnts, mit breiter Stirn, prägnanter Nase und wachen Augen, beugte sich in dem samtbezogenen Lehnsessel weit nach vorn, als wollte er sicherstellen, dass seinem Gegenüber kein Wort über das gedämpfte Stimmengewirr der anderen Gäste hinweg entginge.
»Als Vorsitzender der Londoner Teehändler«, erklärte er, »ist es meine unumgängliche Pflicht, Sie, Sir, auf die prekäre Lage unserer Mitglieder hinzuweisen. Wir sind gezwungen, Tee zu solch exorbitant hohen Preisen zu verkaufen, dass immer weniger Kunden bereit sind, derart viel Geld auszugeben, auch wenn sich der Genuss dieses bekömmlichen Getränks allgemeiner Beliebtheit erfreut. Zu unserem Leidwesen liegen diese horrenden Preise gar nicht in unserem Einflussbereich. Zum einen sind sie den Kosten geschuldet, die uns beim Einkauf der Ware entstehen: Die Ostindien-Kompanie hat ja das exklusive Recht, Tee nach Großbritannien einzuführen. Daher erwerben wir unseren Bedarf, so wie es vorgesehen ist, ausschließlich über die Kompanie – leider zu recht überteuerten Preisen.
Zum anderen, und das ist der weitaus gewichtigere Grund, ist Tee mit einem Satz von sage und schreibe einhundertneunzehn Prozent ad valorem besteuert, einer der höchsten Abgabensätze überhaupt.«
Besorgt zog der Kaufmann die buschigen Augenbrauen zusammen. »In beiden Punkten haben die Schmuggler die Nase vorn: Sie kaufen bei ausländischen Händlern deutlich billiger ein und bringen den Tee dann heimlich und unbemerkt ins Land, ohne einen einzigen Steuerpenny abzuführen. Deshalb können diese Gentlemen, wie sie sich bekanntermaßen gern selbst zu nennen pflegen, Tee um ein Vielfaches günstiger anbieten als wir Teehändler, die wir sorgfältig die Gesetze dieses Landes befolgen.«
Mr Twining zog ein großes Tuch aus der Rocktasche, schnäuzte sich und verstaute es wieder an seinem angestammten Platz, ehe er weiter ausführte: »Um diesem Übel entgegenzuwirken, hat sich unsere Gilde in zahlreichen Zusammenkünften beraten und Maßnahmen überlegt. Doch blieb, zu unser aller Verdruss, bisher jedwede Aktion ohne Erfolg: Haben wir dem Ungeheuer einen Kopf abgetrennt, wuchs alsbald an dessen Stelle ein anderer nach.
Und bedenkt man die menschliche Natur, ist es wohl wenig überraschend, wenn unsere Landsleute bei den Schwarzhändlern so zahlreich Schlange stehen: Niemand will auf den geschätzten Tee verzichten, aber kaum einer will Unsummen dafür ausgeben.«
Mr Twining legte neuerlich eine Pause ein, wohl um dem Kanzler Zeit zu geben, all das Gesagte aufzunehmen und zu verstehen, doch dieser bedeutete ihm mit einem kurzen Nicken fortzufahren, was der Kaufmann sogleich bereitwillig tat.
»Aufgrund dieser widrigen Umstände gerät ein redlicher Teehändler in eine äußerst unangenehme Zwickmühle: Entweder er sieht zähneknirschend zu, wie alles Geschäft an die Schmuggler abwandert, und begnügt sich mit dem Rest, den ihm die sogenannten Gentlemen übrig lassen, oder er opfert seinen Profit und senkt – wider jede kaufmännische Vernunft – die Preise drastisch.
Beide Strategien, das, Sir, können Sie sicherlich nachvollziehen, sind dem finanziellen Überleben der Teehändler wenig zuträglich und es darf wohl nicht verwundern, wenn sich bislang ehrliche Kaufleute ebenfalls dem Schwarzhandel zuwenden, gewisslich widerstrebend, wie ich die Vermutung wagen möchte. Denen, die standhaft bleiben, droht dagegen nichts Geringeres als der Bankrott.«
Mr Twining faltete bedächtig die Hände, bevor er weitersprach: »Sie wissen genauso gut wie ich, Sir, dass im Falle des Konkurses eines Prinzipals nicht nur dessen Angehörige und Dienstpersonal ins Elend gestürzt werden, sondern auch dem Staat selbst höchst unerquickliche Nachteile entstehen: Ein Kaufmann, der im Schuldgefängnis einsitzt, kann keine Steuern zahlen.«
Nach einem prüfenden Blick in das Gesicht seines Gegenübers, welches trotz der langwierigen und sehr detaillierten Darlegungen ungebrochen reges Interesse zeigte, setzte Mr Twining seine Ausführungen fort: »Es liegt mir fern, Ihr Augenmerk, Sir, alleinig auf die Teehändlergilde zu lenken, so sehr mir diese auch, naturgemäß, am Herzen liegen mag. Nein, es gibt noch andere Leidtragende, Institutionen von weitaus größerer Gewichtigkeit und Bedeutung, deren Straucheln das gesamte Königreich zum Wanken bringen könnte.«
Der Ehrenwerte William Pitt, im Dezember letzten Jahres von Seiner Majestät, König George III., zum Premierminister wie auch Schatzkanzler Großbritanniens ernannt, schlug die langen Beine übereinander, die in eleganten, aber keineswegs extravaganten Kniehosen steckten. »Sie sprechen von der Ostindien-Kompanie, Mr Twining?«
Der Kaufmann nickte bestätigend, während er mit der linken Hand recht erfolglos die dicken Tabakwolken zu vertreiben suchte, die bis hinauf zur Decke des dürftig beleuchteten Salons reichten.
»In der Tat, Sir«, antwortete er hüstelnd, »das tue ich. Wir alle wissen, die Kompanie wurde damals bei ihrer Gründung von der ruhmreichen Königin Elizabeth mit weitreichenden Privilegien ausgestattet – unter anderem dem ausschließlichen und alleinigen Recht, in allen Ländern und Häfen östlich des Kaps der Guten Hoffnung und westlich der Magellanstraße Handel zu treiben. Darunter fällt also, ganz unzweideutig und ohne jede Frage, auch der Handel mit dem chinesischen Kaiserreich, von dem die Kompanie all die erlesenen Teesorten bezieht: neben schwarzem Tee wie Bohea, Congou und Souchong auch die grünen Sorten Singlo und Hyson.«
Er nahm einen weiteren Schluck von seinem Glas, ehe er hinzufügte: »Jede Tasse Tee, die in unserem Land getrunken wird, sollte demnach aus einem Kontor der Ostindien-Kompanie stammen. Doch in Wahrheit ist dem nicht so: Die gleichermaßen niederträchtigen wie gesetzwidrigen Entwicklungen der letzten Jahre haben dazu geführt, dass bloß die Hälfte – manche meinen sogar nur ein Drittel – des gesamten in Großbritannien konsumierten Tees über die Kompanie importiert wird. Die andere Hälfte schaffen Schmuggler ins Land.«
Der Premierminister legte erbost die Stirn in Falten.
»Ja, das jüngst einberufene Komitee, das vom Parlament mit der Investigation der durch den Schmuggel verursachten Schädigungen beauftragt ist, hat Erschreckendes zu Tage gefördert. Laut dessen Bericht verkauft die Ostindien-Kompanie jedes Jahr etwa fünf Millionen Pfund Tee, tatsächlich werden aber an die zwölf Millionen Pfund konsumiert. Allein durch den Teeschmuggel entgeht Seiner Majestät dem König also eine enorme Summe an Steuereinnahmen. Da sind all die anderen illegal ins Land gebrachten Waren wie Tabak, Branntwein, Seide und weiß der Himmel noch was, gar nicht mitgerechnet. Ich verrate wohl kein Geheimnis, wenn ich Ihnen sage, dass in den letzten Jahren die Staatsschulden aufgrund der kriegerischen Auseinandersetzungen mit Frankreich, Spanien und den vormals dreizehn nordamerikanischen Kolonien, nun die Vereinigten Staaten von Amerika, in gigantische Höhen geschossen sind. Nach den Friedensschlüssen von Paris und Versailles im vorigen Herbst ist es daher eines der vorrangigen und dringlichen Ziele Seiner Majestät und damit all seiner Minister, ganz besonders aber des Schatzkanzlers, diesen Schuldenberg abzubauen. Jede Steuermünze, die uns entgeht, obstruiert dieses Vorhaben.«
Er legte die Fingerspitzen seiner blassen, schlanken Hände aneinander und fuhr fort: »Um mehr Gelder in die Staatskasse fließen zu lassen, sehe ich drei sich keineswegs ausschließende Möglichkeiten: neue Steuern einführen, geltende Steuersätze anheben und – was den Schmuggel betrifft – Steuerhinterziehungen hintanhalten. Wenn wir nur einen Teil jener Abgaben vereinnahmen könnten, die uns von den Schmugglern vorenthalten werden, wäre es um die Finanzen unseres Landes weitaus besser bestellt. Die Frage ist nur, wie sollen wir das bewerkstelligen?«
»Und hier, Sir«, fiel Mr Twining eifrig ein, »erlaube ich mir, auf das zurückzukommen, was ich vorhin erwähnt habe: Das Übel muss an der Wurzel gepackt werden! Lassen Sie mich den Sinn dieser Worte näher erläutern: Zurzeit wird jedes Pfund Tee, das die Ostindien-Kompanie verkauft, mit Steuern im Wert von einhundertneunzehn Prozent belastet. Die Schmuggler verhökern ihre Ware natürlich, ohne dem König zu geben, was dem König gebührt. Damit ist ein von der Kompanie erstandenes Päckchen Tee mehr als doppelt so teuer wie der Tee der ehrlosen Gentlemen.«
Der Kaufmann blickte dem Kanzler tief in die Augen. »Mein Ratschlag ist es, Sir, und ich darf hier als Vorsitzender der Londoner Teehändler sprechen, die Teesteuer gänzlich abzuschaffen oder zumindest so weit zu senken, dass der gewöhnliche Schmuggler keinen Anreiz mehr hat, diese Genussware illegal einzuführen.
Alles andere hat meiner bescheidenen Meinung nach keine Aussicht auf durchschlagenden Erfolg. Das haben wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten mehr als deutlich gesehen: Die Überwachung der Küsten, die Kontrolle verdächtiger Boote, das Androhen von Strafen, der Einsatz von Soldaten – all diese Maßnahmen mögen gelegentlich dazu beitragen, den einen oder anderen Schmuggler auszuschalten. Doch für eine weitreichende, dauerhafte und lückenlose Behebung des Übels fehlen dem Staat, das sage ich mit Verlaub, derzeit wohl die Mittel. Daher muss dort angesetzt werden, wo das Motiv des Schmugglers begründet ist.«
Mr Pitt strich nachdenklich über das leicht fliehende Kinn.
»Interessant, interessant! Sie bringen etwas zur Sprache, Mr Twining, das mir schon mehrfach durch den Kopf gegangen ist. Der menschliche Charakter, so muss man leider feststellen, ist oftmals vom Drang getrieben, möglichst Vieles auf möglichst einfachem Weg zu erreichen, selbst wenn dieser Weg außerhalb dessen liegt, was wir als recht und billig erachten. Warum sollte ein Bauer mühevoll sein Feld bestellen, warum ein Fischer auf einen glücklichen Fang hoffen, warum ein Fuhrmann den Unbilden des Wetters trotzen, wenn er unter ungleich geringeren Strapazen, obschon unrechtmäßig, ein Vielfaches mehr erwirtschaften kann? Diese Verderbtheit ist allzu weit verbreitet, leider ...« Nach einer kurzen Pause schüttelte er energisch den Kopf. »So verlockend Ihr Vorschlag auch klingen mag, hat er doch einen entscheidenden Haken: Seine Majestät kann es sich schlichtweg nicht leisten, auf die Einnahmen aus der Teesteuer zu verzichten. Wenn wir sie also abschaffen oder zumindest senken wollten, müssten wir Gegenmaßnahmen treffen, die den Ausfall im Säckel des Schatzkanzlers wettmachen. Dazu muss ich, fürchte ich, noch einige Überlegungen anstellen.«
Mr Twinings Miene drückte Zufriedenheit aus. »Sehr wohl, Sir. Wenn ich dabei von Diensten sein kann, stehe ich Ihnen jederzeit mit Freuden zur Verfügung.«
Der Premierminister lächelte verhalten. »Danke, Mr Twining, von diesem Angebot mache ich gern Gebrauch. Ihre Erfahrungen und Einblicke sind äußerst hilfreich. Ich schlage vor, Sie besuchen mich in zwei Wochen wieder hier im Klub. Dann können wir unseren Austausch fortsetzen.«
Der Kaufmann nickte beflissen. »Ihre freundlichen Worte ehren mich in höchstem Maße, Sir. Sie sind der erste Minister, wenn ich das sagen darf, der einen einfachen Teehändler wie mich in dieser Angelegenheit zurate zieht, was nicht nur ich, Sir, sondern die gesamte Kaufmannschaft Ihnen aufs allerhöchste anrechnet.«
Mr Pitt lächelte neuerlich, nun sehr offen. »Ich sehe keinen Grund, mich nicht mit denjenigen zu beraten, die die tiefsten Einblicke und die weitreichendste Expertise auf einem bestimmten Fachgebiet haben, gleichgültig welchem Stand sie angehören. Im Gegenteil, alles andere erachte ich als höchst unvernünftig.«
Bevor sich der Teehändler erhob, zwinkerte er dem Premierminister verschmitzt zu. »Vielleicht haben Sie trotz Ihrer blutjungen Jahre schon von dem altehrwürdigen Sprichwort gehört: Halte Rat vor der Tat.«
Bei diesen Worten versteifte sich der Kanzler plötzlich, seine bislang freundliche Miene verdüsterte sich, und er kniff die Lippen zu einem schmalen Strich zusammen.
Der dritte Herr am Tisch, der die Unterhaltung zwischen dem Kaufmann und dem Premierminister bislang schweigend mitverfolgt hatte, stieß ein kurzes Lachen aus und sagte dann: »Mr Twining, um Himmels willen, nehmen Sie sich in Acht! Was das Alter angeht, sollten Sie mit jeglichen Kommentaren in höchstem Maße vorsichtig sein. Ich fürchte, Sie haben die Achillessehne unseres Kanzlers ausfindig gemacht: Jede noch so unschuldige Anmerkung die herausstechende Jugendlichkeit Mr Pitts betreffend – noch niemals zuvor hat ein jüngerer Mann das Kanzleramt angetreten - löst bei diesem Ablehnung und Unmut aus, ja, sogar Zornesausbrüche.«
Bestürzt starrte der Teehändler in das Gesicht seines bisherigen Gesprächspartners: »Es lag mir fern, Sie zu beleidigen, Sir. Ganz im Gegenteil: Seien Sie versichert, wie sehr all meine Kollegen, wie auch ich selbst, Ihre Person aufrichtigst bewundern. Ich hoffe, wir haben diese Wertschätzung bei Ihrer Ehrung in der Grocers Hall und dem anschließenden gemeinsamen Dinner gebührend zum Ausdruck bringen können. Falls nicht, täte es mir, im Namen der Londoner Kaufmannsgilden, überaus leid ...«
»Schon gut, schon gut, Mr Twining«, unterbrach ihn Mr Pitt, nun tatsächlich leicht schmunzelnd. »Das haben Sie aufs Vortrefflichste getan. Immerhin kommt es nicht alle Tage vor, dass meine Kutsche von Dutzenden Menschen durch die Stadt gezogen wird, nicht wahr?«
Nachdem der Premierminister seine Einladung zu einem neuerlichen Treffen wiederholt und sich für die Mühen des Teehändlers bedankt hatte, verabschiedete sich Letzterer und verließ, geleitet von einem Diener mit Zopfperücke und spitzen Rockschößen, den Salon.
»Du hast dem armen Mann ganz schön zugesetzt, William«, ergriff Jonathan Lacy, der Earl von Darrington, nun lachend das Wort. »Ich befürchtete schon, er würde sich die Zunge abbeißen, nur, um das Gesagte ungeschehen zu machen. Dabei macht Twining ansonsten einen durchaus tadellosen Eindruck. Er weiß, wovon er spricht, und gibt ehrliche Auskunft.«
»Ja«, stimmte der Ehrenwerte William Pitt seinem Freund zu, »deshalb habe ich ihn auch zu mir gebeten. Ich bin überzeugt, die Meinung eines unmittelbar Betroffenen zu hören, ist mehr wert als endlos mit Beamten zu disputieren, die alles nur vom Hörensagen wissen.«
So wie es Mr Twining gerade eben getan hatte, zwinkerte nun Lord Darrington dem Premierminister zu. »Für deine fünfundzwanzig Jahre bist du weise über alle Maßen ...«
Mr Pitt, keineswegs beleidigt, stieß ein gutmütiges Lachen aus.
»Ach, hör schon auf, mich aufzuziehen, Jonathan! In Cambridge hast du das schon ausgiebig genug getan. Du bist gerade einmal ein Jahr älter, also lass doch diese Fopperei. Spielen wir lieber eine Partie Schach. Ich glaube mich zu erinnern, dass du beim letzten Mal kläglich gescheitert bist.«
»Nun gut, mein Freund«, lenkte der Earl ein und winkte einem Bediensteten, der kurz darauf ein Schachbrett samt Figuren sowie eine neue Flasche Portwein brachte.
Nach mehreren raschen Zügen hielt Mr Pitt inne und tippte mit dem Zeigefinger auf seinen Springer, während er sichtlich den nächsten Schritt überlegte.
»Ich benötige deine Hilfe, Jonathan.«
Der Earl sah fragend auf, und Mr Pitt beeilte sich zu erklären: »Ich kann Unredlichkeit nicht ausstehen und werde sie bekämpfen, wo immer ich die Macht dazu habe. Dieser ganze vermaledeite Schmuggel, der unser Land verseucht und brave Menschen in schurkische Kriminelle verwandelt, ist mir ein Gräuel. Ich habe vor, im Unterhaus einen Antrag auf Senkung der Teesteuer einzubringen. Nicht nur Teehändler wie Mr Twining fordern einen solchen Schritt, auch die mächtigen Direktoren der Ostindien-Kompanie liegen mir deshalb in den Ohren, zweifellos aus ihren ganz eigenen Gründen. Ich werde diesen Forderungen nachgeben, um den Schmugglern das Genick zu brechen und den legalen Teehandel anzukurbeln. Und, natürlich, um dringend benötigtes Geld in die Staatskassen zu spülen.«
»Ein guter Plan, Will«, erwiderte Lord Darrington.
»Zu diesem Plan gehört auch«, fuhr der junge Kanzler unbeirrt fort, »die Schmuggler in ihren Nestern aufzuspüren und auszuräuchern. In den südlichen Grafschaften, Kent, Sussex und Hampshire bis hinüber nach Cornwall, ist das Ausmaß ganz besonders schlimm: Dort sollen angeblich ganze Dörfer auf die ein oder andere Weise in den Schwarzhandel verstrickt sein, selbst Bürgermeister und Pastoren.«
»Die Versuchung des schnöden Mammons macht wohl vor keinem Halt«, kommentierte der Earl trocken.
Mr Pitt zog seinen Springer gegen einen von Lord Darringtons Bauern. »Deshalb bedarf es unvoreingenommener, unbestechlicher Personen, die sich von der Lage vor Ort ein Bild machen. Zu deinen Besitzungen gehört doch auch ein größeres Landgut im östlichen Sussex, unweit der Küste.«
»Ja«, nickte der Earl, auf einmal vorsichtig geworden, während er Mr Pitts Manöver aus schmalen Augen verfolgte. »Ashburnham Place kam über meine Mutter in die Familie. Aber wir halten uns dort so gut wie nie auf. Es ist ein recht altes und ungemütliches Haus, und wir leben ja im Norden.«
»Du solltest dort einmal nach dem Rechten sehen, Jonathan«, empfahl Mr Pitt. »Sehr wahrscheinlich treiben sich in der Gegend Schmuggler herum. Dessen solltest du dich vergewissern, und wenn dem so ist, Bericht an mich erstatten.«
Lord Darrington beobachtete mit gerunzelter Stirn, wie – ohne viel Federlesens – ein weiterer seiner Bauern geschlagen wurde.
»Diese Empfehlung«, fuhr der Premierminister mit ruhiger, dennoch bestimmter Stimme fort, »ergeht an alle Grundbesitzer an der südlichen Küste. Ich erwarte, dass sie befolgt wird.«
»Wer immer behauptet hat, dass Großbritannien nun von einem grünen Schuljungen geführt wird, hat sich gründlich getäuscht«, erwiderte der Earl mit anerkennendem Blick.
Mr Pitt lächelte und nahm einen Schluck Portwein. »Bereits mit sieben Jahren wusste ich, dass es mich in die Politik drängt. Mein Vater war Premierminister wie auch mein Onkel mütterlicherseits. Insofern bin ich in diesem Metier wohl eher ein alter Hase ...«
»Oh, sieh an, sieh an! Der Ehrenwerte Kanzler Pitt wie auch Lord Darrington!«, ertönte da eine laute, leicht lallende Stimme und ließ die beiden Herren aufsehen. »Vertieft in geheime Konversationen, von denen der Rest von uns nichts wissen soll?«
»Mitnichten, Fox«, näselte Mr Pitt mit plötzlich unnahbarer, überheblicher Miene, während er den Blick langsam über die korpulente Gestalt seines politischen Erzrivalen wandern ließ. Seit Pitts Ernennung im letzten Dezember hatte dieser nichts unversucht gelassen, den neuen Premierminister schnellstmöglich wieder seines Amtes zu entheben. Des Kanzlers klare blaue Augen waren auf Fox' hervorquellenden Bauch sowie die Brandyflasche in dessen Hand gerichtet, während er spottete: »Mein guter Freund Jonathan und ich vergnügen uns lediglich an einer Runde Schach. Es stünde anderen wohl gut zu Gesicht, vertrieben sie sich mit derart geistvoller Beschäftigung die Zeit.«
Mr Fox schnaubte verächtlich und strich die dunklen, stets zottigen Haarsträhnen aus dem Gesicht, ehe er antwortete: »Es eröffnet sich mir kein Grund, sich an einem Spiel zu probieren, bei dem es keinen Geldeinsatz gibt. Außer womöglich die Unbedarftheit der Spieler, denen aufgrund ihres blassen und kleinlichen Charakters niemals der Sinn nach Abenteuer steht.«
Angesichts dieser beleidigenden Worte sog Lord Darrington scharf die Luft ein, doch Mr Pitt hob als einzige Reaktion auf die Schmähung durch den parlamentarischen Gegner lediglich eine Augenbraue.
»Nicht jedermann«, gab er zurück, »hat den Luxus eines Vaters, der dem Sohn beispringt und dessen Schulden von mehr als hunderttausend Pfund tilgt, nicht wahr?«
Mr Fox öffnete den Mund zu einer weiteren Entgegnung, doch bevor er vielleicht noch ausfallender werden konnte, fiel ihm Lord Darrington unwirsch ins Wort: »Fox, wenn Sie nichts Interessanteres von sich zu geben wissen, dann seien Sie doch so gut und treten ein paar Schritte zur Seite. Ihre breite Gestalt nimmt mir das Licht, sodass ich kaum die Figuren auf dem Brett ausmachen kann. Und es ist mein Zug!«
Der Angesprochene schürzte erbost die Lippen, trollte sich nach einem bösen Blick auf die beiden Herren, die ihn so offensichtlich nicht weiter zu beachten gedachten, aber schließlich von dannen.
»Ein aufgeblasener Gockel ohne Manieren, der sich für den Mittelpunkt der Welt hält«, kommentierte der Earl zornig. »Man muss ihm lassen, im Unterhaus ist er ein brillanter Redner – beinahe so gut wie du, Will -, aber davon abgesehen verstehe ich nicht, warum ihm so viele nachlaufen. Das weibliche Geschlecht eingeschlossen.«
Der Kanzler verzog angewidert die schmalen Lippen.
»Die Herzogin von Devonshire stürmt für ihn sogar in den Wahlkampf. Angeblich verbindet Fox und sie mehr als nur die gemeinsame politische Gesinnung.«
Lord Darrington nahm einen großen Schluck Wein.
»Ja, das habe ich gehört. Bleibt abzuwarten, ob ihm das tatsächlich viele Stimmen einbringt. Ich setze jedenfalls weiterhin auf dich, Will.« Er grinste breit.
»Das will ich doch hoffen, mein Freund«, entgegnete der junge Premierminister augenzwinkernd. »Und übrigens: Schach matt.«
ERSTES KAPITEL
Hastings, Sussex, an einem Nachmittag Mitte Juni 1784
»Oh, sieh doch nur, Eunike! Ist dieser Seidenschal nicht wunderhübsch? Das Himmelblau hat genau denselben Farbton wie mein Mousselinkleid vom letzten Sommer. Du weißt schon, das mit der Lilienbordüre.«
Eunike hörte die Aufforderung ihrer Zwillingsschwester wohl nur mit halbem Ohr, denn sie war über eine große Schachtel gebeugt, die Mr Penfold, der Inhaber des kleinen, aber sehr gut sortierten Ladens für modische Accessoires aller Art vor ihr auf dem Tresen platziert hatte. Darin befanden sich mehrere Dutzend Fächer, und gemeinsam begutachteten sie das Sortiment und inspizierten sorgfältig jedes einzelne kunstvoll gearbeitete Stück: Fächer auf, ein paar Mal fächeln, Fächer zu, und der nächste war zur Hand genommen.
»Ach, Eunike«, rief Amathia, nun bereits ungeduldig, »lass doch diese dummen Fächer und komm hier herüber! Ich kann mich nicht zwischen dem lavendelfarbenen und dem saphirblauen Schaltuch entscheiden. Welches bringt meine Augen besser zur Geltung? So hilf mir doch!«
Nun folgte Eunike doch der Aufforderung ihrer Schwester. Abrupt und ohne eine einzige Silbe der Höflichkeit wandte sie den Fächern wie auch dem ihr einigermaßen verblüfft hinterhersehenden Mr Penfold den Rücken zu und eilte an die Seite ihres Zwillings.
»Ach, junger Mann«, nutzte da Tante Augusta die Gelegenheit, den Ladenbesitzer in Beschlag zu nehmen, »seien Sie doch so gut und holen Sie die weiße Rüschenhaube dort aus der Auslage. Ich möchte das schöne Stück gern anprobieren.«
Dienstbeflissen ließ Mr Penfold sogleich die Schachtel mit den Fächern, die er versucht hatte, wieder in Ordnung zu bringen, stehen und wollte eben zu Tante Augusta eilen, als ihn ein neuerlicher Ausruf Amathias zwang, innezuhalten.
»Mr Penfold, schnell, schnell, wir brauchen Ihre Meinung! Ein Mann hat doch oft den besseren Blick, wenn es darum geht zu beurteilen, was einer Dame am besten zu Gesicht steht!«
Der Ladenbesitzer, ein junger, tüchtiger Mann, der das florierende Geschäft seines Vaters vor knapp zwei Jahren übernommen hatte, war angesichts all dieser Forderungen, die auf ihn einprasselten wie Hagelkörner in einem Sommergewitter, sichtlich überfordert. Sein Blick hetzte zwischen den Zwillingen und Tante Augusta hin und her, unschlüssig, welcher Kundin er zuerst zu Diensten sein sollte. Mit einem Taschentuch wischte er fahrig über die gerötete Stirn, auf der bereits Schweißperlen glänzten.
Ach, der Ärmste! Miss Lysianassa Farley wusste nur zu gut, dass ihre Familie auch den geduldigsten Menschen in den Wahnsinn treiben konnte. Seit mehr als einer Stunde nun beanspruchten die Farley-Damen die Aufmerksamkeit des bewundernswert tapferen Mr Penfold, schickten ihn mit Aufträgen von einem Ende des Ladens zum anderen, löcherten ihn mit Fragen, ließen ihn Schachteln, gefüllt mit allerlei modischen Accessoires, aus den Regalen holen, Schubladen öffnen und wieder schließen. Tatsächlich grenzte es an ein Wunder, dass der junge Mann noch nicht erschöpft zusammengebrochen war oder schreiend die Flucht angetreten hatte.
Als Mr Penfold Lysia nun einen um Gnade heischenden Blick zuwarf – das Farley'sche Stimmengewirr war inzwischen so weit angeschwollen, dass es dem schrillen Gekreische der Fischweiber am Markttag kaum noch nachstand -, erbarmte sie sich seiner. Sie schlug das Londoner Modejournal zu, durch das sie geblättert hatte, und klatschte in die Hände, um die Aufmerksamkeit ihrer Schwestern und der Tante auf sich zu lenken. »Es wird Zeit aufzubrechen. Mama erwartet uns bei Lady Murray, die uns zum Tee eingeladen hat. Kommt, ihr Lieben!«
»Ach, nein!«, rief da Amathia mit schreckgeweiteten Augen entrüstet. »Wir haben doch noch gar nichts eingekauft! Ich brauche dringend ein neues Fichu, außerdem Handschuhe und ... »
»Nicht heute«, unterbrach Lysia sie. »Wir wollen uns nicht verspäten.«
»Och, Lysia«, bestärkte nun Eunike den Wunsch ihrer Schwester, »du weißt genau, dass mein alter Samtbeutel, dieses schäbige Ding, nicht mehr zu verwenden ist. Was soll ich denn beim Picknick der Everfields übernächste Woche tragen, bitte schön?«
Lysianassa schüttelte den Kopf. »Falls der Beutel tatsächlich nicht mehr zu gebrauchen ist, kann Amathia dir einen borgen. Sie besitzt etliche, wie du selbst übrigens auch.«
Doch Eunike erwies sich, wie so oft, als starrköpfig. »Aber keiner von ihnen passt farblich zu dem Kleid, das ich zum Picknick ausführen möchte.«
Lysia ging allmählich die Geduld aus. »Dann suchst du eben ein anderes Kleid aus!«
»Pah!« war alles, was die jüngere Schwester darauf erwiderte. Sie verschränkte die Arme vor der Brust und zog einen Schmollmund.
Lysia schüttelte neuerlich den Kopf. Man könnte meinen, man hätte ein trotzköpfiges Kind vor sich stehen, nicht eine junge Frau, die vor wenigen Wochen ihren siebzehnten Geburtstag gefeiert hatte.
»Wie kannst du nur so hartherzig sein!«, ergriff da Amathia erbost Partei für ihre Schwester. »Jetzt, wo wir endlich, nach neun langen Monaten, statt der düsteren schwarzen Gewänder wieder Farben tragen dürfen, wenn auch nur gedeckte, benötigen wir auch passende Accessoires. Das sollte doch einleuchtend sein!«
Anscheinend war dies einer der wenigen Momente, wo sie mit der gerade einmal um zwei Stunden älteren Zwillingsschwester einer Meinung war.
Lysia warf den beiden Mädchen einen verärgerten Blick zu. Wie konnten sie sich in Gegenwart anderer Leute, an einem öffentlichen Ort, vor Mr Penfold und dessen Kundinnen, derart ungeniert benehmen? Und wie konnten sie nur so gedankenlos sein? Sie wussten genauso gut wie Lysia, dass die Familie seit dem unerwarteten Tod des Vaters im letzten Herbst den Gürtel enger schnallen musste. Für unnötigen Tand war kein Geld vorhanden, sie mussten sich auf die allernotwendigsten Ausgaben beschränken. Aber oft genug hatte Lysia das Gefühl, sie wäre das einzige Mitglied der Familie, das sich um deren Auskommen Sorgen machte. Alle anderen, ihre Mutter, Eunike, Amathia wie auch Tante Augusta, lebten geradezu unbekümmert in den Tag hinein. Es schien ihnen gar nicht in den Sinn zu kommen, dass sie sich den früheren gewohnten Lebensstil nun nicht mehr leisten könnten. An jenem sturmumtosten Tag im letzten September war ihnen nicht nur ein innig geliebter Mensch genommen worden, der Vater, Ehemann und Bruder, nein, sie hatten auch die Grundlage ihrer aller Unterhalt verloren, endgültig und unwiederbringlich.
Lysias Blick wanderte über die hübschen Gesichter der beiden Schwestern, die entrüstet aufblitzenden blauen Augen, die wütend zusammengezogenen goldblonden Brauen. Es war mehr als deutlich, dass sie Lysia als Spaßverderberin und Sauertopf betrachteten. In Momenten wie diesen fühlte sich Lysia mit ihren neunzehn Jahren steinalt.
»Dann lass uns wenigstens ein paar Taftbänder kaufen, damit wir unsere Kleider und Frisuren aufputzen können«, quengelte Amathia, während Eunike beleidigt schmollte.
»Nun gut«, lenkte Lysia seufzend ein. »Sucht euch jede zwei Bänder aus, und dann lasst uns endlich zu Lady Murray fahren.«
»Du bist die Beste!«, riefen da die Zwillinge wie aus einem Munde und liefen mit nun strahlenden Gesichtern in jene Ecke des Ladens, wo Mr Penfold die Bandwaren auszustellen pflegte.
»Dann werde ich es den beiden doch gleichtun!« Mit diesen Worten eilte Tante Augusta den Mädchen rasch hinterher.
Es dauerte schließlich beinahe eine weitere Stunde, bis Eunike, Amathia und die Tante ihre jeweilige Wahl getroffen hatten – Farbe, Muster, Einsatzmöglichkeiten, all das musste ausgiebigst abgewogen und bedacht werden. Danach konnten sie, angeführt von Lysia, Mr Penfolds Geschäft endlich verlassen. Der junge Ladeninhaber verabschiedete seine Kundinnen mit mehreren Bücklingen und geleitete sie zur Türe hinaus. Dabei tupfte er sich – die Erleichterung war ihm deutlich ins Gesicht geschrieben – mit dem Taschentuch über Stirn und Wangen. »Einen schönen Tag, die werten Damen! Beehren Sie mich bald wieder, gnädigste Herrschaften!«
Ob er Letzteres tatsächlich ehrlich meinte, bezweifelte Lysia allerdings.
»Habt ihr denn schon das Neueste gehört, meine Lieben?«
Lady Murray, verwitwete Schwägerin des berühmten Generals James Murray, hielt im Ausschenken des Tees inne und blickte – wohl um sich deren ungeteilter Aufmerksamkeit zu versichern – in die Runde der drei Damen, die zusammen mit ihr um den kleinen Tisch im chinesischen Salon ihres Hauses in der Croft Road saßen.
Lysia nahm einen Bissen von dem pikanten Schinkenbrötchen und legte es dann folgsam auf ihren Teller zurück, um Lady Murrays Ausführungen zu lauschen. Sie beobachtete, wie ihre Mutter und Tante Augusta – die beiden anderen Damen am Teetisch – es ihr gleichtaten und unterdrückte ein Lächeln. Wenn Lady Murray Neuigkeiten mitzuteilen gedachte, dann gab man besser Acht: Die Matrone gehörte zu den tonangebenden Mitgliedern der feinen Gesellschaft von Hastings und sonnte sich gern in Ansehen und Ruhm, die ihrem hochdekorierten Schwager allseits zuteilwurden. Nicht nur war der inzwischen pensionierte Offizier der jüngere Sohn eines schottischen Lords, er hatte auch unter dem Befehl des bis heute unvergessenen Kriegshelden General James Wolfe in Neufrankreich gekämpft und 1759, in jenem Jahr, das seither als Annus Mirabilis bekannt war, an der Schlacht von Québec teilgenommen, in der die Franzosen vernichtend geschlagen worden waren. Deren Niederlage war der Anfang vom Ende der französischen Herrschaft in Nordamerika gewesen.
Diese mehr als zwanzig Jahre zurückliegenden militärischen Auseinandersetzungen waren es auch, die die Familien Murray und Farley verbanden und weshalb Lady Murray – sie war zudem auch Lysias, Eunikes und Amathias Taufpatin – die Farleys gern unter ihre gesellschaftlichen Fittiche nahm: Lysias Vater, Colonel Charles Farley, hatte in Neufrankreich eines jener Regimenter befehligt, die dem damaligen Brigadier Murray unterstanden hatten. Einer gern zum Besten gegebenen Anekdote zufolge hatte ihr Vater seinem Vorgesetzten auf einer Militärexpedition in den Wäldern rund um den Sankt-Lorenz-Strom das Leben gerettet, als dieser von einem riesigen Braunbären angegriffen und beinahe getötet worden wäre. Bei seiner Rückkehr in die Heimat hatte der Colonel die rechte Pranke des Bären als Trophäe mit nach Hause gebracht, wo sie seither, zur Erinnerung an dieses denkwürdige Ereignis, den Schreibtisch im Studierzimmer zierte. Das linke Pendant hing an der Wand von General Murrays Bibliothek in Beauport Park, jenem Anwesen nördlich von Hastings, wo sich der General vor etwa zwei Jahren zusammen mit seiner Familie zur Ruhe gesetzt hatte.
»Milly, meine Zofe, hat es mir gestern berichtet«, eröffnete Lady Murray mit gewichtiger Miene. »Ich litt schon den ganzen Tag über unter einer diffusen Unpässlichkeit, wahrscheinlich des Mondes wegen, und hatte sie daher hinüber zum Apotheker geschickt, um mir ein Fläschchen von Dr. Radcliffes Stärkendem Elixier zu holen. Auf dem Weg dorthin kam sie am Swan Inn vorbei, wo gerade die Postkutsche aus London eintraf. Und der entstieg ...«, sie machte eine effektvolle Pause, »... Sarah Siddons!«
»Oooh«, entschlüpfte Lysia ein freudiger Ausruf, »wie wunderbar! Dann werden wir vielleicht in den Genuss einer Kostprobe ihrer Lady Macbeth kommen. Sie soll die Schlafwandlerszene ja derart eindringlich spielen, dass viele Zuschauer, so habe ich gehört, angesichts der unsäglichen Qualen der armen Seele tief bewegt in Tränen ausbrechen.«
Jedermann in Hastings, so auch Lysia, begrüßte jede Art von Abwechslung in dem kleinen Städtchen, welches trotz seiner zahlreichen Vorzüge, der gesunden Luft, der Lage am Meer, der idyllischen Umgebung, leider das kulturelle Angebot größerer Orte vermissen ließ. Da war der Besuch einer allseits umjubelten Schauspielerin mehr als willkommen. Mrs Siddons beehrte die Gegend zudem nicht zum ersten Mal. Der aufsteigende Stern des Londoner Drury-Lane-Theaters hatte bereits im Vorjahr auf Einladung von Sir Godfrey Webster, dem Vater von Lysias bester Freundin Anne, aus Shakespeares Othello und Wie es Euch gefällt rezitiert.
»Aber das ist bei Weitem noch nicht alles!«, fuhr Lady Murray mit nun dramatisch bebender Stimme fort. »Milly wollte gerade weiterlaufen – ich hatte ihr aufgetragen, sich zu sputen -, als plötzlich eine sehr vornehme Kutsche direkt auf sie zuraste. Im sprichwörtlich letzten Moment sprang sie auf den Gehsteig zurück, um nicht überrollt zu werden, und dabei erhaschte sie einen Blick ins Innere der Karosse. Stellt Euch nur vor, darin saß die Herzogin von Devonshire, Georgiana Cavendish!«
Kaum war der Name ausgesprochen, erfüllten Entzückensschreie, laut und schrill, die Luft, weswegen Lysia nahe daran war, sich die Ohren zuzuhalten. Eunike und Amathia, die sich bisher in einer Ecke des Salons mit Helen, Lady Murrays jüngster und einzig noch unverheirateten Tochter, unterhalten hatten, waren aufgesprungen und taten ihre Begeisterung kreischend kund: eine leidige Angewohnheit der beiden, sobald irgendwo der Name der jungen Herzogin fiel. Ihre Durchlaucht war eine allseits bewunderte Schönheit, die mit ihren extravaganten Frisuren und Kleidern die Hauptstadt modisch in Atem hielt, und – das konnte man wohl unumwunden sagen – das vergötterte Vorbild der Zwillinge. Jeden noch so kleinen Bericht in den Zeitungen verschlangen die beiden wie die griechische Skylla arglose Seeleute. Jede Schilderung der herzoglichen Ballroben wurde akribisch studiert, jede Unternehmung ausführlichst kommentiert. Es war beider erklärtes Ziel, genauso schön und berühmt zu werden wie Georgiana – oder Lady G, wie sie die Herzogin, der sie tatsächlich noch nie begegnet waren, in selbst ernannter Vertrautheit gerne bezeichneten. Den Umstand, dass Lady Gs Ehemann ihr bekanntermaßen untreu war und ihr Leben offensichtlich nicht nur reines Glück verhieß, übersahen sie geflissentlich.
»Oooh, wie himmlisch!«, rief Amathia und hopste aufgeregt umher. »Lady Murray, denken Sie, Georgiana wird in Hastings verweilen? Oh, vielleicht treffen wir sie dann in den Assembly Rooms, wäre das nicht herrlich? Oder meinen Sie, sie ist wegen des Wassers hier? Hatte sie ihr kleines Töchterlein dabei?«
Eunike griff nach den Armen der Schwester, um sie festzuhalten, was ihr aber trotz verzweifelter Anstrengungen nicht gelang. Amathia zappelte wie ein frisch gefangener Fisch, den man so gut wie nicht bändigen konnte.
»So sei doch still!«, rief Eunike da ungehalten. »Das können wir alles später noch ausführlich genug besprechen. Was jetzt viel wichtiger ist: Wie hat sie ausgesehen? Von welcher Farbe war ihr Kleid? Von welchem Schnitt? Wie war ihr Hut? Ach, ich muss es wissen!«
Hätte der Teetisch nicht im Weg gestanden, wären die beiden Mädchen wohl über Lady Murray hergefallen, um die Antworten aus ihr herauszuschütteln. Die arme Dame – sie war zwar von den Farleys einiges gewöhnt – verfolgte mit offenem Mund den Temperamentsausbruch der Zwillinge, dem weder Mutter noch Tante Einhalt geboten. Im Gegenteil, die beiden älteren Damen fixierten Lady Murray mit bohrenden Blicken, offensichtlich um nichts weniger gespannt als die Mädchen. Der Butterkeks, nach dem Tante Augusta zuvor gegriffen hatte und den sie sich eben in den Mund schieben wollte, entglitt ihr und wurde gleich darauf von Amathias Schuhabsatz zerbröselt. Am liebsten hätte Lysia verzweifelt aufgestöhnt.
»Amathia, Eunike, so beruhigt euch doch und nehmt Platz!«, ermahnte sie schließlich mit strenger Stimme die jüngeren Schwestern, da es sonst niemand tat. »Wie soll Lady Murray euch Antworten geben, wenn ihr vor ihr auf und ab hüpft wie zappelnde Hampelmänner. Mir ist noch nicht zu Ohren gekommen, dass die Herzogin von Devonshire sich jemals solcherart närrisch aufgeführt hätte. Zumindest nicht, seit sie der Kinderstube entwachsen ist. Also zeigt euch ihrer würdig und benehmt euch, wie es jungen Damen eures Standes gebührt!«
Der Hinweis auf die tadellosen Umgangsformen des vergötterten Vorbilds trug zum Glück Früchte, denn die Zwillinge gaben das unziemliche Gehopse auf und setzten sich auf zwei hastig herbeigeschobene Stühle, die Blicke erwartungsvoll auf Lady Murray gerichtet.
Diese hatte ihren Schrecken wohl inzwischen überwunden, denn sie schloss den Mund und erklärte – nach einem kräftigenden Schluck schwarzen Tees – im Brustton der Überzeugung:
»Oh, ich halte es für ganz und gar nicht ausgeschlossen, dass die Herzogin einige Zeit hier in Hastings verbringt. Das milde Klima wie auch das belebende Meerwasser werden von vielen Ärzten empfohlen. Und die praktischen Badekarren sind bereits bis nach London hin bekannt. Ich selbst bin ja auch der Gesundheit wegen vor beinahe zwanzig Jahren hierher nach Hastings gekommen, als mein Bruder und seine erste Frau selig drüben bei Hollington ihren Landsitz Beauport Park einrichteten.«
»Das ist so aufregend!«, rief Eunike. »Lady Murray, Sie müssen uns der Herzogin vorstellen, Sie müssen ...«
Lysia warf der Schwester einen ermahnenden Blick zu und schüttelte leicht den Kopf. Da verbesserte sich Eunike, was wohl nur daran lag, dass es um nichts weniger als ihren Herzenswunsch ging: »Ich meine, ich möchte Sie höflichst ersuchen, falls sich die Gelegenheit ergibt, uns mit der Herzogin von Devonshire bekannt zu machen. Wir wären Ihnen ewig dankbar, seien Sie sich dessen gewiss, liebste Patentante!«
Amathia bestätigte diese Bitte der Schwester mit heftigem Kopfnicken und ähnlich süßer Rede.
Die so stürmisch Bedrängte schmunzelte und versprach, sich für die Farley-Zwillinge einzusetzen, die daraufhin vor überschwänglicher Dankbarkeit beinahe zerflossen. Sie wären der Dame wohl, wahrscheinlich auch noch gleichzeitig, um den Hals gefallen, hätte nicht Helen Murray in diesem Moment die Aufmerksamkeit der beiden Mädchen auf ein neues Thema gelenkt, was Lysia ihr überaus hoch anrechnete.
»Eunike, Amathia, kommt doch mit«, schlug sie vor, »ich muss euch unbedingt mein neues Ballkleid zeigen. Ihr werdet staunen – es ist nach einer Vorlage geschneidert, die ich in einem Geschäft in der Londoner Bond Street entdeckt habe!«
Begeistert quiekend sprangen die Zwillinge von ihren Stühlen auf, die sie dabei beinahe umstießen, und folgten der Aufforderung mit dem üblichen ohrenbetäubenden Geschnatter. Kaum dass sich die Tür des Salons geschlossen hatte, war es dort wieder angenehm still.
»Hach, sie sind nun einmal so lebhaft, die beiden!«, erklärte Lysias Mutter, halb entschuldigend, halb stolz. »Seit dem Tod des Colonels scheint diese Neigung noch ausgeprägter zu sein. Er war der Einzige, der ihnen Einhalt gebieten konnte. Weder Augusta noch ich haben das jemals zustande gebracht.«
»Ja, gewiss«, nickte Lady Murray mitfühlend, »die Erziehung unserer Kinder ist keine leichte Aufgabe, weiß Gott. Zum Glück ist meine Helen in dieser Hinsicht ein wahres Goldstück. Sie bedarf kaum eines mahnenden Wortes, geschweige denn einer Schelte.«
»Nun ja«, warf Tante Augusta ein, während sie weitere Kekse auf ihre Untertasse türmte, »Ihre Jüngste, meine Liebe, scheint ja ein ganz besonders ruhiges und ernstes Ding zu sein. In solchen Fällen besteht immer die Gefahr, dass die Ärmste von den heiratswilligen Männern übersehen wird und als Mauerblümchen endet. Wie alt ist sie denn jetzt? Zwanzig? Etwas mehr Lebhaftigkeit würde ihre Chancen sicherlich erhöhen ...«
»Oh, Lady Murray«, unterbrach Lysia hastig die unangebrachte Rede der Tante, die selbst niemals verheiratet gewesen war, »da fällt mir ein, ich habe Ihnen noch gar nicht erzählt: Wir haben letzte Woche zwei Fohlen bekommen. Ganz entzückend, versichere ich Ihnen. Es würde uns sehr freuen, wenn Sie und Helen uns bald in Fairlight besuchen, um die beiden in Augenschein zu nehmen.«
Lady Murray, die Tante Augustas Ratschlägen mit zunehmend pikierter Miene gelauscht hatte, antwortete nun, sichtlich erleichtert ob des Themenwechsels, lächelnd: »Ja, das machen wir sehr gern, meine liebe Lysia. Seit dem Begräbnis des armen Colonels waren wir nicht mehr in Fairlight. Es wird tatsächlich höchste Zeit. Und es ist ja ein solch herrlicher Flecken Erde, dass ihr Euch alle fürwahr glücklich schätzen könnt!«
Bei diesen Worten holte Lysias Mutter schniefend Luft, zog ein Taschentuch aus dem Dekolleté und tupfte ihre Augenwinkel ab.
»Hach, wer weiß, wie lange es uns noch vergönnt ist, dort zu wohnen. Zu unser aller größtem Kummer ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir in ein neues Heim umziehen müssen.«
»Haben Sie denn schon etwas Passendes gefunden?«, wandte Lady Murray sich an Lysias Mutter, woraufhin diese betrübt abwinkte.
»Ach«, klagte sie, »diese ganze Haussuche ist eine fürchterlich anstrengende und umständliche Angelegenheit. Etwas, das den Männern vorbehalten sein sollte! Aber dem Colonel und mir waren keine Söhne beschieden, welch fürchterliche Misere, so müssen wir Weibsvolk das nun besorgen. Zum Glück hat sich Lysia dessen angenommen. Ihr Vater hat ja viel Zeit mit ihr verbracht, wohl um sie in die Verwaltung eines Landguts einzuweisen. Was der Sinn dessen sein soll, habe ich nie begriffen, aber zumindest kann Lysia sich nun um all die Dinge kümmern, die bisher Colonel Farley zugefallen sind. Sie hat ja auch kaum weibliche Interessen.«
Bei dieser letzten, leicht dahingesagten Feststellung hob Lady Murray verwundert die Augenbrauen, und Lysia lief schamrot an. Himmel, Mutter stellte sie ja gar als einen rechten Klotz dar!
Die Gastgeberin bemerkte wohl ihr Ungemach, denn sie beugte sich zu Lysia hinüber und tätschelte deren Hand. »Ach, Mädchen, keine Bange! Es ist mir selten eine junge Dame untergekommen, die so tugendsam, warmherzig und liebenswürdig ist wie du.«
Die Röte in Lysias Gesicht wollte nicht verschwinden, denn dieses Lob war – Lysias Meinung nach – völlig unverdient und zielte an der Wahrheit so weit vorbei, wie der Ärmelkanal breit war. Sie war, das wusste sie nur allzu genau, keinesfalls ein Ausbund an Tugendhaftigkeit, auch wenn sie nach außen hin, der feinen Gesellschaft gegenüber, so erscheinen mochte. Die Umstände hatten sie zu dem gemacht, was sie war, und sie konnte nur inständig beten, dass weder Mutter noch Tante oder Schwestern (oder sonst irgendjemand) davon erführe. Schnell griff sie nach ihrer Tasse, trank von dem mit frischer Sahne versetzten Tee und hoffte auf einen möglichst raschen Wechsel des Gesprächsstoffes. Ihre Mutter kam dem insgeheim gehegten Wunsch nach und lenkte die Unterhaltung ohne viel Umschweife auf ihr Lieblingsthema: das schwere, bittere Los der vom Schicksal hart geprüften Farleys.
»Wie bedauernswert wir doch sind!«, jammerte sie und zerknüllte dabei ein elegantes Spitzentaschentuch. »Der Colonel ist viel zu früh von uns gegangen. Ach, hätte er doch nur besonnener gehandelt! Wie oft habe ich ihn ermahnt, nicht bei Dunkelheit auszureiten. Gewiss hunderte Male! Nicht wahr, Augusta?«
Tante Augusta – sie war die ältere Schwester des Colonels – nickte mit bebenden Lippen. »Ja, das hast du, Schwägerin. Aber mein Bruder hatte schon immer seinen eigenen Kopf. Wir Frauenzimmer konnten da trotz aller Bemühungen nichts ausrichten.«
»Bei jedem Wetter war er unterwegs, gleichgültig, ob Regen, Sturm oder Schnee. Warum konnte er nicht bei uns zu Hause bleiben und am warmen Feuer sitzen, wie andere Familienväter auch?«, fragte Lady Farley in die Runde, und ein herzzerreißendes Schluchzen entrang sich ihrer Kehle.
»Er war eben Soldat, meine Liebe«, versuchte Tante Augusta eine Erklärung. »Ich habe schon des Öfteren gehört, dass Männer des Militärs ihre eingeübten Angewohnheiten schwer ablegen können.« Sie blickte eindringlich zu Lady Murray.
Diese sprang wie auf ein Stichwort hin ein. »Ja, gewiss! Mein eigener Bruder, der General, steht jeden Morgen pünktlich um fünf Uhr auf. Keine Minute früher oder später! Gleichgültig welcher Tag. Seine erste Frau, Gott hab sie selig, die selbst gern den ganzen Vormittag im Bett verbrachte, hat ihn deswegen oftmals gescholten, aber er antwortete immer, er könne nicht anders. Der jahrelang eingeübte Drill sitzt tief in seinen Knochen, obwohl er sich doch schon vor mehreren Jahren zur Ruhe gesetzt hat.«
Lysias Mutter, die einige Momente lang abgelenkt schien, verfiel nun wieder in ihr mit Vorliebe zelebriertes Gejammer.
»Aber ist es nicht fürchterlich ungerecht, dass uns das Schicksal so grausam bestraft, frage ich Sie? Wir sind doch auf den Colonel angewiesen – wie kann er uns da einfach im Stich lassen? Das, liebe Freundin, genau das trage ich ihm nach! Er hätte mehr Vorsicht walten lassen und an seine Familie denken müssen. Wir sind doch nur hilfloses Weibsvolk, das nun völlig auf sich allein gestellt ist. Weder die Mädchen noch ich – das sage ich Ihnen im Vertrauen – haben einen einzigen Penny des Farley-Vermögens geerbt. Das schöne Haus, der Park, die Kutschen, einfach alles, alles fällt diesem, diesem ...«, mit gerümpfter Nase wandte sie sich hilfesuchend an Lysia, »ach, wie war doch gleich sein Name?«
»Mr Ambrose Peregrine Ottershaw, Mutter«, half Lysia aus.
«... ja, richtig, Mr Ottershaw zu. Dieser Cousin des Colonels, den keiner von uns jemals zu Gesicht bekommen hat, angeblich ein Beamter der Ostindien-Kompanie, der seit unzähligen Jahren in einer Faktorei in ... in ...«
»In Masulipatam«, half Lysia neuerlich aus.
«... in Masulipatam lebt – weiß Gott, wo das wohl ist! -, hat als nächster männlicher Verwandter des Colonels all das geerbt, was doch uns, seiner geliebten Familie, zustehen sollte! Unser gesamtes Leben haben wir in Fairlight verbracht, und nun werden wir verjagt wie ... wie lästige Hausierer.«
Sie brach ab, als ein neuerlicher Schluchzer ihre zerbrechlich wirkende Gestalt schüttelte, und Lady Murray reichte ihr ein frisches Taschentuch.
»Ach, meine Lieben, wie leid mir das alles tut!«, sagte sie mitfühlend. »Familientestamente können so fürchterlich herzlos sein. Der althergebrachte Zweck, das Vermögen ungeschmälert über viele Generationen hinweg in der Hand jeweils eines einzigen Erben zu belassen und an den nächsten weiterzugeben, ohne es zu teilen, zu zersplittern und damit aufzulösen, mag ja gut gemeint sein, aber dabei wird weder das Auskommen der jüngeren Söhne noch der Töchter und Ehefrauen bedacht.«
»Ja, das sage ich ja die ganze Zeit«, schniefte Lady Farley verdrießlich. »Sie alle müssen sehen, wo sie bleiben. Wer hat sich nur solch stumpfsinnigen Unsinn ausgedacht?« Lautstark schnäuzte sie sich in das Taschentuch, und Lysia nutzte die Pause, um einzuspringen.
Weitaus unbekümmerter als ihr tatsächlich zumute war, berichtete sie: »Mithilfe der Nachlassverwalter, die uns dabei dankenswerterweise zur Hand gehen, suchen wir gerade ein Haus in London, wahrscheinlich in Bloomsbury. Das ist eine sehr respektable Gegend mit etlichen öffentlichen Gärten und sonstigen Annehmlichkeiten, natürlich nicht so mondän wie Mayfair und St. James's, aber für unsere Bedürfnisse durchaus angemessen.« Was sie nicht erwähnte, war die Tatsache, dass sie sich mit den mageren Mitteln, die ihnen zur Verfügung standen, ein Haus am Grosvenor Square oder in der Bond Streetgar nicht leisten könnten und ihre Suche daher auf jene Stadtviertel beschränken mussten, in denen Häuser zu erschwinglichen Preisen angeboten wurden. Aus seinem Privatvermögen hatte ihr Vater jeder seiner Töchter einhundert Pfund vererbt und seinem Weib, wie auch seiner Schwester, jeweils zweihundert. Nichts, womit man ein standesgemäßes Haus kaufen könnte – selbst, wenn sie alles zusammenlegten.
»Ich bin mir sicher«, erklärte Lady Murray, »dass ihr ein hübsches Haus finden werdet, meine Lieben. Und in London zu leben, wird euch gefallen, dessen bin ich mir sicher. Ihr werdet schon sehen!«