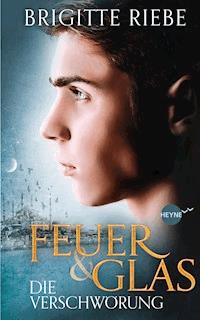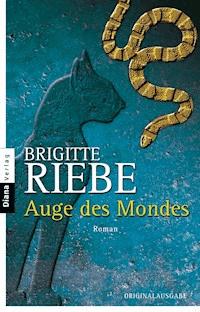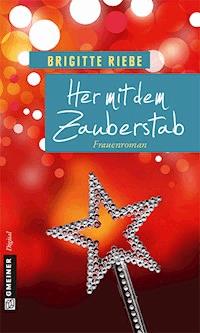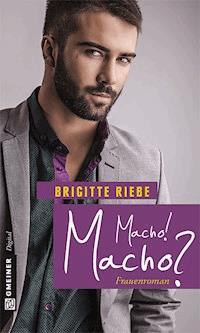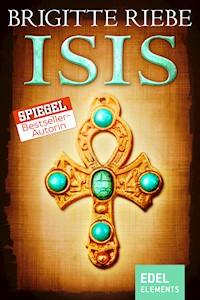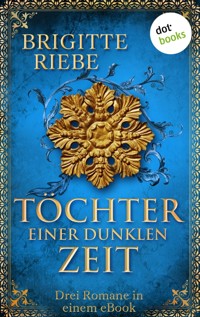Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- E-Book-Herausgeber: dotbooks VerlagHörbuch-Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine mutige Frau – ein folgenschweres Geheimnis: Der Historienroman »Die Braut von Assisi« von Bestsellerautorin Brigitte Riebe als eBook bei dotbooks. Eine Frau im Schatten mächtiger Männer – ein Erbe, das alles überdauert … Assisi im 13. Jahrhundert: Über alle Grenzen hinweg wird Franz von Assisi als berühmtester Sohn dieser Stadt bekannt und nach seinem Tod als Heiliger verehrt. Doch kaum jemand erinnert sich an die Frau, die stets an seiner Seite wirkte, ihm Stütze und Stärke war: Inzwischen ist Chiara zur Äbtissin von San Damiano aufgestiegen und kämpft entschlossen für Fortschritt und Veränderung in ihrem Frauenorden. Dabei wagt sie es, sogar dem Papst die Stirn zu bieten. Ein rätselhafter Todesfall in ihrem Kloster ruft daher bald schon einen Ermittler aus Rom auf den Plan: Ahnt der junge Pater Leo, dass die Lösung des Falls weit in die Vergangenheit zurückreicht? Bei seinen Nachforschungen kommt er Chiaras Geheimnissen gefährlich nahe … »Brigitte Riebes historischer Roman begeistert mit klugen Sätzen über die Liebe und Franz von Assisi.« Für Sie Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der spannende historische Roman »Die Braut von Assisi« über die Heilige Klara, die Begründerin des Klarissenordens, von Bestsellerautorin Brigitte Riebe. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 600
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Eine Frau im Schatten mächtiger Männer – ein Erbe, das alles überdauert … Assisi im 13. Jahrhundert: Über alle Grenzen hinweg wird Franz von Assisi als berühmtester Sohn dieser Stadt bekannt und nach seinem Tod als Heiliger verehrt. Doch kaum jemand erinnert sich an die Frau, die stets an seiner Seite wirkte, ihm Stütze und Stärke war: Inzwischen ist Chiara zur Äbtissin von San Damiano aufgestiegen und kämpft entschlossen für Fortschritt und Veränderung in ihrem Frauenorden. Dabei wagt sie es, sogar dem Papst die Stirn zu bieten. Ein rätselhafter Todesfall in ihrem Kloster ruft daher bald schon einen Ermittler aus Rom auf den Plan: Ahnt der junge Pater Leo, dass die Lösung des Falls weit in die Vergangenheit zurückreicht? Bei seinen Nachforschungen kommt er Chiaras Geheimnissen gefährlich nahe …
Über die Autorin:
Brigitte Riebe, geboren 1953 in München, ist promovierte Historikerin und arbeitete viele Jahre als Verlagslektorin. 1990 entschloss sie sich schließlich, selbst Bücher zu schreiben, und veröffentlichte seitdem über 30 historische Romane und Krimis, mit denen sie regelmäßig auf den Bestseller-Listen vertreten ist. Heute lebt Brigitte Riebe mit ihrem Mann in München.
Bei dotbooks veröffentlichte Brigitte Riebe die folgenden eBooks: »Der Kuss des Anubis«
»Die Töchter von Granada«
»Schwarze Frau vom Nil«
»Pforten der Nacht«
»Liebe ist ein Kleid aus Feuer«
»Die Hexe und der Herzog«
Die Website der Autorin: www.brigitteriebe.com
***
eBook-Neuausgabe November 2020
Copyright © der Originalausgabe 2011 Diana Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2020 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock / Marques / Digiselector / Oksana Alekseeva / MR. LIGHTMAN1975
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (rb)
ISBN 978-3-96655-557-9
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Versand zweimal im Monat – unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Die Braut von Assisi« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Brigitte Riebe
Die Braut von Assisi
Roman
dotbooks.
Per Sabina – mille grazie per tutto!
PAX ET BONUM
Franziskus von Assisi (1182—1226)
Prolog
»Spring!«
Da war sie wieder, jene Stimme, die sie bis in den Traum verfolgte! Fordernd klang sie, so streng und gebieterisch, dass es keinen anderen Ausweg zu geben schien. Sie spürte, wie ihr Körper sich schon fügen wollte. War ihr in all den endlosen Jahren der Gefangenschaft Gehorsam nicht ohnehin zur zweiten Natur geworden?
Zweimal nur hatte sie dagegen aufbegehrt, zunächst, als die Säfte der Jugend so machtvoll in ihr aufgestiegen waren, dass sie geglaubt hatte, an dem Unerfüllten ersticken zu müssen, das ihr für immer verwehrt bleiben würde. All das strenge Fasten, der tagtägliche Verzicht und die heimliche Qual, die andere ihr vorlebten, um von ihr geliebt zu werden, hatten für sie niemals getaugt. Beinahe rasend war sie damals geworden, zweifelnd an der seit jeher vertrauten Welt, verzweifelnd an dem, was in ihr vorging.
In der Stunde der größten Verlassenheit, als Trauer und Hoffnungslosigkeit ihre Sinne schon umwölken wollten, war dann der Engel erschienen, ein Retter, der ihr ganzes Leben verändern sollte, hatte ihr Trost geschenkt und ein Sehnen, das niemals wieder enden sollte. Erst da hatte sie gespürt, an welch brennendem Durst sie gelitten hatte. Doch welch Unglück war aus dieser Erfüllung erwachsen! Ein paar atemlosen Wochen der Seligkeit waren bald die Furcht, schließlich die entsetzlichste Gewissheit gefolgt, die sie wieder zu jenen zurückgetrieben hatte, denen sie entflohen war. Die folgenden Monate hatte sie vollkommen vergessen gehabt, aus dem Gedächtnis gelöscht, als seien sie niemals geschehen ‒ bis vor Kurzem, als sie sich wieder in ihr Bewusstsein geschmuggelt hatten wie etwas Versunkenes, das sich nach und nach aus seiner festen Vertauung auf dem Meeresgrund löst und unaufhaltsam nach oben trudelt, um endlich ans Licht zu gelangen.
Sie war eine Sünderin, das wusste sie, und hatte die strengste Buße dafür auf sich genommen, auch wenn diese ihren Körper taub gemacht, ihr Gesicht verwüstet und ihr Herz leer wie ein zerfleddertes Vogelnest zurückgelassen hatte. Inmitten all der Frömmigkeit war kein Raum für Vergebung gewesen. Im Gegenteil, sie hatte sich wie ein fauliger Apfel gefühlt, der unaufhaltsam weiter verrottete, unwürdig, von der Heiligkeit zu zehren, die die anderen speiste.
Die Zeit heilt alles, das hatte sie die anderen oftmals sagen hören. Außer der Wahrheit, das hatte sie inzwischen am eigenen Leib erfahren müssen. Wahrheit kann schmerzen und pochen wie ein Geschwür vor dem Aufbrechen, wenn sie mit Füßen getreten wird, so lange, bis man ihr Genüge tut und das Lügengespinst zerreißt wie ein mürb gewordenes Spinnennetz.
Von einem Tag zum anderen war sie aus der Blindheit erwacht. Ein hingeworfener Satz, niemals für ihre Ohren bestimmt, hatte ihre Lethargie beendet und die Jägerin in ihr erwachen lassen, eine Jägerin mit spitzer Feder, die ab sofort nichts mehr dem Zufall überlassen würde …
»Spring!«
Jetzt schmeichelte die Stimme, klang gurrend und verführerisch wie laue Sommerluft auf nackter Haut, eine berauschende Erinnerung, die plötzlich wieder ganz lebendig war, als läge kein halbes vergeudetes Leben dazwischen.
Sie spürte, wie ein großes, lautes Lachen in ihr aufstieg, ebenso verboten wie all das andere, das hinter ihr lag. Wie listig sie doch alles eingefädelt hatten, um sie in ewiger Blindheit zu halten! Die ganze Stadt kannte inzwischen die fromme Legende, hegte und liebte sie und erzählte sie getreulich den Kindern weiter, die ihr gespannt lauschten, insgeheim voller Erleichterung, dass ihnen ein ähnliches Schicksal erspart geblieben war.
Doch dabei würde es nicht länger bleiben, dafür hatte sie gesorgt. Ihr Handgelenk war steif, so sehr hatte sie sich anstrengen müssen, um auf Pergament zu bringen, was endlich alle erfahren sollten: dass sie niemals Vergebung erlangen konnte, weil die Sünde schon in ihr war, bevor sie geboren wurde.
»Du wirst nichts spüren, das verspreche ich. Der Aufprall dauert nur einen Lidschlag. Und dann: Ruhe. Frieden. Also zögere nicht länger ‒ spring!«
Im Nacken glaubte sie, seinen Atem zu spüren. Einbildung? Oder war er wirklich schon so nah gekommen?
Ihre Hände wurden klamm. Sie spreizte unwillkürlich die Finger. Noch gehorchten sie ihr, ließen sich öffnen und wieder schließen. Doch ihr Geist, das konnte sie deutlich fühlen, hatte sich bereits auf eine weite Reise begeben.
Sie breitete die Arme weit aus.
Mit dieser Geste hatte der Engel sie bei ihrer ersten Begegnung voller Liebe begrüßt und danach immer wieder, solange er bei ihr geblieben war. Ist er doch noch einmal zurückgekommen, jetzt, wo sie endlich sehend geworden war?
Obwohl der Regen erneut eingesetzt hatte, der seit Wochen die Bäche und Flüsse anschwellen ließ, nahm sie auf einmal mit allen Sinnen den fortgeschrittenen Frühling wahr, der in diesem Jahr verspätet gekommen war, beinahe verstohlen nach einem langen, ungewöhnlich harten Winter. Gras und Blumen roch sie, als läge sie wieder, geschützt von Getreideähren, die sich über ihnen leise im Wind wiegten, mit ihm auf dem warmen Boden, die Glieder ineinander verschlungen, als seien sie ein einziges Lebewesen mit vier Armen und vier Beinen. An der Hüfte spürte sie jenen unnachahmlich sanften Druck, dieses Werben und Drängen, dem sie bald schon voller Verlangen nachgeben würde, die Seide seiner Haut, die Süße seines Kusses.
Sie waren vereint.
Ein Gefühl, so überwältigend, dass sie darüber alles andere vergaß, sogar ihre Todesangst und den Schatten, der sie verfolgt und die steile Steintreppe nach unten getrieben hatte, bis zu dem Felsvorsprung, auf dem sie nun stand. Alles in ihr wurde weich. Sogar der harte Knoten aus Hass und Rache, der ihr Herz so lange zusammengepresst hatte, brach auf. Doch kein Gift ergoss sich daraus, sondern es war ein milder, warmer Strom, der sich tröstlich und heilend anfühlte.
In diesem Moment erfolgte der Stoß.
Ohne den Hauch einer Gegenwehr rutschte sie auf den Abgrund zu. Nichts, was sie noch gehalten hätte.
Sie kippte, stürzte nach vorn.
Schon halb im Fallen riss sie ungläubig die Augen auf, doch die Schwärze hinter ihr war so undurchdringlich, dass sie nichts erkennen konnte.
Dennoch wusste sie auf einmal, wer es gewesen sein musste. Es gab nur einen Einzigen, der dafür infrage kam. Das Letzte, was sie hörte, war das Geräusch riesiger Schwingen, so gewaltig, dass ihr die Ohren zu dröhnen begannen.
Sie schlug unten auf, die Lippen halb geöffnet, als wollte sie noch etwas rufen, zerschmettert auf dem harten Untergrund, als wäre ihr Körper nichts gewesen denn eine nutzlose Hülle.
Eine Hand zeigte gen Himmel.
Im bleichen Licht des aufgehenden Mondes war ihr entstelltes Gesicht beinahe schön.
Erstes BuchVERHEISSUNG
Kapitel 1
In der ersten Dämmerung wirkte der große See wie verwunschen, so spiegelglatt war seine Oberfläche. Endlich hatte auch der Regen aufgehört, der auf dem Ritt nach Süden so lange sein lästiger Begleiter gewesen war. Der Morgenhimmel über ihm war muschelgrau und wolkenlos. Zartes Rot im Osten verkündete bereits den Sonnenaufgang. Sogar das dichte Schilf ringsum schien bewegungslos, bis nach einiger Zeit ein Blesshuhn aufflog und mit seinem rostigen Schrei die heilige Ruhe zerriss.
Jetzt gab es keine Ausflucht mehr, noch länger zu warten. Entschlossen legte er seine Kleider ab, faltete sie zusammen und ging zum Wasser. Die ersten Schritte hinein machte er so schnell, dass er kaum etwas spürte, doch als die Wellen erst einmal seine Schenkel benetzt hatten, drang der unbarmherzige Biss der Kälte bis in sein Innerstes. Alles in ihm zog sich voller Abwehr zusammen. Für einen Augenblick war er versucht, umzukehren und hinaus ins Trockene zu flüchten, dann jedoch überwand er sich, warf sich mit einem Satz bäuchlings ins Wasser und tauchte unter.
Prustend kam er wieder nach oben und begann mit kräftigen Zügen loszuschwimmen, genauso wie sein Bruder Ulrich es ihm vor langen Jahren in einem eisigen Bach nahe der elterlichen Burg beigebracht hatte. Nach und nach schwand die anfängliche Betäubung seiner Gliedmaßen, und ihm wurde wärmer. Als die Isola Maggiore, auf der der heilige Franziskus nach dem Vorbild Jesu vierzig Tage gebetet und gefastet hatte, ein ganzes Stück näher gerückt war, drehte er sich auf den Rücken und ließ sich ein Stück treiben.
Voller Erstaunen sah er an sich hinab.
Die Wochen im Sattel hatten seine Erscheinung verändert. Nicht nur die Schenkel waren schlanker und doch muskulöser geworden, auch der schlaffe Bauch der Wintermonate war gänzlich verschwunden. Alles an ihm wirkte sehnig und straff; ein Körper, der einem deutlich Jüngeren hätte gehören können, einem Mann, der gern jagte und sich mit all dem vergnügte, was sein privilegierter Stand für ihn bereithielt ‒ ein Mann, wie er früher einer gewesen war.
Für einen Moment empfand er beinahe so etwas wie Stolz, den er freilich rasch wieder verscheuchte. Nur in jungen Jahren hatte er sich derartige Gefühle erlaubt, später jedoch den Leib gering geschätzt. Bruder Esel, so hatte der große Heilige den Körper mehr als einmal genannt, weil er immer wieder aufmuckte und besonders, was die Lust betraf, ungeahnte Schwierigkeiten bereiten konnte, anstatt der Seele getreulich zu dienen. Vielleicht verursachte ihm der Anblick seiner bleichen Nacktheit mit all ihren unübersehbar männlichen Attributen deshalb so starkes Unbehagen. Eigentlich lag die Zeit seiner fleischlichen Anfechtungen so weit zurück, dass er sich kaum noch an die zahlreichen Kämpfe und Niederlagen dieser schwierigen Phase zu erinnern vermochte. Mittlerweile war ihm Keuschheit zur Selbstverständlichkeit geworden. Alles, was er früher einmal durchlitten hatte, gehörte der Vergangenheit an und ruhte sicher verschlossen wie hinter einer armdicken Eichentüre ‒ davon war er zumindest bis vor Kurzem überzeugt gewesen. Doch mit einem Mal schienen alte Anfechtungen, die er längst überwunden geglaubt hatte, neu aufzukeimen.
Wie lange hatte er sich nicht mehr derart ungeniert betrachtet!
Seit die Ulmer Pforten hinter ihm ins Schloss gefallen waren, hatte so vieles in seinem Leben sich verändert, und ein untrügliches Gespür sagte ihm, dass es nicht allein mit der Verkleidung zu tun hatte, die er anlegen musste, um unterwegs unentdeckt zu bleiben. Es schien auch an dem Land zu liegen, durch das er ritt, und an den Menschen, die es bewohnten. Da war etwas in ihrem Gang, in ihren Blicken und Gebärden, das sein Herz und seine Sinne auf merkwürdige Weise anrührte und den gewohnten Schutz brüchig werden ließ. Was sie aßen, schmeckte fremdartig und faszinierend zugleich. Sogar die Luft kam ihm auf der Südseite der mächtigen Bergbarriere verändert vor, weicher, schmeichelnder, eine Liebkosung, nach der man sich sehnte, kaum hatte man sie einmal genossen, die sich aber gleichzeitig sündig und damit verboten anfühlte. Diese Reinigung im kalten Seewasser war also mehr als notwendig gewesen, in vielerlei Hinsicht.
War es nicht allerhöchste Zeit, sich endlich wieder in den zurückzuverwandeln, der er eigentlich war?
Den Rückweg zum Ufer legte er umso schneller zurück. Er rannte aus dem Wasser, als seien Dämonen hinter ihm her. Ohne sich um die bemoosten Steine unter seinen Sohlen zu kümmern, schlug er wie wild mit den Armen um sich, um die Kälte zu vertreiben, und rieb sich schließlich mit dem Mantel ab, den er nun nicht mehr brauchen würde.
Ihn, den dick gesteppten Gambeson, wie viele Ritter ihn trugen, dazu die Stiefel sowie die lederne Bruche, all das, was ihm auf dem beschwerlichen Weg über die Alpen gute Dienste geleistet hatte, würde er Simone überlassen, dem Fischer mit dem gütigen Lächeln und den knotigen Gelenken, die ihm die tägliche Ausfahrt bei Wind und Wetter schon in mittleren Jahren beschert hatte. Seine bescheidene Hütte war ihm in den letzten Tagen Unterschlupf gewesen; bereitwillig hatte die Fischerfamilie mit ihm geteilt, was der See an Fängen hergab, bis sein Pferd endlich wieder so weit genesen war, dass er den Weiterritt riskieren konnte.
Der schönste und menschlich wärmste Aufenthalt auf seiner bisherigen Reise, auch wenn die enge Hütte feucht und die Verständigung schwierig gewesen war, denn er verstand nur ungefähr jedes siebte Wort dieser wohlklingenden Sprache, was ihn zunehmend bedenklich stimmte. Seine Mutter, aufgewachsen an den Ufern eines anderen großen Sees am Südrand der Alpen, hatte sie manchmal mit ihm gesprochen, als er noch ein Kind gewesen war und sie ihm Lesen und Schreiben beibrachte, doch das lag mehr als dreißig Jahre zurück, und er hatte das meiste davon inzwischen vergessen. Seine Hoffnung, sich im Lauf der langen Reise wieder darauf zu besinnen und freizulegen, was lange verschüttet gewesen war, hatte sich nur unzureichend erfüllt. Überall, wo er jenseits der Alpen Rast gemacht hatte und mit einfachen Leuten in näheren Kontakt gekommen war, klang ihr Dialekt eine Spur anders, und er konnte das mühsam Erinnerte oder erst vor Kurzem Erlernte kaum sinnvoll einsetzen.
Wie sollte er da seinen schwierigen Auftrag erfüllen, der ihn schon so viele Opfer gekostet hatte? Hätte er nicht besser von Anfang an demütiger sein und die Mission, die der Generalminister ihm übertragen hatte, freiwillig einem anderen Bruder überlassen sollen? Denn wie könnte ausgerechnet ein deutscher Bruder, der in einer weit entfernten Provinz lebte, in der Lage sein, richtig einzuschätzen und zu beurteilen, woran vor ihm andere bereits kläglich gescheitert waren?
Nichts als müßige Fragen, die sich ein getreuer Jünger des heiligen Franz am besten gar nicht stellt, dachte er, während er das flache Bündel mit seiner Kutte und den Hosen öffnete und in beides geschwind hineinschlüpfte. Johannes von Parma, der unserer Ordensgemeinschaft weise und väterlich zugleich vorsteht, wird schon wissen, was er von wem verlangen kann!
Kaum hatte der raue Stoff seine Haut berührt, schien die Verwandlung bereits in vollem Gange, und als er sich auch noch mit dem dreiknotigen Strick der Tugend gegürtet hatte und die harten Sandalenriemen wieder an den nackten Füßen spürte, war sie gänzlich vollzogen: Aus dem Edelmann Leonhart von Falkenstein, der in Eisen und Leder über die Alpen gezogen war, war wieder Bruder Leo geworden, der nach einem langen Weg sein Ziel nun bald erreicht haben würde.
Seine Hände fuhren über den Kopf, und jetzt erhellte ein verschmitztes Lächeln seine Züge. Offenbar hielt die Natur ihn noch immer fest in ihren Krallen. Sein Haarwuchs war so kräftig, dass man die Tonsur kaum noch wahrnehmen konnte, was seiner Tarnung bislang zugutegekommen war. Beim nächsten Kloster der Minderen Brüder würde er dafür Sorge tragen, dass alles wieder so aussah, wie die Regel es gebot.
Sich mit dem Schwert zu gürten, wie zunächst geplant gewesen war, hatte er strikt verweigert, dazu liebte er seine Gelübde viel zu sehr. Doch was sollte er mit dem lästigen Dolch anfangen, den er noch immer mit sich herumschleppte? Zutiefst angewidert, mochte er auch ihn kaum noch anfassen. Blut klebte an ihm, auch wenn seine Klinge mittlerweile wieder silbrig glänzte, Blut, das ein noch viel schlimmeres Unrecht nicht hatte verhindern können. Und dennoch hatte der Dolch ihm das Leben gerettet.
Damit freilich sollte sein frevlerischer Dienst beendet sein!
Aus einem plötzlichen Impuls heraus bückte sich Leo nach ihm, ergriff ihn und holte weit aus, um ihn in den See zu schleudern, hielt aber inne, als seine Stute, die er an einen Baum gebunden hatte, warnend zu wiehern begann.
Ein gutes Stück entfernt war Simone gerade dabei, das kleine Holzboot ins Wasser zu lassen; Pietro und Andrea, die beiden älteren Söhne, mager und krummbeinig wie er, halfen ihm dabei. Keiner von ihnen sollte ihn in seiner wirklichen Gestalt sehen, um nicht auf törichte Gedanken zu kommen. Also ließ er die Waffe unverrichteter Dinge in seine Satteltasche gleiten, band Fidelis los und saß auf.
Das Bündel mit den nutzlos gewordenen Kleidungsstücken hatte er gut sichtbar auf einem großen Stein am Ufer zurückgelassen. Er wusste, dass die Fischer dort jeden Tag anlegten, um ihre kostbaren Reusen trocknen zu lassen.
Sie würden sich wundern, so viel war gewiss, und beinahe tat es ihm leid, dass er ihre staunenden Gesichter nicht mehr sehen konnte. Vielleicht würden sie ja eines Tages ihren Kindern die Sage vom fremden Ritter und seinem lahmen Pferd erzählen, der alle Kleider als Geschenk zurückgelassen hatte, bevor er über Nacht mitsamt der Stute wie ein flüchtiges Traumbild im See verschwunden war.
Die Menschen südlich des Alpenkamms, so kam es ihm vor, schienen solche Legenden ganz besonders zu lieben.
Das Haus war erwacht, früher als gewöhnlich, weil die Zeit bis zu den Festlichkeiten von Tag zu Tag schneller zusammenzuschnurren schien. Unten, in der großen Küche, hörte sie die Mägde beim Schüren des riesigen Brotofens rumoren. Wenig später würden Gemüseputzen und Geflügelrupfen an die Reihe kommen, damit die Minestrone, die lange köcheln musste, um die gewünschte Sämigkeit zu bekommen, rechtzeitig angesetzt werden konnte. Gaia und Carmela waren wie beinahe jeden Morgen damit beschäftigt, dazu Rufina sowie die alte Toma, die schon seit Ewigkeiten hier diente und wegen ihres fortschreitenden Gichtleidens seit dem Winter nur noch leichtere Arbeiten verrichten konnte. Aber es gab auch einige neue Mädchen und Frauen aus der Unterstadt, deren Namen sie sich noch nicht gemerkt hatte, weil sie erst kürzlich als zusätzliche Unterstützung für die anstehenden Hochzeitsvorbereitungen eingestellt worden waren.
Simonettas klangvoller Alt, der lautstark Anweisungen erteilte, übertönte alles andere, und aus jedem Wort, das sie an das Gesinde richtete, schwang das Selbstbewusstsein der reichen Kaufmannsgattin, der Befehlen zur zweiten Natur geworden war. Sie »Mamma« zu nennen, wie Simonetta es von ihr erwartete, brachte Stella noch immer kaum über die Lippen, als gäbe es da eine innerliche Barriere, die ihr das verwehrte. Aber hatte Simonetta sie nicht aufgezogen wie eine leibliche Tochter und sich diese Anrede damit tausendmal verdient?
Beinahe, flüsterte diese aufsässige Stimme in ihr, die sich manchmal einfach nicht zum Schweigen bringen lassen wollte. Immer gerade so, dass du den Unterschied sehr wohl zu spüren bekommen hast.
Der Unterschied lag neben ihr im breiten Bett und gähnte soeben herzhaft, bevor er sich noch einmal auf die andere Seite rollte, um eine genüssliche Runde weiterzuschlafen: Ilaria, einzige überlebende Tochter der Familie Lucarelli ‒ wenn man das Findelkind Stella, das man barmherzig als Neugeborenes aufgenommen hatte, nicht mitzählen wollte.
In Aussehen und Charakter hätten die beiden jungen Frauen unterschiedlicher kaum sein können: Ilaria war groß und blond, mit schalkhaften blauen Augen und einem Wesen, so strahlend und hell wie die Sonne, während die Haare der zierlichen Stella schwarz wie Rabenflügel waren, sie als verträumt und nachdenklich galt, stets mit einer unausgesprochenen Frage in ihren großen Augen, deren Farbe an das silbrig grüne Laub der Olivenbäume erinnerte. Man musste sich schon anstrengen, um Stella überhaupt noch wahrzunehmen, wenn Ilaria zusammen mit ihr den Raum betrat und so unbekümmert lossprudelte, wie es ihrem Temperament entsprach. Doch nach einer gewissen Zeit schien dieser Eindruck zu schwinden, und dann konnte es durchaus Stella sein, die mit ihrer gefühlvollen Art, Geschichten zu erzählen, mit den anmutigen Gesten, die diese begleiteten, und den gekonnt gesetzten Pausen, welche die Spannung noch steigerten, die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich zog.
»Sternenkind«, so nannte Ilaria sie seit Kindheitstagen und hing in zärtlicher Liebe, die jeden Anflug von Eifersucht vermissen ließ, an ihr. »Eines Tages haben Engel dich auf unserer Schwelle abgelegt, damit ich künftig nicht mehr so allein sein musste, nachdem meine anderen Geschwisterchen doch alle schon im Himmel waren. Und jetzt werden wir zwei schon bald auch noch durch unsere Ehemänner für immer verwandt sein ‒ besser hätte es gar nicht kommen können!«
Behutsam strich Stella der Schlafenden eine verklebte Locke aus der Stirn. In Ilaria steckte so viel Leben, dass sie manchmal förmlich zu glühen schien, und so verging in der wärmeren Jahreszeit kein Morgen, an dem sie nicht nass geschwitzt erwachte, einem ungestümen Fohlen gleich, das in seiner Begeisterung im Traum wieder einmal zu weit galoppiert war.
Dass sie ihren Federico von ganzem Herzen liebte, stand für alle außer Frage. Die beiden schienen füreinander bestimmt, zwei strahlend schöne junge Menschen, die sich selbst genügten; das verriet jeder ihrer Blicke, die sie unablässig tauschten, jede Liebkosung, die sie inzwischen sogar öffentlich wagten. Zudem war Federico della Rocca nicht nur in den Augen der Kaufmannsfamilie eine ausgesprochen gute Partie: wohlerzogen, weit gereist und vor allem adelig, wenngleich leider nicht unbedingt begütert. Doch das Vermögen von Vasco Lucarelli und seine Mitgift für Ilaria, über deren sagenhaftes Ausmaß ganz Assisi nur im Flüsterton Mutmaßungen anstellte, würden ohnehin für ein bequemes, standesgemäßes Leben des jungen Paares sorgen.
Wenn Stella dagegen an Carlo dachte, Federicos Vetter, mit dem man sie kurz nach Ilaria verlobt hatte, überwogen gemischte Gefühle. Anfangs war er ihr ausgesprochen schmuck und anziehend erschienen, war er doch einer der begehrtesten Junggesellen der Stadt, auf den viele junge Mädchen ein Auge geworfen hatten, und sie hatte kaum fassen können, dass ausgerechnet sie das Ziel seines Werbens sein sollte. Er war mittelgroß und schlank, mit kräftigen Schultern, schmalen Hüften und einem Schopf kastanienbrauner Locken, die ihm etwas Jungenhaftes gaben. Carlo della Rocca besaß eine Vorliebe für ausgefallene Farben und feine Stoffe, die er auf ungewöhnliche Weise zu kombinieren verstand, und keiner der jungen Edelleute weit und breit trug solch aufwendige Schuhe wie er. Dabei war er alles andere als ein Stutzer oder Lackaffe, sondern wirkte ausgesprochen männlich, mit erlesenen Manieren gesegnet, die ihn überall beliebt machten. Seine galante Art und die vielen Schmeicheleien und Komplimente aus seinem Mund hatten Stella zunächst in eine Art Traumzustand versetzt, der über Monate anhielt.
Bis zu dem Zwischenfall mit dem Falken.
Was als vergnügliche Jagdpartie und festliche Zerstreuung am Morgen ihres Geburtstags begonnen hatte, sollte nur Stunden später in Tod und Tränen enden. Niemals würde sie vergessen können, mit welcher Grausamkeit er sein Falkenweibchen bestraft hatte, als es ihm den Gehorsam verweigert hatte. Das Bild des zerfetzten Vogelkörpers unter seinen genagelten Stiefeln verfolgte sie bis heute, und all seine wortreichen Beteuerungen, wie unendlich leid es ihm tue, für einen Augenblick die Beherrschung verloren zu haben, hatten ihr Herz nicht wirklich erreicht.
Seitdem betrachtete Stella ihn mit anderen Augen, und was sie da zu sehen bekam, ließ unangenehme Ahnungen in ihr aufsteigen. War sein Mund nicht eine Spur zu gebieterisch, der Blick zu kalt, die Miene oftmals so herrisch, als fühle er sich allen anderen heimlich überlegen?
Er schien zu spüren, was in ihr vorging. Jedes Mal, wenn ihr Misstrauen überhandzunehmen drohte, veränderten sich sein Ausdruck und sein Verhalten. Dann wurde Carlo plötzlich weich, fast demütig, begann erneut von seiner Liebe zu ihr zu sprechen und von einer gemeinsamen Zukunft, die in glühenden Bildern auszumalen er nicht müde wurde.
Ilaria hatte sich inzwischen auf den Rücken gedreht und schnarchte herzerfrischend. Nicht mehr lange, und sie würde sich die Augen reiben, um kurz danach mit beiden Beinen in die Welt zu springen, die sich eigens für sie zu einem neuen Tag zu rüsten schien. Sie war eine Eroberin, eine »Frau der Tat«, wie sie manchmal selbst lachend sagte, die nicht lange überlegte, sondern handelte ‒ basta!
Wenn sie doch auch nur mehr davon hätte! Gedankenverloren drehte Stella den Ring mit dem blutroten Granat an ihrem Finger hin und her, den Carlo ihr zur Verlobung angesteckt hatte. Anfangs hatte er perfekt gepasst und sie atemlos vor Glück gemacht, doch inzwischen schien er seltsamerweise zu eng geworden. Unter dem matten Goldband spannte die Haut, war rau und gerötet. Auf einmal erschien ihr der Ring wie eine Last. Sollte sie ihn einfach abstreifen?
Ein Gedanke, den sie sich schnell wieder verbat. Der Adelige und das Findelkind ‒ klang ihre Liebesgeschichte nicht wie ein Märchen? Sie sollte dankbar sein, dass Carlo ausgerechnet sie erwählt hatte. Und nicht nur dafür galt es, in ihrer Lieblingskirche San Rufino einen neuen Satz dicker weißer Kerzen anzuzünden.
Denn natürlich schickte Vasco auch sie nicht mit leeren Händen in die Ehe. Er, weit über Assisi hinaus bekannt für seine großzügigen Schenkungen an die Kirche, vor allem aber für die herzliche Gastfreundschaft, mit der er reisende Ordensbrüder unter seinem Dach aufnahm, hatte auch für Stella eine stattliche Mitgift ausgesetzt, wenngleich natürlich deutlich niedriger als die für Ilaria. Eine Mitgift, die jeden geeigneten Kandidaten die ungewisse Herkunft der Braut vergessen machen konnte. Scham und eine unerklärliche Übelkeit hatten sie überfallen, als er ihr dies eines Abends in feierlichen, fast gestelzt anmutenden Worten mitteilte.
»Du hast jetzt neue Wurzeln, Stella, und trägst den Namen einer achtbaren Familie, das solltest du niemals vergessen. Gewissermaßen ein Geschöpf ohne Vergangenheit, dafür mit stabiler Gegenwart und, wie es aussieht, sogar glänzender Zukunft. Keiner darf wagen, dich zu schmähen, sonst bekommt er es auf der Stelle mit Vasco Lucarelli und seinen streitbaren Vettern zu tun.«
Ob er insgeheim froh war, sie loszuwerden?
In seinen vernarbten Zügen hatte sie vergeblich nach einer Antwort gesucht. All die Fragen, die sich ihr schon auf die Zunge drängen wollten, schluckte sie lieber hinunter, denn seine beherrschte Miene verriet, dass sie ohnehin nur wieder gegen eine Mauer rennen würde wie schon die vielen Male davor. Eine rasche, gefällige Antwort, wie Vasco, der ihr gegenüber seltsamerweise niemals auf der Anrede »Papà« bestanden hatte, sie so gern erteilte, wenn er ein Thema zu beenden wünschte, wollte sie nicht hören. Sie war eine Sucherin, eine, die häufig und gerne grübelte und den Dingen am liebsten auf den Grund ging, bis ihre Liebe zur Wahrheit gestillt war.
Eine Eigenschaft, die im Haus Lucarelli nicht sonderlich hoch im Kurs stand, wie Stella immer wieder feststellen musste. Nicht einmal ihre geliebte Ilaria schien allzu viel davon zu halten, sondern war zufrieden, wenn nach außen hin alles so aussah, als gäbe es keinerlei Schwierigkeiten.
»Was geht nur schon wieder in deinem hübschen schwarzen Köpfchen vor?« Wie ein zum Schmusen aufgelegtes Katzenjunges schmiegte Ilaria sich von hinten an Stella und hielt sie mit ihren heißen Händen fest umklammert. »Carlo, oder? Ich möchte wetten, du denkst gerade an ihn.«
Stella atmete tief aus. »Und wenn ich die Hochzeit noch einmal verschiebe?«, murmelte sie, froh, dass sie Ilaria dabei nicht in die Augen sehen musste. »Vielleicht nur um ein paar Monate, was meinst du? Wir könnten einfach ein gutes halbes Jahr nach euch heiraten. Dann wären jetzt alle Augen auf Federico und dich gerichtet, und wir hätten im Winter ein zweites schönes Fest.«
»Das ist nicht dein Ernst, sorellina!« Ilaria hatte abrupt von ihr abgelassen und stand nun vor Empörung vibrierend im Bett. Das seidene Nachthemd modellierte ihre üppigen Brüste wie die einer Statue. Venus in Person, dachte Stella, soeben erst dem göttlichen Schaum entstiegen. Padre Luca, zweiter Kaplan zu San Rufino, hatte während des Brautunterrichts öfter von den antiken Gottheiten erzählt als von den Pflichten einer zukünftigen Ehefrau und Mutter, und Stella konnte von diesen aufregenden Sagen und wüsten Heroengeschichten gar nicht genug bekommen. Dann jedoch hatte der padre eines Abends Hals über Kopf das Haus verlassen müssen, weil er sich unsterblich in Ilaria verliebt hatte, seine Venus, wie er sie in rührenden Briefen angebetet hatte, die ihm freilich nie gehören würde.
Eine Venus, die gerade auf wenig göttliche Weise schrie und den Mund dabei so weit aufriss, als wolle sie Stella verschlingen. »Willst du Mamma um den Verstand bringen? Und Papa an den Bettelstab? Er ruiniert sich doch ohnehin schon für seine beiden Mädchen. Jedenfalls predigt er mir das Tag für Tag. Wie kommst du nur immer wieder auf solch verrückte Ideen?«
Weil ich dich um dein Glück beneide, dachte Stella, auch wenn ich es dir gleichzeitig von ganzem Herzen gönne. Weil ich immer öfter unsicher bin, die richtige Wahl getroffen zu haben. Weil ich es manchmal richtig mit der Angst zu tun bekomme, wenn Carlos Augen so grausam aufleuchten. Weil ich eben …
»Weil ich eben manchmal ein verrücktes Huhn bin, das nicht genau weiß, wohin es eigentlich gehört«, sagte sie laut und verfluchte dabei innerlich ihre Feigheit.
»Ja, das bist du in der Tat, wenn du solchen Unsinn daherplapperst.« Ilarias weiche Arme umschlossen sie erneut mit erstaunlicher Kraft. »Hierher gehörst du, mein Hühnchen, zu uns, wohin denn sonst? Jeder von uns liebt dich auf seine Weise ‒ Mamma, Papa, ich sowieso und natürlich auch dein Carlo. Der ganz besonders! Du würdest nicht nur seinen männlichen Stolz verletzen, sondern ihm auch das Herz brechen, wenn du jetzt noch einen Rückzieher machst, wo doch alle Vorbereitungen laufen und sogar unsere Brautkleider beinahe fertig sind. Die Hochzeit verschieben ‒ wer hat solch eine wahnwitzige Idee jemals schon gehört! Nein, unser schönes Assisi wird zwei Bräute auf einmal erleben, eine blonde und eine schwarze, die auch noch liebende Schwestern sind. Und damit basta! Ich lasse dich erst wieder los, hörst du, wenn du endlich zur Vernunft gekommen bist.«
Die vertraute Nähe machte Stella ruhiger und besänftigte sogar halbwegs ihr aufgewühltes Inneres. Vielleicht grübelte sie wirklich zu viel. Ilaria und sie waren Schwestern, wenngleich nicht von den gleichen Eltern abstammend, das wusste auch Carlo. Was sollte ihr schon zustoßen, solange sie solchen Rückhalt besaß?
»Soll ich dir heute die Haare flechten?«, schlug sie schließlich vor, um das Thema abzuschließen und auf andere Gedanken zu kommen.
»Du weißt schon, dass wir heute auch noch zu Aldiana müssen«, warf Ilaria ein. »Sie kann unsere nahezu fertigen Gewänder unmöglich durch den Straßenstaub hierher zerren. Und dann würden sie vielleicht gar Federico oder Carlo zu Gesicht bekommen, stell dir das nur einmal vor!«
Auf sie wartete ein Brautkleid in Lichtblau, während das von Stella die Farbe eines zartgrünen Maienwaldes hatte. Selbstredend, dass nur der leiblichen Tochter des Hauses Simonettas funkelnde Aquamarine zustanden. Stella mussten Jugend und Schönheit schmücken, und davon besaß sie mehr als genug, wie ihre Ziehmutter ihr immer wieder so eindringlich versicherte, als wäre sie selbst nicht gänzlich davon überzeugt.
Stella nickte ergeben. »Ich könnte die kleinen cremefarbenen Perlen dazu nehmen, die du so sehr liebst. Was meinst du?«
Ob sie jetzt eine Antwort erhalten würde?
»Das würdest du tun? O ja ‒ bitte! Deine zarten Hände sind nun mal so viel geschickter als Rosinas Wurstfinger.«
Beide prusteten im gleichen Augenblick los.
Erst unlängst vom Küchenmädchen zur Zofe der beiden Bräute befördert, mühte das junge Mädchen vom Land sich noch sichtlich überfordert mit den ungewohnten Pflichten ab. Ihr morgens freiwillig die Haare zu überlassen, konnte bedeuten, sich auf stundenlanges Rupfen und Ziepen einstellen zu müssen, das doch zu nichts führte.
»Dann los!« Ilarias überschäumende Lebenslust hatte sich wieder einmal durchgesetzt.
Sie sprang aus dem Bett; Stella folgte ihr wie beinahe jeden Morgen in einigem Abstand und bekam dabei Gelegenheit, einen Blick auf Ilarias runde Waden zu werfen, die sich unter der dünnen weißen Seide abzeichneten. Federico würde ein Prachtweib zur Frau bekommen, an der so gut wie alles makellos war, während Carlo sich mit einer zerrupften mageren Lerche abfinden musste, an der, wenn überhaupt, einzig und allein die dunkle Haarpracht ins Auge fiel.
Ob ihn wohl vor allem die Aussicht auf die saftige Mitgift verführt hatte, anziehend zu finden, was viele andere junge Männer aus gutem Grund übersehen hatten? Beinahe hätte sie über sich selbst gelacht. Fing sie etwa schon wieder mit diesem hoffnungslosen Grübeln an?
Mit einer ungeduldigen Bewegung riss sie das Fenster auf. Warme Maisonne fiel in das Zimmer und malte runde Kringel auf den rötlichen Steinboden.
Der Tag konnte beginnen.
***
Die Glocke des Aussätzigen drang an sein Ohr, eine ganze Weile, bevor er ihn sah.
Leo kannte den Ton, denn auch zu Hause in Ulm hatte der Rat vor nicht allzu langer Zeit die tönernen Siechenscheppern abgeschafft, die über Jahrhunderte in Gebrauch gewesen waren, und stattdessen Glöckchen eingeführt, um die Bürger vor dem ungewollten Kontakt mit Leprakranken zu warnen. Eine Fülle weiterer Bestimmungen war erlassen worden, die das Leben der Ausgestoßenen noch schwieriger als bisher gemacht hatten, als wären Ekel und Abscheu, die die Gesunden bei ihrem Anblick empfanden, nicht schon Strafe genug.
Die Liste der Verbote war so endlos, dass er nur das Wichtigste daraus behalten hatte: Das Trinken aus Brunnen und Quellen war ihnen verboten, sie durften keine Kirche betreten und hatten stets ihre eigene Essschüssel mitzuführen. Strengste Strafen erwarteten sie, sollten sie es wagen, sich Kindern zu nähern oder gar einen Gesunden zu berühren. In Ulm befand sich ihre baufällige Behausung außerhalb der Stadtmauer, was sie wehr- und damit schutzlos machte, und auch hier in Assisi schien es nicht viel anders zu sein, denn die Stadt, die er im leichten Dunst aufragen sah, lag noch ein ganzes Stück entfernt. Am liebsten hätte man sie hie wie da wohl ganz davongejagt ‒ aber wer würde sie stattdessen aufnehmen?
Der Mann war inzwischen näher gekommen, humpelnd, sichtlich unter starken Schmerzen. Das Tückische am Aussatz war, dass er bei jedem ganz unterschiedlich auftreten konnte. Mal begann er im Gesicht und ließ als Erstes die Nase verfaulen, oder er fraß die Augen in den Höhlen. Bei anderen wiederum wurden zunächst die Gliedmaßen taub, bevor die schwärenden Wunden aufbrachen, gegen die es kein Heilmittel gab. Von Aussatz befallen zu werden galt als Strafe Gottes, als weit sichtbares Zeichen, dass der Mensch, der mit dieser Krankheit geschlagen war, schwer gesündigt hatte ‒ wie aber konnte es dann angehen, dass auch unschuldige Kinder daran litten?
Leo zügelte Fidelis, die leise schnaubte. Der Ritt vom Trasimener See war für ihren gerade erst geheilten Hinterlauf offenbar anstrengender als gedacht gewesen. Eine ausgiebige Pause würde ihnen beiden guttun.
Jetzt sah der Aussätzige, der keinerlei Anstalten machte, den schmalen Weg zu verlassen, zu ihm auf.
»Leo«, flüsterte er mit rauer Stimme. »Fra Leone ‒ sei tu?«
Was wollte er von ihm? Und woher konnte er wissen, wer er war?
Leo starrte in das zerstörte Gesicht, das weder eine Nase noch erkennbare Konturen hatte, sondern ihm nur wie eine breiige Masse aus Hügeln und undefinierbaren Tälern erschien. Ekel stieg in ihm auf, dessen er sich im gleichen Augenblick schämte. Hatte Franziskus nicht einen Leprösen herzlich umarmt und sogar auf den Mund geküsst, so die Legenden? Er aber war nun mal nur ein einfacher Mönch und kein Heiliger wie der große Sohn Umbriens.
»Sei ritornato ‒ finalmente!« Jetzt machte der Mann doch tatsächlich Anstalten, auch noch nach seinem Fuß zu greifen!
»Nimm gefälligst deine Hände da weg, sonst kannst du was erleben!«, rief Leo. Doch in ihm brodelte es weiter. Du bist endlich zurückgekommen ‒ was in aller Welt hatte das zu bedeuten?
Die Stute schien seine wachsende Anspannung zu spüren und stieg unversehens. Er versuchte, sie zu einer Seite abzustellen und mit Kreuz und Schenkel vorwärtszutreiben, um sie zu beruhigen. Leider war er zu langsam gewesen. Sein Oberkörper war schon zu weit nach vorn geschossen, er konnte sich nicht länger im Sattel halten, sondern spürte, wie er zu rutschen begann, dem Boden unaufhaltsam entgegen.
Er schlug unten auf. Dabei stieß sein Kopf an etwas Hartes. Ihm wurde schwarz vor Augen.
Nach einer Weile kitzelte etwas seine Nase. Ein warmer Atem vor seinem Gesicht.
Das zumindest würde der Lepröse doch wohl nicht wagen!
Immer noch zutiefst empört, wollte Leo auffahren, um ihn endgültig in seine Schranken zu weisen, sank jedoch schmerzerfüllt und erneut beschämt wieder zurück. Fidelis stand über ihm und fuhr nach kurzem Zögern mit ihrem sanften Beschnuppern fort, als wolle sie sich davon überzeugen, dass er es auch wirklich war.
Von dem Aussätzigen keine Spur weit und breit.
Das stellte Leo fest, nachdem er sich mühsam aufgerappelt hatte. Am Hinterkopf ertastete er eine Wunde, die jedoch zum Glück nicht stark zu bluten schien. Da er auch seine letzten beiden Hemden großzügig dem Fischer überlassen hatte, blieb ihm nichts anderes übrig, als die Wunde mit einer Handvoll Gras vorsichtig abzutupfen. Dabei überfiel ihn heftiger Schwindel, der den Rest seines kargen Frühstücks nach oben drückte. Er würgte, musste sich übergeben. Seine Befürchtung wuchs. Ob er sich ernsthaft verletzt hatte?
Bruder Anselm, als klösterlicher Infirmar mit allerlei Krankheitsbildern vertraut, hatte die Brüder immer wieder vor Kopfwunden und innerlichen Blutungen gewarnt, die schlimme, manchmal sogar tödliche Folgen haben konnten, wenn man sie auf die leichte Schulter nahm. Das fehlte ihm gerade noch, nach all den Mühen in San Damiano nicht als Visitator, sondern als Schwerkranker anzukommen, der selbst ins Bett gehörte!
In seinem benommenen Zustand war er für die schwierige Mission denkbar schlecht gerüstet, das spürte er mehr als deutlich. Leo kramte in den Satteltaschen und zog die Tonflasche heraus, die er am See frisch gefüllt hatte. Er trank ausgiebig und fühlte dabei Fidelis’ sanften Blick auf sich ruhen. Sie brauchte ebenfalls Wasser. Und eine saftige Wiese, um ihren Hunger zu stillen. Nur ein wenig rasten und durchschnaufen ‒ dann würde es sicherlich besser werden.
Vorsichtig schaute er sich um. Jede zu heftige Bewegung ließ den Schmerz in seinem Hinterkopf erneut aufflammen. Ringsum nichts als Bäume, Wiesen und Felder, über die ein sanfter Wind strich. Die unterschiedlichen Grüntöne, die ineinanderflossen wie die Farben eines Gemäldes, taten seinen gereizten Augen wohl, und fast schien es ihm, als würde bei diesem erfrischenden Anblick auch der Kopfschmerz ein wenig leichter.
Ein Stück entfernt entdeckte er ein steinernes Gebäude, einen Stall oder größeren Heuschober, wie er zunächst dachte. Und sah er daneben nicht auch etwas schmales Silbriges schimmern, das sich durch das Grün schlängelte?
Er nahm Fidelis am Zügel. Längst wieder lammfromm, trottete sie neben ihm her.
Beim Näherkommen bemerkte er, dass er sich getäuscht hatte. Weder Stall oder Heuschober hatten seinen Blick auf sich gezogen, sondern eine kleine, halb verfallene Kirche zwischen hohen Steineichen. Das Dach war löchrig, der Putz an den Wänden blätterte in dicken Blasen ab. In der Baumkrone über ihm schrien Starküken gierig nach Futter. Und nur wenige Schritte weiter floss ein kleiner Bach.
Während Fidelis ihren Durst stillte und danach friedlich zu grasen begann, ging er hinein.
Drinnen war es dämmrig. Es gab nur zwei Fenster über der kleinen Apsis. In einem Reste von buntem Glas, das andere hatte man mit Sackleinen verhüllt. Der Altar war kaum mehr als ein grob behauener Stein, über den ein vergilbtes Leinentuch hing. Überall am Boden Spuren von dürren Zweiglein und Vogelkot, als hätten über Jahre verschiedenste Brutpaare hier genistet.
Wie lange mochte in diesem verlassenen Gotteshaus schon keine heilige Messe mehr gefeiert worden sein?
Als er die unbeholfen bemalten Wände näher inspizierte, bedächtig wie ein alter Mann, weil auch die kleinste Bewegung ihm noch immer Schmerzen bereitete, stieß er auf etwas, das ihn plötzlich innehalten ließ. Zuerst dachte Leo, er habe sich geirrt, und seine Phantasie habe ihm lediglich vorgegaukelt, was er zu sehen wünschte. Sein Blick glitt noch einmal prüfend über den Untergrund, um schließlich auf einer bestimmten Stelle zu verweilen. Leo trat näher, dann noch näher und kniff dabei die Augen zusammen. Kein Zweifel, da war es ‒ jenes Zeichen, das die Botschaft des Heiligen weit hinaus in die Welt getragen hatte!
Seine Finger berührten ein makelloses T, dessen wohl ehemals kräftiger Rotton im Lauf der Zeit zu einem schwachen Rosa verblasst war. Erregung überkam ihn, sein innerliches Zittern verstärkte sich, und jetzt musste er sich an der Wand anlehnen.
Das verrottende Kirchlein war nichts anderes als die Portiuncula, die Urkirche sozusagen, in der Franziskus mit den ersten Brüdern gelebt und gebetet hatte. Hier, in Santa Maria degli Angeli, hatte er Klara mit eigenen Händen das Haar abgeschnitten, ihr hier die grobe Kutte übergestreift.
Der Heilige selbst hatte ihm den Aussätzigen geschickt, um ihn auf die Probe zu stellen! Und wie ein blinder und zugleich tauber Sünder hatte Bruder Leo sein Herz vor dem Bedürftigen verschlossen. Dabei hatte der Lepröse ihn doch hierhergeführt, zu diesem auserwählten Ort, dessen einstige Heiligkeit nun in Schmutz und Verlassenheit unterzugehen drohte.
Der Kopfschmerz war mit einem Mal wie weggeblasen, und auch irdische Bedürfnisse wie Hunger oder Durst spürte Leo nicht mehr. Ein heiliges Feuer hatte ihn erfasst, sein Herz entflammt und all seine Sinne ergriffen. Während bald schon die große Grabkirche in Assisi in Anwesenheit des Heiligen Vaters feierlich geweiht werden sollte, verfiel hier scheinbar unbemerkt, was die Minoriten eigentlich ausmachte! Er war nicht einen Augenblick zu früh gekommen. Und sein Weg, das wurde ihm spätestens in diesem Moment klar, würde vermutlich viel weiter und dornenreicher sein, als er anfangs geglaubt hatte.
Leo ging hinaus, aufrecht, voller Ungeduld, wie es seine Art war. Fidelis schien schon auf ihn gewartet zu haben und trabte ihm mit wehendem Schweif entgegen.
Nach einem kurzen Ritt durch Felder und einen kleinen Laubwald ging es bergauf, dem Kloster San Damiano entgegen. Leo genoss die erfrischende Kühle des grünen Laubdaches, das die erneut auftretenden Schmerzen leicht dämpfte. Die Sonne war höher gewandert und besaß erstaunliche Kraft. Das ganze Land schien von ihr erfüllt, der Boden, die Luft, jede einzelne Pflanze, die am Wegrand wuchs.
Vor dem Konvent saß er ab und band Fidelis an eine Zypresse. Rötlicher Naturstein erhob sich vor ihm, perfekt geschichtet wie auch die Mauern und kleinen Häuser, an denen er unterwegs vorbeigekommen war. Hier hatte der Heilige den Ruf des Kreuzes vernommen, hier mit den eigenen Händen gegen den Verfall des alten Gotteshauses gekämpft, hier, wie manche sagten, seine berührende Hymne an alle Kreaturen verfasst.
Ein Gefühl heiliger Scheu überfiel Leo, als er langsam zur Pforte schritt. Ob die Schwestern ihn bereits erwarteten?
Sein Besuch war schriftlich angekündigt worden, doch Länge und Gefahren des Weges hatten keine allzu genaue Datierung zugelassen, ein Umstand, den er nur allzu gern in Kauf genommen hatte. Ein gewisses Maß an Überraschung tat stets gut, das hatten ihn andere Visitationen bereits gelehrt. Allerdings hatte sein Fuß niemals zuvor so heiligen Boden betreten.
Auf sein Klopfen an der Pforte hin geschah zuerst einmal nichts. Prüfend glitt sein Blick zur Sonne, um genauer abzuschätzen, welche Stunde es wohl sein mochte. Seiner Vermutung nach war der Mittag bereits eine Weile überschritten, das bedeutete, dass die Non bereits gebetet sein musste und die Vesper noch nicht allzu bald beginnen würde. Eigentlich sollten die frommen Schwestern jetzt alle bei der Arbeit sein. Und dennoch glaubte er, leisen Gesang zu hören, der aus der kleinen Kirche drang.
Ein lokaler Feiertag, von dem er nichts wusste?
Leo, dem alle monastischen Stundengebete längst in Fleisch und Blut übergegangen waren, konnte sich keinen rechten Reim darauf machen. Er klopfte abermals, länger und stärker, doch wieder blieb alles ruhig.
Ob sie jeglichen Besuch ablehnten?
Er wusste von der strengen Klausur, die der Heilige Vater Klara und ihren Mitschwestern auferlegt hatte, doch das galt nicht für seine Visitation.
Aber wie sollte er sich bemerkbar machen?
Plötzlich berührte etwas Seidiges seinen Knöchel, und er schrie unwillkürlich auf, um im nächsten Moment über sich selbst zu lachen. Eine graue Katze saß neben ihm und sah aus unergründlich bernsteinfarbenen Augen zu ihm auf. Dann, offensichtlich verlegen, begann sie, ihre Schulter zu putzen.
»Bist du etwa mein Begrüßungskomitee?« Er bückte sich, um sie zu streicheln, doch sie schoss scheu davon.
Als er sich wieder aufgerichtet hatte, stand eine Nonne vor ihm. Wie war sie herausgekommen? Er hatte keinen Laut gehört.
»Sono Fra Leo«, sagte er. »Il visitatore…«
Sie sah ihn staunend an, als könnte sie kaum fassen, was sie da zu hören bekam.
Sofort überfiel ihn die alte Unsicherheit, die er freilich rasch wieder vertrieb. Diese einfachen Worte ‒ sie mussten richtig gewesen sein.
»Sono Fra Leo del monasterium Ulm«, begann er noch einmal von vorn. »Vorreiparlare con l’abbatissa.«
Wieso schüttelte sie jetzt so energisch den Kopf, dass ihre Haube zu wackeln begann? Sie hatte ein schmales, energisches Gesicht und so tiefbraune Augen, dass sie ihm unter der einfachen Haube fast schwarz erschienen.
»Impossibile«, sagte sie mit fester Stimme. »Madre Chiara e troppo malata.«
Dass Klara seit langen Jahren das Bett hüten musste, wusste er bereits. Ob ihr labiler Zustand sich verschlechtert hatte? Hoffentlich kam er nicht zu spät!
»Ich muss sie trotzdem sprechen«, stieß er hervor. »Deshalb bin ich ja den ganzen weiten Weg über die Alpen geritten. Bruder Johannes schickt mich. Es ist sehr, sehr wichtig, für euch alle, für das ganze Kloster, verstehst du …«
Beschämt hielt er inne. Er war vor lauter Aufregung in seine Muttersprache verfallen. Wahrscheinlich hatte die Schwester kein einziges Wort verstanden.
Doch in den dunklen Augen schimmerte ein winziges Lächeln. »Komm mit!«, sagte sie, griff nach dem Schlüsselbund, der an ihrem Strick hing, und schloss auf.
Er folgte ihr in den kleinen Kreuzgang, vollkommen überrascht. Sie sprach Deutsch, den harten gutturalen Dialekt der westlichen Alpen, den auch seine Mutter gesprochen hatte.
»Wir sind froh, dich hier zu sehen.« Die Nonne war stehen geblieben. »Ich bin Suor Regula, die Infirmarin. Die anderen sind alle in der Kirche und beten. Aber wieso bist du allein?«
Sie hatte sofort seinen wundesten Punkt getroffen. Laut den Anweisungen des heiligen Franziskus hatten Minderbrüder sich stets zu zweit auf Reisen zu begeben, erst recht, wenn diese so lang und beschwerlich waren wie die, die hinter ihm lag. Natürlich war er zusammen mit einem Gefährten aufgebrochen. Doch was diesem unterwegs zugestoßen war, lag tief und für immer auf dem Grund seines Herzens begraben.
»Jetzt?«, fragte Leo, um das heikle Thema zu übergehen. »Die Schwestern beten jetzt?«
Sie nickte. Das Lächeln war aus ihren Augen verschwunden. »Es gab da einen Todesfall. Gestern. Suor Magdalena. Ihre arme Seele braucht unseren Beistand.« Sie schien zu zögern, als wollte sie noch etwas hinzufügen, entschied sich dann aber offenbar dagegen.
Irgendetwas zwang Leo zum Nachfragen. »Woran ist sie gestorben?«, sagte er.
Abermals Zögern.
»Ein schrecklicher Unfall«, sagte Suor Regula schließlich. »Ein Sturz aus großer Höhe. Außerhalb.« Ihre Hand fuhr zum Mund, als hätte sie schon zu viel verraten.
»Sie hat das Kloster verlassen?« Wie passte das zur strengsten Klausur, die für San Damiano von oberster Stelle angeordnet war? »Hatte sie denn einen speziellen Auftrag?«
Suor Regula schien zu ahnen, was ihn bewegte. »Wir haben keine Erklärung dafür«, sagte sie. »Magdalena hat die Vigil verpasst, zum ersten Mal in all den Jahren. Da haben wir nach ihr zu suchen begonnen. Gefunden haben wie sie allerdings erst Stunden später. Als es hell war.«
»Kann ich sie sehen?«
Die schmalen Schultern gingen nach oben. »Kein schöner Anblick«, sagte die Infirmarin leise.
»Daran bin ich gewöhnt«, lautete seine Antwort. »Per favore!«
Sie machte ein paar Schritte, er folgte ihr.
»Warte!«, beschied sie ihn. »Das hat einzig und allein Madre Chiara zu entscheiden.«
Sie ging so leise davon, dass sein Blick unwillkürlich nach unten glitt. Ihre Füße waren nackt; sogar auf die einfachen Sandalen, die der Heilige ausdrücklich erlaubt hatte, verzichtete sie offenkundig.
Leo ließ sich auf die kleine Steinbank neben dem Eingang sinken, denn plötzlich meldete sich der Schmerz im Hinterkopf wieder zurück.
Ob die Mutter ihn nun doch empfangen würde?
Zu einem ausführlichen Gespräch wäre er heute gar nicht mehr in der Lage. Schon auf dem Weg hierher hatte er beschlossen, für einige Zeit in Assisi zu bleiben, um sich ein möglichst abschließendes Bild zu machen. Stellte sich allerdings noch die Frage nach einem geeigneten Quartier. Das riesige Monasterium der Minoriten erschien ihm aus vielerlei Gründen nicht als der richtige Ort. Es gab kein Kloster, in dem nicht getratscht wurde, erst recht, wenn es von Männern bewohnt war und offiziell strengstes Schweigegebot herrschte. Sein Auftrag war viel zu delikat, um im unpassenden Moment an die große Glocke gehängt zu werden.
Doch hier würde er auch nicht bleiben können, als einziger Mann inmitten all der Nonnen. Wie viele es wohl sein mochten? Obwohl der Platz beschränkt war, erfreute sich Klaras Kloster, wie er wusste, seit Jahren größter Anziehung, und die Zahl der frommen Schwestern wuchs ständig an.
Um einen kleinen Brunnen herum blühten wilde Sommerblumen. Schmetterlinge tanzten in der Luft. Es roch süß und ein wenig bitter zugleich, eine winzige, unschuldige Idylle inmitten der starken steinernen Mauern. Beinahe wären ihm im friedlichen Halbschatten die Augen zugefallen.
Plötzlich stand Suor Regula wieder vor ihm. Sie musste sich aufgeregt haben, das erkannte er an den roten Flecken, die auf einmal auf ihren schmalen Wangen brannten. Doch sie nach dem Grund zu fragen, wäre ebenso unhöflich wie sinnlos gewesen. Sie erschien ihm wie das Misstrauen in Person. Niemals würde sie einen Fremden einweihen.
»Komm!«, sagte sie.
Leo ging davon aus, dass sie ihn als Nächstes in die Kirche führen würde, wo wie bei ihnen im Ulmer Kloster jeder Tote zum Abschiednehmen einen Tag und eine Nacht vor dem Altar aufgebahrt wurde. Doch sie bog kurz vor dem niedrigen Portal nach rechts ab, öffnete eine unscheinbare Tür und nahm die Treppe nach unten.
Er roch den Tod, noch bevor sie ihr Ziel erreicht hatten. In den Mauern schien er zu sitzen und seine eiskalten Finger nach jedem auszustrecken, der sich hierher verirrte.
Der Raum, eher eine Art Kellerverlies, war so niedrig, dass Leo kaum aufrecht stehen konnte. Der Leichnam war nicht in einen Sarg gebettet, wie er es erwartet hatte, sondern lag auf einer einfachen Holzpritsche. Ein weißes Leintuch bedeckte ihn. Am Kopfende ein schlichtes Holzkreuz. Zu den Füßen der Toten brannten zwei weiße Kerzen.
»Das ist sie«, sagte Regula. »Suor Magdalena. Ihr ganzes Leben hat sie hier im Kloster verbracht.«
Etwas kam Leo merkwürdig an diesem Satz vor, doch er entschloss sich, seine Überlegungen auf später zu verschieben.
»Kann ich sie sehen?«, fragte er.
»Kein schöner Anblick«, sagte sie abermals, hielt aber inne, griff dann nach dem Tuch und zog es langsam herunter.
Eine Frau in den frühen Vierzigern, wie er schätzte, vermutlich kaum ein paar Jahre älter als er selbst. Den fülligen, fast plumpen Körper verhüllte das schlichte Ordenskleid, in ihrem Fall so verwaschen und zerschlissen, dass es wie billigstes Sackleinen aussah. Die Gliedmaßen wirkten seltsam verdreht, als hätte ein Riese sie grob aus den Gelenken gerissen und dann einfach sinnlos baumeln lassen.
»Unzählige Brüche«, drang Regulas Stimme in seine Gedanken. »Arme, Beine, Rippen und wer weiß, was sonst noch alles. Aber arg leiden müssen hat sie wohl nicht. Wir gehen davon aus, dass sie sofort tot war.«
Das Gesicht Suor Magdalenas war flächig und von Schürfwunden bedeckt. Links klaffte ein tiefer Riss, der knapp unter dem Auge begann und bis zu den Lippen reichte. Diese Seite war entstellt, beinahe zur Teufelsfratze geworden, während die rechte Gesichtshälfte entspannt, ja geradezu friedlich wirkte.
Er trat näher und hörte, wie die Nonne hinter ihm die Luft scharf zwischen den Zähnen einsog. Sie will nicht, dass ich genauer hinsehe, schoss es Leo durch den Kopf. Dafür wird sie ihre Gründe haben.
Aber welche? Und weshalb lagen die Hände der Toten nicht gefaltet auf der Brust wie sonst üblich?
Nach kurzem Zögern griff er nach der rechten Hand der Toten und drehte sie behutsam um. »Die Finger sind ja tiefbraun«, sagte er erstaunt. »Dann hat sie wohl bei euch im Scriptorium gearbeitet?«
Ein kurzes, bellendes Lachen, das ihn unangenehm berührte.
»San Damiano besitzt gar kein Scriptorium. Wenn Madre Chiara etwas zu schreiben hat, macht sie das selbst, sofern ihre Kräfte es zulassen, oder Suor Beatrice erledigt es für sie, ihre jüngste leibliche Schwester, der sie am meisten vertraut. Außerdem konnte Magdalena gar nicht schreiben. Das weiß ich ganz genau.«
Leo neigte sich tiefer.
»Für mich sieht das eindeutig nach Schlehdorntinte aus«, beharrte er. »Die hab ich mir selbst jahrelang mühsam von den Fingern kratzen müssen. Ich bin ganz sicher.«
»Magdalena hat hauptsächlich in der Küche gearbeitet«, sagte Suor Regula. »Vielleicht irgendein stark färbender Pflanzensud? Sie war ja ständig am Köcheln und Herumexperimentieren.«
Jetzt hätte er am liebsten Leintuch und Kutte weggezogen und den nackten Leichnam von Kopf bis Fuß genau inspiziert, aber das war natürlich unmöglich. Ob er die Nonne irgendwie kurz ablenken konnte?
Doch Regula stand so steif und gerade wie eine Säule neben der Totenbahre. Ihr Gesicht verriet höchste Achtsamkeit.
Vielleicht gelang es ihm ja auf andere Weise, hinter ihre Fassade zu dringen.
»Das war in Wirklichkeit gar kein Unfall, nicht wahr?«, sagte Leo und brachte es fertig, seine Stimme beiläufig klingen zu lassen und damit die Ungeheuerlichkeit des Inhalts zu mildern. »Eine Schwester, die heimlich die vorgeschriebene Klausur verlässt und sich aus dem Kloster stiehlt, nachts, mutterseelenallein … und die man Stunden später mit zerschmetterten Gliedern tot auffindet. Deshalb ist sie nicht in der Kirche aufgebahrt, sondern liegt hier, in diesem trostlosen Verlies. Weil ihr nämlich eine Todsünde vermutet. Ihr geht davon aus, ihr Tod sei kein Unfall, sondern vielmehr Selbstmord gewesen …«
Regula wandte rasch den Kopf ab, aber nicht rasch genug. Das Entsetzen in ihren Augen war ihm nicht entgangen. Doch er war noch nicht ganz fertig.
»… oder vielleicht sogar Mord. Denn man kann sich ja nicht nur aus eigenem Antrieb in die Tiefe stürzen. Man kann auch von fremder Hand in die Tiefe gestoßen werden. Hatte Suor Magdalena Feinde? Und wenn ja, welche?«
»Was fällt dir ein?«, fuhr die Nonne zu ihm herum. Dann jedoch schien sie sich zu besinnen, wer vor ihr stand, und sie beruhigte sich rasch. »Natürlich hatte sie keine Feinde! Unsere Magdalena hätte keiner Fliege etwas zuleide tun können«, fuhr sie fort, um vieles versöhnlicher. »Aber sie war manchmal betrübt. Besonders in letzter Zeit. Als ob eine schwere Last auf ihr läge. Ich hab sie heimlich seufzen hören. Ein frommes, trauriges Kind Gottes. Wer hätte ihr schon etwas Böses antun können?«
»Das werde ich eben Mutter Klara fragen müssen«, sagte Leo. »Dies und vieles andere mehr. Und du wirst dabei meine Dolmetscherin sein. Gehen wir!«
»Du kannst sie nicht sehen, wie ich schon gesagt habe.« Suor Regula wirkte plötzlich größer. »Madre Chiara ist viel zu schwach, um Besuch zu empfangen. Der Tod einer ihrer geliebten Schwestern hat sie sehr mitgenommen.«
»Aber ich muss sie sehen«, beharrte er. »Wenigstens auf ein Wort.«
»Versuch es morgen wieder!« Regulas Stimme klang abschließend. »Ich werde ihr ein Stärkungsmittel verabreichen, das schon manchmal geholfen hat. Vielleicht fühlt sie sich dann morgen besser. Doch das liegt allein in Gottes allmächtiger Hand.«
Die Endgültigkeit in ihrem Tonfall machte ihn ärgerlich, vor allem, weil er glaubte, auch noch eine Spur trotziger Genugtuung zu hören, aber er ließ sich nichts davon anmerken. Sie würden schon noch zu spüren bekommen, wie hartnäckig er sein konnte!
Hatten sie überhaupt das Totengebet für die Mitschwester gesprochen? Dieses Kellerloch strahlte eine Verlassenheit aus, die ihn sogar daran zweifeln ließ.
Leo faltete seine Hände. »O Herr, gib Schwester Magdalena die ewige Ruhe!«, betete er laut. »Und das ewige Licht leuchte ihr. Lass sie ruhen in Frieden! Amen.«
Er ging zur Tür, die steile Treppe nach oben und atmete auf, als er wieder in die Wärme und Geborgenheit des strahlenden Sommertages entlassen wurde. Dann drehte er sich zur Infirmarin um, die ihn aus schmalen Augen musterte.
»Bis morgen früh nach der Terz!«, sagte er. »Und ich bin ganz sicher, dann wird Madre Chiara mich empfangen.«
***
»Ihr seid ja schon wieder magerer geworden, Signora Stella!« Wenn sie sich erregte, wie gerade, vergaß Aldiana, den kleinen Buckel zu verstecken, den sie sonst so geschickt unter losem Faltenwurf zu kaschieren wusste. »Wollt Ihr etwa, dass Euer Bräutigam sich in der Hochzeitsnacht an Euren Knochen wund stößt?«
Ilaria brach in mitreißendes Gelächter aus.
»Dafür wird mein Bauch immer runder«, rief sie vergnügt. »Wenn du die seitlichen Nähte nicht ein bisschen auslässt, Aldiana, werden die Leute denken, Federico habe mich bereits geschwängert ‒ na, das Getratsche möchte ich hören!«
Stella war ihr dankbar für die Ablenkung. Der Erbin des Hauses Lucarelli würde die Schneiderin nichts Freches entgegenzusetzen wagen, während sie bei ihr, dem Findelkind ‒ wie ganz Assisi wusste ‒ nur zu gern ihre Spitzen anbrachte. Stella wusste selbst, dass sie in letzter Zeit an Gewicht verloren hatte. Aber wie konnte sie Simonettas üppige Speisefolgen genießen, wenn ihr so vieles durch den Kopf ging?
Ein Jammer, dass der Spiegel nicht groß genug und dazu halb blind war! Und dennoch gefiel ihr, was er ihr zurückwarf: eine junge, schlanke Frau in einem hellgrünen Kleid, das perfekt mit dem Schwarz der Haare und der Farbe der Augen harmonierte. Was machte es schon aus, dass es nicht so eng wie eine Wurstpelle saß!
Sie hasste Kleider, in denen sie keine Luft bekam. Als Kind hatte sie manchmal heimlich in Simonettas unzähligen Truhen gestöbert, dabei eines Tages verblichene Knabenkleider entdeckt, sie angezogen und sich in ihnen auf der Stelle sehr wohl gefühlt. Die Ohrfeigen, die sie damals eingefangen hatte, konnte sie noch heute auf ihren Wangen spüren. Doch viel mehr hatten die Worte sie verletzt, die ihre Ziehmutter in höchster Erregung hervorgestoßen hatte. Bis heute waren sie tief in ihrer Seele eingebrannt: »Die Kleider meiner toten Söhne ‒ nie mehr wirst du sie anfassen, du gottverlassenes Hurenkind, hast du mich verstanden? Wären sie noch am Leben, wenigstens einer von ihnen, du hättest niemals unser Haus betreten.«
Ein Tag, der eine Zäsur gesetzt hatte, die bis heute andauerte. Seitdem hatte Stella all dem Gurren und Kosen Simonettas niemals mehr wirklich trauen können, war immer wieder zurückgezuckt vor deren überschwänglichen Zärtlichkeiten und hatte um ihr heißes Herz eine hohe Mauer gezogen.
Sich Simonettas Küchenkünsten zu verweigern, bereitete Stella heimliche Freude. Ihr lag nichts an den verfeinerten Köstlichkeiten, mit denen die anderen sich tagtäglich vollstopften: Trüffeln, Steinpilzen, Wildschweinpasteten, Maronen oder fetten Kapaunen. Ihr Körper sehnte sich nach anderer, leichterer Kost, und dass sie die im Haus Lucarelli nicht so einfach bekommen würde, hatte sie schon lange herausgefunden. Dabei war sie alles andere als eine Hungerleiderin. Schlichte, einfache Speisen mochte sie am liebsten: ein Stück knuspriges Brot, weißen Käse, Oliven sowie die kräftigen Suppen, die das Personal des Stadthaushaltes für sich kochte, wenn die Herrschaft auf dem Landsitz weilte.
»Carlo della Rocca liebt nun mal schlanke Frauen«, sagte Stella angelegentlich und genoss, wie Aldiana zurückzuckte, als habe sie mit einem Mal begriffen, wohin sie gehörte.
Ilaria, die es besonders liebte, wenn ihre Sternenschwester schlagfertige Antworten erteilte, spitzte die Lippen und begann einen Gassenhauer zu pfeifen.
Stella drehte sich weiter vor dem Spiegel. Vielleicht war sie einen Augenblick zu sehr in den eigenen Anblick vertieft gewesen. Vielleicht hatte sie aber auch der Wunsch nach Schönheit und Glück zu weit aus der stickigen Nähstube hinausgetragen in frischere, weitere Gefilde ‒ jedenfalls bemerkte sie die Anwesenheit der jungen Männer erst nach einer kleinen Weile.
Ilaria hing bereits an Federicos Hals, als gäbe es keinen schöneren Platz auf der ganzen Welt, während Carlo seine Braut eher prüfend beäugte.
»Du musst die Augen schließen!«, rief Stella. »Auf der Stelle! Ihr dürft die Brautkleider doch nicht vor dem Hochzeitstag sehen! Das bringt Unglück.«