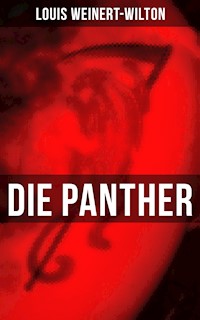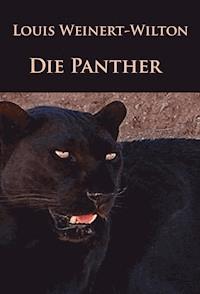Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
In 'Die chinesische Nelke' von Louis Weinert-Wilton handelt es sich um einen historischen Roman, der in China während des Zweiten Weltkriegs spielt. Der Autor beschreibt detailreich die politische und kulturelle Landschaft jener Zeit und lässt den Leser tief in die Ereignisse eintauchen. Weinert-Wiltons literarischer Stil zeichnet sich durch präzise Beschreibungen und komplexe Charaktere aus, die die Realität der menschlichen Natur in schwierigen Zeiten widerspiegeln. Der Roman bietet einen einzigartigen Einblick in das Leben in China während einer turbulenten Ära und lässt die Leser einen fesselnden historischen Moment erleben. Louis Weinert-Wilton, ein bekannter Historiker und Schriftsteller, bringt sein umfangreiches Wissen über China und seine Leidenschaft für die Geschichte in dieses Buch ein. Seine akribische Recherche und sein detailgetreuer Schreibstil verleihen dem Roman eine authentische Note, die den Leser fesselt. Durch 'Die chinesische Nelke' gelingt es Weinert-Wilton, historische Ereignisse mit fiktiven Elementen zu verbinden und eine packende Erzählung zu schaffen, die die Leser mitreißen wird. Allen Geschichtsinteressierten und Liebhabern von historischen Romanen wird dieses Buch wärmstens empfohlen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 337
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die chinesische Nelke
Books
INHALTSVERZEICHNIS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
1
Inhaltsverzeichnis
Es war am 23. Dezember, zwischen zehn und elf Uhr vormittags, als in dem Schicksal der schönen, aber arg bemakelten Miss Maud Hogarth und einiger anderer, weniger anziehender, dafür aber höchst geachteter Persönlichkeiten durch das Zusammentreffen verschiedener kleiner Zufälle plötzlich eine entscheidende Wendung herbeigeführt werden sollte.
Die Sache fing damit an, daß ein sehr gut und sehr jugendlich aussehender Gentleman, der sich Donald Ramsay nannte, diesen Londoner Wintermorgen völlig hoffnungslos fand. Die Welt vor den Fenstern des unscheinbaren Hauses nahe der Westminster-Brücke in Lambeth steckte in einem dicken schmutziggelben Dunst, und der Gedanke, sich durch diese triefende Finsternis hindurchtasten zu müssen, hatte gar nichts Verlockendes.
Also stemmte der junge Mann die Füße wieder gegen den wärmenden Kamin und nahm nochmals die »Times« auf.
Aber erst auf der wappengeschmückten Seite mit den Personalnachrichten und sonstigen Anzeigen blieben seine lebhaften Augen plötzlich auf einer Stelle haften, und dann spitzten sich die bartlosen Lippen zu einem dünnen Pfiff. »Das läßt sich hören ...«, murmelte er und las die Ankündigung noch ein zweites Mal.
Sie betraf das Weihnachtsessen des Piccadilly-Hotels am 25. Dezember um 8 Uhr abends, das Gedeck zu sechs Guineen. Für diese Kleinigkeit gab es neunzehn erlesene Gänge.
»Imperial Pfahlaustern – Marinière – fein ...«, wiederholte der Gentleman, nachdem er mit dem Studium der Speisenfolge zu Ende war, und zog entschlossen das Tischtelefon heran, um die wichtige Angelegenheit sofort zu erledigen. Das Gespräch mit der Hotelleitung gestaltete sich kurz und ergab keine Schwierigkeiten.
»Nein, besondere Wünsche wegen des Platzes habe ich nicht«, erklärte Ramsay, und als ihm daraufhin ein Vorschlag gemacht wurde, war er ohne weiteres damit einverstanden. »Gut, also Nummer 28, äußerste Reihe rechts. Die Tischkarte wird noch im Laufe des heutigen Tages abgeholt werden. – Danke.«
Der junge Mann legte den Hörer auf und warf einen Blick auf die Uhr. Da diese eben ein Viertel vor zehn zeigte, klingelte er.
Bereits in der nächsten halben Minute tauchte nach einem schüchternen Klopfen Mrs. Machennan auf. Sie war eine zierliche, immer noch recht hübsche Frau mittleren Alters, aber das Anziehendste an ihr war die Sanftmut, die sich in ihrem ganzen Wesen offenbarte. Sie hatte geradezu rührend sanfte Rehaugen, eine sanfte, sehr angenehm klingende Stimme, und um den etwas üppig geratenen kleinen Mund spielte ewig ein gewinnendes Lächeln.
Donald Ramsay empfing sie mit einem freundlichen Nicken, und Mrs. Machennan schlug verschämt die sanften Rehaugen nieder. Dann atmete sie tief auf und ließ ihre angenehme Stimme hören.
»Ich hoffe, daß alles nach Ihren Wünschen ist, Mr. Ramsay«, sagte sie. »Leider konnte ich in der Eile ...«
»Es ist alles ganz nach meinen Wünschen, und ich fühle mich bei Ihnen sehr behaglich«, versicherte der neue Hausgenosse lebhaft, und das Lächeln um den Mund der Frau wurde geradezu glückselig. »Machen Sie also meinetwegen keine weiteren Umstände. Die Nachbarschaft könnte sonst vielleicht aufmerksam werden, und das wäre mir nicht angenehm.«
Mrs. Machennan lächelte unentwegt und schüttelte den Kopf. »Die Nachbarschaft kümmert sich nicht um uns, Mr. Ramsay«, erklärte sie. »Ich habe gar keinen Verkehr, und das Mädchen ist etwas menschenscheu und sprechfaul. Außerdem benützen wir stets den Ausgang durch den Hof, und dort gibt es nur Kontorgebäude.«
»Das ist mir lieb«, sagte Donald Ramsay. »Im übrigen werde ich in einigen Stunden aufs Land fahren und erst übermorgen nachmittag zurückkehren. – Ja – und am Abend werde ich dann das Weihnachtsessen im Piccadilly mitmachen.«
Mrs. Machennan, die sehr aufmerksam zugehört hatte, neigte den kokett frisierten Kopf. »Da werden Sie also den Frack benötigen; ich werde alles zurechtlegen. Wünschen Sie auch eine Blume fürs Knopfloch, Mr. Ramsay? – Und was für eine?«
Der junge Mann hob die Oberlippe und zeigte seine kräftigen tadellosen Zähne. »Donnerwetter, Sie denken doch wirklich an alles, liebe Mrs. Machennan. Natürlich eine Blume. Aber was für eine – jawohl ... Das ist sehr wichtig ... Sagen wir also eine ...«
Der Gentleman überlegte mit großer Gründlichkeit. »Ja – also sagen wir: eine chinesische Nelke. Sie verstehen mich? Nicht eine gewöhnliche Gartennelke, sondern eine richtige Chinesen-Nelke. Vielleicht können Sie so etwas auftreiben?«
»Oh, sicher werde ich sie bekommen«, erwiderte Mrs. Machennan und wurde mit einem Mal gesprächig. »Zufällig weiß ich genau, wie solch eine chinesische Nelke aussieht, man kann mir daher nicht etwas anderes aufhängen«, erklärte sie. »Ich habe nämlich diese Blume bei der aufregenden Verhandlung gesehen, die vor einigen Monaten in Old Bailey gegen Miss Maud Hogarth stattfand, weil die junge Dame einen Offizier erschossen haben sollte. Die Sache war sehr geheimnisvoll, und es haben dabei gerade solche chinesischen Nelken eine gewisse Rolle gespielt. Deshalb hat auch ein ganzer Strauß davon vor dem Richter gestanden, und die Leute haben sich um die Blumen förmlich gerauft, als das Urteil gesprochen war. – Leider ist der rätselhafte Fall nicht aufgeklärt worden, und Miss Hogarth wurde nur freigesprochen, weil die Geschworenen keine Beweise hatten ... Ja.«
Mrs. Machennan brach etwas unvermittelt und verwirrt ab, denn ihr zerstreuter Zuhörer sah mit sichtlicher Ungeduld wieder nach der Uhr.
»Es dürfte nun bald ein Mann kommen«, sagte er.
»Der Mann ist bereits hier«, lispelte Mrs. Machennan mit ihrem allersanftesten Lächeln. »Ich habe ihn allerdings auf den Hof geschickt, damit er sich die Schuhe gründlich reinigt. Ich werde ihn sofort heraufbringen.«
Als sich die Tür hinter der geschäftigen Frau geschlossen hatte, sah sich Donald Ramsay veranlaßt, die kurze Anzeige von der Chinesen-Nelke zum dritten Male zu überfliegen.
»›DIE CHINESISCHE NELKE‹ hat neue Blüten getrieben. Wenn sie ins Haus kommt, hat man genau fünf Tage Zeit, nochmals die Wahl zu treffen«, las er halblaut Wort für Wort vor sich hin und wurde so nachdenklich, daß er diesmal das schüchterne Klopfen völlig überhörte.
2
Inhaltsverzeichnis
»Der Mann ...«, meldete Mrs. Machennan und griff hinter sich, um eine schwerfällige Gestalt mit sanfter Gewalt ins Zimmer zu schieben. Hierauf verschwand sie lautlos, und der Besucher ließ einen tiefen Schnaufer der Erleichterung vernehmen. Er trug die wetterfeste verschossene Kleidung der Leute vom Hafen, aber seine derben Stiefel glänzten äußerst feiertäglich. Auch sonst hatte er offenbar für seinen äußeren Menschen ein übriges getan, und dabei waren einige Hautstreifen von den lederartigen Wangen und dem Bulldoggenkinn am Rasiermesser hängengeblieben.
Peter Owen sah weder nett noch sonderlich vertrauenerweckend aus, aber Ramsay nickte befriedigt und schob sogar einladend einen der behaglichen Klubsessel zurecht.
»Setzen Sie sich und zünden Sie sich eine Zigarre an«, sagte er freundlich und dämpfte dann seine Stimme, so daß sie eben nur bis zum Ohr des Besuchers reichte. »Ich habe gehört, daß Sie sehr zuverlässig sind und allerlei Winkel Londons kennen, die man nicht so leicht zu sehen bekommt. Vielleicht läßt es sich machen, daß Sie mich in der nächsten Zeit ein bißchen herumführen und mir auch sonst in Verschiedenem an die Hand gehen?«
Er sah den vierschrötigen Mann erwartungsvoll an, aber dieser vermochte noch immer nicht, ins Gleichgewicht zu kommen. Er drehte den dicken Glimmstengel unschlüssig zwischen den noch dickeren Fingern, schielte scheu nach der Tür, durch die Mrs. Machennan davongeschlüpft war, und ließ die Zigarre schließlich mit einem bösartigen Knurren in der Tasche verschwinden. Dann tastete er mit der Zungenspitze verzweifelt im Munde herum, begann mit den gewaltigen Kiefern zu mahlen, und erst, als die saftige Verwünschung, die ihn würgte, hinuntergeschluckt war, kam Peter Owen endlich zur Sache.
»Natürlich läßt es sich machen, Sir«, erklärte er bereitwillig. »Sie müssen mir nur so beiläufig sagen, was Sie sehen wollen.« In seinen Augen lag eine gespannte Frage, und um den breiten zerschundenen Mund spielte ein verschlagenes Lächeln.
Der junge Gentleman betrachtete sehr angelegentlich das Lichterspiel in dem kristallenen Kronleuchter. »Ich möchte zunächst einmal unter recht viele Leute kommen«, bemerkte er ausweichend. »Besonders auch unter ausländisches Volk. Das weitere wird sich dann vielleicht ergeben.«
Peter kraulte sich nachdenklich das rostbraune struppige Kalbfell auf dem wuchtigen Schädel. »Recht viele Leute und ausländisches Volk ... Das wäre also einmal Tims feine Bude draußen im Dockwinkel«, überlegte er halblaut. »Da gibt es alles, was in der Welt auf zwei Beinen herumläuft. Aber mancher der Jungens sieht aus, als ob sein Vater und seine Mutter noch auf den Bäumen spazieren geklettert wären. Vielleicht ist das wirklich das, was Sie suchen, Sir, nur ...«
Er schnitt eine nachdenkliche Grimasse, und der Blick, mit dem er sein Gegenüber aus verkniffenen Augen musterte, verriet, was er sagen wollte. Er war für solche Führerdienste immer zu haben und nahm es selbst mit einer ganzen Hölle voll tückischer Teufel auf, aber wenigstens ein bißchen mußte sein Begleiter sich seiner Haut doch auch allein wehren können, wenn es not tat. Er hatte schon mit verschiedenen Leuten zusammengearbeitet, aber da hatte man auf den ersten Blick gesehen, daß sie für solche Möglichkeiten das nötige Handwerkszeug bei sich hatten. Dieser Gentleman hingegen schien blutjung, und mit den langen schmalen Händen, die er über dem aufgezogenen Knie gefaltet hatte, konnte man wohl kaum ein ordentliches Nasenbein kaputt schlagen oder einen Magen ins Schaukeln bringen. Das war schlimm, weil ...
Weiter kam Peter in seinen Erwägungen nicht, denn der andere schnellte plötzlich mit einem federnden Sprung auf die Beine.
»Schön, abgemacht – beginnen wir also mit Tims feiner Bude«, sagte er unternehmend. »So bald wie möglich. Vielleicht schon am ...«
Während Ramsay schlüssig zu werden suchte, erkannte Peter, daß die jugendlichen Züge ihn bisher getäuscht hatten. Der Gentleman mußte weit älter sein, als er bei der ersten flüchtigen Betrachtung erschien. Nun, du das volle Licht des Lüsters auf das gebräunte Gesicht fiel, traten um die Mundwinkel scharfe Linien hervor, und auf dem dichten dunkelblonden Haar schimmerte hier und dort bereits ein leichter Reif.
Mit einem Mal gab es dem Manne vom Hafen einen gewaltigen Ruck, und er polterte unter ziemlichem Lärm in die Höhe, um sich krampfhaft in Positur zu stellen.
»Ja«, schreckte Donald etwas verwundert auf – »also vielleicht am zweiten Weihnachtsfeiertag? Da wird es dort gewiß einen besonders großen Betrieb geben.«
»Zu Befehl, Sir«, brüllte Peter mit seiner heiseren Stimme und stand steif wie ein Stock. Dann schnappte er aufgeregt nach Luft und ging in ein gedämpftes Krächzen über. »Vor acht Jahren, Sir, wenn Sie sich zu erinnern belieben ... Bootsmaat Peter Owen. Auf ...«
Ramsay fuhr blitzschnell mit der Hand an Peters offenem Mund vorbei, als ob er nach einer Fliege haschte. »So«, sagte er freundlicher, aber mit Nachdruck, »damit wäre diese Sache ein für allemal abgetan. Und am zweiten Weihnachtstag können Sie mich so um die neunte Abendstunde hier abholen. Nehmen Sie in Zukunft immer den Weg durch den Hof. Mrs. Machennan wird ihn Ihnen zeigen.«
Er machte Miene, den Klingelknopf zu drücken, aber Peter Owen geriet so außer Rand und Band, daß er jeglichen Respekt vergaß und dem anderen in den Arm fiel.
»Tun Sie's nicht, Sir«, stieß er ängstlich hervor, »ich finde den Weg schon allein. Wo der Hof ist, weiß ich bereits. Sie hat mich ja dreimal mit der Bürste hinausgeschickt, weil ihr meine Stiefel nicht blank genug waren. Es wird vielleicht besser sein, wenn ich einfach immer vor dem hinteren Eingang auf Sie warte, Sir ... Es ist nämlich wegen des Priems«, erklärte er auf den verwunderten Blick Ramsays etwas verlegen und gallig. »Ich muß so was im Mund haben, wenn ich auf dem Damm sein soll, aber die Lady hat gesagt, daß ein Teppich kein Themsewasser ist, und daß man es nachher im ganzen Haus riecht. Als ob unsereiner keine Manieren hätte und fortwährend nur so wild 'rumspuckte! Das hab' ich ihr auch gesagt, aber sie hat mich sehr freundlich angelächelt und hat gesagt: ›Geben Sie das Ding heraus.‹ Ich aber habe darauf ebenso freundlich gesagt: ›Nein‹, und da ist sie mir auf einmal mit einem Kochlöffel, den sie hinter dem Rücken versteckt hatte, blitzschnell zwischen die Zähne gefahren und hat mir den Priem einfach herausgefischt. Er war gut einen halben Finger lang und gerade frisch ...«
»Die sanfte Mrs. Machennan?« fragte Ramsay mit einem ungläubigen Lächeln.
Peter verzog bedenklich den linken Mundwinkel, besann sich aber noch rechtzeitig auf den Teppich und auf seine guten Manieren.
»Sie ist eine Schottin, Sir, was ich sofort gehört habe. Das hat immer den lieben Gott auf der Zunge und den Teufel im Leib. Wie gesagt, ich werde nächstens lieber draußen warten. Von acht Uhr an bin ich zur Stelle. Und vielleicht wird es gut sein, wenn Sie sich so herrichten, daß Sie zu mir passen. Es kommen ja manchmal auch feiner angezogene Leute in den ›Durstigen Stockfisch‹ aber da gibt es dann immer ein albernes Hälserecken und Tuscheln. Besonders seitdem die Geschichte mit dem Mann passiert ist, der behauptet hatte, daß so eine lumpige chinesische Nelke fünfhundert Pfund wert sei ...«
»Wie?« entfuhr es Ramsay, und Peter blickte ihn ganz verdutzt an, weil die kurze Frage gar so scharf geklungen hatte.
»Natürlich ist das Unsinn«, glaubte er sich rechtfertigen zu müssen, »aber der Mann hat es wahrhaftig gesagt. Vielleicht hatte er schon ein bißchen zuviel getrunken, obwohl man ihm davon nichts anmerkte. Er hat nur schrecklich protzig getan, und deshalb hat sich sofort eines der aufgetakelten Barmädchen zu ihm gesetzt. Und weil diese diebischen Weiber immer erst mit Kleinem anfangen, wollte sie ihm zunächst einmal die Blume ziehen, die er im Knopfloch stecken hatte. Aber da hat ihr der Mann auf die Finger geklopft, daß es nur so klatschte, und hat ganz laut geschrien: ›Davon laß deine Pfötchen, mein Kind, das ist nichts für dich. Das ist eine chinesische Nelke, die gut ihre fünfhundert Pfund wert ist.‹ – Tja, dabei wäre natürlich weiter nichts gewesen, aber zwei Stunden später hat eine Polizeipatrouille den Mann in der nächsten Gasse mit eingeschlagenem Schädel aufgefunden. – Und wenn wir schon davon reden«, schloß der vorsichtige Peter Owen, indem er sich wieder einmal geräuschvoll das Kalbfell kratzte, »möchte ich sagen, daß es auch gut wäre, wenn Sie etwas Sicheres zu sich steckten, Sir ...«
»Soll geschehen«, erwiderte Donald Ramsay etwas zerstreut, denn seine Gedanken waren bei der chinesischen Nelke, von der er in der letzten Stunde von drei Seiten so verschiedene Dinge vernommen hatte.
3
Inhaltsverzeichnis
Auch Maud Hogarth hatte die Ankündigung von der chinesischen Nelke gelesen, und kaum eine Stunde später war ein großer Strauß dieser ihrer Lieblingsblumen ohne jede Begleitzeile für sie abgegeben worden.
Wenn sie noch im Zweifel gewesen wäre, ob die Botschaft in der »Times« wirklich ihr gelte, so mußte ihr diese Aufmerksamkeit von unbekannter Seite darüber volle Gewißheit bringen. Aber Maud war sich über den Sinn und Zweck der Anzeige bereits von dem Augenblick an im klaren, da sie sie zu Gesicht bekommen hatte. Und sie nahm sie um so ernster, als man nicht einmal den Weg der Öffentlichkeit gescheut hatte, um der Aufforderung besonderen Nachdruck zu geben.
Nach kurzem Aufatmen sollte also für sie der unheimliche Kampf von neuem beginnen; ein Kampf um eine Sache, die für sie alles bedeutete, und gegen einen geheimnisvollen Gegner, der vor keinem Mittel zurückschreckte. Sie hatte das bereits einmal erfahren, und sooft sie daran dachte, schien es ihr geradezu ein Wunder, daß sie in der tückisch gestellten Schlinge nicht wirklich hängengeblieben war.
Immerhin aber hatte sie einen hohen Preis zahlen müssen. Die Gesellschaft, von der sie bisher umschwärmt und verwöhnt worden war, hatte sie plötzlich fallen lassen, und es war recht einsam um sie geworden. Maud empfand das zwar nicht allzu hart, aber das Verhalten ihrer Bekannten empörte ihren Stolz.
Diese Erbitterung spiegelte sich in ihrer ganzen Persönlichkeit wider. Sie trug die ohnehin mehr als mittelgroße Gestalt hoch aufgerichtet, der rassige Kopf mit dem leicht gewellten tiefbraunen Haar war zurückgeworfen, in dem dunklen Gesicht stand zwischen den seidig schimmernden Brauen eine scharfe Falte.
Alles das mochte es wohl bewirken, daß die ungewöhnliche Schönheit der kaum zwanzigjährigen Lady kalt und herb wirkte.
›Hoheitsvoll und streitbar‹ hatte sie ein Reporter in seinem Bericht über die Gerichtsverhandlung genannt. Es waren aber auch Stimmen laut geworden die von einer ›vollendeten Komödiantin in wohlberechneter Pose‹ gesprochen hatten, von einer ›geradezu zynischen Art, die bei einem jungen Mädchen von solcher Herkunft und Erziehung doppelt unfaßbar erscheinen muß‹.
Maud hatte allen Grund, sich dieser und anderer noch weit üblerer Dinge heute lebhafter denn je zu erinnern. Sie wußte nur zu gut, daß die an sie gerichtete neuerliche Aufforderung keinen bloßen Schreckschuß bedeutete, sie wußte aber auch, daß ihr die Möglichkeit einer Wahl genommen war. Mit dem, was man forderte, durfte und wollte sie ihre Ruhe nicht erkaufen. Wenn man glaubte, daß die vielfachen Foltern der letzten Monate sie furchtsam und mürbe gemacht hätten, sollte man sich getäuscht sehen. Vorläufig konnte sie nichts anderes tun, als die weiteren Dinge abwarten, um zu erfahren, woher die neue Gefahr drohte.
Trotz dieser beklemmenden Gedanken vermochte Maud äußerlich ihre Gelassenheit zu bewahren. Sie war sogar imstande, sich mit den unheilverkündenden Blumen völlig unbefangen zu beschäftigen und sie in einer Vase zu ordnen.
Mrs. Adelina Derham, die noch immer bei ihrem ersten Frühstück saß, verfolgte das Tun ihrer Nichte mit scheuen Augen. Sie kannte zwar die Bedeutung des Straußes nicht, aber Nelken, ob nun chinesische oder nichtchinesische, waren ihr seit der schrecklichen Geschichte furchtbar unheimlich. Hatte sie doch wegen dieser Blumen Aufregungen durchmachen müssen, die ihr angeborenes und überdies noch in volle hundertvierundneunzig Pfund gebettetes Phlegma arg ins Wanken gebracht hatten. Sie brauchte nun wirklich Ruhe, und Maud ließ sie nicht dazu kommen. Das Kind hatte ewig irgendwelche unmöglichen Einfälle. Wie eben jetzt wieder dieses Weihnachtsdinner.
Tante Ady war darüber so bekümmert, daß ihr nicht einmal das Frühstück so recht munden wollte. Sie löffelte das dritte Ei nur aus, weil es eben da war, aber dann seufzte sie sehr tief und hörbar. »Du solltest dir die Sache doch noch einmal überlegen, Maud«, begann sie zaghaft, und ihre müde Stimme klang geradezu flehend. »Es würde schrecklich werden. Wenn ich daran denke, daß ...«
Die kurze, eigenwillige Kopfbewegung des jungen Mädchens ließ sie mutlos abbrechen.
»Es wird nicht schrecklich werden, Tante Ady, und es bleibt dabei«, erklärte Maud sehr bestimmt. »Eine bessere Gelegenheit kann sich nicht ergeben. Wir werden so ziemlich alle unsere lieben Freunde und Bekannten von einst beisammen finden und nicht mehr auf zufällige Begegnungen angewiesen sein, um ihnen zu zeigen, wie wenig wir uns aus ihnen machen.«
»Entsetzlich ...«, hauchte Mrs. Derham.
»Warum entsetzlich?« brauste Maud auf. »Schämst du dich etwa meinetwegen? Oder fürchtest du dich vor den Leuten, die uns mit alberner Frechheit anstarren werden? Ich, die es ja vor allem angehen wird, fürchte mich nicht. Im Gegenteil, ich freue mich, denn was sie sehen werden, dürfte ihnen wenig behagen. Aber ich verlange, daß auch du Haltung bewahrst. Du bist trotz deiner zweiundvierzig Jahre noch immer eine Frau, die sehr gut wirkt, und du bist sogar das, was man eine majestätische Erscheinung nennt.«
Es war einiges in diesem energischen Zuspruch, was der wirklich sehr stattlichen Mrs. Derham ganz angenehm klang, aber der Gedanke an das unausbleibliche Spießrutenlaufen war für ihr wenig kriegerisches Gemüt gar zu fürchterlich. Sie machte daher noch einen letzten verzweifelten Versuch, das Schreckliche durch mehr praktische Bedenken abzuwenden.
»Die beiden Gedecke werden zwölf Guineen kosten, Maud«, rechnete sie dieser vor. »Für dieses viele Geld könnten wir doch ganz etwas anderes haben. Das Menü ist allerdings ausgezeichnet und reichlich«, gab sie etwas schwankend zu, »aber ich werde kaum die Hälfte von all diesen guten Dingen ...«
»So wird eben die andere Hälfte stehen bleiben«, schnitt ihr die hartnäckige Nichte auch diesmal wieder das Wort ab. »Im übrigen werde auch ich nicht die ganze Speisekarte herunteressen, aber doch so viel, daß die Leute sehen, wie wenig sie mir den Appetit verdorben haben.«
Damit setzte Maud die Vase mit den chinesischen Nelken so nachdrücklich in die Mitte des Tisches, daß die empfindsame Mrs. Derham ganz erschreckt zusammenfuhr und schleunigst aus der Nähe der ihr so widerwärtigen Blumen rückte. Sie dachte nicht daran, noch weiter zu widersprechen. Das unberechenbare Kind hatte offenbar wieder einmal einen seiner eigensinnigen Tage, und da war mit ihm nichts anzufangen.
4
Inhaltsverzeichnis
Das sollte auch Mr. William Gardner erfahren, der als einziger Besucher um die Mittagsstunde in dem vornehmen, hinter einer hohen Mauer und dichten Baumkronen versteckten Haus in Notting Hill vorsprach. Maud Hogarth war von seinem Kommen unangenehm überrascht, und ihre Begrüßung fiel äußerst kühl aus.
Dabei durfte der gepflegte und korrekte Mann eigentlich auf einen freundlicheren Empfang Anspruch erheben, denn er hatte ihr in dem Gerichtsverfahren als Anwalt zur Seite gestanden.
Mauds Wahl war auf ihn gefallen, weil er sich ihr als erster und mit besonderem Eifer angeboten hatte, als bekannt geworden war, daß sie aus irgendeinem Grund die Verteidigung durch den berühmten Sir Thomas Hamerton abgelehnt hatte. Dieser völlig unverständliche Schritt war damals zu Ungunsten der Angeklagten ausgelegt worden. Sir Thomas war mit Mauds verstorbenem Oheim und Vormund eng befreundet gewesen und galt als ein Mann von strengen Rechtsanschauungen, die er auch seinen Klienten gegenüber vertrat. Man schloß also, daß Miss Hogarth Dinge zu beichten haben mochte, die sie sich scheute, einer ihrer Familie nahestehenden Persönlichkeit von solcher Denkart anzuvertrauen.
Der kaum dreißigjährige Gardner war bis dahin ein unbekannter Anwalt gewesen, aber der Fall Hogarth hatte mit einem Schlag die Aufmerksamkeit der großen Öffentlichkeit auf ihn gelenkt, obwohl ihm in der Verhandlung eigentlich keine besondere Rolle zugefallen war. Die Angeklagte hatte ihre Verteidigung fast ganz allein geführt, und ihr Rechtsbeistand hatte sich damit begnügen müssen, die Schwächen der Anklage möglichst eindrucksvoll aufzuzeigen. Bei der Lage der Dinge war dies jedoch eine ziemlich schwierige Aufgabe gewesen, denn es gab einige wichtige Punkte, über die Maud Hogarth einfach jede Aussage verweigerte.
So schwieg sie vor allem hartnäckig auf die Frage, was die flüchtig hingeworfenen Zeilen zu bedeuten hätten, die in der Schreibunterlage des ermordeten Majors Foster gefunden worden waren:
Die Andeutung hat großen Eindruck gemacht. M. H. kommt heute abend zu mir, um sich selbst zu überzeugen. Sobald ...
Außer dieser unvollendeten Mitteilung ohne Anschrift wies das Briefblatt nur noch eine mit Farbstift vermerkte Zahl auf, und der junge ehrgeizige Inspektor Travers von Scotland Yard hatte auch diesen winzigen Anhaltspunkt aufgegriffen. Er vermutete, daß Foster das Schreiben vielleicht deshalb nicht beendet hätte, weil er eine telefonische Verständigung vorzog, und tatsächlich stellte sich heraus, daß die notierte Zahl mit der Telefonnummer des bekannten ›Klubs der Globetrotter‹ in Chelsea übereinstimmte. Irgendwelchen praktischen Erfolg zeitigte aber diese Entdeckung nicht. Major Foster war weder Mitglied des Klubs gewesen noch dort überhaupt bekannt, und bei der großen Zahl der täglichen Gespräche ließ sich auch nicht ermitteln, ob und wen er an dem betreffenden Tag vielleicht angerufen hatte.
Das Geheimnis dieser Sätze konnte während des ganzen Gerichtsverfahrens nicht gelüftet werden. Maud Hogarth gab lediglich zu, was sie nicht in Abrede stellen konnte: daß sie sich zu einem gewissen Zwecke in Fosters Wohnung begeben hätte und daß die Waffe, aus der der tödliche Schuß abgegeben worden war, ihr gehöre. Sie gab sogar weiter zu, daß es zwischen ihr und dem Major zu einer heftigen Auseinandersetzung, ja zu einem förmlichen Handgemenge gekommen sei, wobei ihr vom Mantel die drei chinesischen Nelken abgerissen wurden, die man in der verkrampften Hand des Toten gefunden hatte. Aber sie bestritt mit unerschütterlicher Hartnäckigkeit, den Schuß abgefeuert zu haben. Sie habe ihn auch nicht gehört, da sie nach der stürmischen Unterredung die vier Stockwerke des Hauses in großer Erregung und fluchtartiger Eile hinabgestürzt sei.
Diese Aussage mußte im wesentlichen als unglaubhaft angesehen werden, da sich sonst zu dem einen unlösbaren Rätsel des Falles noch ein zweites gesellt hätte. Kaum zwei Minuten, nachdem die verstörte junge Dame an dem verwunderten Pförtner, der im Tor stand, vorbeigeschlüpft war, hatte nämlich Oberst Wilkins die Portierloge angerufen und ersucht, Major Foster zu verständigen, daß er ihn verabredungsgemäß in etwa einer Viertelstunde abholen werde. Das Telefon in der Wohnung des Majors scheine nicht in Ordnung zu sein, hatte Wilkins hinzugefügt, da er keine Verbindung erlangen könne.
Da der Pförtner bestimmt wußte, daß Foster gegen sieben Uhr heimgekommen und seither nicht mehr ausgegangen war, hatte er zunächst versucht, die Mitteilung durch das Haustelefon weiterzugeben, war aber ebenfalls ohne Antwort geblieben. Das erschien dem Mann auffallend, und er fuhr daher mit dem Lift in das vierte Stockwerk, nachdem er vorher wegen der späten Stunde – es war bereits ein Viertel vor zehn – rasch noch das Haustor versperrt hatte. Vor der Tür des Majors angelangt, bemerkte er dann sofort, daß diese nicht ganz geschlossen war, da sich ein Zipfel des Korridorläufers zwischen die Flügel geklemmt hatte. Diese Entdeckung veranlaßte ihn, nun ohne weiteres in die Wohnung zu stürzen, wo er Foster mit einer Schußwunde im Hinterkopf leblos vorfand. Einige Schritte von der Leiche lag auf dem Teppich ein kleiner Browning, und neben dem Schreibtisch das Telefon, das aus der Kontaktdose gerissen war.
Der entsetzte Mann hielt sich nur etwa eine Minute auf, dann verständigte er von seiner Loge aus die Polizei. Diese erschien fast gleichzeitig mit Oberst Wilkins, der in seinem Wagen vorfuhr.
Aus diesen klaren und bestimmten Angaben des Portiers ging hervor, daß nach Maud Hogarth niemand mehr unbemerkt das Haus verlassen konnte. Einen anderen Ausgang als das vom Pförtner versperrte Haupttor gab es nicht, und eine Flucht über eine Feuerleiter oder über die Dächer kam, wie ein eingehender Lokaltermin erwiesen hatte, überhaupt nicht in Frage.
Damit brach eigentlich die Verteidigung Maud Hogarths völlig zusammen, und der gewissenhafte Richter unterließ es auch nicht, die Geschworenen in seinem Schlußwort auf alle Umstände aufmerksam zu machen: auf das verstockte Schweigen der Angeklagten über gewisse Punkte, wofür sie wohl sehr triftige Gründe haben müßte; und auf die Ergebnisse der Untersuchung, die einen Selbstmord Major Fosters unbedingt ausschlössen.
Noch mit demselben Atemzug aber sprach der erfahrene Richter plötzlich davon, daß selbst die belastendsten Indizien trügen können, da zuweilen der Zufall mit geradezu unheimlicher Tücke am Werke sei; und daß es Seelenkonflikte von so tragischer Art gebe, daß sie sich der Beurteilung nach gemeingültigen Ansichten und Begriffen entzögen.
Und dann hatte der würdevolle Richter unter atemloser Stille der hundertköpfigen Zuhörerschaft auch noch von dem ihm zustehenden Recht Gebrauch gemacht, seine persönliche Ansicht zu äußern.
»Ich stehe nicht an, zu erklären«, hatte er gesagt, »daß es mir trotz allem schwerfällt, an die Schuld der Angeklagten zu glauben. Es fällt mir schwer, weil die Menschenkenntnis, die ich mir an dieser Stelle in vielen Jahrzehnten erworben habe, gegen die Schuld spricht. Und es fällt mir schwer, an die Schuld zu glauben, weil es mir einfach unfaßbar erscheint, daß ein junges Mädchen von so sorgfältiger Erziehung und so makellosem Lebenswandel plötzlich einer solchen Tat fähig sein sollte; oder daß es, wenn es schon durch irgendwelche unseligen Umstände dazu getrieben wurde, nicht wenigstens den Mut fände, seine Schuld freimütig zu bekennen. Das widerspräche zu sehr dem Geist des ererbten Blutes, das sich, wie wir hier gehört haben, in schwerer Zeit durch Heldenhaftigkeit und andere außerordentliche Leistungen für das Gemeinwohl hervorgetan hat.«
Diese eindrucksvolle Andeutung des Richters bezog sich auf die Feststellung, daß Mauds Vater wie auch ihr Onkel Derham im Kriege gefallen waren, und sie bezog sich vor allem auch auf den erst kürzlich verstorbenen Bruder ihrer Mutter, Sir Herbert Bexter, der während des Krieges eine sehr bedeutende Rolle gespielt hatte. Wenn auch nicht Soldat, sondern Gelehrter, war seine Tätigkeit doch in ungezählten Fällen von entscheidendem Einfluß auf die Geschehnisse gewesen. Sir Herbert war nämlich ein Mann, dem zu seinem erstaunlichen Sprachentalent noch das Talent gegeben war, Geheimschriften mit derselben Leichtigkeit zu entziffern, mit der manche Leute Rätsel lösen. Die kürzeste Zeit genügte ihm, um auf das System zu kommen, und dann machte er sich in einem förmlichen Taumel mit unfehlbarer Sicherheit an die Arbeit. Das Büro, das man ihm im Hause der Admiralität eingeräumt hatte, war Tag und Nacht von einem Doppelposten bewacht, und niemand konnte ohne Angabe eines besonderen Losungswortes Zutritt erlangen. Für diese wertvollen Dienste war Sir Herbert mit den höchsten Auszeichnungen und Ehren bedacht worden, und auch nach dem Krieg war er für Downing Street eine wichtige und geschätzte Persönlichkeit geblieben.
Er war aber auch ein Mann von großer Herzensgüte gewesen, und seit dem vor einigen Jahren erfolgten Ableben ihrer Mutter hatte die nun völlig verwaiste Maud in ihm einen zärtlichen und fürsorglichen Vormund gefunden. Dafür liebte sie ihn geradezu abgöttisch, und sein jäher Tod hatte ihr eine schwere seelische Erschütterung gebracht.
Die Schlußworte des Richters waren während der martervollen Tage auch die einzige Gelegenheit gewesen, bei der Maud Hogarth für einige Augenblicke ihre bewundernswerte Fassung verloren hatte. Sie war plötzlich mit einem Wehlaut zusammengebrochen, und ein verzweifeltes Schluchzen hatte ihren ganzen Körper geschüttelt. Aber gerade, als die Geschworenen sich anschickten, sich zur Beratung zurückzuziehen, war sie ebenso plötzlich wieder aufgeschnellt, und ihre dunkle Stimme hatte die Jury zurückgehalten:
»Ich schwöre, daß ich es nicht getan habe – obwohl ...«
Man erwartete in höchster Spannung irgendwelche Sensation, aber sie blieb aus. Die Angeklagte warf wieder einmal den Kopf zurück und preßte die Lippen zusammen, wie sie es so oft getan hatte. Und manche fanden, daß sie durch dieses seltsame Verhalten die wohlwollende Äußerung des gütigen Richters bedenklich abgeschwächt habe.
Vielleicht war es wirklich so gewesen, denn der Spruch der Geschworenen brachte kein eindeutiges ›Nicht schuldig‹. Lediglich dem ›Mangel an Beweisen‹ hatte Maud Hogarth ihren Freispruch zu verdanken.
5
Inhaltsverzeichnis
Mr. Gardner allerdings gab Maud Hogarth mit großer Selbstgefälligkeit und zudringlicher Ausdauer immer wieder zu verstehen, daß vor allem seine Verteidigung sehr wesentlich zu diesem glücklichen Ausgang beigetragen habe. Das machte ihr den Mann, der in seiner strohblonden Sauberkeit wie ein frisch geschrubbtes Riesenbaby aussah, doppelt unangenehm. So unangenehm, daß sie ihn dies bei jeder Gelegenheit merken ließ. Aber die rosige Kinderhaut des Anwalts war dick. Er fand allwöchentlich irgendeinen Vorwand, um vorzusprechen, und in dieser Woche kam er nun sogar bereits zum zweiten Male.
Maud machte aus ihrem Mißvergnügen kein Hehl, obwohl der bekümmerte Ernst in Gardners rundem Gesicht diesmal auf etwas Besonderes deutete.
Zunächst aber starrte der Anwalt mit seinen etwas gestielten wasserblauen Augen fast erschrocken auf den Nelkenstrauß, dann schüttelte er sorgenvoll den peinlich gestriegelten Kopf, und das ungeduldige junge Mädchen traf ein vorwurfsvoller Blick.
»Ich bin wirklich sehr beunruhigt, Miss Hogarth«, begann er endlich. »Wenn Sie mir schon nicht Ihr Vertrauen schenken wollen, sollten Sie wenigstens vorsichtig sein. Es wäre gewiß nicht zu Ihrem Besten, wenn die alte Geschichte, aus der wir Sie so glücklich herausgebracht haben, plötzlich irgendwie wieder aufgerührt werden sollte ...«
Maud ahnte sofort, worauf er anspielte, aber ihr Mißtrauen gegen den Mann ließ sie auf der Hut sein. »Wovon sprechen Sie eigentlich?« fragte sie mit geradezu verletzender Schärfe.
»Davon!« Gardner holte mit übertriebener Umständlichkeit eine Zeitung hervor, faltete sie bedächtig auseinander und tippte dann mit dem fleischigen Zeigefinger auf eine Stelle. »Ich bin nämlich überzeugt, daß diese Anzeige von der chinesischen Nelke entweder Ihnen gilt oder aber von Ihnen ausgegangen ist. Und alle, die den Prozeß verfolgt haben, dürften das gleiche vermuten. Das Kennwort ist zu außergewöhnlich, um nicht in diesem Sinn gedeutet zu werden, denn vor Ihrem Prozeß hat man von dieser Blumenart hierzulande kaum etwas gewußt. Und die Fassung der Zeilen erinnert daran, daß verschiedene Dinge ungeklärt geblieben sind. Sie können sich denken, daß es da ein begieriges Rätselraten geben wird. Ich gestehe offen, daß ich mich auch damit beschäftigt habe weil ich es geradezu für meine Pflicht hielt, aber ich bin aus der Sache nicht klug geworden. Ich habe nur das Gefühl, daß Sie sich noch immer in irgendwelchen Schwierigkeiten befinden und eines ehrlichen Beraters bedürfen. Deshalb bin ich gekommen. Worum es sich auch handeln mag, Miss Hogarth, ich würde bestimmt alles, was Sie bedrückt, ein für alle Mal in aller Stille und zu Ihrem Besten aus der Welt schaffen. Von meiner Ergebenheit für Sie sollten Sie doch schon überzeugt sein.«
Der rosige und rundliche Mr. Gardner war immer eindringlicher und wärmer geworden und um seiner Ergebenheit noch beredteren Ausdruck zu geben, legte er nun auch noch Seine gepolsterte Rechte auf die schlanken Finger, die krampfhaft die Lehne des Sessels umklammert hielten.
Diese Berührung ließ Maud jäh auffahren.
»Sie meinen also, daß man auf die Vermutung kommen könne, ich selbst hätte die Anzeige aufgegeben?«
»Gewiß, auch das.« Der Anwalt nickte nachdrücklich und erging sich darüber mit großer Wichtigkeit. »Man kann annehmen, daß Sie auf irgend jemanden einen Druck ausüben wollen, um etwas zu erreichen, was Ihnen damals vielleicht nicht gelungen ist. Oder man kann auch vermuten, daß Sie ein Interesse daran haben, gewisse geheimnisvolle Umstände anzudeuten, um die seinerzeitigen Ereignisse in einem andern Lichte erscheinen zu lassen. Das eine wäre ein sehr gefährliches Spiel, Miss Hogarth, das andere aber völlig zwecklos. Das Urteil ist nun einmal gesprochen, und ...«
»Danke«, fiel Ihm Maud ins Wort, und es konnte kein Zweifel bestehen, daß sie die Unterredung damit für beendet hielt. Gardner war sichtlich betroffen, gab aber nicht alle Hoffnung auf.
»Überlegen Sie sich also meinen Vorschlag«, drängte er. »Ich stehe Ihnen jederzeit zur Verfügung. Aber rufen Sie mich nicht zu spät. Ein zweites Mal würde es wohl unmöglich sein ...«
Maud Hogarth hob ungeduldig die Hand. »Ein zweites Mal«, sagte sie mit unheimlicher Ruhe, »dürfte alles viel einfacher und klarer sein, Mr. Gardner. Denn das nächste Mal – wenn es dazu kommen sollte – werde ich wahrscheinlich wirklich das tun, wessen man mich das erste Mal beschuldigt hat ...«
Der Anwalt war über diese Antwort so bestürzt, daß seine ausdruckslosen Augen sekundenlang starr auf der hoch aufgerichteten Mädchengestalt hafteten. Das hatte bedenklich entschlossen geklungen, und Gardner überkam plötzlich das unbehagliche Gefühl, daß seine Aufgabe sich nicht nur sehr schwierig, sondern sogar höchst gefährlich gestalten konnte.
6
Inhaltsverzeichnis
So gegen Mitternacht fand Mr. Gardner Gelegenheit, sich darüber im ›Klub der Globetrotter‹ auszusprechen.
Der ›Klub der Globetrotter‹ dessen Mitgliedschaft mit besonderer Vorliebe auf den Besuchskarten vermerkt wurde, war in den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts von einem wahrhaftigen Herzog mit langmächtigen Titeln und märchenhaft viel Geld gegründet worden, und man mußte damals eine richtige Weltreise nachweisen, um Aufnahme zu finden. Heute stand an der Spitze des Klubs der geschmeidige Mr. Edward Page, ein Mann von sehr vielseitigen und bisweilen dunklen Geschäften, und unter den Mitgliedern gab es viele, die in ihrem Leben noch keine andere Luft als das dicke Londoner Gemisch geschnuppert hatten. Immerhin aber wies die Klubliste eine stattliche Reihe wirklich weitgereister Persönlichkeiten auf, und in den ausgedehnten Räumen wurden in buntem Durcheinander so ziemlich alle Sprachen der Welt gesprochen. Das gab dem Klub seine besondere Note und übte eine so starke Anziehungskraft aus, daß die Mitgliederzahl von Jahr zu Jahr anwuchs. Dadurch wurden natürlich bauliche Vergrößerungen notwendig, und man ging dabei den einfachen Weg, die anstoßenden Wohnhäuser nach und nach aufzukaufen, äußerlich ein bißchen herzurichten und im Innern miteinander in Verbindung zu bringen. So war mit der Zeit ein sehr stattlicher Block einbezogen worden, und nur ganz wenige Eingeweihte wußten genau zu sagen, wo in den beiden Parallelgassen in Chelsea, die am Themseufer mündeten, das Klubheim der Globetrotter begann, und wo es aufhörte. Aber die Mitglieder fühlten sich in diesem Labyrinth von Ein- und Ausgängen, von winkligen Korridoren und dunklen Höfen so wohl und geborgen wie nirgends sonst.
Auch Gardner kannte sich in dem wirr verästelten Bau nur ganz oberflächlich aus, obwohl er bereits seit mehreren Jahren hier verkehrte. Bloß zu den großen Gesellschaftsräumen fand er sich zurecht – und zu einer unscheinbaren Tür in einem Dachgeschosse, zu der man über eine dunkle halsbrecherische Holztreppe sich hinauftasten mußte. Diesen Weg war er zum ersten Mal geführt worden, als Maud Hogarth verhaftet worden war, und er hatte ihm Glück gebracht. Damals in ewigen Nöten, denen er durch nicht ganz einwandfreies Spiel und allerlei anderen bedenklichen Erwerb vergeblich zu entrinnen suchte, war er heute ein gemachter Mann. Damit hätte aber diese geheimnisvolle Beziehung auch ihr Ende finden sollen. Es war gar nicht nach dem Geschmack des Anwalts, daß er für den ihm zugeschanzten Erfolg nun gewisse Gegendienste zu leisten hatte. Die seinerzeitige Weisung, mit Maud Hogarth auch weiter in Verbindung zu bleiben, bedeutete ja an sich keine Zumutung, aber in der verflossenen Nacht hatte er telefonisch einen bestimmt lautenden Auftrag erhalten, der ihn seit dem mißglückten ersten Versuch am heutigen Morgen in steigende Unruhe versetzte. Gardner gab sich keiner Täuschung darüber hin, daß er blindlings in ein Abhängigkeitsverhältnis geraten war, das sehr ernste Gefahren barg. Man hatte ihn gleich bei der ersten Begegnung an einige Entgleisungen in seiner Vergangenheit erinnert, die genügten, um ihn für immer zu erledigen, und schon das wenige, was er bisher von dem geheimnisvollen Apparat kennengelernt hatte, sagte ihm, daß er an bedenkenlose Männer geraten war.
Die Tür lag in einem versteckten Winkel, zu dem auch nicht ein Laut des lebhaften Klubbetriebes drang. Diese Totenstille ließ den Anwalt noch beklommener werden, und er mußte einen Augenblick an der Wand Halt suchen, da er eine alberne Schwäche in den Knien verspürte.
Endlich trocknete er die feuchte Stirn, schöpfte noch einmal tief Atem und drückte dann entschlossen auf den federnden Endknopf der Klinke. Nach einigen Sekunden tat sich die Tür mit einem leisen Knacken gerade mannsbreit auf, und der etwas zur Fülle neigende Gardner hatte einige Mühe, sich an der dicken Polsterung vorbeizudrücken. Dann gab es wieder ein Knacken und ein metallisches Geräusch, das von dem Einschnappen einer schweren Verschlußstange herrührte.
Der hinter der Tür liegende Raum war offenbar ein Teil eines ehemaligen Korridors. Er war schmal und fensterlos und nur durch eine matte Glühbirne erleuchtet. An der einen Schmalseite befand sich ein Schrank, an der andern standen ein Tisch und ein Stuhl. Von dorther kam mit einem Turban auf dem Kopf und vorgeschlagenem Gesichtsschleier ein gedrungener Mann, öffnete wortlos den massiven Schrank und forderte den Anwalt durch eine kurze Geste auf einzutreten. Gardner leistete auf etwas widerspenstigen Beinen Folge und ließ sich, erschöpft wie nach einer ungeheuren Anstrengung, auf die kleine Sitzbank fallen. Im nächsten Augenblick setzte sich der Aufzug in Bewegung und glitt scheinbar endlos in die Tiefe, um dann ebenso endlos wieder aufzusteigen und schließlich nochmals hinunterzufahren ...
Die umständliche Reise endete schließlich in einem gewölbten Gang, wo der Begleiter zurückblieb, während der Anwalt sich durch eine halbgeöffnete schwere Tür in undurchdringliche Finsternis zwängte.
Aber plötzlich sprang aus dem Dunkel um ihn eine so stechende Helle, daß Gardner sekundenlang die Augen schließen mußte. Als er sie vorsichtig wieder öffnete, sah er sich abermals einem stummen, verhüllten Mann gegenüber, der auf ein Haar jenem glich, der ihn hierher geleitet hatte. Alles übrige war hier jedoch anders als im Dachgeschoß und übertraf sogar noch die Gediegenheit der Klubräume. Der spiegelnde Parkettboden des großen Zimmers war mit kostbaren Teppichen belegt, die Wände hatten bis zur halben Höhe eine Verkleidung aus lichtem gemasertem Holz, das wie gelber Marmor schimmerte, und der hohe Plafond trug kunstvolle Stuckarbeit. Das allzu grelle Licht kam von einem großen kristallenen Kronleuchter und einem dicken Kranz von Lampen, der rings um die Wandverkleidung lief. Vor dem Kamin gab es einen Tisch mit Zeitschriften, Zigarren, Zigaretten und Aschenbechern sowie einige Klubsessel.
Der schweigsame Diener wies auf die Tabakwaren, aber Gardner zögerte und blickte mit einer scheuen Frage nach der gegenüberliegenden glatten und leeren Wand. Der Verhüllte schüttelte den Kopf und wiederholte seine Einladung, und der Anwalt zündete sich nun mit unsicheren Fingern eine Zigarette an. Anscheinend mußte er diesmal warten, obwohl seine Nerven bereits am Ende ihrer Spannkraft waren ...
7
Inhaltsverzeichnis
Mr. Gardner mußte warten, weil das sonst auf die Minute eingeteilte Tagesprogramm des Herrn dieser Räume, den man einfach den ›Chef‹ nannte, heute durch einen kleinen Zwischenfall eine Verschiebung erfahren hatte.
Durch diesen Zwischenfall hatte sich zunächst sein Kommen um eine volle Viertelstunde verzögert, und nun war er genötigt, sich auch noch eine geraume Weile mit seiner linken Hand zu beschäftigen.
Diese auffallend kleine, wohlgeformte und gepflegte Hand war garstig zugerichtet. Am Ballen klaffte eine breite, tiefgehende Wunde, die stark blutete und auch äußerst schmerzhaft sein mußte. Aber in dem blassen Gesicht, zu dem weder das glatt zurückgekämmte tiefschwarze Haar noch der buschige dunkle Schnurrbart und die dichten Brauen passen wollten, spiegelte sich nicht die geringste Empfindlichkeit, während der schlanke Mann unter Zuhilfenahme seiner weißen Zähne mit großer Sorgfalt und Kunstfertigkeit einen Verband anlegte.
Als er damit endlich fertig war, warf er zunächst die blutigen Tücher in die Glut des kleinen Füllofens und machte sich daran, im Garderoberaum die Spuren seiner Tätigkeit zu tilgen.