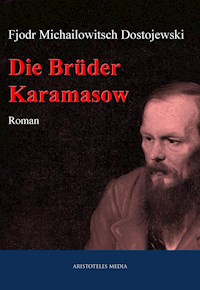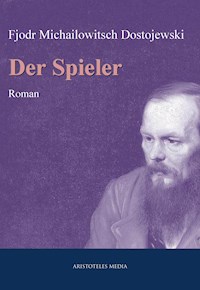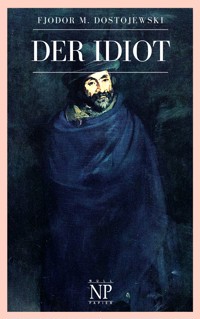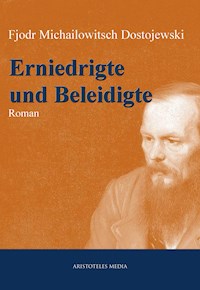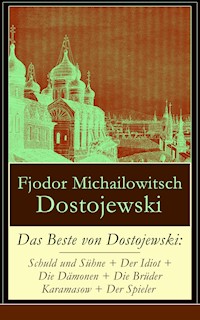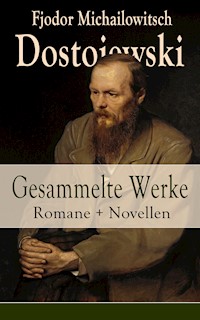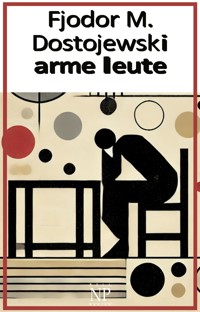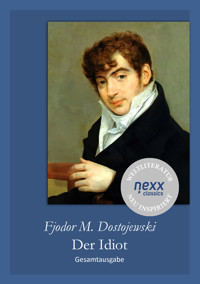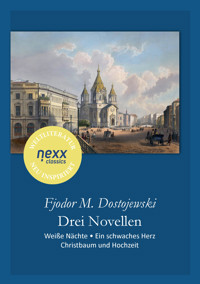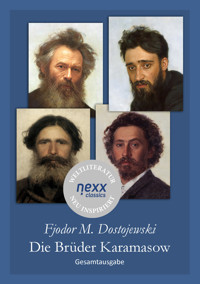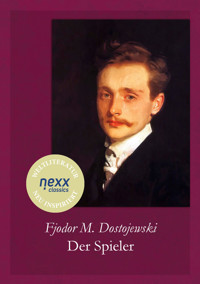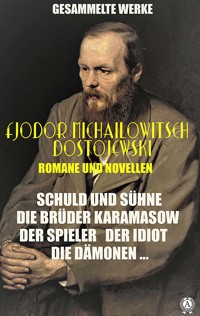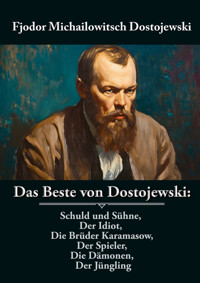Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Klassiker bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
mit Übersetzung aller französischen Passagen und Personenregister "Die Dämonen" ist eine soziale und politische Satire, ein psychologisches Drama und eine große Tragödie. Joyce Carol Oates hat ihn als "Dostojewskis verwirrendsten und gewalttätigsten Roman" und sein "befriedigendstes tragisches" Werk beschrieben. Eine fiktive Stadt versinkt im Chaos, während sie zum Brennpunkt einer versuchten Revolution wird, die vom Rädelsführer Werchowenski inszeniert wird. Ehrgeiz und Machtbesessenheit machen ihn und seine Clique zu Mördern und Terroristen. Sein moralisches Gegenstück, die geheimnisvolle Figur von Stawrogin, übt einen außerordentlichen Einfluss auf die Herzen und Köpfe fast aller anderen Figuren aus. Doch auch er kann die sich abzeichnende Katastrophe nicht abwenden. Die idealistische und westlich geprägte Generation der russischen 1840er Jahre wird ungewollt Komplize der "dämonischen" Kräfte, die die Stadt in Besitz nehmen. "Die Dämonen" wurde in die ZEIT-Bibliothek der 100 Bücher aufgenommen. Null Papier Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1419
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Fjodor Michailowitsch Dostojewski
Die Dämonen
Fjodor Michailowitsch Dostojewski
Die Dämonen
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected]Übersetzung: Hermann RöhlFußnoten: Jürgen Schulze EV: Insel-Verlag, Leipzig, 1920 2. Auflage, ISBN 978-3-962814-67-0
null-papier.de/angebote
Inhaltsverzeichnis
Personenverzeichnis
Erster Teil
Erstes Kapitel.
Zweites Kapitel. – Prinz Harry. Die Brautwerbung.
Drittes Kapitel. – Fremde Sünden.
Viertes Kapitel. – Die Lahme.
Fünftes Kapitel. – Die kluge Schlange.
Zweiter Teil
Erstes Kapitel. – Die Nacht.
Zweites Kapitel. – Die Nacht (Fortsetzung).
Drittes Kapitel. – Das Duell.
Viertes Kapitel. – Alle in Erwartung.
Fünftes Kapitel. – Vor dem Feste.
Sechstes Kapitel. – Peter Stepanowitsch in geschäftiger Tätigkeit.
Siebentes Kapitel. – Bei den Unsrigen.
Achtes Kapitel. – Iwan, der Zarensohn.
Anmerkung des Übersetzers
Neuntes Kapitel. – Stepan Trofimowitsch wird »konfisziert«.
Zehntes Kapitel. – Die Flibustier. Der verhängnisvolle Vormittag.
Dritter Teil
Erstes Kapitel. – Das Fest.
Zweites Kapitel. – Der Schluss des Festes.
Drittes Kapitel. – Der beendete Roman.
Viertes Kapitel. – Der letzte Beschluss.
Fünftes Kapitel. – Die Reisende.
Sechstes Kapitel. – Die mühevolle Nacht.
Siebentes Kapitel. – Stepan Trofimowitschs letzte Wanderung.
Achtes Kapitel. – Schluss.
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Klassiker bei Null Papier
Alice im Wunderland
Anna Karenina
Der Graf von Monte Christo
Die Schatzinsel
Ivanhoe
Oliver Twist oder Der Weg eines Fürsorgezöglings
Robinson Crusoe
Das Gotteslehen
Meisternovellen
Eine Weihnachtsgeschichte
und weitere …
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Personenverzeichnis
Warwara Petrowna Stawrogina – Witwe eines Generals
Nikolai Stawrogin – ihr Sohn
Stepan Trofimowitsch Werchowenski – Dichter und Hauslehrer
Peter Stepanowitsch Werchowenski – sein Sohn
Praskowja Iwanowna Drosdowa – Witwe eines Generals
Lisaweta Nikolajewna Tuschina – ihre Tochter aus erster Ehe
Mawriki Nikolajewitsch Drosdow – Offizier, Neffe des verstorbenen Generals Drosdow
Iwan Osipowitsch – der frühere Gouverneur
Andrei Antonowitsch v. Lembke – der neue Gouverneur
Julija Michailowna v. Lembke – seine Frau
Karmasinow – ein berühmter Schriftsteller
Artemi Petrowitsch Gaganow – Gardehauptmann a.D.
Lebjadkin – angeblicher Stabskapitän a.D.
Marja Timofejewna – seine Schwester
Iwan Schatow, Darja Pawlowna Schatowa (genannt Dascha) – Kinder eines verstorbenen Dieners der Stawrogins
Marja Ignatjewna Schatowa – Schatows Frau
Arina Prochorowna Wirginskaja – eine Hebamme
Alexei Nilowitsch Kirillow – ein Ingenieur
Schigalew – Verfasser einer Schrift über revolutionäre Theorien und Bruder von Frau Wirginskaja
Tolkatschenko, Fähnrich Erkel und andere – Anhänger revolutionärer Ideen
Liputin, Ljamschin, Wirginski – Beamte
Aloscha Teljatnikow – ein ehemaliger Beamter
Fedka – ein entlaufener Sträfling aus Sibirien
Wasili Iwanowitsch Flibustjerow – ein Polizeikommissar
Semjon Jakowlewitsch – Prophet
Tichon – ein im Kloster zurückgezogen lebender Bischof.
Alexei Jegorowitsch, Nastasja, Agafja – Dienstboten
Ortsnamen
Skworeschniki, Duchowo, Brykowo, die Fabrik der Brüder Schpigulin, Matwejewo
Hat der Teufel sich verschworen Gegen uns, führt uns im Kreis, Haben uns im Schnee verloren, Dass ich keinen Ausgang weiß. Hu! Das ist ein schaurig Klingen! Doch wer mag den Sinn verstehn? Ob sie Hochzeitsreigen schlingen, Ob ein Totenfest begehn?
A. Puschkin.1
Es weidete aber daselbst eine große Herde Säue auf dem Berge. Und sie baten ihn, dass er ihnen erlaubte, in diese zu fahren. Und er erlaubte es ihnen. Da fuhren die Teufel aus von dem Menschen und fuhren in die Säue; und die Herde stürzte sich von dem Abhange in den See und ersoff. Da aber die Hirten sahen, was da geschah, flohen sie und verkündigten’s in der Stadt und in den Dörfern. Da gingen die Einwohner hinaus, zu sehen, was da geschehen war, und kamen zu Jesu und fanden den Menschen, von welchem die Teufel ausgefahren waren, sitzend zu den Füßen Jesu, bekleidet und vernünftig; und sie erschraken. Und die es gesehen hatten, verkündigten’s ihnen, wie der Besessene gesund geworden war.
Ev. Lucä 8, 32-36.
Aus dem Gedichte: »Die bösen Geister«, nach der Übersetzung von Bodenstedt. Ein im Schneesturm verirrter Kutscher spricht zu seinem Herrn. Anmerkung des Übersetzers. <<<
Erster Teil
Erstes Kapitel.
Statt der Einleitung: einige Einzelheiten aus der Lebensgeschichte des hochgeachteten Stepan Trofimowitsch Werchowenski.
I.
Indem ich mich anschicke, die sehr merkwürdigen Ereignisse zu schildern, die sich kürzlich in unserer, bis dahin durch nichts ausgezeichneten Stadt zugetragen haben, sehe ich mich durch meine schriftstellerische Unerfahrenheit genötigt, etwas weiter auszuholen und mit einigen biografischen Angaben über den talentvollen, hochgeachteten Stepan Trofimowitsch Werchowenski zu beginnen. Diese Angaben sollen nur als Einleitung zu der in Aussicht genommenen Erzählung dienen; die Geschichte selbst, die ich zu schreiben beabsichtige, soll dann nachfolgen.
Ich will es geradeheraus sagen: Stepan Trofimowitsch hat unter uns beständig sozusagen eine bestimmte Charakterrolle, die Rolle eines politischen Charakters, gespielt und sie leidenschaftlich geliebt, dermaßen, dass er meines Erachtens ohne sie gar nicht leben konnte. Nicht, dass ich ihn mit einem wirklichen Schauspieler vergleichen möchte: Gott behüte; das kommt mir umso weniger in den Sinn, als ich selbst ihn sehr hoch achte. Es mochte bei ihm alles Sache der Gewohnheit sein oder, richtiger gesagt, Sache einer steten, schon aus dem Jugendalter herrührenden wohlanständigen Neigung, sich vergnüglichen Träumereien über seine schöne politische Haltung hinzugeben. Er gefiel sich zum Beispiel außerordentlich in seiner Lage als »Verfolgter« und sozusagen als »Verbannter«. Diese beiden Worte umgibt ein eigenartiger klassischer Glanz, der ihn seinerzeit verführt hatte, ihn dann allmählich im Laufe vieler Jahre in seiner eigenen Meinung gehoben und ihn schließlich auf ein sehr hohes und für seine Eigenliebe sehr angenehmes Piedestal gestellt hatte. In einem satirischen englischen Romane des vorigen Jahrhunderts kehrte ein gewisser Gulliver aus dem Lande der Liliputaner zurück, wo die Menschen nur vier Zoll groß waren, und hatte sich während seines Aufenthaltes unter ihnen so daran gewöhnt, sich für einen Riesen zu halten, dass er, auch wenn er in den Straßen Londons umherging, unwillkürlich den Fußgängern und Wagen zurief, sie sollten sich vorsehen und ihm ausweichen, damit sie nicht zertreten würden; denn er bildete sich ein, er sei immer noch ein Riese und sie Zwerge. Man lachte ihn deswegen aus und schimpfte auf ihn, und grobe Kutscher schlugen sogar mit der Peitsche nach dem Riesen; aber ob mit Recht? Was kann nicht die Gewohnheit bewirken? Die Gewohnheit brachte auch Stepan Trofimowitsch zu einem sehr ähnlichen Verhalten, das sich aber in einer noch unschuldigeren und harmloseren Weise zeigte, wenn man sich so ausdrücken kann; denn er war ein ganz prächtiger Mensch.
Ich glaube allerdings, dass er in der letzten Zeit von allen und überall vergessen war; aber man kann keineswegs sagen, dass er auch früher ganz unbekannt gewesen wäre. Es lässt sich nicht bestreiten, dass auch er eine Zeit lang zu einer angesehenen Gruppe hervorragender Männer der vorigen Generation gehörte, und dass eine Zeit lang (freilich nur während einer ganz, ganz kurzen Spanne Zeit) viele, die damals lebten, übereilterweise seinen Namen beinah in eine Reihe mit den Namen Tschaadajews, Bjelinskis, Granowskis und des damals soeben im Auslande aufgetretenen Herzen stellten. Aber Stepan Trofimowitschs Tätigkeit endete fast in demselben Augenblicke, in dem sie begonnen hatte, angeblich »infolge des Wirbelsturmes der zusammengekommenen Umstände«. Aber wie stand es damit? Es hat sich später herausgestellt, dass es damals keinen »Wirbelsturm«, ja nicht einmal irgendwelche »Umstände« gegeben hat, wenigstens nicht in diesem Falle. Ich habe erst jetzt, in diesen Tagen, zu meinem größten Erstaunen, aber mit völliger Sicherheit erfahren, dass Stepan Trofimowitsch bei uns, in unserm Gouvernement, ganz und gar nicht, wie man bei uns allgemein glaubte, als Verbannter gewohnt, sondern nicht einmal irgendwann unter Aufsicht gestanden hat. Wie groß muss also seine eigene Einbildungskraft gewesen sein! Er hat sein ganzes Leben lang aufrichtig geglaubt, dass man in gewissen höheren Kreisen beständig vor ihm auf der Hut sei, dass alle seine Schritte fortwährend kontrolliert und in Erfahrung gebracht würden, und dass jeder der drei Gouverneure, die einander bei uns in den letzten zwanzig Jahren abgelöst haben, schon bei seiner Ankunft im Gouvernement eine besonders feindselige Meinung über ihn mitgebracht habe, die ihm von oben her als eine Sache von besonderer Wichtigkeit bei Übergabe der Verwaltung des Gouvernements eingeflößt worden sei. Hätte jemand damals dem ehrenwerten Stepan Trofimowitsch den unwiderleglichen Beweis geliefert, dass er überhaupt nichts zu befürchten habe, so würde er sich sicherlich sehr gekränkt gefühlt haben. Und dabei war er ein sehr kluger, begabter Mensch, sogar sozusagen ein Mann der Wissenschaft; allerdings in der Wissenschaft … na, kurz gesagt, in der Wissenschaft leistete er nicht viel oder wohl überhaupt nichts. Aber das ist in unserm lieben Russland bei Männern der Wissenschaft etwas ganz Gewöhnliches.
Er kehrte aus dem Auslande zurück und glänzte ausgangs der vierziger Jahre als Lektor auf einem Universitätskatheder. Er hielt nur einige wenige Vorlesungen, wenn ich nicht irre, über die Araber; auch verteidigte er eine glänzende Dissertation über die im Entstehen begriffene politische und hanseatische Bedeutung der deutschen Stadt Hanau in der Zeit zwischen 1413 und 1428, sowie über die speziellen unklaren Ursachen, weswegen diese Bedeutung dann doch nicht zustande kam. Diese Dissertation versetzte in geschickter Weise den damaligen Slawophilen schmerzhafte Seitenhiebe und verschaffte ihm dadurch unter ihnen zahlreiche erbitterte Feinde. Ferner ließ er (übrigens fiel dies bereits in die Zeit nach dem Verluste des Lehrstuhls), gewissermaßen um sich zu rächen und um der gebildeten Welt zu zeigen, was für einen Mann sie an ihm verloren habe, in einer liberalen Monatsschrift, welche Übersetzungen aus Dickens brachte und die Anschauungen von George Sand vertrat, den Anfang einer sehr tiefsinnigen Untersuchung drucken, ich glaube über die Ursachen des hohen sittlichen Adels irgendwelcher Ritter in irgendwelcher Periode der Weltgeschichte oder ein ähnliches Thema. Jedenfalls behandelte er darin einen sehr hohen und außerordentlich edlen Gedanken. Es hieß später, die Fortsetzung dieser Untersuchung sei schleunigst verboten worden, und das liberale Journal habe sogar wegen des Druckes der ersten Hälfte Maßregelungen zu erdulden gehabt. Sehr möglich; denn was geschah damals nicht alles! Aber im vorliegenden Falle ist es doch wahrscheinlicher, dass nichts Derartiges geschah, und dass einfach der Verfasser selbst zu faul war, die Untersuchung zu beenden. Der Grund, weswegen er seine Vorlesungen über die Araber abbrach, war, dass irgendwie von irgendjemand (offenbar von einem seiner reaktionären Feinde) ein Brief abgefangen war, den er an irgendjemand geschrieben und in dem er irgendwelche »Umstände« dargelegt hatte; infolgedessen hatte dann irgendjemand von ihm irgendwelche Erklärungen verlangt. Ich weiß nicht, ob es wahr ist; aber es wurde auch noch behauptet, in Petersburg sei gleichzeitig ein gewaltiger staatsfeindlicher Klub entdeckt worden, der aus dreizehn Mitgliedern bestanden und beinahe das Staatsgebäude erschüttert habe. Man sagte, sie hätten sogar vorgehabt, die Schriften von Fourier1 zu übersetzen. Es war ein eigentümliches Zusammentreffen, dass gerade in dieser Zeit in Moskau auch ein Gedicht Stepan Trofimowitschs aufgegriffen wurde, das er schon vor sechs Jahren in Berlin als ganz junger Mensch verfasst hatte, und das in einer Abschrift zwischen zwei Literaturfreunden und einem Studenten von Hand zu Hand gegangen war. Dieses Gedicht liegt jetzt vor mir auf dem Tische; ich habe es erst im vorigen Jahre in einer eigenhändigen neuen Abschrift von Stepan Trofimowitsch selbst erhalten; es trägt seine Unterschrift und ist prächtig in roten Saffian gebunden. Übrigens ist es nicht ohne poetischen Wert und bekundet sogar einiges Talent; es ist ja freilich etwas seltsam; aber damals (das heißt genauer in den dreißiger Jahren) schrieb man häufig in diesem Genre. Wenn ich aber den Inhalt erzählen soll, so bringt mich das in Verlegenheit, da ich tatsächlich nichts von ihm verstehe. Es ist eine Art Allegorie in lyrisch-dramatischer Form und erinnert an den zweiten Teil des ›Faust‹. Zuerst erscheint auf der Bühne ein Frauenchor, dann ein Männerchor, dann ein Chor von irgendwelchen Naturkräften, und ganz zuletzt ein Chor von Seelen, die noch nicht leben, aber gern leben möchten. Alle diese Chöre singen etwas sehr Unbestimmtes, großenteils Verwünschungen jemandes, aber mit einer Beimischung erhabensten Humors. Aber auf einmal ändert sich die Szene, und es beginnt eine Art »Lebensfest«, bei dem sogar Insekten singen, eine Schildkröte mit lateinischen religiösen Formeln auftritt und sogar, wenn ich mich recht erinnere, ein Mineral, also ein ganz lebloser Gegenstand, etwas singt. Überhaupt singen alle ohne Unterbrechung, und wenn sie reden, so schimpfen sie einander in einer unbestimmten Weise, aber wieder mit einem Beiklang höchster Bedeutsamkeit. Zuletzt ändert sich die Szene wieder, und es zeigt sich eine wilde Gegend; zwischen den Felsen wandert ein zivilisierter junger Mensch umher, der irgendwelche Kräuter ausreißt und an ihnen saugt und auf die Frage einer Fee, warum er an diesen Kräutern sauge, antwortet, er fühle eine Überfülle von Leben in sich, suche Vergessenheit und finde sie in dem Safte dieser Kräuter; sein größter Wunsch aber sei, möglichst bald den Verstand zu verlieren (vielleicht ein unnötiger Wunsch). Dann kommt auf einmal ein unbeschreiblich schöner Jüngling auf einem schwarzen Rosse hereingesprengt, und ihm folgt eine unabsehbare Menge aller möglichen Völker. Der Jüngling stellt den Tod vor, und alle Völker dürsten nach ihm. Und endlich, in der allerletzten Szene, erscheint auf einmal der babylonische Turm, und eine Anzahl von Athleten baut ihn unter einem Gesange, der von neuer Hoffnung spricht, zu Ende, und als sie ihn bis zur obersten Spitze fertiggestellt haben, da läuft der Herrscher, allerdings nur der des Olymps, in komischer Weise davon, und die Menschheit, die das gemerkt hat, nimmt seinen Platz ein und beginnt sogleich ein neues Leben mit voller Erkenntnis der Dinge. Also dieses Gedicht fand man damals gefährlich. Ich habe im vorigen Jahre Stepan Trofimowitsch den Vorschlag gemacht, es drucken zu lassen, da es in unserer Zeit vollkommen harmlos sei; aber er lehnte diesen Vorschlag mit sichtlichem Missvergnügen ab. Meine Ansicht von der vollkommenen Harmlosigkeit seines Gedichtes gefiel ihm nicht, und ich führe darauf sogar eine gewisse Kälte seinerseits gegen mich zurück, welche volle zwei Monate dauerte. Aber was geschah? Auf einmal, und fast zu derselben Zeit, wo ich ihm den Vorschlag gemacht hatte, das Gedicht hier drucken zu lassen, wurde unser Gedicht anderwärts gedruckt, nämlich im Auslande, in einem revolutionären Sammelwerke, und zwar ganz ohne Stepan Trofimowitschs Wissen. Er war anfangs sehr erschrocken, stürzte zum Gouverneur hin und schrieb einen sehr edlen Rechtfertigungsbrief nach Petersburg, las ihn mir zweimal vor, sandte ihn aber nicht ab, da er nicht wusste, an wen er ihn adressieren sollte. Kurz, er war einen ganzen Monat lang in Aufregung; aber ich bin überzeugt, dass er sich in den geheimen Falten seines Herzens höchst geschmeichelt fühlte. Er nahm das ihm übersandte Exemplar des Sammelwerkes bei Nacht mit ins Bett, versteckte es bei Tage unter der Matratze und duldete nicht einmal, dass das Dienstmädchen das Bett zurechtmachte. Und obgleich er alle Tage von irgendwoher ein unheilvolles Telegramm erwartete, machte er doch eine hochmütige Miene. Ein Telegramm kam nicht. Da versöhnte er sich auch mit mir, was von der außerordentlichen Güte seines stillen, nicht nachtragenden Herzens Zeugnis ablegt.
François Marie Charles Fourier, 1772-1837, fantastischer Sozialist. <<<
II.
Ich will ja nicht behaupten, dass er von seiten der Regierung überhaupt gar nicht zu leiden hatte; aber ich bin doch jetzt völlig überzeugt, dass er seine Vorlesungen über die Araber hätte fortsetzen können, solange es ihm beliebte, wenn er nur die nötigen Zusicherungen abgegeben hätte. Aber er ließ sich nur durch sein Ehrgefühl leiten und hatte nichts Eiligeres zu tun, als sich ein für allemal die Überzeugung zurechtzumachen, seine Karriere sei für sein ganzes Leben durch den »Wirbelsturm der Umstände« vernichtet worden. Wenn man aber die ganze Wahrheit sagen soll, so war der wirkliche Grund zu der Veränderung seines Lebensweges ein ihm schon früher gemachter und jetzt erneuerter höchst zartfühlender Vorschlag Warwara Petrowna Stawroginas, der Gemahlin eines Generalleutnants und schwer reichen Mannes, nämlich der Vorschlag, als pädagogischer Oberaufseher und Freund die Erziehung und gesamte geistige Ausbildung ihres einzigen Sohnes zu übernehmen; von dem glänzenden Gehalte wollen wir gar nicht erst reden. Dieser Antrag war ihm zum ersten Male schon in Berlin gemacht worden, und zwar gerade zu der Zeit, als er zum ersten Male Witwer geworden war. Seine erste Frau war ein leichtsinniges Mädchen aus unserm Gouvernement gewesen, die er als noch sehr junger, urteilsloser Mensch geheiratet hatte, und es scheint, dass er mit ihr, übrigens einem reizenden Persönchen, viel Kummer durchzumachen hatte, aus Mangel an Mitteln zu ihrem Unterhalt und außerdem noch aus anderen, zum Teil etwas delikaten Gründen. Sie starb in Paris, nachdem sie die letzten drei Jahre von ihm getrennt gelebt hatte, und hinterließ ihm einen fünfjährigen Sohn, »die Frucht der ersten, frohen, noch ungetrübten Liebe«, ein Ausdruck, der sich dem schwergebeugten Stepan Trofimowitsch einmal in meiner Gegenwart entrang. Der Knabe wurde alsbald nach Russland geschickt, wo er die ganze Zeit über in der Obhut einiger entfernter Tanten an irgendeinem abgelegenen Orte heranwuchs. Stepan Trofimowitsch lehnte damals Warwara Petrownas Vorschlag ab und verheiratete sich schnell, sogar noch vor Ablauf eines Jahres, von neuem, und zwar mit einer Deutschen, einer Berlinerin, die sehr schweigsam und vor allen Dingen sehr anspruchslos war. Aber außer diesem Grunde hatte er noch einen anderen Grund gehabt, die Erzieherstelle abzulehnen: der hohe damalige Ruhm eines gewissen unvergesslichen Professors hatte für ihn etwas Verführerisches, und so flog denn auch er auf das Katheder, für das er sich vorbereitet hatte, um seine Adlerfittiche zu erproben. Jetzt nun, wo er sich seine Fittiche bereits versengt hatte, war es nur natürlich, dass er sich an den Vorschlag erinnerte, der ihn auch früher schon in seinem Entschlusse beinahe wankend gemacht hatte. Der plötzliche Tod auch seiner zweiten Frau, die mit ihm nicht einmal ein Jahr lang zusammengelebt hatte, führte die definitive Entscheidung herbei. Ich sage geradezu: ausschlaggebend war dabei die warme Teilnahme und die wertvolle und sozusagen klassische Freundschaft (wenn man von einer Freundschaft diesen Ausdruck gebrauchen kann), die ihm Warwara Petrowna erwies. Er warf sich in die Arme dieser Freundschaft, und so wurde ein fester Bund geschlossen, der mehr als zwanzig Jahre Bestand hatte. Ich gebrauche den Ausdruck »er warf sich in die Arme«; aber Gott behüte, niemand darf dabei an etwas Ungehöriges, Unpassendes denken; diese Arme sind nur in einem höchst moralischen Sinne aufzufassen. Das reinste, zarteste Band vereinte diese beiden so merkwürdigen Persönlichkeiten für alle Zeit.
Er nahm die Erzieherstelle auch deswegen an, weil das sehr kleine Gut, das ihm seine erste Frau hinterlassen hatte, ganz dicht bei Skworeschniki lag, dem prächtigen, nahe bei der Stadt gelegenen Stawroginschen Gute. Auch hatte er immer die Möglichkeit, in der Stille seines Arbeitszimmers, und ohne durch die massenhafte Universitätstätigkeit abgezogen zu werden, sich der Wissenschaft zu widmen und die vaterländische Literatur durch die tiefsinnigsten Untersuchungen zu bereichern. Diese Untersuchungen erschienen nun allerdings nicht; aber dafür konnte er sein ganzes übriges Leben lang, also mehr als zwanzig Jahre, sozusagen als lebendiger Vorwurf vor dem Vaterlande dastehen, nach dem Ausdrucke, den ein volkstümlicher Dichter von einem zur Untätigkeit verurteilten Vorkämpfer für die Ideale des Liberalismus gebraucht:
»Vor dem Vaterlande stand er Ein lebend’ger Vorwurf da.«
Aber die Persönlichkeit, von der sich der volkstümliche Dichter so ausgedrückt hat, hatte vielleicht auch ein Recht, das ganze Leben lang in dieser Absicht eine theatralische Stellung beizubehalten, wenn sie Lust dazu hatte, wiewohl die Sache recht langweilig ist. Unser Stepan Trofimowitsch dagegen war, die Wahrheit zu sagen, solchen Persönlichkeiten gegenüber nur ein Nachahmer und wurde auch vom Stehen müde und legte sich auf die faule Seite. Aber auch wenn er sich auf die faule Seite legte, so blieb er doch auch in dieser Haltung ein lebendiger Vorwurf (diese Gerechtigkeit muss man ihm widerfahren lassen), und zwar umso eher, als für unser Gouvernement auch eine solche Haltung genügte. Man musste ihn bei uns im Klub sehen, wenn er sich zum Kartenspiel hinsetzte. Seine ganze Miene besagte: »Karten! Ich setze mich mit euch zum Whist1 hin! Passt das etwa zu meiner Persönlichkeit? Aber wer trägt die Verantwortung dafür? Wer hat meiner geistigen Tätigkeit einen Riegel vorgeschoben und mich gezwungen, sie dem Whist zuzuwenden? Na, dann mag Russland zugrunde gehn!« Und er trumpfte würdevoll mit Coeur.
In Wirklichkeit spielte er leidenschaftlich gern Karten und hatte deswegen, namentlich in der letzten Zeit, häufige scharfe Scharmützel mit Warwara Petrowna, umso mehr, da er beständig verlor. Aber davon später. Ich bemerke nur noch, dass er ein sehr gewissenhafter Mensch war (das heißt manchmal) und deswegen häufig traurig wurde. Während der ganzen zwanzigjährigen Dauer der Freundschaft mit Warwara Petrowna verfiel er drei- oder viermal im Jahre in das, was man bei uns politischen Katzenjammer nennt, das heißt einfach in Hypochondrie; aber jener Ausdruck gefiel der hochachtbaren Warwara Petrowna besonders gut. In der Folge befiel ihn außer dem politischen Katzenjammer manchmal auch ein heftiger Drang zum Champagnertrinken; aber die wachsame Warwara Petrowna behütete ihn lebenslänglich vor allen unwürdigen Neigungen. Und er bedurfte auch einer solchen Kinderfrau, da er sich mitunter sehr sonderbar benahm: mitten im erhabensten Grame begann er bisweilen in der plebejischsten Weise zu lachen. Es kamen Augenblicke vor, wo er sich sogar über sich selbst humoristisch aussprach. Aber nichts mochte Warwara Petrowna so wenig leiden wie den Humor. Sie war eine klassische Mäcenatin und hatte bei allem, was sie tat, nur die höchsten Ideen im Auge. Der Einfluss, den diese hochgesinnte Dame im Laufe von zwanzig Jahren auf ihren armen Freund ausübte, war außerordentlich groß. Von ihr müsste man besonders sprechen, und das werde ich auch tun.
Kartenspiel mit 52 Karten <<<
III.
Es gibt sonderbare Freundschaften; beide Freunde möchten einander fast auffressen vor Ingrimm, verbringen ihr ganzes Leben in diesem Zustande und bekommen es doch nicht fertig, sich voneinander zu trennen. Eine Trennung ist sogar ganz unmöglich. Derjenige von beiden, der in eigensinniger Laune das Band der Freundschaft zerreißt, ist der erste, der infolgedessen krank wird und womöglich stirbt, wenn es sich so trifft. Ich weiß zuverlässig, dass Stepan Trofimowitsch mehrmals und bisweilen, nachdem er sich mit Warwara Petrowna unter vier Augen in der intimsten Weise ausgesprochen hatte, wenn sie weggegangen war, auf einmal vom Sofa aufsprang und mit den Fäusten gegen die Wand zu schlagen begann.
Und er tat das ganz und gar nicht im übertragenen Sinne, sondern so, dass er einmal sogar den Kalk von der Wand losschlug. Vielleicht fragt jemand, woher ich eine so spezielle Einzelheit habe in Erfahrung bringen können. Aber wie, wenn ich selbst Zeuge gewesen bin? Wie, wenn Stepan Trofimowitsch selbst mehr als einmal an meiner Schulter geschluchzt und mir sein ganzes geheimes Leid in grellen Farben hingemalt hat? (Und was für Dinge hat er mir dabei nicht mitgeteilt!) Und nun höre man, was sich fast immer begab, nachdem er in solcher Weise geschluchzt hatte: am anderen Tage hatte er schon die größte Lust, sich selbst wegen seines Undanks zu kreuzigen; er ließ mich eilig zu sich rufen oder kam auch selbst zu mir gelaufen, einzig und allein um mir mitzuteilen, dass Warwara Petrowna ein Engel von Ehrenhaftigkeit und Zartgefühl sei und er das reine Gegenteil davon. Und er kam nicht nur zu mir gelaufen, sondern schrieb auch mehr als einmal all dies ihr selbst in schön stilisierten Briefen und machte ihr zum Beispiel mit seiner vollen Unterschrift Geständnisse von folgender Art: er habe erst am vorhergehenden Tage einer fremden Persönlichkeit erzählt, dass sie ihn nur aus Eitelkeit um sich behalte und ihn um seine Gelehrsamkeit und um seine Talente beneide, dass sie ihn hasse und sich nur deshalb scheue, ihren Hass offen auszusprechen, weil sie fürchte, er könne von ihr weggehen und dadurch ihrem literarischen Rufe schaden; infolge dieser seiner Äußerungen verachte er sich selbst und habe beschlossen, sich das Leben zu nehmen; von ihr erwarte er das letzte, entscheidende Wort, und so weiter, und so weiter, alles in diesem Genre. Danach kann man sich eine Vorstellung davon machen, welchen Grad von Überreizung die nervösen Anfälle dieses unschuldigsten aller fünfzigjährigen Kinder manchmal erreichten! Ich selbst habe einmal einen solchen Brief gelesen, den er ihr nach einem Streite zwischen ihnen geschrieben hatte, welcher aus nichtiger Ursache entstanden, aber in seinem weiteren Verlaufe sehr bitter geworden war. Ich bekam einen Schreck und bat ihn inständig, den Brief nicht abzusenden.
»Es muss sein … es ist ehrenhafter … es ist meine Pflicht … es ist mein Tod, wenn ich ihr nicht alles bekenne, schlechthin alles!« antwortete er beinahe fiebernd und schickte den Brief ab.
Darin lag eben ein Unterschied zwischen ihnen, dass Warwara Petrowna ihm niemals solche Briefe sandte. Er allerdings hatte eine sinnlose Passion für das Briefschreiben und schrieb an seine Gönnerin sogar in der Zeit, als er mit ihr in demselben Hause wohnte, und in Fällen nervöser Überreizung selbst zweimal an einem Tage. Ich weiß bestimmt, dass sie diese Briefe immer mit der größten Aufmerksamkeit durchlas, sogar wenn sie zwei an demselben Tage erhielt, und dass sie sie nach dem Durchlesen, mit dem Eingangsdatum versehen und wohlgeordnet, in einem besonderen Fache aufhob; außerdem bewahrte sie sie in ihrem Herzen auf. Nachdem sie dann ihren Freund einen ganzen Tag lang ohne Antwort gelassen hatte, verkehrte sie mit ihm, als ob nichts geschehen wäre und als ob sich am vorhergehenden Tage nichts Besonderes zugetragen hätte. Mit der Zeit richtete sie ihn so ab, dass er selbst nicht mehr wagte, der Ereignisse des vorigen Tages Erwähnung zu tun, sondern ihr nur eine Weile in die Augen sah. Aber sie vergaß nichts, während er mitunter nur zu schnell vergaß und, durch ihr ruhiges Benehmen ermutigt, nicht selten gleich an demselben Tage, wenn Freunde zu Besuch gekommen waren, beim Champagner lachte und Tollheiten trieb. Mit welchem Ingrimm sah sie ihn in solchen Augenblicken an, ohne dass er etwas davon gemerkt hätte! Etwa nach einer Woche, nach einem Monat oder auch erst nach einem halben Jahre fiel ihm bei irgendeinem besonderen Anlass irgendein Ausdruck aus einem solchen Briefe wieder ein, und demnächst der ganze Brief mit allen Begleitumständen; dann stieg eine heiße Scham in ihm auf, und seine Pein war manchmal so groß, dass er an einem seiner Cholerineanfälle erkrankte. Diese ihm eigentümlichen cholerineartigen Anfälle bildeten den gewöhnlichen Ausgang einer Nervenerschütterung und waren eine in ihrer Art merkwürdige Kuriosität seiner Körperkonstitution.
Allerdings war es sicher, dass ihn Warwara Petrowna hasste, und zwar sehr oft hasste; aber während er dies bemerkte, nahm er etwas anderes an ihr bis zu seinem Lebensende nicht wahr, dass er nämlich schließlich für sie gleichsam ihr Sohn, Fleisch von ihrem Fleische, ihr Geschöpf, ja man kann sagen ihre Erfindung geworden war, und dass sie ihn keineswegs nur deswegen bei sich behielt und unterhielt, weil sie ihn, wie er sich ausdrückte, um seine Talente beneidete. Wie musste sie sich also durch solche Vermutungen gekränkt fühlen! Mitten unter dem unaufhörlichen Hass, der steten Eifersucht und der dauernden Geringschätzung lag in ihrem Herzen eine warme Liebe zu ihm verborgen. Sie behütete ihn vor jedem Lüftchen, sorgte zweiundzwanzig Jahre lang für ihn wie eine Kinderfrau und hätte ganze Nächte nicht geschlafen vor Sorge, wenn sein Ruhm als Dichter, als Gelehrter und als Politiker in Gefahr gewesen wäre. Sie hatte ihn sich ausgesonnen und war die erste, die an das Produkt ihres eigenen Geistes glaubte. Er war gewissermaßen ein Gebilde ihrer Fantasie. Aber dafür forderte sie von ihm auch wirklich viel, manchmal sogar einen sklavischen Gehorsam. Nachtragend war sie in ganz unglaublichem Grade. Bei dieser Gelegenheit möchte ich zwei Geschichtchen erzählen.
IV.
Eines Tages (es war zu der Zeit, als sich eben erst das Gerücht von der Befreiung der Bauern verbreitet hatte und ganz Russland plötzlich aufjubelte und sich zu einer völligen Wiedergeburt anschickte) erhielt Warwara Petrowna den Besuch eines durchreisenden Barons aus Petersburg, der sehr hohe Verbindungen besaß und diesem Vorgange sehr nahe stand. Warwara Petrowna legte auf solche Besuche außerordentlich viel Wert, weil ihre Verbindungen mit den höchsten Gesellschaftskreisen nach dem Tode ihres Mannes sich immer mehr gelockert und zuletzt ganz aufgehört hatten. Der Baron blieb eine Stunde bei ihr und trank Tee. Andere Gäste waren nicht anwesend; aber Stepan Trofimowitsch war eingeladen worden und wurde zur Schau gestellt. Der Baron hatte bereits früher über ihn einiges gehört oder tat wenigstens so, als ob er etwas über ihn gehört hätte, beachtete ihn aber beim Tee nur wenig. Selbstverständlich sollte Stepan Trofimowitsch nach dem Willen seiner Gönnerin nicht im Hintergrunde bleiben, und er besaß ja auch sehr feine Umgangsformen. Wiewohl er meines Wissens nur von geringer Herkunft war, hatte es sich doch so gemacht, dass er schon von frühester Kindheit an in einem Moskauer Hause gelebt und daher eine vorzügliche Erziehung erhalten hatte; Französisch sprach er wie ein Pariser. Auf diese Weise sollte der Baron gleich auf den ersten Blick erkennen, mit was für Leuten sich Warwara Petrowna auch in der Abgeschiedenheit der Provinz umgab. Indessen kam es anders. Als der Baron die völlige Glaubwürdigkeit der sich damals erst soeben verbreitenden Gerüchte über die große Reform positiv bestätigte, da konnte sich Stepan Trofimowitsch auf einmal nicht mehr halten und rief: »Hurra!« ja, er machte sogar mit dem Arm eine Gebärde, die sein Entzücken zum Ausdruck brachte. Er rief ja zwar nicht laut und sogar in einer eleganten Manier; sein Entzücken war sogar vielleicht ein vorherüberlegtes und die Gebärde eine halbe Stunde vor dem Tee absichtlich vor dem Spiegel einstudiert; aber die Sache musste doch wohl bei ihm nicht richtig herausgekommen sein, da der Baron sich erlaubte zu lächeln, obgleich er sofort mit außerordentlicher Höflichkeit eine Redewendung über die allgemeine, erklärliche Rührung aller russischen Herzen angesichts des großen Ereignisses einfließen ließ. Bald darauf brach er auf und vergaß beim Abschiede nicht, Stepan Trofimowitsch zwei Finger hinzustrecken. Als Warwara Petrowna in den Salon zurückkehrte, schwieg sie zunächst etwa drei Minuten lang und tat, als ob sie etwas auf dem Tische suche; plötzlich aber wandte sie sich zu Stepan Trofimowitsch und murmelte leise mit blassem Gesichte und funkelnden Augen:
»Das werde ich Ihnen nie vergessen!«
Am anderen Tage verkehrte sie mit ihrem Freunde, als ob nichts vorgefallen wäre; das Geschehene erwähnte sie niemals. Aber dreizehn Jahre später, in einem tragischen Augenblick, kam sie darauf zurück und machte ihm Vorwürfe, wobei sie ebenso blass wurde wie dreizehn Jahre vorher, als sie ihn zum ersten Male deswegen gescholten hatte. Nur zweimal in ihrem ganzen Leben sagte sie zu ihm: »Das werde ich Ihnen nie vergessen!« Der Fall mit dem Baron war bereits der zweite derartige Fall; der erste ist in seiner Weise so charakteristisch und hatte, wie ich meine, für Stepan Trofimowitschs Lebensschicksal eine solche Wichtigkeit, dass ich mich dazu entschließe, auch ihn zu erzählen.
Es war im Jahre 1855, im Frühling, im Mai, bald nachdem in Skworeschniki die Nachricht von dem Tode des Generalleutnants Stawrogin eingelaufen war, eines leichtlebigen alten Herrn, der auf der Reise nach der Krim, wohin er zur aktiven Armee kommandiert war, an einer Magenverstimmung gestorben war. Warwara Petrowna war Witwe geworden und hatte tiefe Trauer angelegt. Sehr betrübt konnte sie allerdings nicht sein; denn in den letzten vier Jahren hatte sie infolge des schlechten Zusammenpassens der beiderseitigen Charaktere von ihrem Manne völlig getrennt gelebt und ihm ein Jahrgeld gezahlt. (Der Generalleutnant selbst besaß nur hundertfünfzig Seelen und sein Gehalt, sowie außerdem sein Ansehen und seine Konnexionen; der ganze Reichtum aber, darunter auch das Gut Skworeschniki, gehörte Warwara Petrowna, der einzigen Tochter eines sehr reichen Branntweinpächters.) Nichtsdestoweniger war sie durch die unerwartete Nachricht tief erschüttert und zog sich ganz von der Geselligkeit zurück. Selbstverständlich befand sich Stepan Trofimowitsch beständig um sie.
Der Mai war in voller Blüte; die Abende waren wundervoll. Der Faulbaum duftete. Die beiden Freunde kamen jeden Abend im Garten zusammen, saßen bis zur Nacht in einer Laube und sprachen einer dem anderen seine Gefühle und Gedanken aus. Es waren poetische Stunden. Warwara Petrowna sprach unter dem Eindrucke der in ihrem Schicksal eingetretenen Veränderung mehr als gewöhnlich. Sie schmiegte sich gewissermaßen an das Herz ihres Freundes, und so dauerte das mehrere Abende. Da fuhr dem braven Stepan Trofimowitsch plötzlich ein sonderbarer Gedanke durch den Kopf: ob die untröstliche Witwe nicht vielleicht auf ihn spekuliere und am Ende des Trauerjahres einen Antrag von ihm erwarte. Es war ein frivoler Gedanke; aber gerade durch die hohe Vollkommenheit der seelischen Organisation wird mitunter die Neigung zu frivolen Gedanken befördert, schon allein infolge der Vielseitigkeit der Entwicklung. Er begann darüber nachzudenken und fand, dass es allerdings danach aussehe. Er dachte: »Es ist ein gewaltiges Vermögen; aber …« In der Tat, Warwara Petrowna konnte keinen Anspruch darauf erheben, eine Schönheit genannt zu werden: sie war eine hochgewachsene, gelbliche, knochige Frau mit unverhältnismäßig langem Gesichte, das einigermaßen an einen Pferdekopf erinnerte. Immer mehr und mehr geriet Stepan Trofimowitsch ins Schwanken; er quälte sich mit Zweifeln und weinte sogar ein paarmal aus Unschlüssigkeit (er weinte überhaupt ziemlich oft). Abends aber, das heißt in der Laube, begann sein Gesicht unwillkürlich einen launischen, spöttischen, koketten und gleichzeitig hochmütigen Ausdruck anzunehmen. So etwas pflegt unversehens und unwillkürlich zu geschehen, und je edler der betreffende Mensch ist, umso leichter ist ein solcher Ausdruck bemerkbar. Es ist schwer, darüber etwas zu behaupten, aber das wahrscheinlichste ist, dass in Warwara Petrownas Herzen sich nichts regte, wodurch Stepan Trofimowitschs Verdacht hätte gerechtfertigt werden können. Auch hätte sie ihren Namen Stawrogina wohl nicht mit dem seinigen vertauschen mögen, mochte dieser auch noch so berühmt sein. Vielleicht lag ihrerseits weiter nichts vor als ein Spiel mit diesem Gedanken; es dokumentiert sich darin eben ein unbewusstes weibliches Bedürfnis, das in manchen außerordentlichen Situationen des Weibes sehr natürlich ist. Übrigens kann ich dafür keine Bürgschaft übernehmen; die Tiefen des Frauenherzens sind bis auf den heutigen Tag noch unerforscht.
Man muss annehmen, dass sie im stillen den seltsamen Gesichtsausdruck ihres Freundes gar bald verstanden hatte; denn sie war achtsam und scharfsichtig, er dagegen bisweilen nur allzu harmlos. Aber die Abende nahmen ihren bisherigen Verlauf, und die Gespräche waren ebenso poetisch und interessant wie vorher. Eines Abends hatten sie sich bei Einbruch der Nacht nach einem höchst lebhaften, poetischen Gespräche in freundschaftlicherweise mit einem warmen Händedruck voneinander an der Tür des Nebengebäudes getrennt, in welchem Stepan Trofimowitsch wohnte. Jeden Sommer zog er aus dem riesigen Herrschaftsgebäude von Skworeschniki in dieses fast im Garten stehende Nebengebäude um. Kaum war er in sein Zimmer gekommen, hatte sich in unruhvollem Nachdenken eine Zigarre genommen, aber noch nicht Zeit gefunden, sie anzurauchen, hatte sich müde, wie er war, ans offene Fenster gestellt und betrachtete nun, regungslos dastehend, die leichten, weißen Federwölkchen, die an dem klaren Monde vorüberglitten, als plötzlich ein leichtes Geräusch ihn zusammenfahren ließ und ihn veranlasste, sich umzuwenden. Vor ihm stand wieder Warwara Petrowna, die er erst vor vier Minuten verlassen hatte. Ihr gelbes Gesicht war fast bläulich geworden; die fest zusammengepressten Lippen zuckten an den Mundwinkeln. Etwa zehn Sekunden lang sah sie ihm schweigend mit festem, unerbittlichem Blicke in die Augen und flüsterte auf einmal hastig:
»Das werde ich Ihnen nie vergessen!«
Als Stepan Trofimowitsch erst zehn Jahre später, nachdem er vorher die Tür verschlossen hatte, mir flüsternd diese traurige Geschichte erzählte, da schwur er mir, er sei damals so starr vor Schreck gewesen, dass er weder gehört noch gesehen habe, wie Warwara Petrowna wieder verschwunden sei. Da sie nachher nie ihm gegenüber eine Anspielung auf diesen Vorgang machte und alles seinen Gang nahm, als ob nichts geschehen wäre, so neigte er sein ganzes Leben lang zu der Annahme, dass dies alles eine Halluzination vor einer Krankheit gewesen sei, umso mehr weil er in derselben Nacht wirklich für volle zwei Wochen erkrankte, was sehr gelegen auch den Zusammenkünften in der Laube ein Ende machte.
Aber trotzdem er halb und halb an eine Halluzination glaubte, erwartete er doch sein ganzes Leben lang täglich gewissermaßen eine Fortsetzung dieses Ereignisses, eine Lösung dieses Rätsels. Er glaubt nicht, dass die Sache damit zu Ende sei! Unter diesen Um ständen konnte er nicht umhin, seine Freundin mitunter in sonderbarer Weise anzusehen.
V.
Sie hatte sogar selbst für ihn ein Kostüm entworfen, in dem er denn auch lebenslänglich ging. Dieses Kostüm war geschmackvoll und charakteristisch: ein langschößiger, schwarzer, fast bis oben zugeknöpfter, aber elegant sitzender Oberrock; ein weicher Hut (im Sommer ein Strohhut) mit breiter Krempe; ein weißes batistnes Halstuch mit einem großen Knoten und herabhängenden Enden; ein Spazierstock mit silbernem Knopf; dazu bis auf die Schultern reichendes Haar. Er war dunkelblond, und erst in der letzten Zeit begann sein Haar ein wenig zu ergrauen. Den Bart rasierte er weg. Es wurde gesagt, er sei in seiner Jugend sehr hübsch gewesen. Aber meiner Ansicht nach war er auch im Alter noch außerordentlich anziehend. Und kann man überhaupt schon von Alter reden, wenn jemand dreiundfünfzig Jahre alt ist? Aber aus einer Art von politischer Koketterie machte er sich nicht nur nicht jünger, sondern war gewissermaßen auf sein höheres, gesetztes Lebensalter stolz, und in seinem Kostüme, bei seinem hohen Wuchse, seiner Magerkeit und mit dem auf die Schultern reichenden Haare glich er einigermaßen einem Patriarchen oder, noch richtiger, dem lithografierten Bilde des Dichters Kukolnik, das einer in den dreißiger Jahren gedruckten Ausgabe seiner Gedichte beigegeben war. Die Ähnlichkeit trat besonders hervor, wenn Stepan Trofimowitsch im Sommer im Garten auf einer Bank unter einem blühenden Fliederstrauche saß, sich mit beiden Händen auf seinen Stock stützte, ein aufgeschlagenes Buch neben sich liegen hatte und sich in poetische Gedanken über den Sonnenuntergang versenkte. Was Bücher anlangt, so bemerke ich, dass er gegen das Ende seines Lebens immer mehr davon zurückkam, solche zu lesen. Übrigens war das erst ganz kurz vor seinem Ende der Fall. Zeitungen und Journale, deren Warwara Petrowna eine große Menge hielt, las er beständig. Für die Erfolge der russischen Literatur interessierte er sich gleichfalls dauernd, ohne dabei seiner eigenen Würde etwas zu vergeben. Eine Zeit lang fing er schon an, sich durch das Studium der höheren zeitgenössischen Politik auf dem Gebiete der inneren und äußeren Angelegenheiten fesseln zu lassen; aber bald gab er diese Beschäftigung geringschätzig wieder auf. Auch das kam nicht selten vor, dass er Tocqueville mit in den Garten nahm und einen Band Paul de Kock1 in der Tasche versteckt trug. Indessen das sind Lappalien.
Über das Bild Kukolniks bemerke ich in Parenthese folgendes. Dieses Bild war Warwara Petrowna zum ersten Mal in die Hände gekommen, als sie sich noch als junges Mädchen in einer vornehmen Moskauer Pension befand. Sie verliebte sich sofort in dieses Bild, wie es die Gewohnheit aller jungen Pensionärinnen ist, sich in alles zu verlieben, was ihnen vor Augen kommt, zugleich auch in ihre Lehrer, namentlich in die Schreib- und Zeichenlehrer. Merkwürdig war aber dabei nicht das Verhalten des jungen Mädchens, sondern vielmehr der Umstand, dass Warwara Petrowna noch, als sie schon fünfzig Jahre alt war, dieses Bild unter ihren liebsten Kostbarkeiten aufbewahrte und vielleicht nur deswegen für Stepan Trofimowitsch ein Kostüm entwarf, das mit dem auf dem Bilde dargestellten einige Ähnlichkeit hatte. Aber auch das ist natürlich unwichtig.
In den ersten Jahren oder, genauer gesagt, in der ersten Hälfte seines Aufenthaltes bei Warwara Petrowna hatte Stepan Trofimowitsch immer noch an dem Gedanken festgehalten, eine Abhandlung zu schreiben, und es sich täglich ernsthaft vorgenommen. Aber in der zweiten Hälfte begann er offenbar schon das zu vergessen, was er früher gewusst hatte. Immer häufiger sagte er zu uns: »Ich möchte meinen, dass ich zur Arbeit vorbereitet bin, das Material beisammen habe, und doch schaffe ich nichts! Es kommt nichts zustande!« und er ließ in trüber Stimmung den Kopf hängen. Ohne Zweifel musste dies ihm als einem Märtyrer der Wissenschaft in unseren Augen eine noch höhere Bedeutung verleihen; aber er selbst wollte noch auf etwas anderes hinaus. »Man hat mich vergessen; niemand bedarf meiner!« Diese Klage entrang sich nicht selten seiner Brust. Diese gesteigerte Hypochondrie bemächtigte sich seiner besonders ganz am Ende der fünfziger Jahre. Warwara Petrowna gelangte schließlich zu der Erkenntnis, dass die Sache ernst sei. Auch konnte sie den Gedanken nicht ertragen, dass ihr Freund vergessen sei und niemand seiner bedürfe. Um ihn zu zerstreuen und zugleich seinen Ruhm wieder aufzufrischen, nahm sie ihn damals mit nach Moskau, wo sie mit mehreren hervorragenden Literaten und Gelehrten bekannt war; aber auch Moskau brachte nicht die gewünschte Wirkung hervor.
Es war damals eine eigenartige Zeit; es kündigte sich etwas Neues an, das der bisherigen Stille sehr unähnlich war, etwas sehr Seltsames, das aber überall gespürt wurde, sogar in Skworeschniki. Allerlei Gerüchte drangen bis dorthin. Die Tatsachen waren im Allgemeinen mehr oder minder bekannt; aber es war klar, dass außer den Tatsachen auch gewisse sie begleitende Ideen aufgetaucht waren und, was die Hauptsache war, in außerordentlicher Menge. Aber gerade das richtete Verwirrung an: es war schlechterdings unmöglich, sich darin zu orientieren und sich ordentlich darüber klar zu werden, was diese Ideen nun eigentlich zu bedeuten hatten. Warwara Petrowna wollte ihrer weiblichen Natur zufolge darin absolut ein Geheimnis spüren. Sie machte sich selbst daran, Zeitungen und Journale, ausländische verbotene Bücher und sogar die damals aufkommenden Proklamationen zu lesen (all dies konnte sie sich verschaffen); aber davon wurde ihr nur der Kopf schwindlig. Sie machte sich daran, Briefe zu schreiben; aber man antwortete ihr wenig und aus je weiterer Ferne umso unverständlicher. Sie forderte Stepan Trofimowitsch feierlich auf, ihr alle diese Ideen ein für allemal zu erklären; aber sie war mit seinen Erklärungen entschieden nicht zufrieden. Stepan Trofimowitschs Urteil über die allgemeine Bewegung war im höchsten Grade hochmütig; bei ihm kam alles darauf hinaus, dass er selbst vergessen sei und niemand seiner bedürfe. Endlich erinnerte man sich auch seiner, zuerst in ausländischen Publikationen, als eines verbannten Dulders, und dann sofort auch in Petersburg als eines früheren Sternes in einem bekannten Sternbilde; man verglich ihn sogar aus irgendwelchem Grunde mit Radischtschew.2 Dann ließ jemand drucken, Stepan Trofimowitsch sei bereits gestorben, und stellte einen Nekrolog von ihm in Aussicht. In einem Nu war Stepan Trofimowitsch von den Toten auferstanden und nahm nun eine sehr würdevolle Haltung an. Der ganze Hochmut seines Urteils über die Zeitgenossen trat auf einmal zu Tage, und es entbrannte in ihm der schwärmerische Wunsch, sich der Bewegung anzuschließen und seine Kraft zu zeigen. Warwara Petrowna glaubte sofort von neuem an alles und wurde von einem großen Eifer ergriffen. Es wurde beschlossen, ohne den geringsten Verzug nach Petersburg zu reisen, alles an Ort und Stelle in Erfahrung zu bringen, persönlich in diese Kreise einzudringen und womöglich voll und ganz sich einer neuen Tätigkeit zu widmen. Unter anderm erklärte sie, sie sei bereit, ein eigenes Journal zu gründen und diesem von nun an ihr ganzes Leben zu weihen. Als Stepan Trofimowitsch sah, bis zu welchem Punkte die Sache gekommen war, wurde er noch hochmütiger und begann sich unterwegs gegen Warwara Petrowna sogar gönnerhaft zu benehmen, was sie sogleich in ihrem Herzen deponierte. Übrigens hatte sie auch noch einen anderen sehr wichtigen Grund zu dieser Reise, nämlich die Auffrischung ihrer Beziehungen zu hochgestellten Persönlichkeiten. Sie musste sich in der guten Gesellschaft möglichst wieder in Erinnerung bringen oder dies wenigstens versuchen. Der Hauptvorwand für die Reise war ein Wiedersehen mit ihrem einzigen Sohne, der damals ein Petersburger Lyzeum besuchte.
Franz. Schriftsteller und Maler, † 1871 <<<
Er gab im Jahre 1790 eine ›Reise von Petersburg nach Moskau‹ heraus, in der er die furchtbaren Leiden der Leibeigenen schilderte und auf die Schäden der Verwaltung und Rechtspflege hinwies. <<<
VI.
Sie fuhren hin und verlebten in Petersburg fast die ganze Wintersaison. Aber um die großen Fasten platzte alles entzwei wie eine regenbogenfarbene Seifenblase. Die Zukunftsträumereien verflogen, und der unsinnige Wirrwarr klärte sich nicht nur nicht auf, sondern wurde noch widerwärtiger. Zunächst: es gelang fast gar nicht, die Verbindungen mit hochgestellten Persönlichkeiten wieder anzuknüpfen, außer in ganz mikroskopischem Umfange und nur mittels demütigender Anstrengungen. Im Gefühl der erlittenen Kränkung stürzte sich Warwara Petrowna ganz in die »neuen Ideen« und richtete sich einen Abend ein. Sie wünschte sich Literaten als Gäste, und die wurden ihr denn auch sogleich in Menge zugeführt. Demnächst kamen sie auch von selbst, ohne Einladung; einer brachte den anderen mit. Sie hatte noch nie solche Literaten zu sehen bekommen. Sie waren unglaublich eitel, aber in ganz offener Weise, wie wenn sie damit eine Pflicht erfüllten. Manche (wiewohl bei weitem nicht alle) erschienen in Warwara Petrownas Salon sogar in betrunkenem Zustande, aber als ob sie sich damit einer besonderen, erst gestern entdeckten Schönheit bewusst wären. Alle waren sie auf irgend etwas so stolz, dass es ganz seltsam herauskam. Auf allen Gesichtern stand geschrieben, dass sie soeben erst ein außerordentlich wichtiges Geheimnis entdeckt hätten. Sie zankten sich untereinander und rechneten sich dieses Benehmen zur Ehre an. Es war ziemlich schwer, in Erfahrung zu bringen, was sie eigentlich schrieben; aber es gab da Kritiker, Romanschriftsteller, Dramatiker, Satiriker und Polemiker. Stepan Trofimowitsch drang sogar in ihren höchsten Kreis ein, von wo aus die Bewegung geleitet wurde. Bis zu diesen leitenden Persönlichkeiten war es unglaublich hoch; aber sie begegneten ihm freundlich, obwohl keiner von ihnen über ihn etwas wusste oder gehört hatte, außer dass er »eine Idee vertrete«. Er manövrierte so geschickt um sie herum, dass er auch sie trotz all ihrer olympischen Höhe ein paarmal dazu brachte, Warwara Petrownas Salon zu besuchen. Es waren sehr ernste, sehr höfliche Männer; sie betrugen sich gut; die übrigen hatten offenbar Furcht vor ihnen; aber es war augenscheinlich, dass sie keine Zeit hatten. Es erschienen dort auch zwei oder drei frühere literarische Zelebritäten, mit denen Warwara Petrowna schon seit längerer Zeit die besten Beziehungen unterhielt, und die sich damals zufällig in Petersburg aufhielten. Aber zu Warwara Petrownas Erstaunen waren diese wirklichen und unzweifelhaften Zelebritäten wie um den Finger zu wickeln, und manche von ihnen schmeichelten geradezu diesem ganzen neuen Gesindel und buhlten in schmählicherweise um seine Gunst. Anfangs hatte Stepan Trofimowitsch Glück; man bemühte sich um ihn und stellte ihn in öffentlichen literarischen Versammlungen zur Schau. Als er zum ersten Mal an einem öffentlichen literarischen Vortragsabende als einer der Vorlesenden die Rednerbühne betrat, erscholl ein rasendes Händeklatschen, das fünf Minuten lang nicht verstummte. Er erinnerte sich daran neun Jahre später mit Tränen in den Augen, übrigens mehr infolge seiner Künstlernatur als aus Dankbarkeit. »Ich schwöre Ihnen und wette darauf«, sagte er selbst zu mir (aber nur zu mir und im geheimen), »dass unter diesem ganzen Publikum niemand von mir auch nur das geringste wusste!« Ein beachtenswertes Bekenntnis: also besaß er doch einen scharfen Verstand, wenn er gleich damals auf der Rednerbühne seine Situation trotz seines Freudenrausches so klar zu erfassen vermochte, und andrerseits besaß er keinen scharfen Verstand, wenn er noch neun Jahre nachher daran nicht ohne ein Gefühl der Kränkung zurückdenken konnte. Man bat ihn, zwei oder drei Kollektivproteste zu unterschreiben (wogegen, das wusste er selbst nicht); er unterschrieb. Auch Warwara Petrowna wurde um ihre Unterschrift unter einem »Protest gegen das ungehörige Verhalten jemandes« ersucht; auch sie unterschrieb. Übrigens hielten die meisten dieser neuen Männer, wenn sie auch Warwara Petrowna besuchten, doch aus nicht recht verständlichem Grunde sich für verpflichtet, mit Geringschätzung und unverhohlenem Spotte auf sie herabzusehen. Stepan Trofimowitsch deutete mir später in Augenblicken der Bitterkeit an, dass sie ihn seitdem sogar beneidet habe. Sie sah allerdings ein, dass sie mit diesen Menschen nicht verkehren könne; aber trotzdem empfing sie sie bei sich mit großer Beflissenheit und echt weiblicher nervöser Ungeduld, da sie (und das war die Hauptsache) immer erwartete, dass bald etwas kommen werde. Bei den Abendgesellschaften redete sie wenig, obgleich sie sehr wohl imstande gewesen wäre zu reden; aber sie hörte meist zu. Man sprach über die Abschaffung der Zensur und der stummen Endbuchstaben, über den Übergang von der russischen Schrift zur lateinischen, über die tags zuvor erfolgte Verbannung irgendjemandes, über eine Skandalgeschichte, die in der Passage vorgekommen war, über die Zweckmäßigkeit einer Zerstückelung Russlands in einzelne Völkerschaften mit einem freien föderativen Bundesverhältnis, über die Abschaffung der Armee und der Flotte, über die Wiederherstellung Polens am Dnjepr, über die bäuerliche Reform und die Proklamationen, über die Abschaffung des Erbrechts, des Familienlebens, der privaten Kindererziehung und der Geistlichkeit, über die Frauenrechte, über Krajewskis Haus, das niemand Herrn Krajewski verzeihen konnte, usw. usw. Es war klar, dass sich in dieser Gesellschaft von neuen Männern viele Schurken befanden; aber unzweifelhaft waren darunter auch viele ehrenhafte, sogar sehr anziehende Persönlichkeiten, wenn sie auch einige verwunderliche Färbungen aufwiesen. Die ehrenhaften waren weit unverständlicher als die unehrenhaften und groben; aber es war nicht zu erkennen, wer den anderen in seiner Gewalt hatte. Als Warwara Petrowna von ihrer Absicht, ein Journal herauszugeben, Mitteilung machte, strömte ihr noch mehr Volk zu; aber sofort wurde ihr auch die ebenso dreiste wie überraschende Beschuldigung ins Gesicht geschleudert, sie sei eine Kapitalistin und beute die Arbeitenden aus. Der hochbejahrte General Iwan Iwanowitsch Drosdow, ein früherer Freund und Kamerad des verstorbenen Generals Stawrogin, ein (notabene in seiner Art) sehr achtungswerter Mann, den wir alle hier kannten, ein äußerst starrköpfiger, reizbarer Mensch, der gewaltig viel zu essen pflegte und den Atheismus gewaltig verabscheute, der geriet auf einer Abendgesellschaft bei Warwara Petrowna mit einem berühmten Jünglinge in Streit. Dieser sagte ihm gleich zu Anfang des Wortwechsels: »Wenn Sie so reden, sind Sie ein General«, womit er sagen wollte, dass er ein stärkeres Schimpfwort als »General« überhaupt nicht finden könne. Iwan Iwanowitsch brauste heftig auf: »Ja, mein Herr, ich bin General, und zwar Generalleutnant und habe meinem Kaiser gedient; aber Sie, mein Herr, sind ein grüner Junge und ein Gottesleugner!« Es folgte eine hässliche Skandalszene. Am anderen Tage wurde der Fall in der Presse erörtert, und man begann Unterschriften zu einem Kollektivprotest gegen Warwara Petrownas »ungehöriges Verhalten« zu sammeln, weil sie dem General nicht hatte sogleich die Tür weisen wollen. In einem illustrierten Journale erschien eine boshafte Karikatur, in welcher auf ein und demselben Bildchen Warwara Petrowna, der General und Stepan Trofimowitsch als drei reaktionäre Freunde dargestellt waren; dem Bildchen waren auch einige Verse beigefügt, die ein Volksdichter express für den vorliegenden Fall verfasst hatte. Ich bemerke noch von mir aus, dass tatsächlich viele Personen im Generalsrang die lächerliche Gewohnheit haben zu sagen: »Ich habe meinem Kaiser gedient«, gerade wie wenn sie nicht denselben Kaiser hätten wie wir einfachen Staatsbürger, sondern einen besonderen für sich.
Länger in Petersburg zu bleiben war natürlich nicht möglich, umso weniger da auch Stepan Trofimowitsch ein entschiedenes Fiasko machte. Er hatte sich nicht enthalten können, über die Rechte der Kunst zu sprechen, und da lachte man ihn noch mehr aus als schon vorher. Bei seiner letzten Vorlesung gedachte er durch politische Beredsamkeit zu wirken; er bildete sich ein, es werde ihm gelingen, die Herzen zu rühren, und rechnete darauf, dass man ihn wegen der »Verfolgungen«, denen er ausgesetzt gewesen sei, respektieren werde. Er gab die Wertlosigkeit und Lächerlichkeit des Wortes »Vaterland« widerspruchslos zu; auch mit der Anschauung, dass die Religion schädlich sei, erklärte er sich einverstanden; aber er sprach sich laut und mit Festigkeit dahin aus, dass Puschkin mehr wert sei als ein Paar Stiefel, sogar erheblich viel mehr. Er wurde erbarmungslos ausgepfiffen, sodass er gleich auf dem Fleck, ohne von der Rednerbühne hinabzusteigen, in aller Öffentlichkeit in Tränen ausbrach. Warwara Petrowna brachte ihn mehr tot als lebendig nach Hause. »On m’a traité comme un vieux bonnet de coton!«1 stammelte er halb bewusstlos. Sie pflegte ihn die ganze Nacht über, gab ihm Kirschlorbeertropfen und wiederholte ihm bis zum Tagesgrauen: »Sie sind auf der Welt noch nützlich; Sie werden noch zeigen, was Sie leisten können; Sie werden an einem anderen Orte gebührend gewürdigt werden.«
Gleich am anderen Tage erschienen bei Warwara Petrowna früh morgens fünf Literaten, von denen ihr drei ganz unbekannt waren; sie hatte sie nie gesehen. Sie erklärten ihr mit ernster Miene, sie hätten die Angelegenheit mit ihrem Journal erwogen und darüber Beschluss gefasst. Warwara Petrowna hatte absolut nie und niemandem den Auftrag gegeben, in betreff ihres Journals etwas zu erwägen und einen Beschluss zu fassen. Der Beschluss bestand darin, sie solle, sobald sie das Journal werde gegründet haben, ihnen dasselbe sofort mitsamt dem erforderlichen Kapitale übergeben, und zwar mit den Rechten einer freien Handelsgesellschaft; sie selbst solle nach Skworeschniki zurückreisen und nicht vergessen, Stepan Trofimowitsch mitzunehmen, »der schon recht alt geworden sei«. Aus Zartgefühl erklärten sie sich bereit, ihr das Eigentumsrecht zuzuerkennen und ihr jährlich ein Sechstel des Gewinnes zuzusenden. Das rührendste war dabei, dass von diesen fünf Leuten aller Wahrscheinlichkeit nach vier keinerlei eigennützige Absicht hatten, sondern sich nur im Namen der »gemeinsamen Sache« so viel Mühe machten.
»Wir waren, als wir abfuhren, wie betäubt«, erzählte Stepan Trofimowitsch; »ich konnte keinen klaren Gedanken fassen, und ich erinnere mich, dass ich beim Klappern der Waggonräder immer nur ein paar sinnlose Verse vor mich hinmurmelte, bis dicht vor Moskau. Erst in Moskau kam ich wieder ordentlich zur Besinnung, als ob ich dort tatsächlich in eine andere Atmosphäre gelangt wäre.« »O meine Freunde!« rief er manchmal in edler Erregung aus, »Sie können es sich gar nicht vorstellen, welche Betrübnis und welcher Ingrimm die ganze Seele erfüllen, wenn unverständige Menschen eine große Idee, die man schon lange heilig geachtet hat, aufgreifen und zu ebensolchen Dummköpfen, wie sie selbst es sind, auf die Straße schleppen und man sie dann auf einmal auf dem Trödelmarkte wiederfindet, kaum wiederzuerkennen, mit Schmutz besudelt, in abgeschmackter Art in einem Winkel zur Schau gestellt, wo es an aller Proportion und Harmonie fehlt, ein Spielzeug für dumme Kinder! Nein, da war es doch zu unserer Zeit anders, und wir haben andere Ziele verfolgt. Ja, ja, ganz andere Ziele! Ich erkenne die Welt gar nicht wieder … Aber unsere Zeit wird wiederkommen und wird alles, was jetzt schwankt und taumelt, auf den festen Weg führen. Was soll denn auch sonst aus der Welt werden? …«
Ich wurde wie ein alter Baumwollhut behandelt! <<<
VII.
Gleich nach der Rückkehr aus Petersburg schickte Warwara Petrowna ihren Freund »zu seiner Erholung« ins Ausland; auch war es erforderlich, dass sie sich für einige Zeit voneinander trennten, das fühlte sie. Stepan Trofimowitsch fuhr ganz entzückt ab: »Dort werde ich ein neues Leben beginnen!« rief er aus. »Dort werde ich mich endlich wieder der Wissenschaft widmen!« Aber gleich in den ersten Briefen aus Berlin stimmte er wieder die alte Leier an: »Mein Herz ist zerrissen«, schrieb er an Warwara Petrowna; »ich kann die Vergangenheit nicht vergessen! Hier in Berlin hat mich alles an meine alte Zeit erinnert, an meine ersten Wonnen und an meine ersten Qualen. Wo ist sie? Wo sind jetzt diese beiden weiblichen Wesen? Wo seid ihr, ihr meine beiden guten Engel, deren ich nie wert gewesen bin? Wo ist mein Sohn, mein geliebter Sohn? Wo ist endlich mein eigenes früheres Ich geblieben, ich, der ich ehemals stark wie Stahl und unerschütterlich wie ein Fels war, während jetzt so ein Andrejew, ein rechtgläubiger, bärtiger Hansnarr, peut briser mon existence en deux«,1 usw. usw. Was Stepan Trofimowitschs Sohn anlangt, so hatte er ihn nur zweimal in seinem ganzen Leben gesehen, das erstemal, als er geboren wurde, und das zweitemal kürzlich in Petersburg, wo der junge Mensch sich zum Eintritt in die Universität vorbereitete. Die ganze Zeit her war der Knabe, wie bereits gesagt ist, bei seinen Tanten im Gouvernement O…, siebenhundert Werst2 von Skworeschniki entfernt, (auf Warwara Petrownas Kosten) erzogen worden. Was nun jenen Andrejew anlangt, so war das ganz einfach unser hiesiger Kaufmann und Ladenbesitzer Andrejew, ein großer Sonderling, archäologischer Autodidakt, leidenschaftlicher Sammler russischer Altertümer, der sich manchmal vor Stepan Trofimowitsch mit seinen Kenntnissen und namentlich mit seiner patriotischen Gesinnung aufspielte. Dieser achtbare Kaufmann mit seinem grauen Barte und seiner großen silbernen Brille hatte von Stepan Trofimowitsch einige Desjätinen Wald auf dessen kleinem, bei Skworeschniki gelegenen Gute zum Abschlagen gekauft, war aber mit der Zahlung von vierhundert Rubeln im Rückstand geblieben. Obgleich Warwara Petrowna ihren Freund, als sie ihn nach Berlin schickte, reichlich mit Geldmitteln ausgestattet hatte, hatte Stepan Trofimowitsch doch auf diese vierhundert Rubel vor seiner Abreise noch besonders gerechnet, wahrscheinlich für seine geheimen Ausgaben, und hatte beinah geweint, als Andrejew bat, ihm einen Monat Frist zu geben; übrigens hatte dieser sogar ein Recht auf einen solchen Aufschub; denn er hatte die ersten Raten fast ein halbes Jahr vor den Terminen bezahlt, weil Stepan Trofimowitsch sich damals in besonderer Geldklemme befunden hatte. Warwara Petrowna las diesen ersten Brief mit lebhaftem Interesse durch, unterstrich mit Bleistift den Ausruf: »Wo sind jetzt diese beiden weiblichen Wesen?« vermerkte darauf das Eingangsdatum und schloss ihn in das Schubfach. Er hatte natürlich seine beiden verstorbenen Frauen gemeint. In dem zweiten Briefe, der aus Berlin eintraf, war die Tonart eine etwas andere: »Ich arbeite zwölf Stunden täglich«, (»na, wenn’s auch nur elf sind«, murmelte Warwara Petrowna), »stöbere in den Bibliotheken umher, kollationiere, kopiere, laufe herum; ich bin bei vielen Professoren gewesen. Ich habe die Bekanntschaft mit der prächtigen Familie Dundasow erneuert. Wie reizend ist Nadeschda Nikolajewna noch immer! Sie lässt Sie grüßen. Ihr junger Gatte und alle drei Neffen sind in Berlin. Abends unterhalte ich mich mit der Jugend bis zum Morgengrauen, und wir haben somit beinah attische Nächte, aber nur was Geist und Geschmack anlangt; es geht alles sehr gesittet zu; viel Musik, spanische Melodien, Fantasien von der Erneuerung des ganzen Menschengeschlechtes, die Idee der ewigen Schönheit, die sixtinische Madonna, Licht mit stellenweiser Dunkelheit; aber auch die Sonne hat ja ihre Flecken! O meine Freundin, meine edle, treue Freundin! Mit meinem Herzen bin ich bei Ihnen und der Ihrige; mit Ihnen allein möchte ich immer zusammen sein en tout pays,3 und wäre es selbst dans le pays de Makar et de ses veaux,4 von dem wir (Sie werden sich erinnern) so oft mit Zittern und Zagen in Petersburg vor meiner Abreise gesprochen haben. Ich erinnere mich daran mit einem Lächeln. Nachdem ich die Grenze überschritten hatte, fühlte ich mich sicher, ein seltsames, neues Gefühl, zum ersten Mal nach so langen Jahren …« usw. usw.
»Na, das ist lauter dummes Zeug!« sagte Warwara Petrowna, indem sie auch diesen Brief weglegte. »Wenn er bis zum Morgengrauen attische Nächte verlebt, dann kann er nicht zwölf Stunden täglich bei den Büchern sitzen. Ob er das in betrunkenem Zustande geschrieben hat? Wie kann diese Frau Dundasowa sich erdreisten, mich grüßen zu lassen? Übrigens, mag er meinetwegen ein bisschen bummeln …«
Der Ausdruck, »dans le pays de Makar et de ses veaux« bedeutete: »wohin Makar seine Kälber nicht getrieben hat«.5 Stepan Trofimowitsch übersetzte manchmal absichtlich in der dümmsten Art und Weise echt russische Sprichwörter und Redensarten ins Französische, obwohl er sie ohne Zweifel richtig verstand und sie hätte besser übersetzen können; aber er tat das aus einer eigenartigen Geschmacksrichtung heraus und fand es geistreich.
Aber sein Bummelleben dauerte nicht lange; er hielt es nicht vier Monate aus und eilte nach Skworeschniki zurück. Seine letzten Briefe bestanden nur aus Ergüssen der gefühlvollsten Liebe zu seiner abwesenden Freundin und waren buchstäblich von Tränen durchnässt, die er über die Trennung vergossen hatte. Es gibt Naturen, die sich außerordentlich an das Haus gewöhnen, wie Stubenhunde. Das Wiedersehen der Freunde war entzückend. Nach zwei Tagen ging alles wieder im alten Gleise und sogar langweiliger als vorher. »Mein Freund«, sagte Stepan Trofimowitsch nach vierzehn Tagen zu mir unter dem Siegel des tiefsten Geheimnisses, »mein Freund, ich habe etwas Neues entdeckt, was für mich ganz schrecklich ist: Je suis un6 einfacher Parasit et rien de plus! Mais r-r-rien de plus!«7
kann meine Existenz in zwei Teile brechen <<<
Russ. Wegmaß, etwa 1 km <<<
überall <<<
im Land von Makar und seinen Kälbern (siehe Anmerkung weiter unten <<<
Eine Wüstenei, z.B. Sibirien. <<<
Ich bin ein <<<
und sonst nichts! Aber mehr nicht! <<<