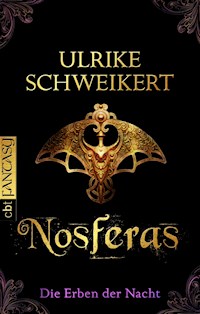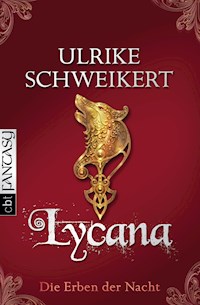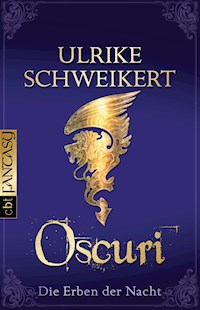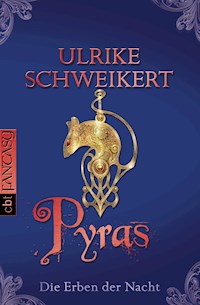Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: AUDIOBUCH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Elisabeth-Reihe
- Sprache: Deutsch
Ein sinnlicher historischer Roman um eine faszinierende Frau im deutschen Mittelalter Würzburg, 1430: Von ihren Verfolgern bewusstlos geschlagen und lebensgefährlich verletzt, wird die junge Elisabeth gerade noch rechtzeitig gefunden und in das nächst gelegene Haus gebracht. Am Leib genesen, aber ohne Gedächtnis, hat sie keine andere Wahl, als in ebendiesem Haus zu bleiben und zu arbeiten. Es ist das Dirnenhaus der Stadt. Mehr als ein Jahr wird sie dort verbringen, bis eines Tages der Landesherr, Bischof Johann von Brunn, die Dienste der schönen Dirne in Anspruch nehmen will. Elisabeth wird abgeholt und zum Bischofssitz gebracht, und dort kehren ihre Erinnerungen schlagartig zurück …
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kurzbeschreibung:
Ein sinnlicher historischer Roman um eine faszinierende Frau im deutschen Mittelalter
Würzburg, 1430: Von ihren Verfolgern bewusstlos geschlagen und lebensgefährlich verletzt, wird die junge Elisabeth gerade noch rechtzeitig gefunden und in das nächst gelegene Haus gebracht. Am Leib genesen, aber ohne Gedächtnis, hat sie keine andere Wahl, als in ebendiesem Haus zu bleiben und zu arbeiten. Es ist das Dirnenhaus der Stadt. Mehr als ein Jahr wird sie dort verbringen, bis eines Tages der Landesherr, Bischof Johann von Brunn, die Dienste der schönen Dirne in Anspruch nehmen will. Elisabeth wird abgeholt und zum Bischofssitz gebracht, und dort kehren ihre Erinnerungen schlagartig zurück …
Ulrike Schweikert
Die Dirne und der Bischof
Historischer Roman
Edel Elements
Edel Elements
Ein Verlag der Edel Germany GmbH
© 2019 Edel Germany GmbHNeumühlen 17, 22763 Hamburg
www.edel.com
Copyright © 2008 by Ulrike Schweikert
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Montasser Agentur
Covergestaltung: Anke Koopmann, Designomicon, München
Konvertierung: Datagrafix
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.
ISBN: 978-3-96215-305-2
www.facebook.com/EdelElements/
www.edelelements.de/
Für meine Freundin Sybille Schrödter und für meinen geliebten Mann Peter Speemann
Inhalt
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Epilog
Michtige Personen
Glossar
Dichtung and Wahrheit
Prolog
Nebel stieg vom Main her auf und hüllte den Fuß des Marienberges ein. Nur die Festung ragte noch aus dem Meer weiß wirbelnder Wogen und starrte aus dunklen Fenstern über das weite Land Bischof Johanns IL von Brunn. Der Fluss, den die steinerne Brücke in weiten Bögen überspannte, schien verschwunden, und auch von der Vorstadt am Fuß des Berges mit seinen drei Klöstern und den Kirchtürmen war nichts mehr zu sehen.
Die beiden Männer fluchten. Sie zerrten den schweren Sack die Uferböschung hinauf und trugen ihn zwischen den im Nebel verschwimmenden Holzstapeln hinüber zur Pforte in der Stadtmauer. Normalerweise hätte sie um diese Zeit verschlossen sein müssen, doch nach einem kräftigen Stoß mit der Schulter schwang sie mit einem Quietschen zurück.
»Was hast du vor?«, flüsterte der Kleinere der beiden und lud sich mit einer Grimasse den Sack wieder auf die Schultern. »Was suchen wir hier?«
»Einen sicheren Ort für unsere Fracht. Schon vergessen?«, grummelte der andere.
»Nein, wie sollte ich das vergessen?«, schimpfte der Erste und rückte den Sack zurecht. »Aber warum haben wir sie nicht einfach in den Main geworfen? Ist das nicht der rechte Platz für so etwas?«
Der Größere spuckte auf den Boden und ging voran durch die nächtliche Gasse der Vorstadt. Er bemühte sich, leise aufzutreten, und ließ den Blick aufmerksam umherhuschen, um zu erkunden, ob nicht ein Licht oder ein Geräusch das Nahen der Scharwächter anzeigte.
»Der rechte Platz vielleicht schon, aber nicht das, was er sich vorstellt. Er hat gesagt, sie soll verschwinden – für immer verschwinden. Und er hat ganz genaue Anweisungen gegeben, wie das zu passieren hat!«
Der Kleinere mühte sich, mit ihm Schritt zu halten und in der Dunkelheit nicht zu stolpern.
»Und jetzt willst du sie vergraben, oder was?«, fragte er spöttisch und sah erstaunt, dass der andere nickte.
»Ja, die Toten gehören unter die Erde.«
»Du willst sie auf dem Kirchhof verscharren?«, fragte sein Begleiter ungläubig und sah zu dem vor ihnen aufragenden Turm von St. Gertraud hinüber, aber der andere ging ohne ein Wort zu sagen weiter. Sie passierten den Kirchhof, ohne dass der Größere anhielt. Die Bebauung wurde spärlicher. Gärten wechselten sich mit Hütten und Häusern ab. Zu ihrer Rechten konnten sie den Graben mit der Kürnach und dahinter die aufragende Stadtmauer erahnen, die die Vorstadt Pleichach vom alten Stadtkern trennte. Da ging dem Kleineren ein Licht auf.
»Du willst sie zwischen den Juden verscharren! Hat er das befohlen?« Er pfiff leise durch die Zähne. »Er muss sie gehasst haben. Dagegen wäre ein Grab draußen zwischen den Weinbergen gnädig!«
Der andere nickte und ließ den Sack zu Boden gleiten. »Wir sollten sie vorher ausziehen. Sicher ist sicher.«
Er zog seinen Dolch vom Gürtel und schlitzte den Sack auf. Grob riss er an den Gewändern. Der Kleine half ihm.
»Du machst ja die Kleider kaputt«, schimpfte er. »So können wir sie nicht mal mehr verkaufen.«
»Verkaufen? Dummer Kerl! Willst du dein eigenes Grab schaufeln? Wir werden sie verbrennen!«
Bevor der andere etwas erwidern konnte, ließ ein Geräusch die beiden Männer herumfahren. Ein Lichtschein näherte sich von der Kirche her, und sie ahnten den Klang von Schritten.
Der Große fluchte lästerlich und sah sich gehetzt um. Dann packte er den nackten, weiblichen Körper und warf ihn über die Böschung, dass er bis in das trübe Wasser der Kürnach hinunterrollte. Ohne zu zögern raffte er Kleider und Sack zusammen und rannte geduckt über den alten Judenfriedhof davon. Der andere folgte ihm. Sie liefen bis ins Hauger Viertel hinüber und ließen sich dann schwer atmend in einem Garten ins dichte Gebüsch fallen. Eine Weile lauschten sie ängstlich, konnten aber nichts hören, was nicht zu den gewohnten Geräuschen der Nacht gehörte.
Nach einer Weile wagte der Kleinere die Stille zu durchbrechen. »Ich glaube, die Scharwächter haben uns nicht gesehen.«
»Hoffentlich nicht«, erwiderte der andere und fluchte noch einmal.
»Und was machen wir jetzt?«, fragte sein Begleiter unsicher, nachdem sie wieder eine ganze Weile geschwiegen hatten. Er kratzte sich. Ein Büschel Nesseln hatte ihm die nackten Waden verbrannt.
»Was wohl? Wir gehen zurück und sagen, dass wir den Auftrag wie befohlen ausgeführt haben. Dann nehmen wir unseren Beutel und sehen zu, dass wir lange Zeit dem Würzburger Land nicht mehr zu nahe kommen.«
»Wir begraben sie nicht auf dem Judenfriedhof?«, wagte der Kleinere nachzuhaken und rückte ein Stück von den Nesseln weg.
»Hast du nicht gesehen? Ich habe sie in die Kürnach gestoßen! Meinst du, ich taste nun im Schlamm nach einer Leiche, bis mich die Scharwächter herausziehen und mir ein schönes Quartier in einem der Türme anbieten? Nein! Der Körper wird dort im Schlamm verrotten. Und wenn nicht, dann finden sie ihn erst, wenn wir schon weit weg sind. Wir haben unseren Teil getan, und wir werden uns unseren Lohn dafür holen.«
»Du hast also nicht vor, von unserem... äh... Missgeschick zu berichten?«
Der Große schnaubte durch die Nase. »Hältst du mich für dämlich? Ich hänge am Leben und will es noch eine Weile genießen! Und das werde ich – und du auch, wenn wir uns nicht ganz dumm anstellen.«
»Möge Sankt Kilian geben, dass du recht behältst!«, seufzte der Kleine und bekreuzigte sich.
Der Große lachte rau. »Seit wann ist Sankt Kilian der Schutzherr der Taugenichtse und Mörder?«
»Ich bin kein Mörder!«, widersprach der Kleine, »und du auch nicht.«
»Nein«, stimmte ihm sein Begleiter zu, während sie auf die unbewachte Pforte zugingen, die sie aus der Stadt brachte. »Manches Mal kann man das den feinen Wamsträgern überlassen.«
Der Kleinere wandte sich noch einmal um und sah in die Richtung, in der irgendwo der Bach an den alten Judengräbern vorbeifloss. Er bekreuzigte sich. »Die Kürnach hat sie verschlungen. Möge der Herr ihrer Seele gnädig sein«, flüsterte er.
Er irrte sich in zwei Dingen. Erstens hatte die Kürnach den Körper nicht verschlungen. Er war an einem der zahlreichen Querdämme hängen geblieben, die das Wasser des Baches aufstauten, sodass der gesamte Graben um die Stadt bis zum Main hinunter stets mit Wasser gefüllt war. So ragte der weiße Frauenleib nun halb aus dem Wasser. Nur die Beine und einer der Arme waren von der schlammigen Flut bedeckt. Und zweitens war die Frau nicht tot. Noch war ihre Seele nicht von ihr gewichen. Auch wenn sie schon stundenlang durch die Tiefen der Finsternis taumelte.
Und in noch einem Punkt hatten sich die beiden Männer mit ihrer verbotenen Last geirrt: Es war nicht die Scharwache gewesen, die sie aufgescheucht und bei ihrem Auftrag gestört hatte.
Kapitel 1
Wilhelm, was ist denn nun schon wieder?«, rief der Mann mit schwerer Zunge, schob sich den Hut in den Nacken, der schon wieder in seine Stirn gerutscht war, und blieb schwankend auf unsicheren Beinen stehen.
»Ich muss pissen«, rief der Kumpan zurück, der auf die Böschung der Kürnach zustakste. Er war offensichtlich genauso betrunken wie der andere, der nun den Kienspan etwas höher hielt.
»Muss das hier sein? Das kannst du auch hinter der Eselsstube machen. Ich will endlich etwas trinken, und ich will ein Weib!«
Wilhelm kicherte. »Erstens hast du schon genug getrunken – ich übrigens auch«, er rülpste vernehmlich, »zweitens kriegst du eh keinen mehr hoch, und drittens muss ich jetzt pissen, sonst passt nichts mehr in mich rein!« Er nestelte an seinen Hosen.
»Robert, komm her, und leuchte mir!«, befahl er.
Der Gerufene schwankte heran. »Zu Befehl, mein Hauptmann«, lallte er und lachte.
Wilhelm ließ sein Wams sinken und vergaß den Druck auf seiner Blase. Seine Stimme hörte sich fast nüchtern an. »Leuchte mal dort drüben. Was ist das?« Gehorsam ging Robert ein paar Schritte in die ihm gewiesene Richtung. Der Feuerschein der Fackel wanderte über den Boden und erhellte kniehohes Unkraut, kleine Büsche und so manchen Unrat. Als der Feuerschein ihn nicht mehr blendete, hieß Wilhelm seinen Freund stehen bleiben. Er betrachtete das niedergedrückte Gras, das sich bereits wieder aufzurichten begann. Sein Blick wanderte über das Unkraut die Böschung hinunter, wo etwas Großes, Helles aus dem Wasser ragte. Er ließ es nicht aus den Augen, während er langsam näher trat. Nach und nach erfasste er einen Bauch, zwei feste Brüste und einen Arm, der sich um den Kopf gelegt hatte, der von langem, honigblondem Haar verhüllt wurde.
»Ein Weib«, stotterte Robert und starrte auf den Körper hinunter. »Ein junges Weib.«
Wilhelm trat noch ein Stück näher. »Ja, und wie es scheint, ein junges, totes Weib.«
Robert wich zurück. »Mir sind sie lebendig lieber. Komm, lass uns gehen. Im Eselshaus ist es warm und lustig, und wir bekommen was zu trinken.«
Doch Wilhelm hörte nicht auf ihn, sondern stieg die Böschung hinunter, bis seine Schuhspitzen vom schlammigen Wasser umspült wurden. Er ging in die Hocke und schob mit dem Zeigefinger die blonden Locken zur Seite.
»Ein hübsches, junges, totes Weib«, sagte er.
»Das nützt jetzt auch nichts mehr«, erwiderte sein Freund und schwenkte die Fackel. »Also, komm jetzt!«
Wilhelm ignorierte das Drängen. »Seltsam«, murmelte er, »warum liegt sie hier?«
Rudolf seufzte und kam nun auch die Böschung herunter. »Vermutlich, weil sie hier gestorben ist«, sagte er. »Warum auch sonst? Und nun lass sie. Vielleicht war es das Fieber oder die Pest! Also rühr sie um Gottes willen nicht an.«
»Und wo sind ihre Kleider?«, wollte Wilhelm wissen.
Robert hob die Schultern und ließ sie dann wieder fallen. »Woher soll ich das wissen?« Er sah sich suchend um. »Hier sind sie jedenfalls nicht. Vielleicht hat sie sich vorher ausgezogen, oder jemand anderes hat es getan und die Kleider mitgenommen.«
»Genau!«, rief sein Freund. »Jedenfalls wird sie sich kaum selbst ausgezogen und zum Sterben hierher gelegt haben!«
Roberts Gesicht zeigte Unbehagen. »Aber dann ist das vielleicht eine Sache für den Schultheiß und den Rat. Ganz sicher geht es uns nichts an.« Er begann die Böschung wieder zu erklimmen. »Und nun komm! Mein schöner Rausch ist schon fast verflogen, weil du so rücksichtslos bist, mich mit toten Leichen zu belästigen. Dafür bist du mir einmal huren und einen Humpen Wein schuldig.« Er drehte sich um und grinste seinen Freund entwaffnend an. »Ich habe eh keine einzige Münze mehr, mit der ich bezahlen könnte – und du bist schließlich mein Freund und kannst nicht zulassen, dass ich darben muss, während du dich deinen Freuden hingibst.«
»Du bist ein Schuft, Robert, ein ganz hinterhältiger Schuft!«, schimpfte Wilhelm, erhob sich und betrachtete seine nun schlammigen Schuhspitzen mit einem Seufzer. Sein Freund lachte gackernd.
»Du wirst es mir nicht abschlagen. Das kannst du gar nicht!«, bettelte er sehnsuchtsvoll.
»Vermutlich sollte ich das aber«, begann Wilhelm und brach dann mitten im Satz ab. Er stützte die Handflächen auf die Oberschenkel und beugte sich nach vorn.
»Was ist?«
»Komm näher, ich brauche Licht!«
Robert schüttelte übertrieben heftig den Kopf. »Nein, nein, nein«, quengelte er. »Ich mag keine Leichen.«
»Nein, da ist etwas, dort im Wasser. Es glitzert wie Gold!«
Schon stand Robert an seiner Seite.
»Wo? Ich kann nichts erkennen.« Er beugte sich herab und ließ den Schein der Fackel übers Wasser gleiten.
Wilhelm ließ es zu, dass der Schlamm sich noch einmal schmatzend an seine Sohlen saugte. »Da drüben, ein wenig weiter nach links!«
»Ja, nun sehe ich es!«, jauchzte Robert. Ohne auf Beinlinge und Schuhe Rücksicht zu nehmen, watete er zwei Schritte ins Wasser, bückte sich und angelte eine goldene Kette an die Oberfläche, an deren Ende ein flaches, ovales Medaillon hing. Ein tropfenförmiger Rubin, der von einem Ring kleiner Perlen umgeben war, glitzerte im Flammenschein. Robert pfiff durch die Zähne.
»Dann ist heute ja doch mein Glückstag!« Feierlich reckte er sich und zog das Wams über seiner Brust glatt.
»Mein Freund, ich spendiere dir heute so viele Huren, wie du schaffen kannst.«
Wilhelm feixte. »Ich denke, die alte Frauenhauswirtin hat nur sechs Mädchen im Angebot.«
Robert schnaubte. »Ach, und du meinst, du könntest die alle bedienen? Noch heute Nacht? In deinem Zustand?«
Der Freund sah ihn empört an. »Was soll das heißen, in meinem Zustand? Ich bin wieder völlig nüchtern und im Besitz all meiner Kräfte.«
Robert lachte hell auf und hakte sich bei ihm unter. »Dann will ich aber was sehen!«
Sie hatten den bleichen Körper dort am Ufer bereits vergessen, noch ehe sie sich zwei Schritte von ihm entfernt hatten, als ein leises Seufzen und eine Bewegung, die er im Augenwinkel erhaschte, Wilhelm innehalten ließen.
»Hast du eben den Seufzer getan?«
Robert schüttelte den Kopf. »Nein, warum sollte ich? Obwohl, warum nicht? Aus Vorfreude auf die Brüste, die ich gleich zwischen den Fingern haben werde?«
»Blödsinn!«, fauchte Wilhelm und drehte sich zögernd um. Er starrte auf den weißen Frauenkörper, der still und bewegungslos halb im Wasser lag. Er hatte sich getäuscht. Natürlich hatte er sich getäuscht! Leichen seufzten und bewegten sich nicht. Erleichterung durchflutete ihn, aber noch ehe er sich abwenden konnte, zuckte der Leib und warf einen Ring kleiner Wellen auf, die sich träge nach allen Seiten ausbreiteten. Auch Robert hatte die Bewegung gesehen.
»Meinst du, die lebt etwa noch?«
Zögernd beugte sich Wilhelm herab und legte seine Hand an ihren Hals. Die Haut unter seinen Fingern war kalt, aber er konnte deutlich ein Pochen im Innern spüren. Und dann zuckten ihre Lippen, und ein zweiter Seufzer entwich in die Nacht.
»Ja, sie lebt!«, verkündete Wilhelm.
»Und was machen wir nun mit ihr?«, fragte Robert. »Ich kenne mich da nicht aus. Ich habe noch nicht allzu viele nackte Weiber im Stadtgraben gefunden.«
Wilhelm kaute auf seiner Lippe. »Vermutlich wäre es richtig, den Schultheiß zu holen oder zumindest die Scharwächter.«
Robert, der die Freuden der Nacht schwinden sah, seufzte tief. »Ade, du lustiges Frauenhaus«, lamentierte er, dann ruckte sein Kopf nach oben. »Glaubst du, dass sie eins der Mädchen der alten Eselswirtin ist? Das würde alles erklären. Sie ist mit einem Besucher hinausgegangen – und dann wurde sie ohnmächtig, und er bekam es mit der Angst zu tun, weil er dachte, sie wäre tot. Und dann hat er sie hier liegen lassen und sich davongemacht.« Er strahlte. »Na, wie habe ich das Rätsel gelöst?«
Wilhelm wiegte den Kopf hin und her. »Das wäre eine Möglichkeit. Dann sollten wir sie zurückbringen. Die Buhlerin wird schon wissen, was mit ihr zu tun ist.« Wilhelm packte die beiden Handgelenke. »Los, fass mit an!«
Froh, dass sie nun doch noch zum Frauenhaus gingen, fasste Robert die Beine der Bewusstlosen und half seinem Freund, sie die Böschung hinaufzutragen. Die Vorstadt lag in der Dunkelheit der Nacht, doch aus dem niederen Haus vor der Mauer, die den Judenfriedhof begrenzte, drang trübes Licht durch die Pergamentscheiben. Die beiden Männer schleppten die junge Frau auf das Frauenhaus zu. Zweimal stolperten sie, und einmal rutschte ihnen der Körper gar aus den Händen und fiel auf den mit Unkraut bedeckten Boden, aber die Frau erwachte nicht. Nicht einmal ein Stöhnen entrang sich ihren Lippen. Sie schien dem Tod näher als dem Leben.
Der freundliche Gruß blieb der Eselswirtin im Hals stecken, als ihr Blick auf die leblose, nackte Gestalt fiel, die die beiden jungen Männer hereintrugen. Sie sahen sich suchend um und legten den Körper dann auf den Tisch, der rechts der Tür stand. Ein Tonbecher fiel herab und ging zu Bruch. Die vier leicht bekleideten Frauen, die mit zwei Kunden auf der anderen Seite an einem zweiten Tisch saßen, verstummten und starrten zu ihnen hinüber. Nun waren nur noch die Geräusche der beiden Paare zu hören, die hinter einem Wandschirm eindeutig der Sache nachgingen, zu deren Zweck die Eselswirtin ihre Frauen beschäftigte.
»Was bringt ihr mir da?«, fragte die Wirtin leise und trat zögernd näher. Sie strich der Bewusstlosen die Haare aus dem Gesicht. »Was habt ihr mit dem Mädchen getan?«
»Wir?«, entrüstete sich Robert. »Was unterstellst du uns, Buhlerin! Wie kannst du es wagen!«
Die Wirtin des Frauenhauses wehrte ab. »Ich unterstelle gar nichts. Ich frage nur, und das wird ja wohl erlaubt sein, wenn ihr mir eine Leiche in mein Haus schleppt!«
Die Geräusche hinter dem Wandschirm ebbten ab. Else wusste nicht, ob die Männer fertig waren oder ob ihre Worte sie aus dem Rhythmus gebracht hatten. Jedenfalls schien jeder aufzuhorchen, der sich in dem einen großen Raum des Frauenhauses befand, der sich von der Eingangstür bis zur rückwärtigen Wand erstreckte.
»Und außerdem ist sie nicht tot«, stellte Wilhelm richtig. »Jedenfalls noch nicht.«
Die Wirtin legt ihre Hand erst an den Hals, dann zwischen die Brüste der jungen Frau. Sie nickte.
»Jeanne, hol eine Decke«, rief sie einem der Mädchen am anderen Tisch zu. Die mollige Französin beeilte sich, den Befehl auszuführen.
»Ist sie eine von deinen Mädchen?«, wollte Robert wissen.
Die Eselswirtin wich seinem Blick aus. »Könnte schon sein«, murmelte sie. »Warum?«
»Na ja, wir müssen doch wissen, ob wir sie bei dir lassen können oder was sonst zu geschehen hat.«
»Und außerdem würde uns interessieren, was mit ihr passiert ist. Ist sie mit einem Gast rausgegangen? Weißt du, mit wem sie zuletzt zusammen war?«, mischte sich Wilhelm ein.
»Ihr wollt mir also sagen, dass nicht ihr es wart, die ihre Hände als Letzte auf diese Haut gelegt haben?«
»Nur, um sie aus der Kürnach zu ziehen und hierher zu tragen«, bestätigte Wilhelm.
Die Wirtin, die eigentlich Else Eberlin hieß, aber meist Buhlerin oder Eselswirtin genannt wurde, betrachtete die beiden jungen Männer. Sie kannte sie seit Langem, genauso wie ihre Väter, von denen der eine ein Metzger war, der im Rat saß, und der andere eine gutgehende Silberschmiede besaß. Sie waren leichtsinnig, dem Wein, den Würfeln und den Weibern zugetan, aber sie waren nicht bösartig. Else glaubte ihnen.
Ein Mann trat hinter dem Wandschirm hervor und ordnete seine verblichene Kutte. Die Eselswirtin wünschte dem Vikar eine gute Nacht. Kurz darauf war auch der zweite Kunde so weit, dass er sich sein Wams wieder schnüren ließ. Der Gerber, der mit Weib und vier Kindern hier in der Pleichacher Vorstadt wohnte, ging gähnend hinaus. Die Wirtin wandte sich wieder an die beiden Freunde.
»Nun, ihr beiden, wenn ihr schon einmal hier seid, dann kann ein wenig Entspannung nach dieser Unannehmlichkeit nicht schaden.« Robert nickte zustimmend.
»Wein? Ein wenig Wurst und Brot? Ein kleines Würfelspiel oder eines der Mädchen?«
»Ein Mädchen?«, rief Robert übermütig. »Wir wollen alle! Und ein ganzes Dutzend Krüge Wein dazu!« Er warf die Kette mit dem Medaillon auf den Tisch, dass es neben den nassen, schlammigen Füßen der Bewusstlosen liegen blieb. Die Eselswirtin griff danach, rückte eine Öllampe näher und betrachtete das Schmuckstück mit gierigem Blick. Dann sah sie misstrauisch den jungen Mann an.
»Ist das dein Eigen? Ich will nicht hoffen, dass, wenn ich es annehme, mir morgen ein wütender Vater die Tür eindrückt oder gar der Schultheiß mein Haus nach gestohlenem Gut durchsucht.«
»Willst du mich beleidigen, elendes Kupplerweib?« Robert stemmte drohend die Hände in die Hüften.
Die Augen der Wirtin blitzten, dennoch senkte sie demütig den Blick. »Nein, nichts läge mir ferner. Nehmt euch heute Nacht, was ihr haben wollt.«
Robert klatschte erfreut in die Hände und winkte seinem Freund zu. »Nun dann, lass deinen großen Worten auch große Taten folgen. Ich warte gespannt!«
Wilhelm grinste zurück. »Nun gut, ich fange mit Mara und Gret an. Kommt her, meine Schönen, und lasst uns zuerst einen Becher Wein zusammen leeren.«
Die beiden Dirnen ließen sich nicht lange bitten. Mara holte einen Krug, dann zogen sie den jungen Mann auf eine strohgefüllte Matratze, die von schmuddeligen Decken und Kissen bedeckt war. Bevor Wilhelm Grets Küsse erwiderte, warf er noch einen Blick zu der Wirtin, die auf die nun von einer Decke verhüllte Gestalt niederblickte.
»Was wird mit ihr geschehen?«, wollte er wissen.
»Ich lasse den Bader holen, vielleicht wacht sie wieder auf. Denk nicht mehr daran, und überlass dich deinen wohlverdienten Freuden.«
Wilhelm nickte und ließ sich von Mara auf die Kissen niederdrücken. Er sah noch, wie Robert mit den anderen beiden hinter dem Wandschirm verschwand. Die Männer, die am Tisch gesessen hatten, verabschiedeten sich, drückten die geforderten Münzen in die vorgestreckte Hand der Wirtin und verließen dann das Frauenhaus.
Else wartete, bis die beiden jungen Männer sich nur noch um die Mädchen und den Wein kümmerten, dann schob sie den Arm unter den Nacken der Bewusstlosen.
»Anna, nimm ihre Füße!«, befahl sie der Dirne, die den Vikar bedient hatte.
Sie trugen die Reglose um einen zweiten Wandschirm herum und legten sie auf eines der beiden Betten, die dahinter standen. Die Laken waren fleckig und rochen nach Schweiß und vergossenen Körpersäften. Else rückte eine Lampe heran.
»Meisterin, erkennst du sie?«, fragte Anna und beugte sich, die Stirn gerunzelt, über das bleiche Gesicht.
Die Wirtin schüttelte den Kopf. »Du etwa?«
Anna verneinte. »Sie kann nicht von hier sein. Zumindest nicht von der Pleichach.«
Else stimmte ihr zu. »Aber wo kommt sie dann her? Und was hat sie nackt in unserem Stadtgraben verloren?«
»Das kann sie uns erzählen, wenn sie aufwacht. – Sie wird doch wieder aufwachen?« Die kleine Frau mit dem unscheinbaren mausbraunen Haar sah fragend auf. Else zuckte mit den Schultern.
»Kann ich nicht sagen.« Sie schob die Decke ein Stück zur Seite. »Sieh dir die Flecken am Hals und an der Schläfe an. Und dort im Haar ist ein Riss in der Haut. Es ist noch völlig mit Blut verschmiert. Jemand hat sie gewürgt, und sie hat mindestens zwei Schläge auf den Kopf bekommen.«
»Soll ich den Bader holen?«, fragte Anna.
Die Frauenhauswirtin überlegte. Der Bader tat nichts umsonst. Schon gar nicht nachts nach einem halb erwürgten und niedergeschlagenen Mädchen sehen. Andererseits, vielleicht war sie noch zu retten. Sie war jung und schön. Sie konnte ihre Schulden abarbeiten. Wenn sie überlebte.
Else nickte. »Ja, hol ihn her.«
Kaum war Anna verschwunden, zog die Wirtin die Decke herab. Sie betrachtete den reglosen Körper genau, betastete die Füße und Hände, ließ das Haar durch ihre Finger gleiten und schob dann die Beine ein wenig auseinander, um die Scham zu untersuchen. Ein harsches Klopfen an der Tür ließ sie zusammenfahren. Hastig warf sie die Decke wieder über das Mädchen und eilte zur Tür.
Der Mann, der mit einer Fackel in der Hand draußen vor der Tür stand, war groß, mit breiten Schultern und kurzem, grauem Haar. Sein scharf geschnittenes Gesicht war sorgfältig rasiert. Er hielt sich auffällig gerade und neigte nur leicht den Kopf, als die Eselswirtin ihm öffnete.
»Welch angenehme Überraschung«, sagte sie ohne Freude in der Stimme und trat zurück, um ihn eintreten zu lassen. »Was verschafft uns die Ehre?«
Er musste sich ein wenig ducken, damit sein Hut nicht an den Türbalken stieß. Er steckte den Kienspan erst in einen der Halter in der Wand, ehe er ihr antwortete.
»Else, versuche nicht, mir Honig um den Mund zu schmieren, du müsstest inzwischen wissen, dass das bei mir nichts nutzt. Außerdem brauchst du nicht so zu tun, als würde dich mein Kommen erfreuen.«
Sie seufzte. »Du weißt, dass ich nichts gegen dich habe, aber wer will schon den Henker im Haus? Nicht einmal für mich ist das gut.«
Meister Thürner neigte zustimmend den Kopf. »Und doch ist es an mir, dafür zu sorgen, dass im Frauenhaus die Dinge so laufen, wie sie sollen.«
Else verschränkte trotzig die Arme vor ihrem schlaffen Busen. »Es ist alles so, wie es sein soll.«
»So?« Der Henker hob seine grauen Augenbrauen. »Was denkst du, wie lange ist es her, dass die Weinglocke geläutet wurde, um die Leute zu mahnen, dass es nun an der Zeit ist, nach Hause zu gehen?«
»Ich weiß es nicht«, wich sie aus. »Ich habe sie nicht gehört. Aber du weißt genau, dass ich meine Gäste um diese Zeit noch nicht wegschicken kann. Wann sollen sie denn hierherkommen, um sich von ihrer Mühsal zu entspannen? Wenn die Sonne am Himmel steht, müssen sie ihrer Arbeit nachgehen – oder es ist Sonntag oder Feiertag, dann müssen sie in der Kirche beten. Für uns bleibt nur die Nacht. Ich bin für die Mädchen verantwortlich. Wie soll ich sie ernähren und kleiden, wenn sie nichts verdienen?«
Der Henker hob den Zeigefinger. »Ah, du lieferst mir das rechte Stichwort. Sonntag! Wann fängt der Sonntag wohl an? Wenn die Sonne aufgeht?«
»Nein«, brummte die Wirtin mürrisch. »Wenn es zur Mitternacht läutet. Ist es wirklich schon so spät?«
Der Besucher nickte und deutete auf den Wandschirm, hinter dem ein verzücktes Kichern erklang. »Wen hast du noch da?«
»Keine Pfaffen, keine Ehemänner, keine Juden«, fauchte Else, »nur zwei ehrliche, ledige Handwerkssöhne, die ein wenig Vergnügen suchen.«
Der Henker nickte beifällig. »Gut, ist mir recht, wenn ich dir keine Strafe aufbrummen muss. Es ist das Gesetz des Bischofs und des Rats, nicht meins.«
»Ha, der Bischof!«, stieß Else erbost aus. »Der soll sich bloß nicht so aufspielen. Mir Vorhaltungen machen, wie ich hier meine Mädchen führe, während er sich dort auf seiner Festung mit seinen Mätressen im Bett herumwälzt!«
»Vorsicht, Else, du betrittst gefährlichen Boden«, mahnte der Henker.
Die Frauenhauswirtin schnaubte durch die Nase. »Ach ja? Darf man in diesem Land nicht sagen, was wahr ist?«
»Manchmal ist es klüger, es nicht zu tun«, riet der Henker.
Else grinste. »Also streitest nicht einmal du ab, dass unser Bischof und Landesvater ein geiler Hurenbock ist.«
»Ich würde es nie so ausdrücken«, widersprach der Henker, doch um seine Mundwinkel zuckte es.
»Ich möchte mal wissen, wie viele seiner Bastarde auf dem Marienberg herumlaufen. Jedenfalls ist es kein Geheimnis, dass er seinen Mätressen das Geld in den Rachen stopft, das er uns anständigen Bürgern in immer neuen Steuern abpresst.«
Der Henker nickte nachdenklich. Er protestierte nicht dagegen, dass sich Else zu den anständigen Bürgern zählte.
»Ja, und nicht nur das. Er verkauft und verpfändet alles, was ihm Geld bringt. Die Domherren wissen nicht, wie sie ihm Einhalt gebieten können. Man hört sie Worte im Munde führen wie: ›den Bischof absetzen, bevor er das ganze Land verschleudert hat‹. Der Bischof andererseits lässt Büchsen gießen und auf den Marienberg bringen.«
»Da steht das Kapitel schlecht da, wenn er seinen Stuhl mit Bewaffneten verteidigt«, sagte die Wirtin.
Der Henker wiegte den Kopf hin und her. »Die Stadt wird sich entscheiden müssen, auf welcher Seite sie steht. Und wir wissen beide, dass kein Bürger oder Hintersasse sich freiwillig für diesen Bischof schlagen würde. Tja, und dann bleibt uns nur, gegen seine Kanonen anzugehen.«
»Du meinst, es wird wieder einen großen Krieg geben?«, keuchte die Wirtin. »Heilige Jungfrau, nicht schon wieder. Ich habe Bergtheim nicht vergessen!«
»Ich auch nicht«, schüttelte der Henker den Kopf. »Aber ich fürchte, es wird wieder zu einem Kräftemessen kommen, und dann gnade uns Gott, wenn wieder die Bischöflichen siegen.«
»Ach, bei manch einem Ratsherrenkopf wäre es nicht so schlimm, wenn er zu seinen Füßen rollte«, sagte Else wegwerfend.
»Das ist aber nicht das Einzige, was die Stadt verlieren kann und verlieren wird, wenn wir gegen Bischof von Brunn die Waffen ziehen und verlieren.«
Die Wirtin seufzte. »Ja, das weiß ich, und ich kann nur hoffen, dass es nicht so weit kommt. Soll er sich doch auf seiner Festung mit seinen Dirnen vergnügen und uns hier unten in Frieden lassen.«
Das erinnerte den Henker wieder an den Grund seines nächtlichen Besuches. »Also sieh zu, dass deine Gäste fertig werden und sich auf den Heimweg machen. Ich möchte heute Nacht nicht noch einmal kommen müssen. Ein paar ungestörte Stunden in meinem Bett sind mir lieber.«
»Nun, dann wünsch ich dir eine freudvolle Nacht, und grüß dein zärtliches junges Weib von mir!« Sie grinste ein wenig boshaft.
»Reiz mich nicht!«, schnaubte der Henker, doch dann grinste auch er. »Freches Weibsstück«, schimpfte er und ging zur Tür. »Dir täte eine Tracht Prügel auch nicht schaden.«
Else knickste spöttisch. »Und wer sollte mir die verpassen? Du vielleicht? Das gehört nicht zu deinen Aufgaben!«
»Dass du dich da nur nicht täuschst«, brummte er und öffnete die Tür. Draußen stieß er fast mit Anna zusammen, der der Bader mit seiner dicken Utensilientasche folgte. Überrascht blieb der Henker stehen.
»Was führt dich zu dieser Stunde hierher?«
»Jedenfalls nicht mein Vergnügen«, brummte der Bader, nickte ihm zu und schob sich durch die Tür. Der Blick des Henkers wanderte vom Bader zu Else.
»Geht es um etwas, das ich wissen sollte?«
Die Wirtin hob lässig die Schultern. »Nein, warum? Er soll sich eins meiner Mädchen ansehen. Ist da etwas dagegen einzuwenden?«
»Mitten in der Nacht?«
»Na und? Sie hatte halt... einen Anfall oder so was. Ich möchte lieber gleich wissen, womit ich zu rechnen habe.«
»Wer ist es?«
»Geht dich das etwas an? Es sind meine Mädchen!«
Anna schob sich an der Wirtin vorbei und führte den Bader um den Wandschirm herum. Nun stand Else alleine mit dem Henker vor der Tür.
»Pass auf, dass du dich nicht in Schwierigkeiten bringst«, sagte er leise und wandte sich ab. »Falls du deine Meinung ändern solltest und zu dem Schluss kommst, dass es mich doch etwas angeht, dann weißt du ja, wo du mich findest«, rief er über die Schulter zurück. Dann verschwand er in der Nacht. Die Wirtin trat zurück ins Haus und warf die Tür hinter sich zu.
»Mara, Gret, seht zu, dass ihr fertig werdet, und bringt die Gäste hinaus!«, rief sie und trat zu Bader Wander und Anna. Sie schickte das Mädchen weg.
»Geh schlafen. Du musst heute Nacht mit Mara das Lager teilen. Hier kannst du nicht schlafen!«
Anna zog schmollend die Lippe hoch, widersprach aber nicht und trollte sich. Die Wirtin hörte, wie die anderen die beiden jungen Männer hinauskomplimentierten, dann wurde es still. Es war ihr bewusst, dass die Frauen auf ihren Betten saßen und gespannt lauschten, was hinter dem Wandschirm vor sich ging. Else trat näher an den Bader heran, der die Decke heruntergezogen hatte und den noch immer reglosen Frauenkörper betrachtete.
»Kannst du ihr helfen?«, frage sie nach einer Weile, nachdem der Bader immer noch schwieg.
»Ich weiß es nicht. Was ist mit ihr geschehen?«
»Ich war nicht dabei«, wehrte die Eselswirtin brüsk ab. »Woher also soll ich das wissen?«
Der Bader betastete die Wunden am Kopf und die verfärbten Stellen am Hals. Ansonsten fand er nur ein paar harmlose Schürfwunden und ein paar blaue Flecken. Er begann die Kopfwunde auszuwaschen.
»Ihr Herz schlägt kräftig«, sagte er. »Und der Atem ist regelmäßig, wenn auch flach. Halte sie warm, und versuche, ihr ein wenig Wein einzuflößen. Mehr kann man im Moment nicht tun.«
»Wird sie wieder erwachen?«
Der Bader packte seine Utensilien wieder in seine Tasche. »Das weiß nur Gott alleine. Ich komme morgen nach der Messe noch einmal vorbei.«
»Ist das denn nötig?«, brummte die Wirtin. In Gedanken zählte sie die Münzen, die sie würde bezahlen müssen, wenn das Mädchen starb. »Wenn du eh nichts für sie tun kannst? Abwarten können wir auch alleine!«
Der Bader schürzte missbilligend die Lippen. »Nun, wenn du nicht willst, dann komme ich eben nicht.«
Else versuchte sich an einem versöhnlichen Lächeln. »So habe ich das nicht gemeint, Bader Wander. Wenn sie aufwacht und deiner Hilfe bedarf, schicke ich Anna zu dir herüber. Ansonsten wird es nicht nötig sein, deine Sonntagsruhe zu stören.«
Er neigte den Kopf und nahm den Becher mit saurem Wein entgegen, den Else ihm entgegenstreckte.
»Nun denn, Eselswirtin, eine gesegnete Nacht«, wünschte er zum Abschied und ging hinaus. Else warf einen Blick zu den Lagern ihrer Frauen, die sich alle schlafend stellten, und kehrte dann zu der Bewusstlosen zurück. Sie hatte gerade entschieden, dass es nicht lohne, bei ihr zu wachen, als ein Seufzer sich den halb geöffneten Lippen entrang und die junge Frau die Augen aufschlug.
Kapitel 2
Um sie herum war es dunkel. Sie schwebte. Sie konnte ihren Körper nicht mehr fühlen. Wo war sie? Was war mit ihr geschehen? Sie konnte sich nicht mehr daran erinnern. Wer war sie überhaupt? Verschiedene Namen und Gesichter huschten durch ihren Geist, doch keiner davon löste ein besonders intensives Gefühl aus. Vielleicht war sie gar kein Mensch, kein lebendes Wesen, nur ein Gedanke in der Leere, bevor Gott die Welt schuf? Diese Vorstellung löste ein Gefühl von Frieden in ihr aus. Die Finsternis verlor ihren Schrecken. Sie musste sich nicht länger mühen, diesen Ort hinter sich zu lassen. Alles lief nach Gottes Plan, und sie würde so lange hier in der Dunkelheit schweben, bis der Schöpfer sich ans Werk machte und »Es werde Licht!« rief.
Es wurde Licht! Erst war es nur ein schwacher, rötlicher Schimmer, den man für eine Täuschung der Sinne halten konnte, doch dann wurde er stärker und brannte sich schmerzhaft in den losgelösten Geist. Und plötzlich gab es auch Geräusche dort irgendwo hinter dem roten Schein. Es war keine Musik. Es waren Stimmen. Verschiedene Stimmen. Ein Mann und eine Frau und dann noch jemand. Sie sprachen irgendwelche Worte, und ihre Stimmen störten die göttliche Harmonie, die so kurz vor Beginn der Schöpfung herrschte. Wie konnten sie es wagen, sich vorzudrängen? Warum warteten sie nicht einfach, bis sie an der Reihe waren? Sie hatte das Bedürfnis, ärgerlich die Stirn zu runzeln, doch wie sollte das gehen ohne einen Körper? Als wolle ihr Leib sie vom Gegenteil überzeugen, zuckte Schmerz durch sie hindurch. Er begann im Kopf, wand sich über Rücken und Schultern und fuhr ihr dann bis in die Beine. Fast enttäuscht musste sie sich eingestehen, dass sie nicht nur ein körperloser Gedanke war. Nun verstand sie auch einige der Worte, die um sie herum gesprochen wurden. Der Mann stand links von ihr, die Frau auf der rechten Seite. Dann erklang noch eine dritte Stimme von einer weiteren Frau, die jünger sein musste als die erste. Eine Hand griff nach ihrem Arm, dann tasteten Finger über ihren Hals. Ein kalter Lufthauch strich über ihre nackte Haut.
Ihr Geist ließ ein Seufzen durch den Raum ihrer Gedanken hallen. Es wurde Zeit, die Augen zu öffnen. Noch ehe sie sich im Klaren war, ob sie dem zustimmen sollte, zuckten ihre Lider, und Licht fiel in einem grellen Streifen in ihre Augen. Ein feistes Männergesicht beugte sich über ihren nackten Leib. Eine fleischige Hand hielt eine Öllampe. Der Schmerz schoss wie ein Blitz durch ihren Kopf, und sie kniff die Lider hastig wieder zu. Obwohl sie kein Verlangen spürte, den Versuch zu wiederholen, öffnete sie nach einer Weile noch einmal die Augen. Nun war es ruhig, die Stimmen und Schritte waren verklungen, das Licht gedämpft. Der Schmerz hielt sich in Grenzen, und sie blinzelte ein paar Mal, bis das verschwommene Bild so weit an Schärfe gewann, dass sie etwas erkennen konnte.
Von Alter und Ruß geschwärzte Dachbalken, die Sparren mit Stroh gedeckt. Es roch feucht und modrig, aber auch seltsam süßlich. Alles kam ihr fremd vor. So fremd wie ihr eigener Körper, der sich nun mit immer schärferen Wellen von Schmerz in ihr Bewusstsein zurückmeldete. Sie versuchte, sich wieder auf ihre Umgebung zu konzentrieren.
Sehr weit entfernt schien die Decke nicht zu sein. Wenn sie aufstehen würde, könnte sie sie bestimmt mit den Fingerspitzen erreichen. Wenn sie in der Lage gewesen wäre, aufzustehen – ja sich überhaupt zu rühren! Immerhin gehorchten ihr die Augenlider schon ganz gut, und so versuchte sie nun die Lippen und die Zunge zu bewegen.
Das faltige Gesicht einer älteren Frau drang in ihr Blickfeld. Sie hob eine Lampe hoch und sah auf sie herab. Das Mädchen kniff rasch die Augen zu, doch der erwartete Schmerz blieb aus. Zögernd öffnete sie die Lider wieder.
»Du bist also erwacht«, stellte die Frau fest. Es klangen weder Freude noch Erleichterung aus ihrem Tonfall. Ihre Wangen waren gerötet, ein Rußfleck prangte auf ihrem Kinn. Sie trug eine schmuddelige Haube, unter der ein paar graue Haarsträhnen hervorlugten. Ihre Lippen hatte sie rot gefärbt, was sie aber nicht hübscher aussehen ließ. Als sie sich vorbeugte, konnte das Mädchen die faltige Haut ihrer schlaffen Brüste sehen.
»Wer bist du? Kannst du mich hören? Dann sag mir deinen Namen und woher du kommst.«
Die Augen zu öffnen, war eine Sache. Sich jedoch zu erinnern, wer sie war, oder das gar laut auszusprechen? Die Alte mit den schlaffen Brüsten verlangte Unmögliches von ihr! Die junge Frau wollte wieder zurück in die tröstliche Dunkelheit, in der sie nur ein Gedanke Gottes gewesen war!
Die Frau beugte sich vor und kniff das junge Mädchen fest in die empfindliche Haut ihrer Seite.
»Au!«, stieß sie empört aus und zuckte zusammen. »Was fällt dir ein?« Ihre Stimme war rau und fremd und brannte in der Kehle.
Die Alte verzog die geschminkten Lippen zu einem Grinsen. »Stumm bist du also nicht, mein Täubchen. Aber du hörst dich an, als könntest du einen Schluck vertragen.«
Eine Gestalt mit üppigem kastanienbraunem Haar huschte aus den Schatten und trat neben die Alte. »Meisterin, soll ich Wein holen?«
»Mara! Was habe ich befohlen?« Die Alte hob die Hand, als wolle sie ihr eine Ohrfeige geben, aber die zierliche Frau wich zurück und duckte sich. Die Wirtin ließ die Hand sinken. »Nun gut, hol den gebrannten Heidelbeerwein. Ich denke, sie braucht etwas Kräftiges.«
Else schob ihren Arm unter den Kopf der jungen Frau, hob ihn an und drückte den Hals der Tonflasche an die aufgeplatzten Lippen. Sie trank zwei Schlucke. Röte schoss in ihre Wangen. Sie riss die Augen auf. Ihr Körper bäumte sich auf. Die Decke rutschte von ihrem nackten Oberkörper. Sie hustete krampfhaft, Tränen rannen über ihre Wangen, ihre Brust wölbte sich und ließ die Luft dann in einem Stoß entweichen. Die Wirtin grinste und nickte.
»So, jetzt können wir uns unterhalten. – Mara, mach, dass du in dein Bett kommst!«
»Ach Meisterin, bitte«, flehte die junge Frau, »wir kommen um vor Neugier und wollen auch wissen, was geschehen ist.«
Else wiegte den Kopf hin und her, aber ihre Miene war nicht unfreundlich. Sie sah zu der blonden Frau auf dem Bett, die sie aus großen Augen anstarrte, die Decke mit beiden Händen umklammert und schamhaft über ihre Brust gezogen. »Nun gut«, stimmte sie zu, dann hol unserem Gast ein Hemd und einen Becher Wein, und sieh nach, ob noch Mus im Kessel ist. Vielleicht kann sie schon etwas essen.«
»Danke, Meisterin!« Mara wandte sich um und eilte davon. Üppig fiel ihr kastanienbraunes Haar in leichten Wellen über den Rücken herab. Bevor sie mit dem Hemd zurückkam, lösten sich weitere Schatten aus der Dunkelheit des Hauses, brachten Weinkrug und Becher und eine Schale mit kaltem Mus und ließen sich dann in einigem Abstand in den Binsen nieder. Die Wirtin ließ den Blick schweifen und seufzte.
»Das hätte ich mir denken können. Ihr habt mal wieder gelauscht, statt mir zu gehorchen. Ich ziehe euch allen einen Schilling von eurem Lohn ab!«
Die Frauen nahmen es gelassen. Die meisten mussten sowieso noch etliche Schulden bei Else abarbeiten. Es gab verschiedene Gründe, warum sie hier gestrandet waren, doch keine der hier versammelten Frauen gab sich der Illusion hin, es läge in ihrer Hand, das Frauenhaus in der Pleichacher Vorstadt von Würzburg gegen ein besseres Heim tauschen zu können. Und so schlecht war es hier gar nicht. Die Meisterin sorgte für eine warme Mahlzeit am Tag und ab und zu ein neues Gewand, sie hatten ein Dach über dem Kopf, wenn sie sich zum Schlafen niederlegten, und eine warme Wolldecke, um sich zuzudecken, wenn der Wind durch die Ritzen des altersschwachen Hauses pfiff. Dafür mussten sie den Männern, die hier Zerstreuung suchten, zu Diensten sein. Meist forderten sie nichts Unerträgliches, und die Wirtin achtete darauf, dass kein Gast ihre Mädchen quälte. Ja, wenn sie Prügel bekamen, dann meist von der Wirtin selbst. Die Frauen – jede für sich – hatten schon schlimmere Zeiten erlebt als die hier unter Else Eberlins wachsamen Augen. Natürlich freuten sich die Frauen, wenn die Meisterin ihnen von den Münzen, die sie von den Kunden forderte, ihren Anteil gab und sie sich ein wenig billigen Tand bei den Krämern der Stadt oder Süßigkeiten an einem der Bäckerstände kaufen konnten, aber nun waren sie alle gern bereit, einen Schilling für eine spannende Geschichte zu geben und mit dabei zu sein, wenn die fremde blonde Frau zu erzählen beginnen würde.
Die Wirtin wartete, bis Mara ihr in das verschlissene Hemd geholfen hatte, dann fragte sie noch einmal: »Wer bist du? Wie ist dein Name?«
Die Blonde starrte erst sie und dann die anderen Frauen an, die im Kreis auf dem Boden kauerten und erwartungsvoll zu ihr aufsahen, doch sie blieb stumm und schüttelte nur den Kopf.
Ein ärgerlicher Zug trat in die Miene der Wirtin. Ein paar der Frauen zogen die Köpfe zwischen die Schultern. Sie alle wussten, dass es nicht ratsam war, Else zu reizen. Sie konnte sehr wohl großzügig und aufgeräumter Stimmung sein, doch nur allzu schnell schlug ihre Laune um, und dann brach ein Gewittersturm über denjenigen herein, der so leichtsinnig gewesen war, ihren Zorn zu entfachen.
»Sag uns deinen Namen!«, forderte sie noch einmal in strengem Ton, doch die Frau auf dem Bett starrte sie nur aus ihren weit aufgerissenen Augen an und schüttelte noch einmal den Kopf.
Die Frauenhauswirtin hob die Rechte – alle zuckten zurück, nur nicht die junge Frau, die sie unverwandt aus ihren graugrünen Augen anstarrte. Die Hand traf sie hart ins Gesicht. So viel Kraft würde man einem Weib diesen Alters gar nicht zutrauen! Die Blonde schrie auf und wankte. Fast wäre sie hinten übergekippt und aus dem Bett gefallen, aber sie fing sich noch und richtete sich wieder auf. Tränen tropften auf die schmierige Decke.
»Nun, willst du mir jetzt antworten? Sag uns deinen Namen!«
Ein Name! Ja, natürlich, sie musste einen Namen haben, mit dem die anderen Menschen sie gerufen hatten. Die junge Frau tastete in ihrem Geist umher, doch je mehr sie sich anstrengte, desto undurchdringlicher wurde die Finsternis. Er ließ sich nicht fassen. Sie konnte Gestalten erahnen, die durch die Schatten huschten und Worte murmelten, doch wenn sie sie zu greifen suchte, entflohen sie und zogen sich in Räume zurück, die ihr Bewusstsein nicht betreten konnte.
»Ich – ich weiß ihn nicht«, antwortete sie. Ihre Stimme war nun nicht mehr so heiser und rau. Man konnte den hellen Klang erahnen, den sie normalerweise hatte. Und man hörte ihr Erstaunen.
Die Wirtin, die bereits die Hand zu einer zweiten Ohrfeige erhoben hatte, ließ sie wieder sinken. »Du weißt nicht, wie du heißt?«
Die Blonde schüttelte den Kopf.
»Und auch nicht, wo du herkommst?«
Sie überlegte einige Augenblicke, dann schüttelte sie wieder den Kopf.
»Hm.« Die Eselswirtin kaute auf ihrer Unterlippe. »Kannst du dich daran erinnern, was dir zugestoßen ist? Jemand muss dich gewürgt und niedergeschlagen haben.«
»Nein, ich kann mich an gar nichts erinnern«, klagte die junge Frau und sah flehend in die Runde, als hätte eine der anderen Frauen ihr helfen können. Die Wirtin folgte ihrem Blick.
»Nun, kann eine von euch uns weiterhelfen? Habt ihr sie schon einmal gesehen? Strengt euer Hirn an! Ihr habt euren Kopf nicht nur, damit die Läuse ein Zuhause finden!«
Jeanne, die kleine, schwarzhaarige Französin, kicherte und ließ ihre Zahnlücke sehen. Die anderen schüttelten nur einmütig die Köpfe.
»Was wird nun mit ihr geschehen?«, wollte Gret wissen. Sie war groß und hager, ihr Gesicht von Sommersprossen übersät und ihr Haar lodernd rot wie die Flammen des Kaminfeuers.
»Sollen wir sie zum Spital bringen?«, fragte Mara.
»Sie kann bei uns bleiben«, schlug Anna, die jüngste der Frauen, vor.
Die hübsche blonde Marthe schnaubte mürrisch. »Ich teile mein Bett nicht mit ihr. Schlimm genug, dass ich manchmal Mara unter meine Decke lassen muss, aber sie ist wenigstens klein und zappelt nachts nicht so herum.«
»Sie kann zu mir ins Bett kommen«, bot Ester an.
»Natürlich, unsere barmherzige Seele, unsere gute Schwester des Hauses«, keifte Marthe.
»Lass sie in Ruhe!«, zischte Gret und zog Marthe an ihrem goldblonden Haar.
»Nimm deine Finger weg, Feuerdämon!«, kreischte Marthe.
Die Wirtin war wie ein Blitz über ihnen und verpasste beiden Frauen eine Ohrfeige. »Ruhe!«, donnerte sie.
Die beiden ließen voneinander ab, warfen sich jedoch noch giftige Blicke zu. Die junge Frau auf dem Bett starrte sie entsetzt an.
»Was glotzt du so?«, fauchte Marthe.
Else hob die Augenbrauen. »Hast du noch nicht genug? Ich kann auch den Riemen holen, wenn du das mal wieder nötig hast.«
Die schöne Blonde senkte den Blick. »Nein, Meisterin, das ist nicht nötig«, murmelte sie. Gret verbarg ein Grinsen hinter ihrer Hand. Auch sie war mit Sommersprossen bedeckt.
Else wandte sich wieder dem Bett zu. »Ja, was machen wir mit dir? Als Erstes werde ich dir ein paar Kleider heraussuchen. So kannst du ja nicht herumlaufen. Und Schuhe brauchst du auch. Dann bekommst du ein Linnen und eine Decke. Sieh zu, dass du sie sauber hältst. Jeder ist für seine Wäsche selbst verantwortlich. Wenn du sonst noch etwas benötigst, dann wende dich an mich. Wir essen zweimal am Tag gemeinsam. Morgens gibt es Milchsuppe oder Mus, abends einen warmen Eintopf und Brot. Der gute Wein ist nur für die Gäste. Die Mädchen zeigen dir, welches euer Fass ist. Fürs Erste kannst du allein in diesem Bett schlafen. Wenn es dir besser geht, können wir die Betten neu verteilen.«
Die namenlose Frau lächelte und sagte warm: »Du hast ein christlich gutes Herz, ich danke dir! Wie kann ich dir das jemals vergelten?« Die anderen Frauen warfen einander Blicke zu.
Die Wirtin mied die graugrünen Augen. »Das werden wir dann sehen«, murmelte sie nur und scheuchte dann ihre Frauen davon. »Nun aber marsch in eure Betten, sonst werdet ihr meinen Zorn erleben!«
Die Frauen erhoben sich und klopften sich die Binsen aus den Hemden.
»Wie sollen wir sie denn nennen, wenn wir ihren Namen nicht wissen?«, wollte die mollige Jeanne wissen.
»Wir müssen ihr einen Namen geben«, stimmte Gret zu.
Die Wirtin nickte. »Ja, das ist eine gute Idee. Hast du einen Vorschlag?«
Die Rothaarige zuckte mit den Schultern. »Ich weiß nicht recht. Vielleicht Maria? Oder Susanne? Oder Afra?«
Sie sah zu der jungen Frau im Bett, doch die zuckte nur hilflos mit den Schultern.
»Barbara? Johanna? Margret?«, schlug Anna vor, doch auch diese Namen lösten keine Reaktion aus.
»Was ist?«, drängte die Wirtin. »Entscheide dich, oder wir suchen einen für dich aus.«
»Ursula oder Margarete?«, fuhr Gret fort. »Vielleicht Luzia? Brigitta oder Elisabeth?«
Die Frau im Bett zuckte zusammen. Elisabeth. Ein warmes Gefühl durchflutete sie.
Sie sah in ihrem Geist ein kleines Mädchen mit strengen, blonden Zöpfen auftauchen. Es saß im Heu, ein kleines Kätzchen an die Brust gedrückt. Wie wunderbar frisch das Heu roch!
»Elisabeth! Wo bist duf« Eine Frauenstimme durchbrach den Frieden, Das Kind duckte sich hinter den Heuberg, doch da hörte es eine Tür quietschen, und helles Sonnenlicht flutete herein, Schwere Schritte näherten sich. Ein geschürzter Rock mit schmutzigem Saum tauchte in ihrem Blickfeld auf und ein paar geschwollene Füße, die in ausgetretenen Schuhen steckten, Sie hörte den keuchenden Atem der dicken Frau.
»Elisabeth! Hast du mein Rufen nicht gehört?«
Der Vorwurf war nicht zu überhören. Das Kind ließ den Blick weiter auf Saum und Schuhe gesenkt und schüttelte den Kopf, obwohl es den Ruf natürlich deutlich vernommen hatte.
Mit einem Stöhnen beugte sich die Dicke herab und wand das Kätzchen aus ihren Händen. Die Finger schlossen sich um den dünnen Kinderarm.
»Komm jetzt! Dein Vater kann jeden Augenblick zurückkommen!«
Sie zerrte das Mädchen auf die Beine und zog es hinter sich her ins grelle Sonnenlicht hinaus.
»Ja, er kommt. Die ersten Boten sind schon am frühen Morgen eingetroffen. Der Feldzug ist vorüber. Das Heer kehrt zurück. Dein Vater ist wohlauf.«
»Hat das fränkische Heer denn gesiegt?«, wollte das Mädchen wissen, während es neben der Dicken herstapfte.
Sie brummte unwillig. »Über so etwas weiß ich nicht Bescheid. Ich bin nur eine einfache Magd und froh über jeden Mann – sei er nun Bürger oder Ritter –, der unbeschadet aus Böhmen zurückkehrt und dem diese Ketzer nicht den Bauch aufgeschlitzt haben.«
»Was ist?«, drängte die Rothaarige mit den Sommersprossen und holte die junge Frau in die Wirklichkeit zurück. Sie lächelte Gret zu und nickte.
»Ja, wir nennen sie Elisabeth«, rief Ester. »Das ist gut. Hieß das Haus nicht so, als es einst für zehn arme Frauen gestiftet wurde, die hier Kost und Kleidung bekommen sollten?« Die anderen nickten zustimmend.
»Gut, dann ist das abgemacht.« Wirtin Else klatschte in die Hände. »Also, ab in eure Betten, und ich will kein Gerede mehr hören!«
»Elisabeth«, flüsterte die Frau im Bett und lauschte dem Klang. Ja, das war gut so. Auch wenn sie sich nicht sicher sein konnte, ob sie selbst das Mädchen gewesen war. War es überhaupt eine echte Erinnerung? Wenn ja, wo waren all die anderen, die sie im Laufe ihres Lebens aufgesammelt haben musste? Doch so sehr sie auch suchte, außer diesem einen bunten Fetzen war rund herum nur düsterer Nebel in ihrem Geist zu finden. So konzentrierte sie sich auf diese eine Begebenheit und beschloss, sie wie einen Schatz zu hüten. Erschöpft schloss Elisabeth die Augen. Das kleine Mädchen lächelte ihr zu.
Else wartete, bis Ruhe eingekehrt war, dann löschte sie die Lampe. Die Wirtin ging hinaus und zog die Tür hinter sich zu. Der große Schlüssel knirschte im Schloss. Ein paar Sterne leuchteten ihr den Weg zu ihrem Haus. Nun ja, es war mehr eine Hütte denn ein Haus, klein und niedrig, mit lehmbestrichenen Flechtwänden und einem durchhängenden Strohdach, dennoch konnte sie es ihr Eigen nennen, und es hatte alles, was sie brauchte: Eine Feuerstelle mit einem Kessel darüber, einen Tisch, eine Holzbank und zwei Hocker und ein Wandbord, auf dem sie ihr Tongeschirr und Lebensmittel aufbewahrte. Ein zweiter, winziger Raum wurde von einer schulterhohen Flechtwand abgetrennt. Der vorherige Besitzer hatte dort in der Ecke sein Vieh gehalten, ein Schwein, eine Ziege und ein paar Hühner, aber Else hatte den Verschlag gesäubert, mit frisehen Binsen bestreut und ihre Bettstatt dort eingerichtet. Dort stand auch ihr größter Stolz: Eine eisenbeschlagene Truhe mit einem Schloss, in der sie ihre Kleider, das eingenommene Geld und all ihre anderen wertvollen Habseligkeiten aufbewahrte.
Else trat an den Herd und schob die Asche auseinander. Darunter glühten noch ein paar verkohlte Scheite. Sie zündete ein Binsenlicht an und stellte es auf den Tisch. Schwerfällig ließ sie sich auf die Bank sinken. Sie griff unter ihre Röcke und zog das Medaillon hervor, das der Handwerksbursche ihr als Bezahlung gegeben hatte. Die goldene Oberfläche schimmerte im Licht der Flamme, der große Edelstein und die Perlen blitzten. Das war kein billiger Tand! Dieses Schmuckstück hatte ein kunstfertiger Goldschmied hergestellt, und sie war bereit, jede Wette einzugehen, dass der Stein und die Perlen so wertvoll waren, wie sie ihr im warmen Licht der Lampe erschienen.
»Junger Narr«, murmelte die Wirtin und ließ das Kleinod an seiner Kette hin und her schwingen. Dann wickelte sie es sorgsam in ein Tuch und verstaute es unter Hemden und Strümpfen in ihrer Truhe. Ein zufriedenes Lächeln spielte um ihre Mundwinkel, als sie unter ihre Federdecke schlüpfte und sofort einschlief.
Elisabeth lag im Dunkeln. Es machte keinen Unterschied, ob sie die Augen öffnete oder geschlossen hielt. Fast könnte sie meinen, sie wäre wieder in ihre Ohnmacht zurückgeglitten, wenn nicht verschiedene Geräusche an ihr Ohr gedrungen wären. Sie konnte die Frauen atmen hören, eine von ihnen schnarchte leise, eine andere murmelte etwas im Schlaf. Dann raschelte das Stroh einer Matratze, als sich jemand auf seinem Lager herumdrehte. Draußen tropfte irgendwo Wasser. Ein Hund jaulte. Sie konnte auch den Wind hören, der um die Häuserecken strich.
»Elisabeth«, flüsterte sie und lauschte dem Klang des Namens. War sie das wirklich? Von nun an ja, aber wer war sie gewesen, bevor die Finsternis sie umfangen hatte? Gehörte sie hierher oder war ihr ein anderes Leben bestimmt gewesen? Was hatte sie dort herausgerissen? Sie schickte ihre Gedanken auf die Suche nach ihrer Vergangenheit, fand aber nur Leere. Es war, als habe Gott sie in dieser Stunde erst – jungfräulich und nackt – auf die Erde gesandt. War das möglich? Sie wusste es nicht. Und was war dann mit der Erinnerung an das kleine Mädchen und die dicke Frau? Sie hatte von ihrem Vater gesprochen. Es gab dort draußen also eine Familie, die vielleicht in diesem Augenblick nach ihr suchte und sich Sorgen machte, was mit ihr geschehen sei. Ein Vater und vielleicht auch eine Mutter und Geschwister. Oder gar ein Ehemann? Elisabeth lauschte in sich hinein. Eher nicht. So alt war sie sicher noch nicht. Sie legte ihre Hände auf ihren Leib. Wenigstens war sie sich ziemlich sicher, dass sie noch kein Kind geboren hatte. Plötzlich blitzte das Bild eines kleinen Jungen auf, der sie gegen das Schienbein trat und ihr an den Zöpfen zog.
Das blonde Mädchen, das ihn kaum um einen Zoll überragte, schrie auf und schlug ihm ins Gesicht.
»Aua!«
Der Junge blinzelte die Tränen weg und hielt sich die gerötete Wange.
»Du blöde Ziege«, schrie er erbost. Dann wandte er sich um und rannte davon. »Elisabeth ist ein blöde Ziegel«
Das hörte sie ihn noch rufen, ehe das Bild verblasste und der Nebel ihre Erinnerungen wieder verhüllte.
»Ich bin Elisabeth!«, sagte sie leise, dann schlief sie ein.
Ein Kichern nahe ihrem Ohr weckte sie. Dann legte sich eine Hand auf ihre Schulter und schüttelte sie leicht.
»Wach auf! Es ist schon lange Tag. Willst du den ganzen Sonntag verschlafen? Wir waren schon in der Frühmesse. Müßiggang ist eine Sünde, sagt der Pfarrer!«
Die junge Frau hob die Lider und rieb sich die Augen. Fremde Gesichter starrten sie an. Eine Weile brauchte sie, um sich zu erinnern. Richtig, sie war aus der Finsternis geboren worden und in diesem Haus aufgewacht mit all diesen Frauen, die sie Elisabeth genannt hatten. Nein, korrigierte sie, sie war Elisabeth und hatte als Kind ein Kätzchen gehabt und einen Jungen gekannt, der sie an den Zöpfen gezogen hatte! Erleichterung durchflutete sie, dass die Nacht weder das Kätzchen noch den frechen Knaben mit sich genommen hatte. Elisabeth richtete sich auf und lächelte in die Runde.
»Ich bitte um Verzeihung. Ich wollte keine Unannehmlichkeiten bereiten.« Die Frauen lachten.
»Wie sie spricht!«, sagte die Mollige mit dem mausbraunen Haar und presste kichernd die Hand vor den sinnlichen Mund. Sie schien die jüngste der Frauen zu sein.
»Du hast keine Unannehmlichkeiten gemacht. Die Meisterin hat gesagt, wir sollen dich schlafen lassen«, beschwichtigte sie die große Frau mit dem roten Haar und den Sommersprossen.
»Aber jetzt steh auf«, ergänzte die Schwarzhaarige mit den dunklen Augen. Sie schien nicht aus der Gegend zu sein, so wie sie die Worte betonte. Eher weich und singend. Sie streckte Elisabeth einen einfachen, dunklen Rock, den man unter der Brust schnüren konnte, und eine Haube entgegen. »Hier, das hat mir die Meisterin für dich gegeben. Das müsste dir passen. Ich bin übrigens Jeanne.« Sie lächelte und ließ gerade Zähne sehen, in deren Reihe allerdings eine Lücke klaffte. »Der Feuerkopf neben mir heißt Gret, die Kleine mit dem Haar wie Kastanien heißt Mara, unsere Jüngste mit den weichen Formen ist Anna. Die gute Seele, die Gott mit einem Pferdegesicht gestraft hat, heißt Ester. Die Narben hat sie allerdings von ein paar Männern. Und die, die entweder verkniffen oder zornig dreinschaut und uns das Leben hier zur Hölle macht – wenn die Männer es gerade nicht tun – ist Marthe.«
Die Letztgenannte zog Jeanne an den Haaren und zischte: »Halt dein französisches Schandmaul. Man sollte dich dahin zurückschicken, wo du hergekommen bist. Ich warne dich! Fordere nicht meinen Zorn heraus!«
Jeanne schien sich nichts daraus zu machen. Sie schob sich außer Reichweite von Marthes Händen und grinste Elisabeth an. »Da hörst du es! Vor ihr musst du dich in Acht nehmen. Aber nun komm!«
Sie schlug die Decke zurück, zog Elisabeth das Hemd über den Kopf und begann die junge Frau mit warmem Wasser abzuwaschen. Errötend nahm ihr Elisabeth den Lappen aus der Hand. »Danke, das kann ich selbst.« Sie senkte den Blick. Es war ihr unangenehm, dass die Frauen noch immer dastanden und sie anstarrten. Jeanne half ihr, sich mit einem Laken abzutrocknen und das Hemd wieder anzuziehen.
»Darf ich dir das Haar waschen? Es muss wunderschön sein, wenn es erst einmal von dem ganzen Schlamm und Moder befreit ist.«
Elisabeth nickte und ließ es auch zu, dass Jeanne ihr anschließend in den Rock half und ihn unter der Brust zuschnürte. Er war tief ausgeschnitten und hatte nur halblange Ärmel, sodass über der Brust und an den Armen das helle Hemd zu sehen war. Zuletzt band Jeanne ihr eine Haube um das nasse Haar. Inzwischen waren Mara und Anna hinausgegangen und kamen nun mit einem Kessel zurück, den sie auf den Tisch wuchteten. Ester holte Schalen und Becher vom Wandbord. Die Frauen setzten sich um den größeren der beiden Tische, aßen heißen Haferbrei und tranken mit Wasser verdünnten, sauren Wein. Sie lachten und scherzten, sodass die Beklemmung, die Elisabeth in der fremden Umgebung empfand, von ihr abfiel. Vielleicht gehörte sie ja hierher? Vielleicht hatte sie ihre Familie schon vor langer Zeit verloren, und dies war nun ihr Zuhause? Sie ließ den Blick über die Gesichter schweifen. Sie waren alle so freundlich – bis auf Marthe. Fast wie eine liebende Familie. Da machte es ihr auch nichts aus, dass alle sie jetzt kurz Lisa nannten, auch wenn ihr Elisabeth irgendwie vertrauter erschien.
»Was ist? Warum schaust du uns so an?«, wollte Anna wissen.
»Es ist so friedlich hier, dass ich fast glauben könnte, heimgekehrt zu sein. Ich danke euch.«
Die Frauen tauschten Blicke und murmelten unverständliche Worte. Nur Jeanne sah ihr in die Augen. In ihrem Blick lag eine Traurigkeit, die Elisabeth nicht verstand. Sicher hatte das Schicksal ihnen allen eine Bürde auferlegt, die sie jedoch überwunden hatten, denn nun lebten sie hier zusammen, hatten es warm, waren satt und geborgen. Was hatte Ester heute Nacht gesagt? Das Haus hieß wie sie, Elisabeth, und war für zehn Frauen gestiftet worden, die hier Kost und Kleidung bekommen sollten. Die hier wie ein Familie zusammenleben konnten!
Die Frauen hatten den Kessel fast geleert, als die Tür aufging und ein Mann in einer verschlissenen Kutte eintrat.
»Guten Morgen und Gottes Segen, Pater Thibauld«, grüßten die Frauen höflich. Anna kicherte. Der Pater war vielleicht um die fünfzig, hatte nur noch spärlich Haar auf dem Kopf, und sein faltiges Gesicht war mager. Er ließ sich neben Jeanne auf die Bank fallen und nahm dankend den Becher, den Gret ihm hinüberschob. Sie füllte ihn nicht aus dem Krug, von dem die Frauen tranken, sondern holte einen anderen, der auf dem Kaminsims stand. Der Pater trank, rülpste und seufzte erleichtert. Er legte Jeanne den Arm um die Taille und rutschte ein Stück näher. Sein Blick schweifte durch die Runde und blieb dann an Elisabeth hängen.
»Ah, sieh an, ein neues Gesicht«, freute er sich. Er deutete eine Verbeugung an. »Ich bin Vikar Thibauld vom Stift Haug«, sagte er. »Und wie ist dein Name, schönes Kind?« Die junge Frau starrte ihn nur mit offenem Mund an.
»Sie heißt Lisa... äh... eigentlich Elisabeth«, half Gret nach.
»Könnte ich, ich meine, würde sie...« Der Geistliche leckte sich die Lippen, ohne den Blick von ihr zu wenden. Elisabeth rutschte ein Stück von ihm weg. Ein Gefühl von Scham breitete sich in ihr aus, während seine Augen sie ungeniert anstarrten. Die anderen Frauen tauschten unbehagliche Blicke. Erleichterung trat in ihre Gesichter, als sich die Tür ein zweites Mal öffnete und die Meisterin einließ.