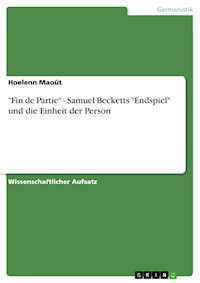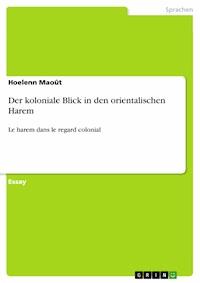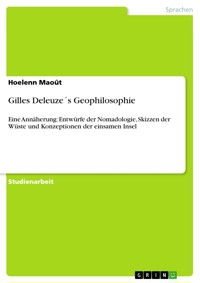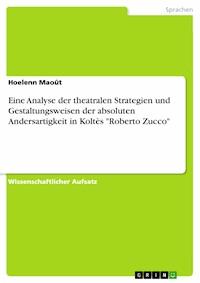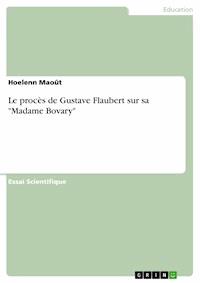15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich Germanistik - Sonstiges, Note: 1,0, Technische Universität Berlin (Institut für Literaturwissenschaft), Veranstaltung: Architektur und Schrift, Sprache: Deutsch, Abstract: Ganz allgemein gesprochen geht es in der vorliegenden Arbeit um die Dimensionen und Deutungen Jacques Derridas hinsichtlich der metaphorischen Kraft, welche, hier schon vorweg nehmend, im Verlauf dieser Ausführungen als die unbeherrschbare Kraft der Schrift charakterisiert wird. Da die Metapher jenseits der traditionellen Vorstellungen von der Schrift wesentliches über das Funktionieren der Sprache aussagt, und dies nicht nur im als fiktional definierten Diskurs der Literatur, ist es zunächst notwendig, durch einen einführenden Abschnitt auf die Problematik der Schrift und Sprache sowie auf deren unhinterfragte Prämissen und logische Folgerungen einzugehen, was Derridas Gesamtwerk wie ein roter Faden durchzieht und an dem es sich abzuarbeiten gilt. So befasst sich das erste Kapitel mit dem Sprachmodell des Saussurschen Strukturalismus sowie mit dessen Übergang und den Perspektivänderungen durch die sogenannte Postmoderne. Denn erst diese richtet ihren Blick auf die eigene Brille und insbesondere auf das, was ihrem Blick entweicht, die uneingestandenen Voraussetzungen, was speziell am Beispiel des Metapherndiskurses deutlich wird. Nach diesem formal-historischen Einstieg, welcher verkürzt als eine Überführung von der Differenz in die différance zusammengefasst werden kann, geht es im Weiteren explizit um die Derridaschen Modifikationen des Schrifttopos. Da diese Anreicherungen und Verkomplizierung der sprachlichen Strukturen in der Derridaschen Inszenierung seiner Texte insbesondere durch ihren performativen Aspekt eine sozial-politische Ausdehnung haben, verlangt ein semiotischer Textbegriff nicht nur Konsequenzziehung innerhalb der Literaturwissenschaft und Linguistik...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Page 1
HS: Architektur und Schrift
Technische Universität
SS 2005
Die doppelte Ankunft:
Von Metaphorizität oder die Metaphysik der Sprache
Von:
Hoelenn Maoût
Page 3
Die doppelte Ankunft:
Von Metaphorizität oder die Metaphysik der Sprache
1. Einleitung
Ganz allgemein gesprochen geht es in der vorliegenden Arbeit um die Dimensionen und Deutungen Jacques Derridas hinsichtlich metaphorischer Kraft, welche, hier schon vorwegnehmend, im Verlauf dieser Ausführungen als die unbeherrschbare Kraft der Schrift charakterisiert wird. Da die Metapher jenseits der traditionellen Vorstellungen von der Schrift wesentliches über das Funktionieren der Sprache aussagt, und dies nicht nur im als fiktional definierten Diskurs der Literatur, ist es zunächst notwendig, durch einen einführenden Abschnitt auf die Problematik der Schrift und Sprache sowie auf deren unhinterfragten Prämissen und logischen Folgerungen einzugehen, was Derridas Gesamtwerk wie ein roter Faden durchzieht und an dem es sich abzuarbeiten gilt. So befasst sich das erste Kapitel mit dem Sprachmodell des Saussurschen Strukturalismus sowie mit dessen Übergang und den Perspektivänderungen durch die sogenannte Postmoderne. Denn erst diese richtet ihren Blick auf die eigene Brille und insbesondere auf das, was ihrem Blick entweicht, die uneingestandenen Voraussetzungen, was speziell am Beispiel des Metapherndiskurses deutlich wird. Nach diesem formal-historischen Einstieg, welcher verkürzt als eine Überführung von der Differenz in diedifférancezusammengefasst werden kann, geht es im Weiteren explizit um die Derridaschen Modifikationen des Schrifttopos. Da diese Anreicherungen und Verkomplizierung der sprachlichen Strukturen in der Derridaschen Inszenierung seiner Texte insbesondere durch ihren performativen Aspekt eine sozialpolitische Ausdehnung haben, verlangt ein semiotischer Textbegriff nicht nur Konsequenzziehung innerhalb der Literaturwissenschaft und Linguistik, sondern auch über diese hinaus. Infolgedessen sollen am Ende dieses ersten Teils die Vorbedingungen für eine Interpretation des AufsatzesDie weiße Mythologienoch einmal zusammenfassend formuliert werden, um eine durch Querverbindungen erleichternde Lektüre zu versuchen, welche dabei jenseits der klassischen Unterteilung in philosophisch-argumentativen vs. literarisch-fiktiven Diskurs explizit zur Problematik der Intentionalität des Autors führt. Aufgrund dessen befasst sich der dann nachfolgende Gesichtspunkt mit den diskursiven Konfigurationen der Autorfunktion insbesondere während der Frühromantik, welche zudem die eben angesprochenen ausdifferenzierten Textklassen (argumentativ vs. fiktiv) ins Schwanken bringt.
Derridas Kritik an der Metaphysik sowie an der in dieser Tradition konzipierten Sprache mit Hilfe des Platonischen Entwurfs einer gedanklichen Welt in Abgrenzung zu einer sinnlichen manifestiert sich ergänzend auch außerhalb der klassischen Buchstabensprache, so beispielsweise im Werk des schweizerischen Architekten Bernard Tschumi. Da die Welt als
Page 4
Die doppelte Ankunft:
Von Metaphorizität oder die Metaphysik der Sprache
Text lesbar ist, ihre Normen und Hierarchien durch die verschiedenen Schriftmodi vorangetrieben und verschoben werden können, soll in einer dritten Etappe das Beispiel der Architektur und Architektonik erörtert werden, gerade weil ihr hartes und stabiles Material als letzte Bastion der Metaphysik die Derridasche Dezentrierung der Strukturen auf sinnliche Art und Weise zum Ausdruck bringen kann.
Letztlich muss in einer wissenschaftlichen Arbeit ihre formale Struktur eingehalten werden, so dass im Anschluss an die Lektüre und Auseinandersetzung mit den Derridaschen Texten und jenseits von diesen, Form und Inhalt der Eigenleistung reflektiert und diese in Zusammenhang zu dem sogenannten poststrukturalistischen Schreib- und Lesekonzept gesetzt werden.
2. Einführung in die Idee der Differenz: Die verrückte Mitte
Eine Voraussetzung für die Idee der Differenz ist der Auftritt des Signifikanten auf der akademisch-theoretischen Bühne im Zuge desLinguistic turn(Begriff geprägt durch den Philosophen Richard Rorty) zu Beginn des zwanzigsten Jh., was (bisher) sowohl für die Sozial- als auch die Geisteswissenschaften vielfältige Konsequenzen nach sich zog, insbesondere die Derridasche Dezentrierung der Strukturen und die der Interdisziplinarität. Dies bedeutet, dass das nun nachzuskizzierende sprachliche Zeichensystem des Strukturalismus und (im fließenden Übergang)dessogenannten Poststrukturalismus auf alle anderen akademischen Disziplinen ausgeweitet und als Analysemethode angewendet wird, so dass ein Paradigmenwechsel festgestellt werden kann. Die Naturwissenschaften hingegen richten ihren Blick (noch) nicht auf ihre eigenen Kodierungslogiken, um diese ständig zu hinterfragen, sondern formalisieren und funktionieren weiterhin nach binär strukturierten Denkmustern und dem Hegelschen dialektischen Argumentationsmodell (These, Antithese, Synthese), verharren hierbei in der Sehnsucht nach vermeintlich unikaler, nachweisbarer Wahrheit und Objektivität. DieGrammatologievon Jacques Derrida hingegen
„[diskutiert] im Modus einer Vervielfältigung der Ursprünge (...) verschiedene historische (Antike, 18. Jh., Moderne) und epistemologische (Philosophie, Linguistik, Anthropologie/ Ethnologie, Grammatologie) Urszenen der Schrift, in denen es um eine Reflexion jener verborgenen Bewegungen geht, die der Entstehung und Fixierung von bedeutungskonstituierenden Differenzen2
vorausgehen.“
Es sei zunächst bemerkt, dass bereits mit Aristoteles die Unterscheidung der Schrift in gute Schrift, d.h. „natürliche“ Schrift (so auch beispielsweise später die Kartesische Metapher vom