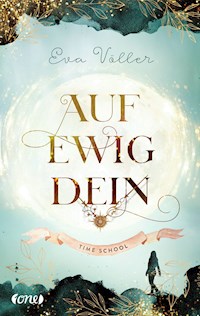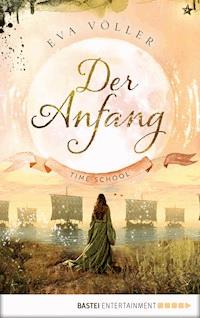9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Dorfschullehrerin
- Sprache: Deutsch
1964: Als Helene das Angebot erhält, an die Schule in Kirchdorf zurückzukehren, geht sie nur zögernd darauf ein, denn sie befürchtet, dass ihre Gefühle für den Landarzt Tobias ihr Leben erneut durcheinanderwirbeln könnten. Doch nicht nur diesem Problem muss sie sich stellen. An der Schule warten ungeahnte Herausforderungen auf Helene, die ihren ganzen Einsatz erfordern. Ihre zwölfjährige Tochter Marie zeigt sich zunehmend dickköpfig, und ihre Freundin Isabella hat eine Beziehung zu einem schwarzen GI, den die Dorfbewohner mit Argwohn betrachten. Die nahe Zonengrenze sorgt für zusätzlichen Zündstoff in dem kleinen Ort. Und dann wird Helene völlig unerwartet von den Schrecken aus ihrer Vergangenheit eingeholt. Plötzlich scheint alles auf dem Spiel zu stehen, was sie liebt ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 515
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressumWidmungTeil 1Kapitel 1Kapitel 2Kapitel 3Kapitel 4Kapitel 5Teil 2Kapitel 6Kapitel 7Kapitel 8Kapitel 9Kapitel 10Kapitel 11Teil 3Kapitel 12Kapitel 13Kapitel 14Kapitel 15Kapitel 16Kapitel 17Teil 4Kapitel 18Kapitel 19Kapitel 20Kapitel 21Kapitel 22Kapitel 23EpilogNachwortÜber dieses Buch
Band 2 der Reihe »Die Dorfschullehrerin«
1964: Als Helene das Angebot erhält, an die Schule in Kirchdorf zurückzukehren, geht sie nur zögernd darauf ein, denn sie befürchtet, dass ihre Gefühle für den Landarzt Tobias ihr Leben erneut durcheinanderwirbeln könnten. Doch nicht nur diesem Problem muss sie sich stellen. An der Schule warten ungeahnte Herausforderungen auf Helene, die ihren ganzen Einsatz erfordern. Ihre zwölfjährige Tochter Marie zeigt sich zunehmend dickköpfig, und ihre Freundin Isabella hat eine Beziehung zu einem schwarzen GI, den die Dorfbewohner mit Argwohn betrachten. Die nahe Zonengrenze sorgt für zusätzlichen Zündstoff in dem kleinen Ort. Und dann wird Helene völlig unerwartet von den Schrecken aus ihrer Vergangenheit eingeholt. Plötzlich scheint alles auf dem Spiel zu stehen, was sie liebt …
Über die Autorin
Eva Völler hat sich schon als Kind gern Geschichten ausgedacht. Trotzdem verdiente sie zunächst als Richterin und Rechtsanwältin ihre Brötchen, bevor sie die Juristerei endgültig an den Nagel hängte. »Vom Bücherschreiben kriegt man einfach bessere Laune als von Rechtsstreitigkeiten. Und man kann jedes Mal selbst bestimmen, wie es am Ende ausgeht.«
Die Autorin lebt mit ihren Kindern am Rande der Rhön in Hessen.
E V A V Ö L L E R
DieDorfschul-lehrerin
Wasdas Schicksalwill
ROMAN
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Originalausgabe
Copyright © 2022/2023 by Bastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6 – 20, 51063 Köln
Vervielfältigungen dieses Werkes für das Text- und Data-Mining bleiben vorbehalten.
Textredaktion: Anna Hahn, Trier
Umschlaggestaltung: Christin Wilhelm, www.grafic4u.deunter Verwendung von Illustrationen von © Elisabeth Ansley/arcangel; © Olga Sayuk/shutterstock; © Plasteed/shutterstock
eBook-Produktion: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7517-1043-5
luebbe.de
lesejury.de
Für Kerstin
Teil 1
KAPITEL 1
Helene stand auf dem Bahnsteig und hörte von ferne den nahenden Zug. Das Rattern der Räder wurde stetig lauter, gleich würde er einfahren. Sie hielt die Hand ihrer Tochter umklammert. Diesmal würden sie es schaffen! Niemand würde auftauchen und sie daran hindern, in diesen Zug zu steigen, der in die Freiheit fuhr. Hinüber in den Westen. Diesmal würde sie entkommen, zusammen mit Marie, und dann würden sie wohlbehalten ein paar Stationen weiter ihr Ziel erreichen. Sie würden am Bahnhof Zoo aussteigen, wo Jürgen, der sich ein paar Stunden vor ihnen auf den Weg gemacht hatte, bereits auf sie wartete.
Da, der Zug war schon in Sichtweite, in wenigen Sekunden würde er langsamer werden und anhalten. Helene ließ die Hand ihrer Tochter nicht los. Sie durfte Marie nicht aus den Augen lassen, unter gar keinen Umständen!
Und dann, als der Zug bereits abbremste und zum Stillstand kam, erschienen wie aus dem Nichts die beiden Männer auf der Bildfläche. Graue Mäntel, graue Hüte, graue, kalte Gesichter. Mit raschen Schritten hielten sie auf Helene und Marie zu.
Helene zog die Kleine an sich, legte ihr den Arm um die Schultern. Sie durfte ihr Kind auf keinen Fall loslassen!
»Sind Sie Helene Werner?« Die Worte klangen eiskalt.
Sie wollte lügen, einen falschen Namen nennen, irgendeinen. Oder wegrennen, mit Marie. Irgendwohin.
Aber es war zu spät. Der eine Mann holte die Handschellen hervor. Schon schnappten sie zu. Der andere Mann zerrte Marie von ihr weg, egal wie sehr Helene versuchte, das Kind festzuhalten.
»Mama, Mama!«, schrie die Kleine weinend.
»Lasst mich los!«, wollte Helene rufen, aber nur ein Stöhnen drang aus ihrem Mund. So wie immer, wenn der eine Mann Marie über den Bahnsteig von ihr fortbrachte, während sie selbst von dem anderen Mann in die entgegengesetzte Richtung geschubst und gezerrt wurde. So wie immer, ehe sie aufwachte und begriff, dass alles nur ein Traum gewesen war.
Ein Traum und gleichzeitig eine Erinnerung.
Helene schnappte nach Luft und starrte in die Dunkelheit des Schlafzimmers, während sie darauf wartete, dass ihr jagender Herzschlag sich beruhigte. Doch es dauerte lange. Die Gefühle aus dem Traum wollten nicht weichen. Das Grauen, die Angst, die Ungewissheit, die Hoffnungslosigkeit. Sie selbst im Stasiknast und Marie im Kinderheim.
In Gedanken sagte sie sich wieder und wieder, dass das alles vorbei war. Sie hatten es überlebt. Wenigstens sie und Marie.
Aber Jürgen nicht. Für ihn hatte es keinen Neuanfang gegeben, denn er war tot. Im Gefängnis der Staatssicherheit gestorben, angeblich an Herzversagen. In seiner unverbrüchlichen Loyalität hatte er den Fehler begangen, zu Frau und Kind in den Ostteil der Stadt zurückzukehren, getrieben von der Hoffnung, damit alles wieder zum Guten wenden zu können. Wie sehr er sich geirrt hatte!
Helene hatte hämmernde Kopfschmerzen, und der Nacken tat ihr ebenfalls weh. Diese Art von Albträumen setzte ihr jedes Mal auch körperlich stark zu, und in den letzten Monaten schienen sie deutlich häufiger vorzukommen als vorher. Genau genommen seit … Nein, sie wollte jetzt nicht an Tobias denken. Das machte alles nur noch schlimmer.
Mit kreisenden Bewegungen massierte sie ihre Schläfen und blickte auf die Leuchtanzeige ihres Weckers. Erst halb sechs. Eigentlich hätte sie noch eine Stunde liegen bleiben können, normalerweise stand sie unter der Woche nicht vor halb sieben auf. Doch sie wusste aus Erfahrung, dass sie nach diesem Traum sowieso nicht wieder einschlafen konnte, also entschied sie, das Beste daraus zu machen.
In Großtante Augustes altertümlichem, aber nobel ausgestatteten Badezimmer stieg sie in die klauenfüßige Wanne und duschte sich heiß ab, bevor sie vor dem dampfbeschlagenen Spiegel in frische Unterwäsche schlüpfte und die neue Strumpfhose überstreifte. Inzwischen trug sie zu Kleidern und Röcken nur noch solche Strumpfhosen. Im Vergleich zu den früher üblichen Strümpfen, die jedes Mal umständlich mit Strapsen an kneifenden Hüfthaltern befestigt werden mussten, waren die mittlerweile gängigeren Feinstrumpfhosen eindeutig ein Fortschritt. Und im Gegensatz zu früher musste sie sich auch nicht länger den Kopf darüber zerbrechen, ob sie sich diese modische Errungenschaft für immerhin stolze 2,95 DM überhaupt leisten konnte – von ihrem Gehalt gab sie sowieso nicht viel aus, denn Großtante Auguste weigerte sich beharrlich, einen Kostenbeitrag für Miete oder Essen anzunehmen, obwohl Helene immer wieder entsprechende Anläufe unternahm.
»Ihr seid doch meine Familie!«, wehrte Auguste solche Ansinnen regelmäßig ab. »Lass mir doch die Freude, für euch zu sorgen! Was soll ich denn sonst mit meinem Geld machen?«
Helene konnte nicht umhin, ihr zu glauben, denn ihre Großtante schien in ihrer Rolle als großzügige Mäzenin regelrecht aufzublühen. Davon abgesehen war die alte Dame tatsächlich recht wohlhabend. Die imposante Frankfurter Stadtvilla, in deren Erdgeschoss sie wohnten, war Augustes Eigentum, und allein das Einkommen, das sie mit der Vermietung der beiden oberen Etagen erzielte, reichte für einen sorglosen Lebenswandel aus. Daneben verfügte sie über eine sehr solide Witwenversorgung – ihr Ehemann war Bankier gewesen. Seit seinem Tod vor vielen Jahren war beständig mehr Geld in die Kasse gespült worden, als sie ausgeben konnte, und so hatte sich über einen langen Zeitraum hinweg ein beträchtliches Vermögen angesammelt. Immer wieder ließ sie durchblicken, wie glücklich es sie mache, ihre Familie unterstützen zu können.
Die Familie – das waren nicht nur Helene und Marie, sondern auch Helenes Vater Reinhold und seine zweite Frau Christa sowie deren betagte Mutter Else. Alle miteinander waren sie nach ihrer Flucht im Oktober 1961 bei Auguste untergekrochen, Knall auf Fall und buchstäblich über Nacht, direkt nach ihrer spektakulären Flucht über die Zonengrenze. Doch schon wenige Monate später war Reinhold mit seiner Frau und seiner Schwiegermutter wieder ausgezogen. Er hatte mit Augustes finanzieller Unterstützung in der hessischen Rhön eine Tierarztpraxis eröffnet – in Kirchdorf, dem Ort, wo Helene über ein halbes Jahr darauf gewartet hatte, dass er Marie zu ihr in den Westen brachte. Er hatte es ihr versprochen. Und am Ende hatte er es geschafft …
Helene verdrängte die bedrückenden Erinnerungen, weil sie dann unweigerlich auch wieder an Tobias denken musste – was sie nach Lage der Dinge lieber vermied.
Stattdessen schaute sie durch die Verbindungstür in das Zimmer ihrer Tochter. Blonde Locken ringelten sich über das zerknautschte Kopfkissen, sonst war nichts von Marie zu sehen. Das Mädchen hatte sich tief unter der Decke verkrochen und schlief noch fest.
Helene ging hinüber in die große Wohnküche, wo Großtante Auguste bereits Kaffee trank. Die alte Dame stand jeden Tag in aller Herrgottsfrühe auf. Makellos frisiert und adrett gekleidet wie immer saß sie am Tisch und las die Tageszeitung.
Überrascht blickte sie über den Rand der Frankfurter Allgemeinen, als Helene hereinkam. »Nanu, so früh heute?« Ein mitfühlender Ausdruck trat auf ihre feinen, von vielen Fältchen durchzogenen Gesichtszüge. »Wieder schlecht geträumt?«
Helene nickte stumm und goss sich ebenfalls eine Tasse Kaffee ein. Auguste reichte ihr wortlos einen Teil der Zeitung, und eine Weile lasen sie in einträchtigem Schweigen, jede für sich. Helene informierte sich über die aktuelle Weltpolitik, und Auguste überflog die Lokalnachrichten sowie die Todesanzeigen. Die studierte sie jeden Tag besonders sorgfältig, denn es kam häufig vor, dass der eine oder andere Verblichene zu ihrem Bekanntenkreis gehörte und sie deshalb kondolieren musste.
»Oje«, entfuhr es ihr. »Der Joachim Wiesfeld ist gestorben. Da muss ich zur Beerdigung.«
»Mein Beileid«, sagte Helene automatisch.
»Ach wo, den konnte ich nie leiden. Aber seine Frau, das ist eine Nette, mit der hab ich früher im Kirchenchor gesungen.«
»Hm«, machte Helene zerstreut. Sie konnte sich der Lektüre der Zeitung nur oberflächlich widmen, in Gedanken war sie woanders.
Großtante Auguste hatte schon immer ein feines Gespür für Helenes Befindlichkeiten gehabt. »Dir geht es gerade nicht so gut, oder? Du musst nicht drüber reden, wenn du nicht willst. Aber falls ich dir irgendwie helfen kann …« Teilnahmsvoll hielt sie inne. »Jeder Liebeskummer geht einmal vorbei, mein Kind. Das kann ich dir versprechen.«
Helene lächelte gequält. Wie so oft hatte Auguste einen Nerv getroffen. Ja, der Schmerz über die zerbrochene Beziehung saß immer noch tief, und manchmal, wenn Helene allein war, fing sie aus heiterem Himmel an zu weinen, weil sie Tobias so sehr vermisste. Wie hatte es nur so zwischen ihnen enden können?
Dabei hatten sie nicht mal richtig Schluss gemacht. Von einer Auszeit war die Rede gewesen, ganz modern, das klang nicht so endgültig, sondern höchstens nach einer Pause. Doch das war jetzt schon drei Monate her, und die Funkstille, die seitdem herrschte, machte ihr schwer zu schaffen. Er hatte sich nicht mehr gemeldet. Und sie sich auch nicht, denn das hätte sie zwangsläufig als Bittstellerin erscheinen lassen und so ausgesehen, als wollte sie sich seinen Vorstellungen fügen.
Ein paarmal hatte sie mit der Hand am Telefon dagesessen, aber sie hatte sich nicht überwinden können, die Wählscheibe zu drehen. Schließlich hatte sie auch ihren Stolz.
Dann wieder sagte sie sich trotzig, dass es seine Schuld war, weil er zu viel von ihr erwartet hatte. So, wie er es sich mit ihnen beiden erträumt hatte, konnte es nun mal nicht funktionieren. Seine Wünsche ließen sich mit ihren nicht in Einklang bringen. In der Mathematik nannte man das Inkongruenz.
Trotzdem wäre es vielleicht irgendwie gut gegangen, mit ihnen allen, wenn sich jeder nur ein bisschen mehr Mühe gegeben hätte …
Großtante Auguste riss Helene aus ihren Gedanken. »Ich kümmere mich mal um das Frühstück.« Die alte Dame stand vom Tisch auf und begab sich zur Anrichte, wo bereits die Zutaten für ein opulentes Frühstück bereitstanden. Sie ließ es sich nicht nehmen, Helene und Marie schon morgens alle möglichen Köstlichkeiten vorzusetzen, angefangen von frischen Brötchen und feinster Konfitüre über auserlesenen Aufschnitt bis hin zu frisch gepresstem Orangensaft. Für das Mittagessen, das meist ebenso reichhaltig ausfiel, sorgte regelmäßig Augustes altgediente Zugehfrau Adele, die eine fabelhafte Köchin war und obendrein die leckersten Torten zaubern konnte.
Als Helene damals nach ihrer Flucht bei Auguste Unterschlupf gefunden hatte, war sie sich nach den schrecklichen Monaten im Stasigefängnis vorgekommen wie im Schlaraffenland, und manchmal fühlte sie sich in der weitläufigen, vornehm eingerichteten Villenwohnung ihrer Großtante immer noch wie auf einem fremden Planeten. Eigentlich war das hier nicht ihre Welt, sie war in schlichten, bodenständigen Verhältnissen aufgewachsen, in einem kleinen alten Haus in einem thüringischen Städtchen, das nun auf dem Gebiet der DDR lag, direkt hinter der Zonengrenze. Auch später in Ostberlin war ihr Leben von Genügsamkeit geprägt gewesen. Keiner hatte da große Sprünge machen können, und abgesehen davon gab es viele Dinge einfach nicht. Während die Leute im Westen Ende der Fünfzigerjahre schon wieder alles Mögliche einkaufen konnten, hatte man in der DDR selbst für den alltäglichen Bedarf häufig vor den Läden anstehen müssen, und gewisse Luxusartikel suchte man dort auch heute im Jahr 1964 immer noch vergebens. Die Menschen in Westdeutschland schickten weiterhin Päckchen mit Bohnenkaffee, Kakao und Schokolade an ihre Verwandten und Bekannten in die Ostzone, und ein Ende dieser Verhältnisse war nicht in Sicht.
Helene sah auf ihre Armbanduhr – höchste Zeit, Marie zu wecken. Sie legte die Tageszeitung zur Seite und ging hinüber in das Zimmer ihrer Tochter. Dort schob sie zuerst die Vorhänge zur Seite und schaltete anschließend das Radio an, denn sie wusste, dass Musik bei Marie zuverlässig als Muntermacher wirkte. Im Moment war ein Song von den Beatles zu hören, eine englische Popgruppe, die gerade weltweit Furore machte. Die vier Sänger mit den pilzförmigen Haarschnitten waren Maries erklärte Lieblingsmusiker, sie konnte alle Lieder auswendig mitträllern.
She loves you, yeah, yeah, dudelte es aus dem Apparat, der auf dem Schreibtisch beim Fenster stand, doch an diesem Morgen schien die Radiomusik nicht zu fruchten. Marie blieb liegen und zog sich mit einem unwilligen Laut die Decke über den Kopf.
»Hoch mit dir, Schlafmütze!« Helene zupfte an der Bettdecke, bis der helle Lockenschopf wieder sichtbar wurde. »Zeit für die Schule!«
»Ich bin krank«, tönte es dumpf zwischen den Laken hervor.
»Was fehlt dir denn?«
»Ich glaub, ich hab Fieber.«
Helene fühlte ihr die Stirn. »Keine Spur«, stellte sie fest. »Nun mach schon, raus aus den Federn!«
»Ich hab Kopfweh. Und Bauchweh.«
Helene rechnete kurz nach. Marie bekam seit ein paar Monaten ihre Periode, und an jenen Tagen hatte sie wie viele junge Mädchen nicht zu knapp mit Unterleibsschmerzen zu kämpfen. Aber bis es wieder so weit war, dauerte es noch mindestens anderthalb Wochen, das konnte es also nicht sein.
Sie setzte sich auf den Rand von Maries Bett und strich sanft über die Decke. »Was ist los, Schätzchen?«
»Lass mich einfach nur in Ruhe, ja? Ich will nicht aufstehen. Mir geht es nicht gut. Ich kann heute auf keinen Fall zur Schule.«
Helene runzelte die Stirn. Mit einem Mal ahnte sie, woher die ungewohnte Aufmüpfigkeit kam. »Schreibt ihr zufällig eine Deutscharbeit?«
Ihre Tochter war eine sehr gute Schülerin, sie stand in allen Fächern zwischen eins und zwei, und das Lernen fiel ihr für gewöhnlich spielend leicht. Doch in der letzten Zeit hatte sie zunehmende Schwierigkeiten im Deutschunterricht. Mit Beginn der Quarta waren die Unterrichtsinhalte anspruchsvoller geworden, womöglich lag es daran. Allerdings vermutete Helene, dass Maries Widerwillen vorwiegend mit der neuen Klassenlehrerin zusammenhing. Diese Frau Buschmann war noch nicht lange an der Schule, Helene hatte sie erst einmal gesehen, auf dem Elternabend im vergangenen Halbjahr, wo der Direktor sie kurz vorgestellt hatte. Die vorherige Deutschlehrerin hatte aufgehört – sie hatte ein Kind bekommen.
Seitdem hatten Maries Leistungen in Deutsch und Geschichte – dem anderen Fach bei Frau Buschmann – deutlich nachgelassen. Und sie war nicht die Einzige, wie Helene aus Gesprächen mit mehreren Müttern wusste. Angeblich gebärdete sich die neue Klassenlehrerin im Unterricht wie ein veritabler Drachen, herrisch und herablassend, teilweise gar beleidigend. In der letzten Deutscharbeit hatte Marie eine Drei minus bekommen, garniert mit einem niederschmetternden Vermerk in roter Tinte: Fehlinterpretation! Miserabler Ansatz! Nur wegen fehlerfreier Rechtschreibung gerade noch befriedigend.
Helene fand an Maries Textinterpretation von Pole Poppenspäler nicht viel zu bemängeln, ihrer Meinung nach hätte es durchaus für eine bessere Note gereicht, aber sie kannte ja den Klassenschnitt nicht.
»Du hast zwei Möglichkeiten«, teilte sie ihrer Tochter mit. »Entweder du gehst zur Schule und schreibst die Arbeit mit. Oder ich gehe hin und rede mit Frau Buschmann, um herauszufinden, wieso du neuerdings diese Probleme hast.«
»Das machst du nicht!« Marie setzte sich ruckartig im Bett auf und starrte Helene entrüstet an.
»Soll ich etwa tatenlos zusehen, wie der Deutschunterricht dich krank macht?« Das war keineswegs bloß so dahingesagt, und ebenso wenig war es nur ein taktisches Manöver, damit Marie zur Schule ging. Tatsächlich war Helene entschlossen, baldmöglichst mit besagter Frau Buschmann zu sprechen, um sich ein persönliches Bild von dieser Lehrerin zu machen. Und um zu ergründen, was sie selbst tun konnte, damit ihr Kind wieder Freude am Lernen hatte. In allen Fächern, auch in diesem.
»Du schaffst das schon«, munterte sie ihre Tochter auf. »Willst du dich etwa von einer einfachen Deutscharbeit unterkriegen lassen?«
Grummelnd rang sich Marie dazu durch, doch noch aufzustehen. Sie verschwand im Bad, und Helene ging zurück in die Wohnküche, wo Großtante Auguste inzwischen das Frühstück hergerichtet hatte. Helene schenkte ihnen beiden Kaffee nach und widmete sich wieder der FAZ, diesmal, um richtig darin zu lesen.
In Innsbruck waren gerade die Olympischen Winterspiele zu Ende gegangen. Das Traumpaar im Eiskunstlauf, Marika Kilius und Hans-Jürgen Bäumler, hatte wider alle Erwartung keine Goldmedaille errungen, sondern sich mit Silber begnügen müssen – das Fernsehen hatte am Vortag schon eine Zusammenfassung gebracht.
In Wiesbaden war ein kleiner Junge entführt worden, mittlerweile war eine Lösegeldforderung eingegangen. Von dem Kind fehlte jedoch nach wie vor jede Spur. Helene hatte einen Kloß im Hals, als sie den Bericht las, denn sie hatte eine recht genaue Vorstellung davon, wie den Eltern jetzt zumute war. Nur allzu deutlich erinnerte sie sich an die Zeit vor vier Jahren. Die quälenden Monate, die sie in der Isolationshaft verbracht hatte. Keiner hatte ihr sagen wollen, was mit ihrem Kind geschehen war. Mit absichtlicher Grausamkeit hatte man ihr jede Information über Maries Verbleib vorenthalten.
Wochenlang hatte sie immer wieder flehen und betteln müssen, bis der Vernehmungsbeamte es ihr im Laufe eines der endlosen Verhöre schließlich doch noch erzählt hatte. Ganz beiläufig, in einem belanglos klingenden Nebensatz. So, wie er ihr auch mitgeteilt hatte, dass ihr Mann gestorben sei – als wäre es reiner Zufall und nicht weiter von Bedeutung.
Marie kam fertig angezogen in die Küche und setzte sich mit mürrischem Gesichtsausdruck zu ihr und Auguste an den Tisch. Helene faltete die Zeitung zusammen und legte sie zur Seite. Aufmerksam betrachtete sie ihre Tochter. Das frische junge Gesicht, das sorgsam zurückgekämmte und von einem Stirnreif gehaltene Lockenhaar, das ebenso ungebärdig war wie ihr eigenes. Jeder sagte, Marie gleiche ihr wie ein Ei dem anderen. Zwischen ihnen beiden bestand tatsächlich eine unübersehbare Ähnlichkeit, auch vom Körperbau her – die zartgliedrige Statur, der hohe Wuchs, die langen Beine.
Aber Marie hatte auch einiges von Jürgen, etwa die silbergrauen Augen oder die angedeutete Kerbe im Kinn; sein offenes Lachen, seine Art, den Kopf zur Seite zu legen und dabei die Nase zu krausen, wenn er etwas seltsam fand. In solchen Momenten glich sie ihrem Vater so sehr, dass es Helene manchmal den Atem verschlug. Dann erfasste sie wieder dieser ohnmächtige Kummer, weil Jürgen sein Kind nicht aufwachsen sehen konnte.
Ihre Trauer um ihn hatte sich im Laufe der Zeit zu einem unterschwelligen Gefühl des Verlusts abgemildert, sie empfand sein Fehlen nicht mehr wie eine offene Wunde, die bei jeder Berührung wehtat. Geblieben war jedoch das schmerzliche Bewusstsein, dass ihr Kind den innig geliebten Vater verloren hatte, das Leben in einer intakten Familie, in der es geborgen und sicher war. Das hatte die Stasi Marie genommen. Dieses Leid, das man ihrem Kind zugefügt hatte, hing immer noch wie ein unsichtbarer Schleier über den letzten Jahren. Der traumatische Heimaufenthalt, dann die Monate voller zermürbender Ungewissheit bei ihrem Großvater, zuletzt die lebensgefährliche Flucht – es grenzte schon an ein Wunder, dass das Kind diese Zeit offenbar ohne dauerhafte psychische Schäden überstanden hatte.
Mechanisch biss Helene von ihrem Marmeladenbrötchen ab und legte es zurück auf den Teller. Der Appetit war ihr vergangen, wie so oft, wenn sie an damals zurückdachte. Mit gespielter Fröhlichkeit fragte sie Marie, ob sie nicht Lust hätte, mal wieder ins Kino zu gehen, da seien sie doch schon länger nicht gewesen.
Marie zuckte verdrossen mit den Schultern, ließ sich dann aber immerhin zu einer Gegenfrage herab. »Was läuft denn gerade?«
Helene nannte aufs Geratewohl den Film, der ihr vorhin in einer Werbeanzeige im Kulturteil der Zeitung aufgefallen war. »Ein neuer James Bond. Liebesgrüße aus Moskau.«
Maries Miene hellte sich auf. »Oh! Mit Sean Connery?«
»Ich glaube schon.«
»Da würde ich sehr gerne reingehen!«
Helene lächelte ihre Tochter an. »Fein, abgemacht. Dann haben wir für Samstag was Schönes vor.«
Auguste reichte Marie ein säuberlich in Butterbrotpapier eingewickeltes Brötchen. »Da, bitte sehr, für die große Pause. Mit Schnittkäse, wie du es am liebsten magst.«
»Danke schön, Omili!« Marie strahlte die alte Dame an. Zwischen den beiden hatte von Anfang an eine ungetrübte Zuneigung geherrscht. Auguste vergötterte das Mädchen geradezu und las ihm jeden Wunsch von den Augen ab. Marie wiederum hing in kindlicher Inbrunst an der alten Frau und nannte sie zärtlich Omili – ein Vorschlag, der von Auguste gekommen war; sie sei zwar nur Maries Urgroßtante, aber es wecke so zauberhafte Erinnerungen in ihr, da sie selbst ihre Großmutter immer so genannt habe. Marie hatte nicht das Geringste dagegen. Ihre eigenen Großmütter hatte sie nie kennengelernt, da beide früh verstorben waren.
Helene begleitete Marie zur Wohnungstür und gab ihr zum Abschied einen Kuss auf die Stirn. »Mach’s gut, Schätzchen! Und keine Sorge wegen der Arbeit – du schaffst das schon! Ich drück die Daumen!«
Marie verzog ein wenig kläglich das Gesicht, dann schulterte sie ihren Schulranzen und sprang leichtfüßig die drei Stufen bis zur Haustür hinunter. Unten wandte sie sich noch einmal um und schaute stirnrunzelnd zu Helene hoch. »Du willst doch nicht ernsthaft mit der Buschmann über mich reden, oder?«
»Falls du befürchtest, dass sie dir dann noch schlechtere Noten verpasst – das wird nicht passieren.«
Marie wirkte nicht überzeugt. »Woher willst du das wissen?«
»Weil ich selbst unterrichte und mich mit solchen Gesprächen auskenne«, erwiderte Helene gelassen.
Marie machte keinen Hehl aus ihrem Unbehagen. »Mir wär’s ehrlich gesagt lieber, wenn du damit noch bis zum Ende des Schuljahres wartest, Mama. Das ist heute sowieso die letzte Deutscharbeit vor den Zeugnissen.«
Helene gab nach. »Na schön. Wenn du es unbedingt möchtest.«
Tatsächlich neigte das Schuljahr sich dem Ende zu. Es war bereits Mitte Februar, und die Versetzungszeugnisse würde es wie üblich vor den Osterferien geben. Falls Marie allerdings davon ausging, in der Mittelstufe eine neue Klassenlehrerin zu bekommen, täuschte sie sich. Auf diese Weise würde sich das Problem leider nicht in Luft auflösen: Die Buschmann würde der Klasse auch in der Untertertia erhalten bleiben, der Direktor hatte es auf dem Elternabend kurz erwähnt. Womöglich war das den Kindern noch gar nicht offiziell mitgeteilt worden.
Helene verkniff sich jedoch eine Bemerkung darüber. Sie winkte Marie noch ein letztes Mal zu, dann ging sie zurück in ihr Zimmer, um sich ebenfalls für die Schule fertigzumachen.
*
In den folgenden Stunden kam sie nicht mehr dazu, sich gedanklich mit Maries Schulproblemen zu befassen. Wie es aussah, hatte sie plötzlich selbst welche: Ohne Vorankündigung war ein Ministerialbeamter in ihrer Klasse aufgetaucht! Volle vier Unterrichtsstunden lang hatte er mit ernster Miene auf einem Stuhl hinten an der Wand gesessen und sich Notizen gemacht. Am Ende war ihr Unbehagen in jähe Sorge umgeschlagen – er hatte sie zu einer persönlichen Besprechung ins Dienstzimmer des Rektors gebeten! Und hier saß sie nun und war gefasst auf alle möglichen Vorhaltungen.
Der Rektor war ebenfalls anwesend. Er hatte einen zweiten Stuhl neben seinen geschoben, und Helene saß den beiden Männern auf der Besucherseite des Schreibtischs gegenüber, mit durchgedrückten Schultern und nervös ineinander verschlungenen Händen.
»Sie wirken ein wenig angespannt, Frau Werner«, meinte der Rektor. »Mir scheint, Sie haben noch gar keine Vorstellung von dem, was hier besprochen werden soll.«
»Ich … ähm, nein. Die habe ich in der Tat nicht.«
Der Ministerialbeamte räusperte sich. »Nun ja, ich hatte noch nichts durchblicken lassen, aber jetzt sitzen wir ja hier zusammen, um darüber zu sprechen, nicht wahr?«
»Worüber?«, platzte es aus Helene heraus.
»Über ihre Versetzung.«
»Versetzung?«, echote sie. So schlimm war es also. Ihr Unterricht war diesem Ministerialen ein Dorn im Auge. Irgendwer hatte sie angeschwärzt, vielleicht jemand von den Eltern. Da gab es einige, denen sie als Lehrerin suspekt war. Zu neumodisch für eine altehrwürdige Volksschule, zu wenig dem traditionellen Rollenbild von Mann und Frau verpflichtet. Das fing bei gemeinsamen Sportübungen in den mittleren Klassen an und setzte sich über ihre unorthodoxe Auswahl der Deutschlektüre fort, bis hin zu den manchmal unkonventionellen Themen im Sachunterricht. Es schmeckte längst nicht allen, wie sie den Unterrichtsstoff aufbereitete.
»Eine Versetzung an Ihre frühere Schule in Kirchdorf«, erläuterte der Ministerialbeamte.
Helene sank die Kinnlade herab. Der Mund blieb ihr offen stehen. Sie brauchte ein paar Schrecksekunden, um sich zu fassen. »Nach Kirchdorf?«, vergewisserte sie sich schließlich. Ihre Stimme klang rau vor Emotionen. Ungezählte Fragen schwangen darin mit.
Der Ministerialbeamte schien einzusehen, dass er sie mit seiner umständlichen Art auf die Folter spannte, und er beeilte sich, sie endlich umfassend zu informieren.
»Die Schule in Kirchdorf bedarf dringend einer neuen Leitung. Der bisherige Rektor ist vor vier Wochen in Pension gegangen.«
»Meinen Sie Herrn Wessel?«, fragte Helene entgeistert.
Der Beamte blätterte in seinem Notizbuch, in das er auch während Helenes Unterricht seine Anmerkungen eingetragen hatte. »Ganz recht, sein Name ist Wessel, inzwischen ist er aus dem Ort weggezogen. Davor hat er sich jedoch in wiederholten Eingaben dafür starkgemacht, Sie an die Schule zurückzuholen – als seine Nachfolgerin für die Schulleitung. Seit seinem Ausscheiden ist die Rektorenstelle vakant. Übergangsweise ist eine altgediente Lehrerin eingesprungen, eine Frau …« Erneutes Blättern.
»Fräulein Meisner«, half Helene ihm auf die Sprünge.
»Richtig. Fräulein Meisner. Doch sie will den Posten nicht und hat ebenfalls darum nachgesucht, unbedingt Sie als Rektorin einzusetzen. Mit insgesamt drei Eingaben in ebenso vielen Monaten. Eine weitere Empfehlung kam von dem früheren Rektor, einem Herrn …« Diesmal reichte ein kurzer Blick in die Notizen. »Winkelmeyer. Zusätzlich gab es ein befürwortendes Schreiben des örtlichen Bürgermeisters, Herrn Brecht. Nach alledem scheint man sich einig darüber zu sein, dass Sie zur Leitung dieser Dorfschule geeignet sind. Nachdem ich heute Gelegenheit hatte, Ihrem Unterricht beizuwohnen, neige ich dazu, diese Einschätzung zu teilen.« Er hielt kurz inne, um dann einschränkend hinzuzufügen: »Auch wenn mir persönlich Ihre Methoden vielleicht eine Spur zu … modern vorkommen. Doch Ihre früheren Kollegen scheinen Sie damit überzeugt zu haben. Und es entspricht ja auch der derzeitigen landespolitischen Linie, ganz egal, was ich selbst davon halten mag.«
»Vielen Dank«, sagte Helene, die nicht recht wusste, ob sie sich über diese Art von Lob freuen sollte.
Der Rektor, der bisher schweigend dagesessen hatte, meldete sich ebenfalls zu Wort. »Hier an unserer Schule wissen wir ebenfalls schon seit einer Weile, dass Frau Werner eine äußerst versierte und beliebte Lehrerin ist.«
Für Helene klang es so, als wollte er in Wahrheit Einwände gegen ihre Versetzung erheben, schließlich müsste dann jemand Neues her, der ihre Stelle übernahm. Neue Lehrkräfte bedeuteten erhöhten Aufwand, man wusste vorher nie, wer da kam. Manche wurden selten krank, andere ständig, so wie etwa Fräulein Meisner, die während Helenes Zeit an der Kirchdorfer Schule durch ihr häufiges Fehlen regelmäßig alle Unterrichtspläne durcheinandergebracht hatte.
Der Ministerialbeamte räusperte sich. »Wären Sie mit dieser Versetzung auf eine Stelle als Rektorin in Kirchdorf einverstanden?«
Eine Flut von Empfindungen brach bei dieser unverblümten Frage über Helene herein. Sie konnte unmöglich nach Kirchdorf zurück! Nicht nach diesem Debakel mit Tobias! Was für eine Situation würde sie heraufbeschwören, wenn sie auf einmal wieder da wäre!
Aber irgendwas musste sie wohl oder übel antworten. Hilflos suchte sie nach Worten. Mit einiger Erleichterung fiel ihr ein, dass sie zunächst mal ein paar Gegenfragen stellen könnte.
»Ab wann wäre das denn überhaupt?«
»Zu Beginn des neuen Schuljahres. Ich sagte ja, die Stelle ist schon seit Monaten vakant.«
Schon so bald! Helene schluckte.
»Bis dahin hätten Sie immerhin noch fast zwei Monate. Zeit genug, um einen Umzug zu organisieren. Wie ich hörte, lebt Ihr Vater in Kirchdorf, folglich haben Sie dort bereits Familienanschluss. Davon abgesehen ist laut den Bekundungen von Bürgermeister Brecht schon für eine angemessene Dienstunterkunft gesorgt. Die Hauptwohnung im dortigen Lehrerhaus steht leer und soll im Laufe des Schuljahres hergerichtet werden.«
Helene wusste, wovon er sprach, denn sie hatte seinerzeit selbst ein Zimmer in besagtem Lehrerhaus bewohnt. Die Hauptwohnung lag im Parterre; drei Zimmer, Küche, Bad, alles sehr geräumig, und ein Stück Garten gehörte auch noch dazu. Früher hatte Rektor Winkelmeyer mit seiner Gattin dort gelebt, und nach ihm war Herr Wessel von seinem Einzelzimmer in der oberen Etage in die Hauptwohnung gezogen, obwohl er alleinstehend war. Er hatte, wie er Helene einmal anvertraut hatte, einfach keine Lust mehr gehabt, sich mit Fräulein Meisner, die ebenfalls ein Zimmer im Obergeschoss bewohnte, über die Putz- und Nutzungspläne von Bad und Treppenhaus herumzustreiten.
»Vielleicht braucht Frau Werner ein wenig Bedenkzeit«, warf der Rektor ein – nach Helenes Gefühl nicht ganz uneigennützig. Bestimmt hoffte er, dass sie nicht aus Frankfurt wegwollte. Ein paar Wochen nach ihrem Dienstantritt im vergangenen Jahr hatten sie sich einmal länger persönlich unterhalten, unter anderem über die Unterschiede zwischen Dorf- und Stadtschulen. Helene hatte erwähnt, wie sehr sie die überschaubaren Klassengrößen und die säuberlich eingeteilten Unterrichtsinhalte an ihrer neuen Arbeitsstätte zu schätzen wisse – was die Wahrheit war. In einer städtischen Schule brauchte man nicht damit zu rechnen, plötzlich drei oder gar vier Jahrgangsstufen auf einmal vor sich zu haben und beim Stoff entsprechend improvisieren zu müssen. Was das betraf, so herrschte in den ländlichen Gegenden wegen des immer noch anhaltenden Lehrermangels mancherorts das reinste Chaos.
Außerdem wusste der Rektor, dass ihre Tochter in Frankfurt aufs Gymnasium ging und dass sie in einer vornehmen Villa im Frankfurter Westend logierten, Personal und Verpflegung inbegriffen. Draußen in der Rhön wäre es mit diesem Komfort schlagartig vorbei. Auf dem Dorf lebte man bescheiden. Höhere Schulen, Kinos, gut sortierte Supermärkte, Kaufhäuser, die zum Bummeln einluden – für die Erfüllung solcher Wünsche musste man stundenlang durch die Gegend fahren.
»Natürlich können Sie erst mal drüber schlafen und sich alles genau überlegen. Auf ein paar Tage kommt es jetzt auch nicht mehr an. Allerdings müsste ich bis Ende der Woche Bescheid wissen.« Der Ministerialbeamte zog eine Visitenkarte mit dem Aufdruck des hessischen Staatswappens hervor und schob sie Helene über den Schreibtisch zu. »Bitte sehr, meine Telefonnummer. Rufen Sie mich einfach innerhalb der Bürozeiten an. Falls ich persönlich nicht erreichbar sein sollte, können Sie Ihre Entscheidung auch meiner Sekretärin mitteilen. Es war nett, mit Ihnen zu plaudern, vielen Dank!« Mit diesen Worten erhob er sich. Verdattert stand sie ebenfalls auf und schüttelte die dargebotene Hand. Auch der Rektor gab dem Besucher zum Abschied die Hand und wartete, bis der Ministerialbeamte den Raum verlassen hatte.
»Auf ein Wort, Frau Kollegin«, sagte er, als Helene ebenfalls hinausgehen wollte.
Mit einem inneren Seufzen blieb sie stehen. Sie konnte sich leicht vorstellen, was er jetzt hören wollte: Dass sie auf gar keinen Fall daran dachte, wirklich an die Landschule zurückzukehren.
Doch mit seiner nächsten Bemerkung überraschte er sie. »Wenn Sie mich fragen, sollten Sie den Posten annehmen. Diese Chance kommt so schnell nicht wieder.«
Sie konnte den Rektor nur erstaunt ansehen. Hatte sie ihn so falsch eingeschätzt?
Er schien ihre Gedanken zu erraten und lachte ein wenig kläglich. »Glauben Sie mir, ich lasse Sie nur äußerst ungern ziehen, Frau Werner! Allein der Aufwand, bis jemand Neues eingearbeitet ist, ganz zu schweigen von der Frage, ob überhaupt so schnell für Ersatz gesorgt werden kann! Aber ich weiß, wie gern Sie weiterkommen möchten, und es gehört nun mal zu den Tatsachen, dass Sie so eine Beförderung innerhalb der nächsten zehn Jahre unter normalen Umständen kaum erwarten können. Nicht in Ihrer Dienstaltersstufe.«
Helene versagte sich den Hinweis, dass sie vor ihrer Zusatzausbildung bereits etliche Jahre an DDR-Schulen unterrichtet hatte. Sie war keineswegs so neu in dem Beruf, wie seine Bemerkung anklingen ließ. Doch in gewisser Weise hatte er recht – ihre Jahre als Lehrerin in der DDR wiesen offiziell nicht denselben Stellenwert auf wie eine gleich lange Dienstzeit in der BRD. Das war ihr damals schon bei ihrer Anstellung als Hilfslehrerin klargemacht worden. So gesehen grenzte es wohl an ein Wunder, dass ihr diese unerwartete Beförderung angetragen wurde.
Andererseits – es gab kaum Lehrer, die ins Zonenrandgebiet ziehen wollten, ob als Rektor oder einfacher Dorflehrer. Die Arbeit da draußen verlangte einem einiges ab. Man musste ständig improvisieren, und wer dazu nicht bereit war, hatte schon verloren. Es war eine Herausforderung ganz eigener Art.
Kirchdorf … Allein bei dem Gedanken musste sie tief durchatmen. Kirchdorf, da war Tobias.
Und genau das war das Problem.
Schon deswegen sollte sie es sich gut überlegen. Wie musste es für ihn aussehen, wenn sie sich plötzlich wieder in Kirchdorf häuslich niederließ? Vor allem, nachdem sie so häufig betont hatte, dass sie schlecht von Frankfurt wegkönne? So oder so, sie stand vor einem Dilemma.
*
»Was sagt dir denn dein Herz?«, erkundigte sich Großtante Auguste, als Helene ihr gleich nach der Schule von dem Angebot sowie ihren damit zusammenhängenden Bedenken erzählte.
»Das Herz ist bei mir kein guter Ratgeber«, entgegnete Helene. »Deshalb wollte ich eigentlich nur den Verstand entscheiden lassen.«
Die alte Dame verzog keine Miene. »Dann ohne Herz. Lass der reinen Vernunft den Vortritt. Tu einfach so, als gäbe es Tobias nicht. Oder als würde er im Ausland leben. Wie würdest du dann entscheiden? Ich meine, aus beruflicher Sicht.«
»Rein beruflich? Ich würd’s machen«, erwiderte Helene spontan. Leicht verwundert über ihre impulsive Antwort zog sie die Stirn kraus. »So eine Chance kommt so schnell nicht wieder«, fügte sie hinzu. In dem Punkt hatte der Rektor völlig recht gehabt, und je länger sie darüber nachdachte, umso dümmer erschien es ihr, diesen unverhofften Karrieresprung sausen zu lassen. Vor der damit verbundenen Arbeit und den neuen Aufgaben scheute sie nicht zurück. Sie wusste, dass sie das hinbekam. »Trotzdem, ich kann ja nicht nur an mich selbst denken«, fuhr sie fort. »Marie hat sich an das Leben in der Stadt gewöhnt, sie hat nette Freundinnen.«
Ganz zu schweigen davon, wie froh Marie gewesen war, als die Treffen mit Tobias und seinem Sohn aufgehört hatten. Die beiden Kinder hatten nie einen Draht zueinander gefunden, und mit Tobias war Marie auch nicht wirklich warm geworden. Unter all den Gründen, die Helene und ihn schließlich auseinandergebracht hatten, war das womöglich der ausschlaggebende gewesen. Doch davon sprach Helene lieber nicht.
»So richtig eng sind diese Freundschaften nicht«, warf Auguste ein. »Wie oft trifft sie sich denn mit ihren Klassenkameradinnen außerhalb der Schule?«
»Selten«, räumte Helene ein. Marie hatte bei ihrem Wechsel aufs Gymnasium eine festgefügte Klassengemeinschaft vorgefunden und war zudem älter als die meisten anderen Mädchen, weil sie nach ihrer Flucht aus der DDR zuerst noch für ein halbes Jahr die Volksschule besucht hatte. Das amtliche Prozedere für einen Wechsel mitten im Schuljahr hätte sich zu lange hingezogen, sodass Helene ihren ursprünglichen Plan, Marie gleich aufs Gymnasium zu schicken, zu ihrem Bedauern hatte aufgeben müssen.
»Ich müsste ihr dann aber schon wieder einen Schulwechsel zumuten«, sagte Helene. »Das wäre schon der dritte – nein, der vierte! – in vier Jahren! Sie müsste nach Hünfeld aufs Gymnasium, und obendrein müsste sie dann mit dem Bus fahren.«
»Ich bitte dich, das sind doch gerade mal dreißig Minuten. Und vielleicht hat sie überhaupt nichts dagegen, woanders zur Schule zu gehen. In der letzten Zeit hatte ich den deutlichen Eindruck, dass sie sich auf dem hiesigen Gymnasium nicht mehr wohlfühlt.«
Das konnte Helene schlecht abstreiten, denn sie hatte seit einer Weile denselben Eindruck. Genau genommen, seit Frau Buschmann Maries neue Klassenlehrerin war.
»Du hast recht«, stimmte sie notgedrungen zu.
»Davon abgesehen hast du einen ganz besonders wichtigen Aspekt noch gar nicht bedacht«, erklärte Auguste. »Nämlich, dass dein Vater ebenfalls in Kirchdorf lebt und vor lauter Begeisterung völlig aus dem Häuschen wäre, wenn er seine einzige Tochter mitsamt seinem Enkelkind auf einmal in der Nähe hätte.«
Das traf allerdings zu. Ihr Vater würde gewiss einen Freudensprung machen, wenn er hörte, dass Helene nach Kirchdorf zurückkehren wollte. Falls sie es wollte. Und das war und blieb fraglich. Denn da war schließlich auch noch Auguste. Die alte Dame war zwar körperlich noch recht rüstig und geistig voll auf der Höhe, aber mit ihren fast achtundachtzig Jahren doch in einem sehr fragilen Alter.
Als hätte Auguste Helenes Gedanken gelesen, brachte sie mit ihrer nächsten Bemerkung von allein die Sprache darauf.
»Und komm bloß nicht auf den Gedanken, aus Rücksicht auf mich in Frankfurt zu bleiben!«, sagte sie. »Ich bin zwar schon steinalt, aber weit davon entfernt, hilfsbedürftig zu sein.« Einschränkend fuhr sie fort: »Nun ja, vielleicht nicht sehr weit. Aber doch genug, um noch für eine ganze Weile problemlos allein zurechtzukommen.« Nach kurzem Nachdenken ließ sie eine weitere Einschränkung folgen. »Mit Unterstützung meiner lieben Perle Adele, versteht sich.«
»Für mich klingt das fast so, als wolltest du uns loswerden«, meinte Helene trocken.
Auguste schien die Bemerkung so aufzunehmen, wie sie gedacht war: als scherzhafte Auflockerung dieses in Wahrheit ernsten Gesprächs. »Du weißt, wie wichtig ihr beiden mir seid, du und die Kleine. Wie sehr es mein Leben erfüllt und bereichert hat, euch um mich zu haben. Wenn ich die Wahl hätte, allein zu leben oder in eurer Gesellschaft, würde ich keine Sekunde mit der Antwort zögern. Euch hier zu haben ist die größte Freude, die mir in meinen späten Jahren widerfahren konnte.« Sie besann sich und setzte mit einem leisen Lächeln hinzu: »Ich gestehe allerdings, dass die ersten Monate ziemlich anstrengend waren. Aber das lag hauptsächlich an Else. Die hatte mir einfach zu viele Haare auf den Zähnen.«
Davon konnte auch Helene ein Liedchen singen. Die Schwiegermutter ihres Vaters war ein streitbares altes Unikat, sie hatte zu allem und jedem ihre eigene Meinung, mit der sie selten hinterm Berg hielt.
»Kurzum, nichts läge mir ferner, als dich und Marie rauszuekeln«, betonte Auguste. »Aber bist du denn hier wirklich glücklich? Und für Marie gilt dasselbe. Es kommt mir so vor, als würde euch beiden etwas Wichtiges fehlen.«
Marie kam in die Küche geschneit, viel früher als erwartet, offenbar war die letzte Stunde ausgefallen. »Wer will hier wen rausekeln? Und was soll uns denn hier fehlen?«
»Wir unterhalten uns gerade über das Stellenangebot, das man deiner Mutter gemacht hat«, erwiderte Auguste.
»Ach ja? Also eine Versetzung? Wo wäre das denn?«
»In Kirchdorf«, sagte Helene.
Marie verzog das Gesicht. »Wirklich? Du willst doch nicht ernsthaft wieder da raus in diese Einöde, Mama! Was sollen wir denn da?«
»Ich überlege noch«, gab Helene zurück. »Wir hätten dann Opa und Tante Christa in unserer Nähe. Und du würdest auf das Gymnasium in Hünfeld gehen.« Aufmerksam musterte sie das Gesicht ihrer Tochter. Marie runzelte zweifelnd die Stirn, aber die Aussicht, auf eine andere Schule zu gehen, schien sie weit weniger zu stören als befürchtet. Und ihren Opa liebte sie heiß und innig. Doch besonders angetan wirkte sie auch nicht.
»Muss das denn unbedingt sein? Da gibt’s doch überhaupt nichts! Ich meine – die haben nicht mal ein Kino da! Das ist ein langweiliges Dorf!« Ein Hauch von Misstrauen zeigte sich in Maries Zügen. »Es hat doch nichts mit Tobias zu tun, dass du da hinwillst, oder?«
»Nein«, sagte Helene wahrheitsgemäß. »Es ist eine berufliche Chance, wie sie so schnell nicht wiederkommt. Trotzdem habe ich noch nicht zugesagt. Ich denke noch darüber nach.«
Doch bei diesen Worten war ihr bereits klar, dass sie die Entscheidung schon gefällt hatte.
KAPITEL 2
Tobias setzte das Stethoskop unterhalb des Schulterblatts an und lauschte dem Geräusch, das aus der Lunge des Patienten drang. Er klopfte ein weiteres Mal den Brustkorb ab, doch das klang genauso besorgniserregend wie zuvor.
»Sie können sich wieder anziehen, ich schreib Ihnen was auf«, sagte er zu Anton Hahner, der mit nacktem Oberkörper vor ihm stand. Der Landwirt war der Vater von Agnes, Tobias’ junger Sprechstundenhilfe, die mit ernster Miene im Hintergrund wartete.
Während Anton sich hustend hinter dem Wandschirm Hemd und Pullover überstreifte, stellte Tobias ein Rezept für ein Antibiotikum aus.
»Sorg dafür, dass er es auch nimmt«, sagte er zu Agnes. »Und dass er in drei Tagen nochmal zur Untersuchung herkommt. Er hat es ziemlich lange verschleppt, oder?«
Sie nickte resigniert, und Tobias fragte sich, wie häufig sie in den letzten Wochen wohl versucht haben mochte, ihren Vater zu überreden, endlich zum Arzt zu gehen. Anton Hahner war einer vom harten Schlag, felsenfest davon überzeugt, dass jede Krankheit von allein vorüberging, wenn man nur lange genug durchhielt. Wahrscheinlich hatte er sich mit Flaschen voller eigenhändig gebrauter Hustentinktur selbst kuriert, ehe er sich dazu durchgerungen hatte, doch noch zum Arzt zu gehen. Noch schlimmer war es bei seiner Frau Hilde, die machte um jeden Doktor einen weiten Bogen.
Agnes schickte den nächsten Patienten herein, Albert Exner, den alten Vater der Gastwirtin, der wegen der Phantomschmerzen seines amputierten Arms regelmäßig Medikamente benötigte.
Während Tobias sich um Albert kümmerte, hörte er im Vorzimmer das Telefon läuten. Es kam immer häufiger vor, dass in der Praxis angerufen wurde – die Anzahl der Leute, die über einen privaten Telefonanschluss verfügten, vergrößerte sich zusehends, und so riefen sie an und fragten nach einem Termin, statt wie sonst einfach vorbeizukommen.
Eigentlich war es ein vernünftiger Gedanke, auf diese Weise alle anfallenden Behandlungen planbar zu gestalten. Doch die Masse derjenigen, die weiterhin Tag für Tag unangemeldet zur Sprechstunde erschienen, überwog die Zahl der Terminsuchenden immer noch um ein Vielfaches. Eine Vorzugsbehandlung von denen, die sich telefonisch anmeldeten, scheiterte schlichtweg am vollen Wartezimmer, weshalb Tobias Agnes angewiesen hatte, keine festen Termine mehr zu vergeben – es gab bloß Ärger, wenn die Leute dann trotzdem warten mussten. Dennoch riefen immer wieder welche an und versuchten ihr Glück.
Agnes hatte im Vorzimmer abgehoben, ihre Stimme war durch die angelehnte Verbindungstür zu hören. Tobias verstand nicht, was sie sagte, doch ihr Tonfall klang überrascht. Und im nächsten Moment läutete der Apparat auf seinem Schreibtisch. Sie hatte das Telefonat zu ihm durchgestellt.
Er hob sofort ab, denn Agnes leitete Anrufe nur dann an ihn persönlich weiter, wenn es sehr wichtig war. Etwa, wenn Isabella anrief und seine Unterstützung bei einer Entbindung brauchte. Als erfahrene Hebamme konnte sie genau einschätzen, wann es brenzlig wurde. Sie kontaktierte ihn wirklich nur bei ernsthaften Problemen, und dann musste es regelmäßig schnell gehen.
»Krüger«, meldete er sich.
Am anderen Ende der Leitung war ein tiefer Atemzug zu hören, dann sagte eine vertraute Stimme: »Helene hier. Grüß dich, Tobias.«
Sofort schlug sein Herz einen schmerzhaften Trommelwirbel.
»Helene«, brachte er bloß hervor. Er merkte, dass seine Stimme belegt klang, und räusperte sich.
Sie räusperte sich ebenfalls. »Ich hoffe, ich störe nicht.«
»Nein, nein«, sagte er rasch. »Ich habe Zeit.«
Der alte Albert Exner, der auf der Untersuchungsliege saß, wandte ihm das faltige Gesicht zu. Er hatte nur noch ein Auge – das andere hatte er ebenso wie den Arm im Krieg verloren –, doch das wirkte sehr interessiert.
Tobias hob fahrig die Hand, in einer Geste, die alles Mögliche besagen konnte, angefangen von Hab einen Moment Geduld über Hör bitte mal kurz weg bis hin zu Tut mir leid, das hier ist wichtig.
»Was liegt an?«, fragte er, in einer, wie er hoffte, angemessen zurückhaltenden Weise. »Ich hoffe, ihr seid alle gesund über den Winter gekommen.«
»Oh, ja, es geht uns gut«, erwiderte sie. Auch ihre Stimme klang reserviert, und Tobias hatte den deutlichen Eindruck, dass dieser Anruf ihr widerstrebte. Ganz sicher hatte sie sich nicht deshalb gemeldet, weil sie ihn vermisste, sondern weil es irgendeinen triftigen Grund gab. Er spürte, wie etwas, das gerade in ihm hatte aufblühen wollen, binnen Sekundenbruchteilen welkte und erstarb.
»Ich wollte dir gern etwas erzählen, bevor du es von anderen hörst.«
Sie hat einen Neuen, durchfuhr es ihn. Der Schmerz, bis eben noch vage und erträglich, verdichtete sich zu seinem Brennen.
»Ich komme demnächst nach Kirchdorf zurück. Man hat mir die Stelle der Schulleiterin angeboten, und ich möchte sie annehmen. Es ist … eine unglaubliche Chance.«
Tobias hielt die Luft an. Sie kam zurück! Der Schmerz verflog auf der Stelle und wurde durch jähe Hoffnung ersetzt. Eine Hoffnung, die indessen ebenso unvernünftig wie unangebracht war, wie er bei ihren nächsten Worten erkannte.
»Ich wollte das gern vorher mit dir klären«, meinte sie. »Also nicht, dass du denkst, ich würde … ich hätte im Sinn, dass wir beide vielleicht …« Sie hielt in erkennbarer Verlegenheit inne, ehe sie in förmlicherem Ton hinzufügte: »Ich möchte dich mit meiner Rückkehr auf keinen Fall in Verlegenheit bringen. Dahinter stehen wirklich nur rein berufliche Motive.«
»Gewiss«, sagte er höflich. »Ich hatte schon davon gehört, dass sie dich hier gern als Rektorin hätten. Ich dachte nur nicht, dass ein Leben auf dem Dorf für dich von Interesse wäre.«
Darauf ging sie nicht ein, und er selbst hielt auch lieber den Mund. Das Schweigen zwischen ihnen schien sich zu einer Ewigkeit auszudehnen.
»Ich wollte nur vermeiden, dass du dich vor den Kopf gestoßen fühlst, wenn ich auf einmal wieder da bin«, erklärte sie schließlich ein wenig steif.
»Etwa, indem ich mich darüber wundere, weil du auf einmal für dein berufliches Fortkommen auf die vielen Vorzüge der Großstadt verzichten möchtest?« Die Worte waren ihm herausgerutscht, und er bereute sie sofort. Am liebsten hätte er die unbedachte Bemerkung zurückgenommen, auch wenn sich die Wahrheit kaum leugnen ließ: Für ihren Beruf wollte Helene besagten Verzicht auf sich nehmen. Um der Karriere willen ließ sie die Annehmlichkeiten der Großstadt sausen. Für ein gemeinsames Leben mit ihm hatte sie das nicht fertiggebracht. Sie hatte schon immer ihre Prioritäten gehabt, und er hatte nie an erster Stelle gestanden. Höchste Zeit, dass er das endlich begriff.
»Wenn du so darüber denkst, ist das dein gutes Recht.« Ihre Stimme klang ausdruckslos. »Wie dem auch sei, jetzt weißt du jedenfalls Bescheid. Sicher laufen wir uns in Zukunft wieder das eine oder andere Mal über den Weg, das ist ja unausweichlich, und da wollte ich das einfach vorher mit dir besprochen haben.« Sie holte tief Luft, dann schloss sie: »Ich hoffe, es geht dir und deiner Familie gut. Richte Michael und Beatrice schöne Grüße von mir aus, ja? Bis dann, Tobias.«
Bevor er noch etwas sagen konnte, hatte sie aufgelegt. Aufgewühlt starrte er den Hörer in seiner Hand an. Seine Fingerknöchel waren weiß, so fest hielt er das Ding umklammert. In der letzten Zeit hatte er ernstlich geglaubt, er wäre über sie hinweg. Endlich, nach über drei Monaten. Er hatte wieder häufiger lachen und sich über alltägliche Dinge freuen können. Hatte wieder mehr Spaß am Leben gehabt, zumindest, soweit ihm die Arbeit Raum dafür ließ. Er war sogar zwei-, dreimal ausgegangen, und das waren ganz private Vergnügungen gewesen, nicht die obligatorischen sonntäglichen Unternehmungen mit seinem Sohn und seiner Tante. Erst kürzlich hatte er die Karnevalsveranstaltung des Schützenvereins besucht und sich dabei nicht schlecht amüsiert. Vergangenen Monat war er mit seinem alten Studienfreund Udo in einem Wiesbadener Tanzclub gewesen. Sie hatten beide bis in die frühen Morgenstunden mit attraktiven Frauen getanzt, in prächtiger Stimmung und um keinen Witz verlegen. Udo, frisch geschieden und unternehmungslustig, hatte ihn ermuntert, sich eine an Land zu ziehen, wie er es ausgedrückt hatte. Udo selbst war dann auch Arm in Arm mit einer enthemmt kichernden Rothaarigen abgezogen. Deren Freundin, brünett und mit laszivem Augenaufschlag, hatte offen durchblicken lassen, dass sie auf Ähnliches aus war, ohne dabei mehr zu erwarten als ein heißes Abenteuer. Doch diesen letzten Schritt hatte Tobias nicht gehen können. Nach einem Abschiedsdrink hatte er den Rest der Nacht allein verbracht, in einem Hotel, weil Udo das Apartment, das er seit seiner Scheidung bewohnte, für sich und seine neue Flamme brauchte.
Hinterher war Tobias ins Grübeln darüber geraten, wieso zum Teufel er sich diese Zurückhaltung auferlegt hatte, doch diese Frage hatte er sich recht schnell selbst beantworten können: Helene war immer noch in seinen Gedanken. Mehr noch, sie steckte ihm im Blut, wie ein Virus, das sich nicht so leicht loswerden ließ. In manchen Nächten wurde er wach und streckte die Hand nach ihr aus, weil er sie gerade noch im Traum neben sich gespürt hatte. Doch da waren jedes Mal nur die leere Bettseite und die Einsamkeit, die ihn seit der Trennung erfüllte.
Ein rasselndes Schnarchen riss ihn aus seinen Gedanken. Perplex drehte Tobias den Kopf in Richtung des Geräuschs. Der alte Albert hatte es sich auf der Untersuchungsliege bequem gemacht und war tief und fest eingeschlafen.
*
Isabella war nicht allzu überrascht, als Helene ihr eröffnete, dass sie demnächst nach Kirchdorf zurückkehren würde. Trotzdem freute sie sich unbändig. Bald hatte sie ihre beste Freundin wieder in der Nähe!
Strahlend sah sie Helene an. »Eigentlich wussten es schon alle«, erklärte sie. »Harald hat bereits am Montag im ganzen Dorf herumposaunt, dass es quasi amtlich ist.«
Helene hob die Brauen. »Ich hab erst heute Morgen im Ministerium angerufen und die Stelle angenommen!«
»Da siehst du mal, wie kurz die Informationswege bei wirklich wichtigen Fragen sind«, sagte Isabella grinsend.
Sie aß einen Bissen Frankfurter Kranz. Helene und sie saßen in einem kleinen Café in der Nähe der Zeil. Ab und zu verabredeten sie sich zum Kaffeetrinken oder Bummeln, und für Isabella waren diese Zusammenkünfte mit Helene immer eine willkommene Abwechslung vom alltäglichen Einerlei. Vor allem aber boten sie einen Anlass, gelegentlich einen Ausflug in die Großstadt zu machen. Das Leben auf dem Dorf konnte recht öde sein, erst recht, wenn man in einem Kaff im Zonenrandgebiet lebte. Da war für gewöhnlich noch weniger los als in anderen ländlichen Gegenden. Wer wie sie gerne tanzen ging, musste jedes Mal etliche Kilometer weit fahren. Inzwischen hatte sie einen Wagen, das war nicht mehr das Problem. Aber zugleich bedeutete es, dass sie an solchen Abenden dem Alkohol entsagen musste, obwohl das Feiern mit einem kleinen Schwips viel mehr Spaß machte.
»Weißt du, dass im Dorf Wetten darauf abgeschlossen worden sind?«, fragte sie mit einem Augenzwinkern, während sie ihren Kaffee umrührte.
»Worauf?«, fragte Helene zurück. Sie errötete leicht, ein Zeichen dafür, dass sie genau wusste, was Isabella meinte.
»Na, dass du zurückkommst. Freuen können sich darüber jetzt alle. Die einen, weil sie dich gut leiden können, die anderen, weil sie wieder jemanden haben, über den sie lästern können. Du weißt ja, unverheiratete Frauen wie du und ich sind das beste Klatschthema.«
Die Röte in Helenes Wangen vertiefte sich. Sie hob ihre Kaffeetasse, als wollte sie ihr Gesicht dahinter verbergen. »Es ist bloß wegen der Stelle. Ich hoffe, das ist den Leuten klar.«
»Natürlich«, sagte Isabella und zwinkerte ihr zu.
Helene stellte ihre Tasse wieder ab, es klirrte vernehmlich. »Es ist so, wie ich sagte, Isa. Ich möchte einfach die Gelegenheit nutzen, beruflich einen großen Schritt weiterzukommen. Wann bekommt man schon mal so eine Chance …«
»Wenn du meinst«, gab Isabella nachsichtig zurück, ohne die Sache zu vertiefen. Helene war allzu deutlich darauf bedacht, sich gefühlsmäßig bedeckt zu halten.
Davon abgesehen hätte Isabella in diesem Moment ohnehin keine weiteren Fragen stellen können, denn an der Eingangstür des Cafés war Unruhe entstanden. Ein schwarzer G.I. hatte in Begleitung einer blonden jungen Frau das Lokal betreten. Noch bevor das Paar einen der freien Tische ansteuern konnten, wurden aus mehreren Richtungen widerwärtig rassistische und beleidigende Bemerkungen laut. »Amiflittchen«, zischte eine ältere Dame am Nebentisch. Und von weiter hinten konnte man deutlich eine männliche Stimme hören, die etwas rief, das nach »Schwarze raus!« klang. Die Leute machten sich nicht mal die Mühe, ihre Stimmen zu dämpfen. Und vom Personal fühlte sich niemand berufen, dagegen einzuschreiten.
Die junge Frau sah sich hilflos nach allen Seiten um. In ihren Augen standen Tränen. Der G.I. starrte entsetzt in die feindseligen Gesichter. Isabella wäre am liebsten aufgesprungen und hätte die beiden an ihren Tisch geholt, doch da hatte der amerikanische Soldat schon schützend den Arm um seine Begleiterin gelegt und sie hastig aus dem Café geführt.
Isabella holte tief Luft. »Tut mir leid, ich muss hier raus«, sagte sie zu Helene.
»Ich auch«, pflichtete die Freundin ihr in grimmigem Ton bei.
Sie ließen alles stehen und liegen, warfen einen Geldschein auf den Tisch und verließen ohne Grußwort das Café.
»Ich könnte kotzen«, befand Isabella, als sie draußen waren.
»Geht mir genauso«, stimmte Helene zu. Sie wirkte nicht weniger betroffen als Isabella. »Das tut mir so leid.«
»Du kannst doch nun wirklich nichts dafür.«
»Ich weiß nicht. Hätten wir vorhin nicht was sagen müssen?«
»Was denn? Etwa so was wie ›Schämt euch‹?!« Isabella schüttelte den Kopf. »Das kapieren die doch gar nicht, so vernagelt und borniert, wie die sind!«
Sie gingen stumm nebeneinanderher, bis Isabella herausplatzte: »Eigentlich dachte ich, in der Stadt wär’s weniger schlimm als auf dem Dorf. Aber hier sind die Leute ja ganz genauso.« Danach verfiel sie wieder in Schweigen. Schließlich wechselte sie mit bemühter Sachlichkeit das Thema. »Was sagt denn eigentlich Marie zu dem geplanten Umzug nach Kirchdorf?«, erkundigte sie sich.
Helene hob die Schultern. »Bisher nicht viel«, antwortete sie, erkennbar Isabellas Wunsch folgend, die Unterhaltung wieder in neutrales Fahrwasser zu lenken. »So richtig begeistert ist sie nicht. Aber auch nicht so widerspenstig, wie man es erwarten könnte, wenn ein junges Mädchen von der Stadt aufs Dorf ziehen soll. Sie hatte in letzter Zeit Probleme in der Schule hier, sie kommt mit der Deutschlehrerin nicht klar, und wahrscheinlich ist sie froh, den Drachen bald los zu sein.«
Isabella nickte. Sie hatte Mühe, sich auf Helenes Ausführungen zu konzentrieren. Der Eklat in dem Café hing ihr immer noch nach.
»Außerdem freut sich Marie auf ihren Opa«, fuhr Helene fort. Sie hakte sich bei Isabella ein, während sie gemeinsam weiter über die Zeil schlenderten. »Und darauf, dass sie ihm wieder bei der Arbeit mit den Tieren über die Schulter schauen kann. Das hatte ihr schon in Weisberg immer so gut gefallen.«
Helenes Vater Reinhold hatte, bevor er in Kirchdorf seine Tierarztpraxis eröffnet hatte, jenseits der Zonengrenze im thüringischen Nachbarort Weisberg als Veterinärmediziner gearbeitet – dort allerdings unter dem strengen Regime der DDR, welches die Tierärzte zu schlecht bezahlte und zu heillos überarbeiteten Angestellten des Staates degradiert hatte. Obwohl er nicht mehr der Jüngste war und zudem an einer unfallbedingten Gehbehinderung litt, hatte er sich mit erstaunlichem Elan in Kirchdorf eine neue berufliche Existenz aufgebaut.
»Jetzt erzähl aber auch mal was über dich!« Helene musterte Isabella aufmunternd. »Wir haben uns ja fast zwei Monate nicht gesehen, gibt’s irgendwas Neues? Was macht die Arbeit?«
Isabella zuckte mit den Schultern. »Geht so. Meine Auftragslage lässt nach. Viele Frauen entbinden mittlerweile lieber im Krankenhaus, und wenn das so weitergeht, bin ich in ein paar Jahren als Dorfhebamme arbeitslos.«
»Woran liegt das?«, wollte Helene wissen.
»An dem Frauenarzt, der in Hünfeld eine Praxis aufgemacht hat. Der hat Belegbetten in der Klinik und arbeitet da auch als Geburtshelfer. Tobias überweist die Schwangeren, die zu ihm in die Sprechstunde kommen, gerne an diesen Arzt. Er selber war noch nie so wirklich für Hausgeburten zu haben, das fand er schon immer ein bisschen zu riskant.«
»Ja, das hat er mal erwähnt«, meinte Helene mit vager Beiläufigkeit.
Isabella blickte sie prüfend an, sagte jedoch nichts. Dann hellte ihre Miene sich auf. »Ach, das hätte ich ja beinahe vergessen zu erzählen. Stell dir vor, Jim ist wieder da! Ich soll dich schön von ihm grüßen.«
»Ach, wie nett. Geht’s ihm gut?«, erkundigte sich Helene. Ihre Miene zeigte aufrichtiges Interesse, was für Isabella nicht weiter verwunderlich war. Dem jungen G.I. würde ihre Freundin wohl bis an ihr Lebensende dankbar sein: Als ausgebildeter Scharfschütze der U.S.-Army hatte er entscheidend dazu beigetragen, dass ihre Tochter und ihr Vater die schreckliche Flucht über die Zonengrenze unbeschadet überlebt hatten – Jim hatte einem mordlüsternen DDR-Funktionär die Waffe aus der Hand geschossen, als der gerade hinterrücks auf Helenes flüchtende Familie angelegt hatte.
Isabella hatte seinerzeit mit Jim und seinem besten Freund Brad so manche Nacht durchgefeiert und dabei einiges erfahren, was die Männer ihr in nüchternem Zustand sicher nicht so offenherzig anvertraut hätten. Aber gewisse Dinge hatte sie auch von allein bemerkt. Etwa, dass Jim damals bis über beide Ohren in Helene verknallt gewesen war. Er war fünf Jahre jünger als sie, aber er hätte ihr ohne zu zögern sein ganzes Herz zu Füßen gelegt. Nachdem er allerdings begriffen hatte, dass sie bereits vergeben war, trug er es wie ein Mann – zumindest nachdem er seinen Kummer in einer ganzen Batterie von Drinks ertränkt hatte.
»Jim war für ein paar Monate auf einem Einsatz in Vietnam«, berichtete Isabella. »Da nehmen die kriegerischen Konflikte wohl immer mehr zu. Aber Jims Vater hat es irgendwie geschafft, ihn da so schnell wie möglich wieder rauszuholen. Dass sein Vater ein hohes Tier im US-Kongress ist, hatte ich dir schon mal erzählt, oder? Anschließend war er eine Weile in Bayern stationiert, bevor man ihn auf seinen Wunsch hin wieder hierher nach Hessen abkommandiert hat. Natürlich wurde er zwischenzeitlich auch befördert, er ist jetzt Captain und leitet eine eigene Einheit.«
»Das freut mich aber«, meinte Helene. »Er hat es verdient.«
»Na, bald kannst du ihm persönlich dazu gratulieren, denn er hat auch öfters in Kirchdorf zu tun. Die planen gerade einen besseren Schutz der Zonengrenze. Mit Wachturm und Soldatenbaracken und allem möglichen Drum und Dran. Harald steckt deswegen dauernd in irgendwelchen Verhandlungen, er legt sich als Bürgermeister mächtig dafür ins Zeug und sucht schon nach dem passenden Gelände am Ortsrand.«
Helene runzelte die Stirn. »Noch ein Beobachtungsstützpunkt?«
»Nein, es soll der Beobachtungsstützpunkt schlechthin werden. Der größte, beste, am stärksten ausgestattete in ganz Hessen. Alle wollen den haben, angeblich wird es höchste Zeit dafür. Jim ist felsenfest davon überzeugt, dass der Russe uns auf der Stelle überrennt, wenn die Amis uns nicht rund um die Uhr mit allem beschützen, was sie in die Schlacht werfen können. Er meint, die Kommunisten wären in drei Stunden mit ihren Panzern bis nach Frankfurt gerollt, wenn keiner an der Grenze bereitsteht, um sie aufzuhalten.«
»Ja, so was hat er mir auch schon mal erzählt«, sagte Helene trocken.
Isabella grinste. »Und bei Harald läuft er damit offene Türen ein. Die beiden liegen völlig auf einer Wellenlänge, was das angeht.«
Helene verzog in einer Mischung aus Besorgnis und Belustigung das Gesicht. »Auf diese Art wird der Kalte Krieg bestimmt niemals enden.«
Isabella blieb bei einem der Läden stehen, die an ihrem Weg lagen. Im Schaufenster war modische Unterwäsche ausgestellt. »Wir müssen in Kirchdorf das Beste daraus machen. Der Stützpunkt kommt so oder so, und für den Ort gibt’s bestimmt Schlimmeres. Die G.I.s bringen ein bisschen Geld in die Gegend. Und wir fühlen uns da draußen wirklich sicherer, seit sie da sind. So nah an der Zonengrenze ist es schon ziemlich beängstigend, seit die Kommunisten drüben dermaßen aufgerüstet haben, mit all den Minen und den Hundestaffeln und den höheren Zäunen.« Isabella hielt inne, denn das Unbehagen, mit dem Helene ihre Schilderung aufnahm, war fast mit Händen zu greifen. Sie ahnte, dass die Freundin an die Nacht zurückdachte, die von den Leuten in Kirchdorf nur Die große Flucht genannt wurde. Isabella musste schlucken, weil sie mit einem Mal selbst wieder alles vor ihrem inneren Auge ablaufen sah. Der Traktor, der die Sperranlagen durchbrach. Die Menschen aus Weisberg, die in Scharen dem rumpelnden Gefährt hinterherliefen und erst innehielten, als sie die westdeutsche Seite jenseits des Niemandslands erreicht hatten. Und dann der Augenblick, als Helene weinend auf die Knie sank und ihre Tochter in die Arme schloss. Dieses Bild hatte sich für immer bei Isabella eingebrannt. Niemand, der damals dabei gewesen war, würde das je vergessen können.
»Apropos Harald«, meinte Helene, offenbar darauf bedacht, ein anderes Thema anzuschneiden. »Wie läuft es bei euch?«
Isabella wunderte sich über den kurzen, scharfen Schmerz, den Helenes Frage bei ihr ausgelöst hatte. Angelegentlich betrachtete sie ein mit Rüschen überladenes Dessous-Ensemble aus rosafarbener Seide. »Wie gewonnen, so zerronnen«, sagte sie betont gleichmütig.
Helene wirkte erschrocken, beinahe schockiert. »Sag bloß, ihr habt schon wieder Schluss! Was ist denn passiert? Hast du nicht gesagt, ihr hättet beide aus euren früheren Fehlern gelernt und wolltet es diesmal besser hinkriegen?!«
»Das dachte ich ja auch. Aber irgendwie … Ach, ich weiß auch nicht. Wir hatten einen blöden Streit, keine Ahnung warum, und dann …« Sie hob vielsagend die Schultern und überließ es Helene, sich den Rest zu denken.
»Lässt es sich denn wieder einrenken?«
»Lässt sich das mit dir und Tobias wieder einrenken?«, gab Isabella zurück.