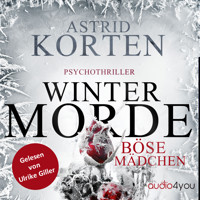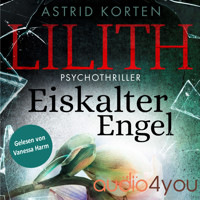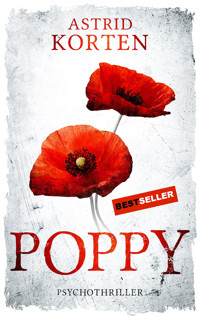4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
„Alles begann, als David Wood zu uns kam, auch der Beginn eines neuen Lebens. Ich war stolz, dass er da war, bis zu dem Vorfall mit Aileen…“ Der fünfundsechzigjährige Drehbuchautor Alexander Martin wendet sich an die West Vancouver Police Division, weil er ein Verbrechen verhindern will. Im Befragungszimmer trifft er auf Inspector Constable Abbott, der eine Vergewaltigungsserie und einen Mord aufklären muss. Alex überlässt dem Ermittler sein Tagebuch. Nachdem Abbott die Aufzeichnungen gesichtet hat, häutet er Alex wie eine Zwiebel. Fast ohne dass sie es merken, verbinden sich die Grübeleien der beiden Männer und das Tasten nach dem Sinn einer Tat mit einer geheimnisvollen, rätselhaften Geschichte um ein Geheimnis, das zwischen Alex und seinem Pflegebruder David steht … Die Dornen der Stille ist ein zutiefst bewegender Psychothriller und ein leidenschaftlicher, tief empfundener Widerstand gegen Gleichgültigkeit, Verachtung und Ignoranz.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Astrid Korten
Die Dornen
der Stille
Psychothriller
Über das Buch
„Alles begann, als David Wood zu uns kam, auch der Beginn eines neuen Lebens. Ich war stolz, dass er da war, bis zu dem Vorfall mit Aileen…“
Der fünfundsechzigjährige Drehbuchautor Alexander Martin wendet sich an die West Vancouver Police Division, weil er ein Verbrechen verhindern will. Im Befragungszimmer trifft er auf Inspector Constable Abbott, der eine Vergewaltigungsserie und einen Mord aufklären muss. Alex überlässt dem Ermittler sein Tagebuch. Nachdem Abbott die Aufzeichnungen gesichtet hat, häutet er Alex wie eine Zwiebel. Fast ohne dass sie es merken, verbinden sich die Grübeleien der beiden Männer und das Tasten nach dem Sinn einer Tat mit einer geheimnisvollen, rätselhaften Geschichte um ein Geheimnis, das zwischen Alex und seinem Pflegebruder David steht …
Die Dornen der Stille ist ein zutiefst bewegender Psychothriller und ein leidenschaftlicher, tief empfundener Widerstand gegen Gleichgültigkeit, Verachtung und Ignoranz.
Prolog
Burnaby Lake, Vancouver - 3. Juli 2021
Die sengend heiße Nacht und der erdige Atem des Burnaby Lake verhängt das Grün des Parks mit einem modrigen Geruch. Ich schreie laut auf, will den Albtraum aufhalten, ihm entkommen und an die Oberfläche auftauchen. Die grausame Vision ist auf meinen geschlossenen Augenlidern fixiert, die verzerrte Grimasse eines Mörders. Dieses Bild ist wie ein Wasserzeichen auf meine Netzhaut, wie mit einem glühenden Eisen in meinen Kopf gebrannt.
Ich liege in der Dunkelheit der Schlafkoje meines Bootes und starre mit trockenen Augen in das Schweigen des Raumes. Still haben die Wolken das Licht der Mondsichel gelöscht. Eine ungewöhnliche Stille herrscht auch zwischen den Vögeln und den Bibern, selbst das ständige Rascheln zwischen den am Rande stehenden Laubbäumen hat die Nacht verschluckt. Ausgewaschen wie schöne Erinnerungen.
Zwei Erinnerungsfetzen an das gestrige Gespräch mit meiner Schwester Patricia rauben mir den Atem. Ein Fetzen ist wie eine heftige, fast greifbare Spannung, die in der Luft hängt und schmerzt. Er darf aber einen anderen Gedanken nicht stören, sonst verliere ich das Bild, das sich mir in diesem Moment offenbart: Das Lächeln meiner Schwester, die mich liebevoll zum Abschied umarmt und geküsst hat. Ein seltener Moment.
Ich habe Patricia gestern von den glücklichen Zeiten meines Lebens erzählt, in denen ich verliebt war, wirklich verliebt. Vermutlich ist das der Grund dafür, dass ich immer wieder versuche, meine Erinnerung lebendig zu halten.
Mein ganzes Leben lang war ich auf der Suche nach den Momenten der Liebe. Eltern, Geschwister, Freunde. War ich in den vergangenen fünfundsechzig Jahren ein achtsamer Mensch gewesen? Ich weiß es nicht. Jedenfalls ein Mann der Stille, der ein gutes und erfülltes Leben hatte, würden die meisten Menschen an meinem Grab sagen. Menschen, die es wissen müssen, Menschen, die mich lieben. Heute erinnere ich mich nur an die Stille dieses Lebens, an die Farben, an die endlosen Worte, und an die Suche nach etwas, das ich bis gestern nicht mit Worten benennen konnte: die Ursache meiner Albträume, das Übel – die Dornen der Stille.
Meine Fäuste graben sich in die Bettdecke. Jetzt, in diesem Augenblick, will ich nur an Patricias Worte denken, suche wieder die Erinnerung. Aber ich hatte diesen Albtraum, und das Einzige, was mir die Stille der Nacht gibt, ist eine Beklommenheit, die meine Brust aushöhlt, und eine mörderische Wut. Alles, was in meinem Leben von Bedeutung ist, war vor ein paar Tagen mit einem Mal auf einem imaginären Dorfplatz im Vancouver Theater zusammengekommen, zwischen Platanen, einem Brunnen, der Stille, dem künstlichen Sonnenlicht. So unwahrscheinlich das auch war, aber selbst ein Monster spielte auf dieser Bühne eine Rolle in dem Stück India Song, dessen Kulisse Fernand, der Mann meiner Schwester, gestaltet hatte. Das Bühnenstück hätte etwas in mir auslösen müssen, tat es aber nicht.
Es ist 03:50 Uhr. Die perfekte Zeit, um meine Schlaflosigkeit zu nutzen und mir einige ältere Fotos anzusehen. Ich brauche Gewissheit.
Ich bringe den Schuhkarton in meine Schlafkoje, lege ihn aufs Bett und halte unwillkürlich die Luft an, um meinen Atem zu beruhigen. Dann öffne ich den Deckel und nehme die Fotos heraus.
Dad … Der Schmerz findet immer Antworten.
Warum dieser Gedanke?
Mom … Liebevoll und erdrückend fürsorglich.
Patricia … Desinteressiert an dem kleinen Bruder.
David … Sein Blick auf uns gerichtet.
Die Szene im Wohnzimmer habe ich damals nicht analysiert. Ich war zu jung, um zu verstehen. Auch gab es keine Hinweise, dass sich eine Katastrophe anbahnte. Es gab auch keine Vorzeichen, die uns in die Irre führten. Erst als Aileen die Bühne betrat und wir uns anfreundeten, spürte ich, dass es da etwas Unheilvolles gab, was mich mein Leben lang begleiten sollte.
Als ich eine spätere Momentaufnahme meines Lebens aus dem Karton nehme, weiten sich meine Augen.. Und dann sehe ich es. Ich reibe das Foto mit der freien Hand, als hätte ich mir das Wahrgenommene eingebildet. Ich habe aber nicht halluziniert.
Erst jetzt wird mir bewusst, dass der Wahn mich schon immer umgeben hat. Ist er jetzt auch da und beobachtet mich? Mein Herz pocht wild, meine Atmung beschleunigt sich, mein Blut pulsiert in den Adern und meine Gedanken überschlagen sich. Ich bin erschöpft. Nicht nur, weil ich seit Tagen unruhig geschlafen habe, sondern vor allem, weil ich unter ständiger Anspannung stehe. Auch ist es anstrengend, in der Nacht zu hundert Prozent konzentriert und hellwach zu sein. Es zehrt an den Kräften.
Ich nehme das Foto in die Hand an gehe an Deck. Alle Lichter in der weit entfernten Häuserfront sind ausgeschaltet. Am gegenüberliegenden Ufer ist nichts zu sehen, ein Wasservogel schießt aufgeschreckt in die Höhe.
Ich bin verwirrt, in Aufruhr, spüre die Wellen meiner Gedankengänge, mein Körper fühlt sich taub an. Ich sitze in der Falle. Erbreche mich, lege eine Hand auf den Mund und starre weiter wie hypnotisiert die Szene vor meinem inneren Auge an. Um mich herum winden und dehnen sich die Erinnerungen der Vergangenheit. Das pulsierende Summen der Morgendämmerung verstärkt sich und bringt in mir einen Tinnitus hervor, der in meinen Ohren pfeift. Meine Mundwinkel zucken. Ich lasse meinen Unterkiefer spielen, um die Geräusche zu bändigen, die in meinen Schädel dringen. Vergeblich.
Tränen treten mir in die Augen. Ich greife nach einem Taschentuch und wische die Galle in den Mundwinkeln weg. Danach hebe ich langsam den Kopf und stütze mich auf die Reling. Der Tinnitus wird leiser und verabschiedet sich nach einigen Minuten ganz.
Wieder unter Deck sehe ich auf meine Uhr. 08:00 Uhr. Ich habe schon zu viel Zeit verstreichen lassen, greife zum Handy und wähle die Rufnummer der West Vancouver Police Division.
„Inspector Constable Jonah Abbott.”
„Guten Morgen, Inspector Abbott. Mein Name ist Alex Martin.“
„Womit kann ich Ihnen helfen, Mr. Martin?“
„Ich möchte mit Ihnen über einen Vorfall sprechen, der sich vor vielen Jahren in West Vancouver ereignet hat.“
„Um welchen Vorfall handelt es sich, Mr. Martin?“
„Das Telefon ist nicht der geeignete Kommunikator, Mr. Abbott. Es ist zu heikel.“
„Dann würde ich vorschlagen, Sie kommen zu uns. Sagen wir um die Mittagszeit, so gegen 12.00 Uhr, Mr. Martin? Dann ist es ein wenig ruhiger hier und wir können uns ungestört unterhalten.“
„Muss ich einem Anwalt hinzuziehen?“
„Haben Sie ein Verbrechen begangen, Mr. Martin?“
„Ist die Stille ein Verbrechen, Inspector Abbott?“
„Es kommt darauf an, was in der Stille geschehen ist, Mr. Martin.“
„Darüber möchte ich mit Ihnen sprechen. Ich werde um 12:00 Uhr zu Ihnen kommen.“
„Dann bis später, Mr. Martin.“
Ich lege auf, sehe aus dem Fenster und lasse meinen Blick über den Burnaby Lake schweifen. Mit einem Mal fühlt es sich so an, als wäre ich ferngesteuert durch das Leben geirrt, als hätten die anderen Menschen in diesem Leben schon immer ein Ablaufdatum gehabt.
West Vancouver Police Division
Besprechungsraum, 4. Juli 2021 – 12.30 Uhr
Das Besprechungszimmer liegt im südlichen Flügel des Gebäudes. Ein uniformierter Constable führt mich in das Besprechungszimmer. Mit einer brüsken Handbewegung deutet der Mann zum Tisch hin, auf dem eine kleine Schaltvorrichtung für Videoaufzeichnungen steht. Ich setze mich auf einen der Stühle.
„Darf ich...?“, murmele ich heiser und hole meine Aufzeichnungen aus meiner Mappe.
„Sicher“, erwidert der Polizist, rückt den Stuhl neben der Tür ein Stück von der Wand ab und setzt sich wieder an seinen Schreibtisch.
Ich sehe mich um. Es ist seltsam, dass Polizeidienststellen immer eine ganz besondere Atmosphäre anhaftet. Selbst dem Polizeibeamten, für den seine Dienststelle nichts weiter ist als ein Arbeitsplatz, sieht man an, dass im Lauf der Jahre die Arbeit mit den Gesetzlosen Spuren in seinem Gesicht hinterlassen hat. Das löst in mir ein Gefühl der Beunruhigung aus, ein leises Frösteln des Sich-schuldig-Fühlens, das selbst ein Unschuldiger verspürt.
Meinem Auge bietet sich der Befragungsraum als beinahe perfekter Kubus dar. Das Zimmer hat zwei Türen, ein Fenster und eine verspiegelte Glaswand. Zwei lange, parallel angeordnete Leuchtstoffröhren liefern das Licht; ein kaltes, bläulich getöntes Licht, das alle Schatten verschluckt und zugleich die Farbe aufsaugt. Die Wände sind seidenmatt getüncht, der Boden ist auf matten Spiegelglanz gebohnert.
Dies ist also ein Besprechungszimmer und jener Teil der Polizeidienststelle, wo es zu einer Konfrontation bis aufs Messer zwischen einem Verdächtigen und seinem Vernehmungsbeamten kommt. Eine Kampfarena, wo im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des kanadischen Strafrechts Duelle ausgefochten werden. Hier werde ich meine Geschichte erzählen.
Ich betrachte den Raum jetzt wie eine Bühne, was wohl daran liegt, dass ich Theaterstücke schreibe. Das Zimmer wird im Wesentlichen zur Bühne, auf der ich mein Leben entfalte. Mehr noch: es ist zugleich Kulisse und Dekoration, mit der Tür als Vorhang, der es, wenn er sich öffnet, einem der Hauptdarsteller erlaubt, genau auf sein Stichwort hin zu erscheinen und danach seinen Text ohne die Hilfe eines Souffleurs und in glänzender Abstimmung auf sein Gegenüber vorzutragen. Wenn ich diesen Raum so sehe, fällt es mir leichter, meine Geschichte zu erzählen. Es ist genau Viertel nach zwölf, als Inspector Constable Jonah Abbott und sein junger Kollege, Constable Ben Weire, den Raum betreten.
Wir reichen uns die Hand. „Werden Sie meine Aussage aufnehmen, Inspector Abbott?“, frage ich
Jonah Abbott und Ben Weire sehen sich an.
„Es kommt darauf an, was Sie uns erzählen werden“, antwortet Abbott. „Haben Sie denn ein Verbrechen begangen, Mr. Martin?“
„Nein, aber das erwähnte ich bereits am Telefon.“
„Gut. Erzählen Sie uns erst einmal Ihre Geschichte und dann sehen wir weiter. Aber zuerst sind da noch einige Fragen, allgemeine Fragen, Hintergrundinformationen, die wir benötigen, Mr. Martin.“
„Zum Beispiel?“
„Nennen Sie uns bitte Ihren vollständigen Namen, Geburtstag und Geburtsjahr sowie Ihre derzeitige Anschrift.“
„Alex Martin, geboren am 25. März 1956 in West Vancouver. Meine aktuelle Adresse ist 2976 Point Grey Road im Stadtteil Kitsiland. Momentan verbringe ich aber die meiste Zeit auf meinem Boot in Burnaby. Bitte, hören Sie mir zu. Ich möchte nicht, dass noch mehr passiert.“
„Was könnte denn passieren?“, fragt Abbott.
„Etwas Schlimmes, befürchte ich.“
Es wird still.
Die Beamten tauschen wieder einen kurzen Blick aus.
„Etwas Schlimmes?“ Weire hängt jetzt nicht mehr gelangweilt im Stuhl. Er richtet sich auf. „Und wa…?“
„Erzählen Sie uns bitte Ihre Geschichte, Mr. Martin“, unterbricht Abbott seinen jungen Kollegen.
Ich hole einige Fotos aus meiner Jackentasche und breite sie vor den Beamten aus. „Alles begann vor vielen Jahren, als David Wood zu uns kam, auch der Beginn eines neuen Lebens. Ich war damals noch ein Teenager und so stolz, dass David da war, bis zu dem Vorfall mit Aileen …,“ beginne ich. „Es war der Moment, der alles veränderte. In den vergangenen Stunden habe ich mich immer wieder gefragt, warum ich nicht früher auf die Anzeichen geachtet habe.“ Ich räuspere mich und erzähle von meinem Verdacht. „Es begann genau in diesem Augenblick, denke ich. Noch hatte Aileen keine Ahnung davon, was in den …“
Eine halbe Stunde später verlassen Abbott und Weire den Besprechungsraum. Es war eine anstrengende halbe Stunde und ein langes Gespräch, bemerkenswert, auf eine dunkle, beunruhigende Weise, denke ich. Für die Beamten der West Vancouver Police Division, die gemeinsam die Ermittlungen einleiten werden, ist dieser Tag gewiss noch lange nicht vorüber.
„Glaubst du, das er uns angelogen hat?“, höre ich Constable Weire fragen.
Durch die offenen Türen verstehe ich jedes Wort, die Glasscheibe gewährt mir einen freien Blick auf die beiden Beamten. Sie stehen einander im Korridor gegenüber, jeder mit einem Plastikbecher lauwarmem Automatenkaffee in der Hand. Abbott wirkt müde, und ich glaube, dass seine Familie und das Bett noch ein paar Stunden auf ihn warten müssen.
„Warum sollte er? Er hätte nicht zu uns kommen müssen. Ich kann kaum fassen, was ich da gehört habe. Wir müssen die Kollegen verständigen und einen Wagen zum Haus seiner Schwester schicken. Und uns die verstaubten Cold-Case-Akten aus dem Archiv kommen lassen. Was für eine kranke Scheiße!“
„Ja, die Sache ist irre. Ich meine, ernsthaft krank“, fährt Weire fort.
„Ich verabscheue es, alte Fälle zu bearbeiten, bei dem Staub, den sie aufwirbeln werden – in jeder Hinsicht. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache.“
Weire hört Abbott aufmerksam zu. Ich vermute, dass Abbotts messerscharfer Verstand den jungen Polizisten schon einige Male vor schwerwiegenden Fehlern bewahrt hat.
Weire nippt an seinem Kaffee. „Glaubst du, dass Martin auch darin verwickelt sein könnte?“
„Keine voreiligen Schlüsse, Ben.“
„Die Presse wird aus dieser Sauerei einen verdammten Zirkus machen. Kann man den Jungs nicht verdenken, schließlich ist er ein weltberühmter Theater- und Drehbuchautor.“
„Woher weißt du das?“, fragt Abbot.
„Google! Es ist eine große Story und die Presseleute machen auch nur ihren Job.“
„Das müssen wir auch.“ Abbott deutet auf die Tür. „Lass uns wieder reingehen. Wir müssen Mr. Martin jetzt offiziell befragen und das protokollieren. Meine Güte. Dieser Mann hat sein ganzes Leben zurückgezogen und in einer grausamen Stille gelebt, weil …“
Weire zuckt mit den Schultern. „Sollen wir unkonventioneller vorgehen und gegen die Regeln verstoßen?“
Abbott nickt. „Absolut!“
Sie betreten den Vernehmungsraum.
„Fangen wir von vorn an, Mr. Martin. Was Sie uns erzählt haben, hm … dem werden wir nachgehen müssen. Lassen Sie uns also ganz zum Anfang zurückkehren. Und denken Sie daran, ich will alles wissen …“
Ich reiche Inspector Abbott meine Notizen. „Ich habe mich so oft gefragt, wo das Leben geblieben ist. Hätte ich kein Tagebuch geführt, ich hätte es nicht gewusst. Irgendwo zwischen diesen Zeilen liegt die Antwort. Ich hätte mich früher gerne mit David angefreundet, aber ich konnte es nicht. Irgendetwas hat mich davon abgehalten. Alles erscheint heute in einem anderen Licht.“
Abbott hebt die Augenbrauen. „Das verstehe ich. Ein Verbrechen ist wie ein Teppich aus Emotionen. Tausend verschiedene Gefühle werden an tausend verschiedenen Tagen miteinander verwoben.“
„Nur hier liegt es anders, Inspector Abbott.“
„Dann würde ich vorschlagen, dass ich zuerst Ihre Notizen sichte und Sie währenddessen einen Kaffee trinken. Wäre das für Sie in Ordnung, Mr. Martin?“
„Sicher.“
„Gut, dann sehen wir später wieder.“
TEIL I
DIE UNZÄHLIGEN FARBEN DER ANGST
Kapitel 1
West Vancouver
Unterdrückt, spöttisch, so höre ich sie husten. Und lachen, zur gleichen Zeit, nur ganz kurz. Patricias Lachen, nur einen Moment lang, störend in der Stille des Hauses, das Lachen, mit dem ich nichts zu tun haben darf, das ich aber trotzdem hören soll. Es geht mich nichts an, das soll ich verstehen, aber ich weiß nicht wie und spüre Unbehagen. Ihr Lachen soll mich treffen, das weiß ich, und sie weiß es auch.
Ich hörte sie nicht nach Hause kommen, ich saß mit dem Musikexpress im Garten und betrachtete nachdenklich ein Foto von Bob Dylan, der in engen dunklen Kleidern und mit Sonnenbrille hinter einem Klavier saß, konzentriert, als gehöre er nicht zu unserer Welt und, soweit ich mir unsere Welt vorstellen konnte, auch zu keiner anderen. Er war nur ganz bei sich, was auch ich immer wollte: ganz bei mir in meiner Welt sein.
Ich warte, vielleicht höre ich ihr Lachen noch einmal, aber es bleibt stumm. Es ist die Art von Stille, die mich nervös macht. Dad ist in der Schule, Mom besucht eine Freundin, mit der sie alle zwei Wochen über ein neues Buch spricht, Gespräche, über die sie zu Hause kein einziges Wort verliert.
Normalerweise ruft Patricia schrill und gebieterisch: „Ich bin wieder da!“ Mein Vater ging neulich auf den Flur und sagte: „Wir auch, Patty.“ Sie erträgt es nicht, wenn er sie Patty nennt. Deshalb ärgere ich sie manchmal und sage: „Misch dich nicht ein, Patty.“ Patricia kann mit ihren Augen toben wie eine Wahnsinnige.
Meine Schwester hat mir nichts zugerufen, obwohl sie mich im Garten gesehen haben muss. Ganz sicher.
Seit ein, zwei Monaten lebt Patricia nicht mehr hier, sie ist zu Beginn des Sommers nach East Vancouver umgezogen, wo sie an der Kunstakademie studieren wird. Sie hat ein Zimmer am Victoria Drive gefunden, das nicht groß ist, aber der Blick auf den Trout Lake Park, mit seinen zahlreichen, modernen Skulpturen, die den Park beleben, ist sehr schön. Die Aussicht lässt ihr Zimmer geräumiger erscheinen. Es ist der größte Teil eines niedrigen Dachbodens in einem alten Herrenhaus, das einer Mrs. Garner gehört, einer älteren Dame, die alle zwei Monate einige Wochen in Cornwall verbringt und die es mag, wenn das Haus dann bewohnt wirkt. In den Zeiten ihrer Abwesenheit darf Patricia sich auch im kühlen Wohnzimmer von Mrs. Garner aufhalten, das vollgestopft ist mit Erinnerungen an Indonesien, wo sie am ersten Tag des zwanzigsten Jahrhunderts geboren wurde, in einem kleinen Krankenhaus irgendwo in der grünen Hölle von West-Sumatra.
Als Patricia auf Wohnungssuche war, bekam sie das Zimmer sofort, weil sie aufmerksam zuhören konnte, zumindest behauptete Mrs. Garner das, die Patricia mit Vergnügen ihre Lebensgeschichte erzählte. „Sie artikuliert wie eine Schauspielerin aus ruhigeren Tagen, mit leicht heiserer Stimme und entzückten Augen“, berichtete Patricia fast stolz.
Mir war nach Provokation. „Hast wohl mit Interesse zugehört, Miss Patty?“
„Ja, es war interessant, was sie erzählt hat, kleiner Bruder, was man von deinem Schweigen nicht behaupten kann!“
Ich habe Patricia beim Umzug geholfen, zusammen mit Dad, der nicht sehr geschickt war und zerstreut auf dem Bürgersteig stand, neben dem gemieteten dunkelblauen Lieferwagen, und der über fast alles reden wollte.
„Weißt du noch, wann du diese Lampe bekommen hast, Patricia?“ Oder: „Und diese Vase ist noch von Tante Emma. Ihr fehlte der Daumen der rechten Hand. Sie sagte, ihre Hand sei wie eine Gabel ...“ Anfangs fragte er noch: „Erinnerst du dich?“, aber als er sah, dass seine Frage eine zornige Röte an Patricias Hals aufstiegen und ihre Lippen schmal werden ließ, blieb es bei kurzen Bemerkungen. Manchmal konnte Patricia ein verfluchtes, kleines Miststück sein.
Für Dad hat alles einen festen Platz in jedem Moment unseres Lebens und verdient Aufmerksamkeit, nichts ist ohne Grund vorhanden. Seine Frage Erinnerst du dich? blieb mir danach im Gedächtnis. Eine Frage, die vielleicht Schlimmes hätte aufhalten können. Dad versuchte stets, an etwas festzuhalten, das kaum aufzuhalten war. Und darin lag eine leichte Traurigkeit.
An diesem warmen Morgen im Juni 1974, zwei Wochen nach ihrer Abschlussprüfung, war es das erste Mal, dass ich mich vage mit Patricia verbunden fühlte, auch wenn ich nur eine nutzbringende Funktion bedeutete. Davor war sie nur meine ältere Schwester gewesen, die mich für ihren kleinen, lächerlichen Bruder hielt und die selbst ein Leben führte, von dem ich keine Ahnung hatte. Mit Freundinnen auf schrille Partys gehen, und oft mit ‚Jungs‘, die stets mit frisch gewaschenen, cremeweißen, um die Schultern geworfen Tennispullovern herumliefen. Sie sprach oft über sie, aber ich schaffte es nie, ihr eine längere Zeit zuzuhören. In regelmäßigen Abständen beendete sie die Beziehung mit einem ihrer Jungs. Mom sagte dann mit unterwürfigem Respekt: „Lass Patricia in Ruhe, sie ist so aufgebracht.“
Ich ließ sie immer in Ruhe, sie alle forderten von mir, dass ich sie in Ruhe ließ, und ich konnte mir nicht vorstellen, sie nicht in Ruhe zu lassen, immerhin war es das, was ich auch wollte.
An diesem Nachmittag geschah aber noch etwas Merkwürdiges. Ich glaube an Intuition, weil nicht alle Dinge erklärt werden können. Schon auf der Straße vor unserem Haus in West Vancouver spürte ich, dass etwas nicht stimmte. Mit Ausnahme des psychisch gestörten Mr. Wood, der mich vom Straßenrand aus flüchtig anstarrte, sah ich aber niemanden. Dennoch war mir mulmig zumute. Dad musste es auch gespürt haben, denn er schaute ebenfalls oft über die Schulter, als ob er sich beobachtet fühlte. Mich beschäftigte noch etwas anderes, etwas Unheilvolleres, vielleicht lag das aber auch an meiner überbordenden Fantasie. Dennoch war in mir dieses seltsame Gefühl: Ich spürte Schmerz und Verderben.
Am neuen Domizil meiner Schwester am Trout Lake Park angekommen, fühlte ich mich verfolgt, obwohl ich nie jemand kommen und gehen sah. Ab da dachte ich, dass ich ein leichtes Ziel für das Unheil in meinem Leben wäre und kaum eine Chance hätte, dem zu entkommen.
Woher wusste ich, ob ich tatsächlich verfolgt wurde? Ich versuchte, die Geräusche zu isolieren, konzentrierte mein Gehör auf die Umgebung. Ich nahm nur Dads Keuchen neben dem Lieferwagen wahr, das Platschen unserer Schritte in den Wasserpfützen. Ich presste die Zähne zusammen und versuchte, meine Angst zu unterdrücken.
„Na, kleiner Bruder, nicht grübeln, lass uns nicht die ganze Arbeit allein machen“, rief Patricia mir zu und stieß mich an. Ich zuckte unter ihrer Berührung zusammen. „Du bist gerade neunzehn Jahre geworden, ich bin schon sechzehn, nenn mich also nicht kleiner Bruder, Patty!“
„Ups, schon gut!“
Mom sagte manchmal, dass Patricia und ich uns später wiederfinden würden. Ich fragte mich, wo und wann das sein könnte und was wir mit unserem Fund machen würden. Bis heute war ich nur ein Vorhandensein in ihrem Leben, wie sie in meinem. Dass ich mir wünschte, die Dinge wären anders, war ein Gedanke, den ich stets schnell verwarf. Dann müsste ich ihr etwas bedeuten, außer nur anwesend zu sein, und ich wusste nicht, wie ich das anstellen sollte, etwas zu bedeuten – nicht nur für sie.
David hatte ihr immer mehr bedeutet, er war nicht – wie ich – der kleine Bruder, der kaum etwas zu sagen hatte. Ich glaube, Patricia fand ihn ‚traurig‘ oder ‚erbarmenswert‘, weil ‚das Leben ihn so früh allein gelassen hat‘, sagte sie später bei einer der seltenen Gelegenheiten, bei denen wir zu Hause über unsere Vergangenheit sprachen. Patricia war die Einzige, die ihn Davìd nannte. Mit der Betonung auf der zweiten Silbe, als ob es ein französischer Name wäre. Das tat sie vom ersten Tag an, als er bei uns einzog. Eine jämmerliche Art, sich für ihn bedeutungsvoll zu machen.
Warum ich in die Richtung ihres Hustens gehen will? Keine Ahnung, es passiert einfach instinktiv. Neben dem Husten gibt ihr eigenartiges raues Flüstern auch ihr Geheimnis preis. Aber da weiß ich bereits, was ich wissen muss, es ist keine Überraschung, ich möchte das Lauschen vermeiden, aber ich kann nicht. Dass ich das vermeiden will, ist eine dunkle Erkenntnis, die mich stört, dabei sollte es mir egal sein. Aber auch wenn ich keine Bedeutung in ihrem Leben habe, möchte ich sie beschützen, weil ich spüre, dass sie sich mit Gefahr umgibt.
Ich gehe die Treppe hinauf und halte kurz inne, als ich Patricia wieder husten höre, als ob etwas mit ihrer Atmung nicht in Ordnung sei. Dann stehe ich an der Tür zu Davids Zimmer, huste jetzt auch laut und so gelassen wie möglich. Patricia soll wissen, dass ich dort stehe, sie soll wissen, dass ich weiß, dass sie hinter dieser Tür ist. Ihr kleiner Bruder, der nie Interesse für sie empfunden oder an ihr gezeigt hat. Dass das jetzt plötzlich anders und mein Interesse auffallend intensiv ist. Und ich habe panische Angst, ohne zu wissen, wovor und ohne das wissen zu wollen und das ist die schlimmste Angst.
Es gab Momente in meinem Leben, in denen ich nur deshalb so intensiv mit meinem Leben beschäftigt war, um diese unbestimmte Angst nicht zu spüren. Dann gab ich mein Bestes, um mehr zu sein als ihre zahlreichen Farben. Das spürte besonders der Beobachter in mir: Wie sehr er sich doch anstrengt. Trotzdem war diese Angst überall, zu jeder Zeit, und ich wurde sie nicht los. Ich hatte einmal geschrieben, dass es die Angst vor der Scham sei, aber schließlich vor allem der Anfang von dem, was die Farben der Angst mit mir machten.
Ich öffne die Tür und ahne längst, was meine Augen sehen: David und Patricia in dem schmalen Bett. Sie stellen sich schlafend, die Bettdecke fest und kindlich bis zum Kinn hochgezogen. Ich sehe Patricias langes rechtes Bein, glatt, leicht angewinkelt und schön, mit gestreckten Zehen – die Nägel dunkelrot lackiert –, die eine fast unkontrollierbare Spannung zeigen. Ihre Münder lächeln und schlucken hinunter, dass sie über mich lachen, sie ersticken fast daran. Selbstverständlich kenne ich die Bedeutung, von dem was ich sehe, aber auch wiederum nicht, weil ich außerhalb des Geschehens stehe, weil ich nichts damit zu tun habe. Allein dadurch, dass mir das auffällt, dränge ich mich ihnen auf. Störend für sie, beschämend für mich.
Wenn ich fast fünfzig Jahre später daran zurückdenke, fällt es mir nicht schwer, mich in diesen Moment zurückzuversetzen. Erst jetzt mit fünfundsechzig Jahren erkenne ich, dass er ein Teil von allem war, das es mir ermöglichte, das Leben zu leben, anstatt zu oft darüber nachzudenken. Ich bin dieser Moment, ich bin derjenige, der dasteht und sieht, was er nicht sehen will, ohne zu wissen warum, ich bin die Frage, warum ich es nicht sehen will, ich bin all diese Arten von unbeantwortbaren Fragen. Und auch ein Teil meiner Unfähigkeit, Davids Freund zu sein, so jemand zu sein.
Jetzt, wo ich diese Erkenntnis habe, frage ich mich, was ich fast fünfzig Jahre später noch damit anfangen kann? Normalerweise beschäftige ich mich nicht mit der Tatsache, dass ich immer älter werde, aber eine solche Frage gehört auch zum Leben.
Ich habe nie mit David über diese Szene gesprochen, schon gar nicht mit Patricia. Der Erinnerung fügte ich immer wieder aufs Neue eine kleine Verletzung zu, und die Stille schmerzt immer, wenn gewisse Dinge zusammentreffen: der Duft der Rosen in einem Garten, ein schwarzer Vogel, der von einem Platz zum anderen flattert, sonst kein Geräusch.
David und Patricia haben nie angedeutet, dass sie sich Gedanken darüber machten, wie ich an diesem Nachmittag da stand, wie ich die Tür leise hinter mir schloss, leise, wie der Klang meiner Scham. David war mein Rückzug damals nur ein gezwungenes Lächeln wert. Ein Lächeln wie unter Komplizen. Ein hässliches Lächeln.
Ich rannte in den Garten und brach dort in Tränen aus. Legte den Kopf in meine Hände, krallte die Nägel in meine Wangen und richtete den Blick aus weit aufgerissenen Augen auf das Meer. Ich wusste, dass es in unserem Elternhaus nie wieder so sein würde, wie es einmal gewesen war. Das Böse bahnte sich einen Weg durch die Stille. Nein, es war es schon früher da. Ich habe es nur nicht bemerkt.
Kapitel 2
Der Sprung - 1969
Der Nachmittag ist mir lieb, es ist die schönste Zeit des Tages, was auch oft am Licht liegt, das vorsichtig und zögernd den Tag loslässt.
Wenn ich mich an mein bisheriges Leben erinnere, dann fanden an den Nachmittagen viele wunderbare und beeindruckende Ereignisse statt. Aber es gab auch entgleiste Situationen. Als Kind war mir das nicht bewusst, ich hatte alle Hände voll zu tun, mich von den Schulstunden zu lösen und wieder an all die Dinge zu denken, die ich mir ausgemalt hatte, denn in meinen Fantasien wollte ich mich so weit wie möglich von der Aufmerksamkeit entfernen, die mir im Klassenzimmer abverlangt wurde. Oft konnte ich nur auf die Worte schauen, mit denen etwas an der Tafel erklärt wurde, und ich fragte mich, was ich mit diesen Worten anfangen könnte. Aber dann rief ich meine Fantasien zurück und speicherte sie in der Welt, in der ich nur mir selbst gehörte.
Und dann ist da dieser Nachmittag: ein Montagnachmittag im September 1969. Es ist immer noch Sommer, aber der Sommer ist schwer und alt geworden, das Sommerlicht auch, als wird der Nachmittag langsam damit gesättigt. Du fragst dich, was du mit dem Tag anfangen sollst und wie lange er noch dauert, und wie lange es noch dauert, bis der Herbst endlich da ist.
Ich war gerade von der Schule nach Hause gekommen und hatte mein erstes Bob-Dylan-Musikalbum aufgelegt, das mir Moms Bruder geschenkt hatte, ihr einziger, der Weltreisende, der Rastlose mit dem lauten Lachen, das jeden ansteckte. Vielleicht lag es daran, dass sich meine Eltern nicht an seinem unberechenbaren Alkoholproblem störten, das Chaos und Briefe voller Entschuldigungen brachte. Briefe, die ich las, wenn sie auf dem Tisch liegen blieben, und in denen es um Macau oder Paris oder um eine Frau aus New York oder Montreal ging, die ihre Sucht besiegt hatte oder Insolvenz anmelden musste. Manchmal verlor mein Onkel seinen Pass und fragte Dad, ob er das „regeln“ könne, worüber Dad dann immer ernsthaft nachdachte …
Die Häuser in unserer Straße stehen weit auseinander, unseres ist etwas nach vorne versetzt und hat den schönsten Vorgarten, als hätte es versucht, sich aus der Reihe zu befreien. Von meinem Zimmer aus blicke ich auf das Haus der Familie Wood: David und seine Eltern. Ich treffe David oft auf der Straße, wir sagen hallo, spielen aber nie zusammen, was auch meine Schuld ist, denn ich spiele nicht gerne draußen, ich bin lieber in meinem Zimmer, höre Musik und zeichne. Außerdem ist er ein Jahr älter als ich. Manchmal besuchen uns fremde Leute und ich höre sie sagen, dass das nicht gut für mich sei, „so ein Junge muss an die frische Luft“, aber dann antwortet entweder Mom oder Dad mit angenehmer Bestimmtheit: „Alexander muss schon viel zu viel, und das ist eben das, was er will. Was gibt es daran auszusetzen?“
„Aber ein Junge in seinem Alter muss an die frische Luft!“
„Alexander muss gar nichts.“
Meine Eltern haben keinen Kontakt mit der Familie Wood, und das liegt nicht daran, dass sie lieber für sich sein wollen, sondern da ist etwas mit dieser Familie, worüber ich nichts weiß. Meine Eltern reden mit anderen Menschen über sie. Ein Priester unserer Kirchengemeinde kam neulich auch zu uns, um über die Woods zu sprechen. Ich war nicht dabei, aber ich hörte ihn, als Mom ihm die Haustür öffnete. Ich glaube, sie wollte den Priester dort einfach stehen lassen, was sonst nicht ihre Art war, aber Dad rief, er solle doch hereinkommen.
Mrs. Wood besuchte uns einmal, eines Abends, ich war schon im Bett, aber noch wach. Sie weinte heftig und verzweifelt. Ich stieg aus dem Bett und lauschte auf der Treppe. Ich hörte sie sagen – fast schreien –, dass es unmöglich mit ihm sei und dass es so nicht weitergehen könne.
Am nächsten Tag fragte ich, wer es gewesen sei. „Mrs. Wood hat es schwer zu Hause“, antwortete Mom. „Mr. Wood ist ein seltsamer, schwieriger Mann, weil er in einem japanischen Strafgefangenenlager war, er ist psychisch gestört.“
Mom sprach diese Worte mit Nachdruck. Ich hatte sie das noch nie sagen hören, aber ich wusste, was sie meinte, zumindest in etwa.
Wenn Mom seltsam sagte, bedeutete das nie etwas Gutes. Und im Fall von Mr. Wood fügte sie ein schwierig hinzu. Wenn sie nur seltsam sagte, lachte Dad manchmal, nur dieses Mal nicht.
An diesem aus dem Ruder gelaufenen Nachmittag im September, in der trägen Nachmittagssonne, steht der psychisch gestörte Mr. Wood im Garten. Er hat die Hände in den Taschen seiner übergroßen roten Hose und die mageren Schultern hochgezogen, die Spitzen zeigen in den Himmel. Er steht vor der offenen Haustür, hinter der es dunkel ist. Mrs. Wood steht am kleinen Gartentor, die Beine rastlos, sie zeigt auf ihn, und ich kann an ihrem Mund erkennen, dass sie laut mit ihm spricht, fast schreit.
Sie trägt ein enges blaues Kleid mit allerlei kleinen roten Knöpfen vorne und sieht aus wie diese Sängerin, die neulich Lieder wie Puppet on a String trällerte, Lieder, die man barfuß singen muss.
Ich öffne das Fenster meines Zimmers und höre ihr Schreien. „So kann es nicht weitergehen!“ Und „Dann schlag mich, wenn du dich traust!“ Und „Du musst den Jungen in Ruhe lassen! Der Junge kann doch nichts dafür!“
Mit dem Jungen ist David gemeint. Ich sehe ihn nicht, aber ich weiß, dass er im Haus ist, in dieser klammen Dunkelheit. Seine Anwesenheit ist spürbar in der Art, wie sein Dad dasteht, mit den Händen in den Taschen, in seiner angespannten Regungslosigkeit. Mir stockt der Atem.
Mrs. Wood geht auf ihn zu, den Kopf leicht gesenkt, sie streckt die Arme aus, ich glaube, sie will ihn umarmen, und dann attackiert er sie, eine blitzschnelle Bewegung, ein heftiger Tritt in den Bauch, sie kippt nach vorne. Ich kann mich nicht bewegen, spüre einen Schmerz in meinen Händen, weil ich sie auf die Kante des Fensterrahmens drücke. Ich spüre, wie mein Kopf in glühende Aufruhr gerät, eine Panik, die ich so nicht kenne und spüre die plötzliche Notwendigkeit, jetzt mit dem Grauen vor meinen Augen und der Stimme im Ohr eine Entscheidung zu treffen.
Ich grübele seit Längerem über eine Veränderung. Wann ist der Moment? Heute, an einem Nachmittag im September? Es kommt mir vor, als hätte ich all die Jahre in einem imaginären Flugzeug hoch über den Wolken meine Runden gedreht und könne nun endlich den Sprung mit meinem Fallschirm in Richtung Erde wagen. Allmählich dämmert es mir, warum ich mit dem Sprung ins wahre Leben so lang gewartet habe. Ich sehe, was dort unten im Garten passiert und bin nur ein Zuschauer. Das muss ich mir eingestehen. Ich habe mich stets hinter Moms Rockzipfel oder Dads Worten versteckt und das flößt mir in diesem Moment mächtig viel Angst ein.
Tief in mir ist diese jämmerliche Hintergrundstimme, die mir immer wieder: Du bist feige, das wagst du nicht, zuraunt, begleitet von dem absurden Klang einer Geigensaite und einem Hintergrundchor, der den Refrain anstimmt: Du bist feige, Alexander. Vergiss das nicht.
Anfangs wird meine Veränderung sich wohl nicht so gut anfühlen. Ich habe mich immer unauffällig verhalten. Vielleicht wirke ich nach dem Sprung nicht überzeugend oder gekünstelt, aber das wird sich mit der Zeit gewiss geben. Zunächst einmal muss ich die Umstände ändern. Der Bruch soll radikal sein – und endgültig.
In der Vergangenheit ist mir immer schwindlig geworden, sobald ich an den Sprung aus meinem imaginären Flugzeug gedacht habe. Seltsamerweise verspüre ich jetzt keine Angst, obwohl immer neue weiße Streifen mit rasender Geschwindigkeit an mir vorbeiwehen. Und der Wind! Er zieht mich an sich, saugt, pfeift und protestiert, während unten auf dem Rasen Mr. Wood seine Frau auf bestialische Weise verletzt.
Mein altes Ich sieht mit ängstlichem Blick zu, wie ich mich voller Zuversicht auf die Tür des Flugzeuges zubewege. Diese Vorstellung mag ich. Wenn ich an den verängstigten kleinen Alexander denke, habe ich fast Mitleid mit ihm. Aber nur fast!
Ich will mich nicht mehr mit ihm beschäftigen. Ich bin jetzt ein anderer Junge. Der feige Alexander ist tot! Die Wahrheit ist, dass ich nichts mehr von ihm wissen will.
Ich bin bereit, den Sprung zu wagen. Im Garten wartet Mrs. Wood auf meine Hilfe und das imaginäre Publikum auf meinen freien Fall. Ich will sie nicht länger warten lassen.
Spring, Alexander, spring!, glaube ich sie in der Tiefe rufen zu hören.
Ich springe.
Alexander stirbt.
Alex – der Entschlossene wird geboren.
Kapitel 3
Krieg
Mrs. Wood taumelt rückwärts und krümmt sich vor Schmerzen. Gleich fällt sie hin. Der gestörte Mr. Wood geht langsam auf sie zu, als sei er stolz, vielleicht ist er es, weil er bestimmt, was im Garten mit seiner Frau passiert: Schmerz und Demütigung. Mrs. Wood fällt auf die Knie und wieder steht er regungslos vor ihr.
Dann kommt Dad auf seinem Fahrrad die Straße heruntergeradelt. Ich sehe, dass er die qualvolle Szene im Vorgarten einen Moment beobachtet, sehe ihn den Bürgersteig hinaufradeln, sehe, dass er am Gartenzaun anhält.
Ich muss meinen Kopf aus dem Fenster strecken, um zu hören, was er sagt, aber ich kann seine Worte nicht verstehen.
Mrs. Wood dreht sich um und zeigt auf ihren Mann, der sich immer noch nicht bewegt. Dad stellt sein Fahrrad gegen die Hecke, öffnet das Gartentor, während Mrs. Wood aufsteht und rückwärts auf meinen Dad zugeht. Sie packt seinen Arm und Dad legt seine Hand auf ihre, eine beruhigende Geste, und sie nickt. Ich bin so froh, dass Dad sie berührt.
Ich weiß, dass etwas passieren wird, was vieles verändern wird, es ist, als würde der Nachmittag zähflüssig in den Garten sickern, in dem drei Menschen stehen, regungslos, gefangen in allem, was sie nicht wissen und was nicht zu verstehen ist.
Ohne sich von der getretenen Mrs. Wood zu lösen, geht Dad mit ihr auf den Psycho zu, der mit erhobenem Kopf dasteht wie ein Herrscher, ein Erhabener mit feuerroten Wangen. Ich sehe die Freundlichkeit meines Dads, seine Höflichkeit, seine zivilisierte Ruhe. Er macht mit der freien Hand eine Geste in Richtung von Mr. Wood, der empört den Kopf bewegt, es ist die Geste einer Frage, die nicht anders gestellt werden kann als durch eine Handbewegung.
Mr. Wood packt Dads freie Hand und zieht ihn zu sich, die Köpfe der Männer sind nun dicht beieinander, näher ist kaum möglich.
Das dauert alles viel zu lange, denke ich, meine Panik hat zugenommen, atemraubend ist sie, ich muss jetzt irgendwo Hilfe holen.
Mrs. Wood löst sich von meinem Dad und dreht sich mit ausgebreiteten Armen um.
„Hilfe! Wer hilft uns?“ Ihre Stimme ist so laut, dass sie mir völlig fremd ist.
Mr. Wood starrt auf Dads Hand, es ist ein grimmiger Blick, voll mörderischen Wahns, sein Kopf kommt näher, ich weiß, was passieren wird, es ist unmöglich und doch weiß ich es: Er setzt seine Zähne in Dads Hand. Dad schreit vor Schmerz, der Schrei wirft seinen Kopf zurück. Mr. Wood legt seine Hände in den Nacken von Dad und zieht seinen Kopf zu sich heran, immer tiefer, bis er sich beugt und sein Knie ruckartig nach oben geht. Dad fällt neben ihn auf den Boden und bewegt sich einen Moment lang nicht.
Mr. Wood steht breitbeinig vor Dad und während er auf ihn zeigt, beginnt er zu zählen: „One, two, three.“ Und weiter bis zehn. Mit jeder weiteren Zahl tritt er Dad in die Seite, in den Bauch. Ich kann das Gesicht von Mr. Wood immer noch nicht sehen, aber ich höre, dass er laut lacht. Wo ist Mrs. Wood, wo sind ihre lustigen roten Knöpfe?
Das Gartentor ist offen und das macht alles noch schlimmer. Warum rühre ich mich nicht? Ich fühle meine Tränen über die Wangen rollen, und Scham, Scham über das, was da passiert, über meinen Dad, der da unten liegt. Ich sehe Mrs. Wood die Straße überqueren, sie war auf der anderen Seite, hinter ihr geht der korpulente Mann aus dem Lampenladen, der keinen Kittel trägt, sondern ein verschwitztes Unterhemd über seiner zu weiten, von Hosenträgern gehaltenen Hose. Er hat einen hochroten Kopf. Über seinem rechten Auge ist eine schwarze Augenklappe, auf die seine Frau eine kleine Glühbirne gestickt hat. Ich habe ihn nie anders gekannt. Er geht schwerfällig, als hätte er Schmerzen. Das hält ihn aber nicht davon ab, auf Mr. Wood zuzulaufen und ihn grob zur Seite zu stoßen, fort von meinem Dad, über den er sich beugt.
Dads rechter Fuß zittert nach, die Muskeln entspannen sich. Es ist still. Dann ist da eine weiße Hand auf seiner Schulter. Dad schließt die Augen und stellt sich vielleicht vor, dass es Mom ist, die sie hält.
Mrs. Wood fängt an zu weinen, still, unkontrolliert, verängstigt, aber diesmal ist es eine Kapitulation, als würde sich das Ende nähern. Sie löst sich absichtlich von der Welt, so dass sie es nicht mehr bewusst erleben muss.
Es ist, als ob der Himmel vom trüben Sommerlicht so schwer würde, dass er sich wie eine Decke über den Vorgarten legt, als existierten für einen Moment nur diese vier Menschen und keiner von ihnen könne etwas daran ändern. Und damit endet alles.
Aber dennoch verändert sich alles, die ganze Welt mischt sich in das Geschehen ein, ich höre die Sirene eines Polizeifahrzeuges. Die Frau des Mannes aus dem Lampenladen, die sich immer lautstark unterhält, überquert jetzt in einer dunkelgrünen Schürze mit leuchtend roten Äpfeln die Straße, und hinter ihr erscheinen weitere Nachbarn auf der anderen Straßenseite, die Straße ist plötzlich voller denn je.
Ich kann mich auch wieder bewegen und gehe die Treppe hinunter, meine Beine sind schwer, und einen Moment lang überlege ich, so zu tun, als wäre ich gerade nach Hause gekommen und wüsste nicht, was los sei, aber es ist so viel los, dass ich den Gedanken an diese feige Ausrede gar nicht zu Ende führen kann.
Ich betrachte mich in dem großen Spiegel im Flur und beuge mich vor, um mein Gesicht besser sehen zu können. Wo erkenne ich darin meinen Dad? Im Regal neben dem Spiegel stehen fünf Exemplare seines kürzlich erschienenen Buches, einer Studie über den französischen Maler Courbet, das bald ins Deutsche und Russische übersetzt wird. Ich kann immer noch den Stolz spüren, als er mit einer Kiste Bücher nach Hause kam und mir von den Übersetzungen erzählte.
Ich stehe vielleicht nur ein paar Sekunden da, und ich bin älter, weiter weg vom Leben meines Dads, in meinem eigenen , und ich weiß, dass ich in diesem Leben eine Menge lösen muss. Das schießt mir durch den Kopf: Lösungen. Wo ist Mom? Sie wird hier so sehr gebraucht, es muss doch etwas geben, worüber wir gleich lachen können.
Ich muss mich fast gegen die Hitze stemmen, als ich die Eingangstür öffne. Im und um den Vorgarten der Familie Wood stehen viele Menschen. Irgendwo zwischen all diesen Menschen ist Dad, ich muss zu ihm, er ist immer zu mir gekommen, aber jetzt hat sich alles verändert, ich weiß nicht, wie ich ihn erreichen kann.
Ich schiebe einen Mann in schwarzer Kleidung zur Seite.
„Hey, immer mit der Ruhe!“, sagt er.
Ich spüre eine Aggression und kann mich kaum noch beherrschen. „Ich bin Alex, sein Sohn.“ Und plötzlich bin ich so glücklich, dass ich das sagen kann. Das ist es, was ich jetzt sein muss: Alex, sein Sohn.
„Von wem bist du der Sohn?“, fragt der Mann.
„Mein Dad liegt dort. Er wurde zusammengeschlagen.“
Der Mann schubst mich nun nach vorne, er ruft einem Polizisten etwas zu, ein Wort, das alle zur Seite treten lässt. Dann stehe ich bei meinem Dad, er sieht mich an und lächelt entschuldigend.
„Oh Papa …“, sage ich.
Eine weitere Sirene nähert sich. Einer der Beamten hält Mr. Wood am Oberarm fest. Er blickt ins Leere. Dann sieht der Psycho mich an und lächelt bösartig aus schwarzen toten Augen, als wäre ich und alles lächerlich. Es macht mich rasend.
Alexander ist tot.
Ich bin Alex, der Entschlossene und laufe auf Mr. Wood zu.
Kapitel 4
Einfach ehrlich sein
Als es Stunden später dunkel und draußen alles still ist, sitzen sich meine Eltern am Tisch gegenüber, unter der niedrigen Lampe mit den Fransen, einem Geschenk meiner Großmutter. Mom hält die Hände von Dad, der den Kopf gesenkt hat, nicht aus Traurigkeit, sondern als würde er über etwas grübeln, worüber er noch nie nachgedacht hat. Neben den Händen meiner Eltern stehen eine Bierflasche, zwei leere Gläser und ein Teller mit Käsestückchen, als würden sie etwas feiern.
Dad ist glimpflich davon gekommen. Er hat ein blaues Auge und ein paar Prellungen. Keine Knochenbrüche, hat unser Hausarzt gesagt.
Mom sieht mich liebevoll an. „Du solltest schlafen gehen, Junge“, sagt sie leise und schenkt Dad ein Bier ein, vorsichtig, mit einer schönen Schaumkrone.
„Ich muss noch Hausaufgaben machen“, erwidere ich. Worte, die ich sonst nie sage.
„Heute war ein entsetzlicher Tag, Alexander“, sagt sie. „Ich werde morgen in der Schule anrufen und sagen, dass du einen Tag zuhause bleibst. Vielleicht erzähle ich ihnen, was passiert ist. Einfach ehrlich sein?“
„Das würde ich jetzt nicht unbedingt tun“, antwortet Dad. „Besser nicht.“ Er nickt mir fast unmerklich zu, wodurch die Unergründlichkeit seiner Worte mich unvorbereitet trifft.
Ich erinnere mich, dass ich nach dem herablassenden Lachen auf Mr. Wood zugelaufen und mit ihm zu Boden gestürzt bin, plötzlich Kopfschmerzen bekommen und irgendwann Dads Stimme gehört habe, der meinen Namen gerufen hat. Ich weiß nicht, was los war, meine Eltern haben noch nicht darüber gesprochen.
In meinem Zimmer lege ich The Freewheelin von Bob Dylan auf. Auf der Vorderseite des Covers spaziert er mit einer Frau – vermutlich seine Freundin – durch das winterliche New York, eine Art des Gehens, die energetische Intimität ausstrahlt: Was auch immer in der Welt passiert, was auch immer wir mit der Welt machen wollen, wir gehören zusammen, denn wie wir zusammengehören.
Ich schaue aus dem Fenster, auf den leeren Garten der Familie Wood. Im Haus brennt kein Licht, es ist, als würde dort niemand wohnen. Es sind auch keine Menschen mehr auf der Straße, obwohl es noch nicht acht Uhr ist.
Ich wehre mich gegen die Scham, die ich für Dad empfinde. Er wollte eingreifen, er hat sein Bestes getan, er hat Mut gezeigt. Er hätte denken können: Die Woods werden es selbst lösen, vielleicht aber auch: Sie können es nicht selbst lösen, und ich auch nicht, aber jemand muss etwas tun, um das Problem zu lösen. Dad war dieser Jemand, mein Dad.
Ich sehe ihn wieder auf dem Boden liegen, und mich einen Moment lang denken, er sei tot, mir ist wieder, als würde ich erbarmungslos durch diesen Gedanken hindurchgeschleudert, von einer Seite zur anderen, so mächtig ist er. Was wäre, wenn Dad jetzt tot wäre? Wäre dann der Sprung aus dem Flugzeug umsonst gewesen? Ja, denn dann hätte Alex versagt.
Patricia ist noch nicht da, auch beim Abendessen habe ich sie nicht gesehen, dabei wollte sie sofort kommen, als sie von dem Vorfall mit Mr. Wood erfahren hat.
„Lasst uns ein Sandwich essen. Jeder soll es selbst in der Küche zubereiten“, sagte Mom.
Ich erinnere mich nicht, das getan zu haben.
Es sind nicht Patricias Schritte, die ich später auf der Treppe höre. Es ist Mom, die leise an meine Tür klopft und mit einem Glas Milch mein Zimmer betritt.
„Das ist lange her, Mom, seit du mir ein Glas Milch gebracht hast“, sage ich, und sie lächelt.
„Manchmal ist nichts lange her. Ich weiß gar nicht, wie du dich fühlst, Alexander.“
„Wie ich mich fühle, Mom?“
„Ja.