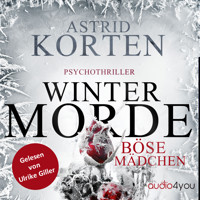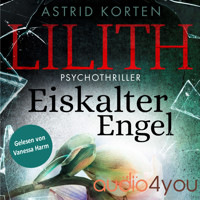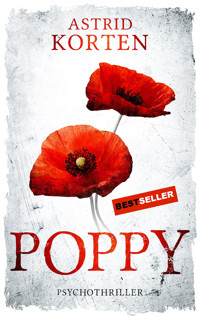4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zwei Städte. Zwei Epochen. Eine Liebe, die ein Jahrhundert trägt. München, 2020. Bei einem Besuch der Ausstellung „Zarenpracht“ wird die Journalistin Lilly Falkenberg auf ein Ballkleid aufmerksam: ein Meisterwerk aus Seide, Chiffon und Tüll, einst im Besitz der russischen Gräfin Alexandra Oblenskaja. Fasziniert von der Ausstrahlung des Gewandes beginnt Lilly nachzuforschen und reist nach Sankt Petersburg, in jene Stadt, in der ihre Mutter mit einer neuen Familie lebt. An der Seite von Christian, einem vertrauten Freund ihres Stiefvaters, folgt sie den Spuren eines Jahrhunderts: tastend, suchend, mit jedem Schritt näher an eine glanzvolle und erschütternde Epoche. Zwischen der glanzvollen Melancholie Sankt Petersburgs und der zeitlosen Eleganz von Paris, zwischen Vergangenheit und Gegenwart, entfaltet sich eine Geschichte von Erinnerung und Verlust, Schmerz und Liebe. Verlorene Träume ist ein bewegender Roman über das Echo der Liebe, die Zeit und Umbrüche überdauert und die Gegenwart verändert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über das Buch
Zwei Städte. Zwei Epochen.
Eine Liebe, die ein Jahrhundert trägt.
München, 2020. Bei einem Besuch der Ausstellung „Zarenpracht“ wird die Journalistin Lilly Falkenberg auf ein Ballkleid aufmerksam: ein Meisterwerk aus Seide, Chiffon und Tüll, einst im Besitz der russischen Gräfin Alexandra Oblenskaja.
Fasziniert von der Ausstrahlung des Gewandes beginnt Lilly nachzuforschen und reist nach Sankt Petersburg, in jene Stadt, in der ihre Mutter mit einer neuen Familie lebt. An der Seite von Christian, einem vertrauten Freund ihres Stiefvaters, folgt sie den Spuren eines Jahrhunderts: tastend, suchend, mit jedem Schritt näher an eine glanzvolle und erschütternde Epoche.
Zwischen der glanzvollen Melancholie Sankt Petersburgs und der zeitlosen Eleganz von Paris, zwischen Vergangenheit und Gegenwart, entfaltet sich eine Geschichte von Erinnerung und Verlust, Schmerz und Liebe.
„Verlorene Träume“ ist ein bewegender Roman über das Echo der Liebe, die Zeit und Umbrüche überdauert und die Gegenwart verändert.
Widmung
Für Menschen, die die Liebe in sich tragen.
Prolog
Juri
Alle Geräusche waren verstummt. Granaten, Schüsse, Schreie. Die Welt hatte den Ton abgedreht. Alles klang weit entfernt, gedämpft und fremd.
Juri Gagarin kam es vor, als würde er unter Wasser treiben, in jenem stillen, dunklen See hinter seinem Anwesen. Doch das Wasser war eine Illusion. Da war das Pochen seines Blutstroms in den Ohren, dumpf und schwer wie ein sterbender Takt.
Er lag auf kaltem, modrigem Boden, durchweicht von Sumpf und Blut. Hoch über ihm spannte sich der Nachthimmel wie ein finsterer Baldachin, in dessen Zentrum der Mond hing: groß, rund, silbrig-leuchtend, gespenstisch schön in seiner makellosen Vollkommenheit.
Juris Lider wurden schwer. Mit jeder Sekunde lief er Gefahr, dass sie ihm entglitten, vergleichbar mit dem Entgleiten eines sich verlierenden Lebens.
Dort, wo ihn die Kugel getroffen hatte, klebte das Hemd an seiner Brust: feucht, kalt und schwer vom Blut. Der Stoff sog sich an seine Haut wie eine fremde, klamme Hand.
Der Schmerz bohrte sich wie ein glühender Dorn in sein Fleisch. Mit letzter Kraft zwang er sich, den Blick nicht vom Mond zu nehmen. Vielleicht blickte Alexandra in diesem Moment ebenfalls zum Himmel, irgendwo auf dieser zerrissenen und erbarmungslosen Welt. Vielleicht trafen sich ihre Blicke auf seiner silbernen Oberfläche.
Eine unsichtbare Brücke aus Licht, zart und doch unzerbrechlich. Ein Gedanke wie ein Lichtstrahl in der Dunkelheit. Schön genug, um die Angst zu ertränken.
Für einen Moment war sie bei ihm. So nah, dass er beinahe ihren Atem auf seiner Haut spüren konnte. Ein letzter Rest von Nähe. Von Wärme. Von dem, was womöglich zuvor Liebe war. Dann kam der Schmerz zurück, schwer und erbarmungslos. Langsam senkten sich seine Lider, unwiderruflich wie der Vorhang nach dem Schlussakt eines Theaterstücks.
Die Dunkelheit schlug zu. Die Welt wurde schwarz.
Kapitel 1
München, 2020
Lilly
Der Minutenzeiger von Großmutters altmodischem Wecker auf meinem Nachttisch springt mit einem kaum hörbaren Klacken weiter. Viertel vor zehn. Ein Geräusch, so leise, dass man es nur wahrnimmt, wenn man darauf wartet. Oder wenn alles andere schweigt.
Max ist nie länger als bis zehn geblieben. Nie. Nicht ein einziges Mal. Ich weiß das. Und dennoch greife ich nach seinem Arm, als könne ich ihn so an mich binden, ihn mit einer Berührung hierbehalten, für immer. Ein kindlicher Reflex, der mir selbst peinlich ist, kaum dass ich ihn vollzogen habe. Vielleicht erkennt er die Verzweiflung in dieser Geste. Vielleicht aber auch nicht.
„Wie spät ist es?“, murmelt er mit geschlossenen Augen, seine Stimme dumpf vom Schlaf, vielleicht noch halb in einem anderen Leben.
Ich antworte nicht. Die Zeit auszusprechen hieße, sie heraufzubeschwören. Ich will den Moment nicht töten. Nicht jetzt. Er ist nach unserem Liebesspiel eingeschlafen, bestimmt eine halbe Stunde lang. Ich habe jede Minute gezählt, während ich ihn mit einer fast schmerzhaften Zärtlichkeit beobachtete. Seine Bewegungen, seine Atmung, die Art, wie sich seine Lider manchmal unruhig bewegten, als holte ihn im Traum etwas ein, das tief in ihm nachhallte. Er wirkt so verletzlich im Schlaf, fast fremd. Nicht friedlich. Nur leer, ausgebrannt. Wie jemand, der eine Entscheidung zu lange aufschiebt und daran zerbricht: der Stress in der Redaktion, die Sache mit seiner Frau, mit seinem kleinen Sohn. Ich kenne die Liste. Ich kenne sie besser als er, glaube ich.
Seine langen, dunklen Wimpern ruhen wie Seidenfäden auf seiner Haut. Nur sie machen ihn weich. Er sieht jünger aus, wenn er schläft. Verletzlicher. Ich fahre mit dem Finger über seine Lippen, sanft, zögernd. Nur der Hauch einer Bewegung. Mit geschlossenen Augen drückt er sanft meine Fingerspitze an seine Lippen. Eine Geste, kein Bekenntnis. Ein Gruß aus einer Welt, in der wir vielleicht gemeinsam leben könnten. Sein Haar ist weich und viel zu lang, aber ich liebe es so. Liebe es, durch die dunklen Wellen zu fahren wie durch einen Teil seiner Seele.
Er zieht mich näher an sich. Ich rieche ihn. Ein subtiler Duft nach Gewürzen und menschlicher Haut, maskulin, tiefgründig, sinnlich, kaum wahrnehmbar, doch stets präsent. Er riecht nach Sehnsucht, nach Fernweh und Heimat zugleich.
Seine Hände gleiten über meinen Körper, erkunden mich mit langsamer Selbstverständlichkeit. Ich lasse es zu. Es gibt keine Vernunft in diesem Moment, nur das körperliche Wissen, dass er gleich gehen wird, dass er mich noch einmal spüren will. So wie ich ihn spüren will. Und wir tun es noch einmal. Nicht wie Liebende, sondern wie zwei Ertrinkende, die wissen, dass das Ufer nur eine Lüge ist.
Als seine Finger meine Hüfte erreichen, durchfährt mich ein elektrisierendes Beben. Ich spüre seine Erregung, spüre mein eigenes Verlangen wie eine Welle, die über mich zusammenschlägt. Wir stöhnen fast gleichzeitig auf, ein Klang, der sich im Halbdunkel ausbreitet wie Musik. Mit einer einzigen, fließenden Bewegung gleitet er über mich, bettet mich unter sich, stützt sich mit den Händen rechts und links neben meinem Körper ab.
„Ich kann nie genug von dir bekommen“, flüstert er. Sein Mund versiegelt meine Lippen mit einem Kuss, der alle Grenzen aufhebt. Raum und Zeit lösen sich auf, wir sind nur noch Berührung, Atem, Herzschlag und Haut. Ich vertraue ihm, obwohl mir bewusst ist, dass dies keine Veränderung bewirkt.
Dann, mitten in der Stille, zerschneidet das Vibrieren seines Handys die Intimität unserer fragilen Blase. Die WhatsApp‑Nachrichten überfluten sein Leben bis in mein Schlafzimmer.
Max flucht leise, fast entschuldigend. Er rollt sich auf die Seite. Ich sehe ihn nicht an, aber ich höre, wie er sich abwendet. Ein kurzer Blick auf den Wecker. Die schnelle und routinierte Bewegung eines Mannes, der rechtzeitig nach Hause zurückkehren muss.
Jetzt beobachte ich ihn. Ich kenne jede seiner Bewegungen. Es gibt nichts Spontanes mehr an ihm. Nur noch Gewohnheiten. Die Reihenfolge bleibt konstant: die Hose zuerst, dann das Hemd. Alles ist geordnet, schnell, effizient. Der prüfende Blick aufs Handy, der letzte Griff durch die Haare, der Blick zur Tür.
„Mit dir vergeht die Zeit wie im Flug“, sagt er.
Ich hasse diesen Satz. Nicht weil er falsch ist, sondern weil er stimmt. Auch in mir ist etwas erloschen. Die Hitze weicht einer kühlen Leere, die sich wie ein Film über alles legt. Die glühende Sehnsucht ist einer dumpfen Enttäuschung gewichen. Ich ziehe die Decke über mich, wie ein Kind, das sich vor der Dunkelheit versteckt, obwohl es längst weiß, dass die Monster nicht draußen lauern, sondern in uns.
„Ich wünschte, du würdest einmal bei mir bleiben.“ Meine Stimme klingt anders. Nicht wie die einer Frau. Eher wie ein Mädchen, das etwas erbettelt, das ihm nie gehört hat.
Draußen ist es dunkel. Nur eine einsame Laterne auf der gegenüberliegenden Straßenseite spendet mattgelbes Licht. Selbst dieses Licht wirkt trostlos. Bereits als Kind empfand ich eine tiefe Abneigung gegen die Straßenbeleuchtung. Es erinnert mich an Krankenhausgänge, an stille Wohnzimmer nach einem Streit, an Tage, an denen niemand zurückruft.
Max setzt sich zu mir aufs Bett. Seine Nähe ist plötzlich wieder da, abermals gefährlich. Ich möchte sie und fürchte sie zugleich. Er legt seine Hand unter mein Kinn und zwingt mich sanft, ihn anzusehen. Seine Augen sind so tief, dass man darin untergehen kann.
„Ich würde es selbst so sehr wollen, Lilly. Eine Flasche Wein öffnen, einen Film schauen, lachen, still sein. Nur du und ich. Keine Heimlichkeiten. Kein Lügen. Nur wir beide und uns später wiederfinden, langsam, zärtlich, ohne Eile. Dann in deinen Armen einschlafen. Genau das möchte ich.“
Er sagt es mit einer solchen Überzeugung, dass ich ihm fast glaube. Es ist, als hätte er in mein Herz geschaut, und gerade deshalb trifft es mich umso tiefer. Die Illusion wiegt schwerer als die Wirklichkeit. In ihrer Schwere liegt ein Schmerz, der sich leise in mir ausbreitet.
Eine einzelne Träne entweicht ungehorsam. Max streicht sie mit der Fingerspitze fort, küsst die feuchte Stelle mit einer Zärtlichkeit, die mehr sagt als jedes Wort. In seinem Blick erkenne ich meine eigenen Gefühle: Liebe, Traurigkeit, Hoffnungslosigkeit.
„Liebste Lilly …“ Er schiebt die Hand unter die Decke, findet meine, hält sie fest. „Ich liebe dich. Du forderst mich, machst mich mutiger, klarer, lebendiger. Mit dir will ich noch einmal ganz neu beginnen. Wenn ich geschieden bin … wirst du mich dann heiraten?“ Seine Stimme bebt kaum merklich bei den letzten Worten.
Viel später schlägt mein Herz in der Stille wie eine Warnung.
*
„Und? Was hast du geantwortet?“
Coco klopft mit präziser Geste die Asche ihrer Zigarette in den überfüllten Aschenbecher. Der Rauch kringelt sich träge in der Luft wie ein Geist, der nicht weiß, wohin mit sich.
„Was glaubst du?“ Ich kann ein Kichern nicht unterdrücken. „Ich liebe ihn. Natürlich habe ich Ja gesagt.“ Meine Stimme klingt beinahe wie ein Echo aus einer früheren Zeit.
Hier, in der engen Raucherkabine mit dem abgestandenen Geruch von Nikotin und ohne den Bürofrust, benehmen wir uns wie zwei Mädchen, die sich in einem Fahrradschuppen hinter der Schule versteckt haben. Wir tuscheln über Jungs.
Stille. Coco kichert nicht. Sie zieht an ihrer Zigarette, als würde sie überlegen, ob sie mich retten oder aufgeben soll.
„Weißt du …“ Sie lässt sich Zeit mit dem Satz, als müsse sie ihn Wort für Wort aus etwas Zähem ziehen. Ich würde gerne mit Ihnen über das Hochzeitskleid, die Blumendekoration, die Gästeliste und die Wahl der Location sprechen. Nur, es fühlt sich trügerisch an.“ Sie sagt es leise. „Und das macht es nur noch schlimmer.
„Er meint es ernst, Coco.“
„Nein“, sagt sie. „Er ist verlogen.“ Cocos Stimme ist weich, aber unnachgiebig. „Es ist die Fortsetzung von etwas, das wieder zu wenig sein wird. Wieder nicht genug.“
„Spielverderberin.“
„Mag sein. Aber ich bin auch deine Freundin, der dein Bestes am Herzen liegt. Ich kann mich einfach nicht mit einer Illusion zufriedengeben, bloß weil sie dich gelegentlich wärmt.“
„Es ist nur noch eine Frage der Zeit.“ Ich höre, wie sich meine Stimme leicht hebt, fast beschwörend. „Er liebt sein Kind, ja, aber diese Ehe ist ein Trümmerhaufen. Wenn das Kind größer ist, wenn die Übergabe geregelt ist, dann wird er frei sein.“
Coco sieht mich an, kühl, klar. „Für eine hochqualifizierte Journalistin bist du erstaunlich naiv“, sagt sie. „Wenn du nicht aufpasst, wirst du eines Tages aufwachen und dann wird er nicht mehr da sein. Vielleicht war er es nie.“
Ich sehe zu Boden. Kontere nicht mehr. Es lohnt sich nicht. Sie meint es nicht böse, sie ist nur ehrlich. Coco drückt die Kippe in den überfüllten Aschenbecher und verlässt die Kabine.
Erleichtert folge ich ihr. Für mich als Nichtraucherin ist die Raucherkabine eine Folterkammer, ein stickiger, beißender Käfig aus Glas. Aber es ist auch der einzige Ort, an dem wir ungestört sprechen können. Wo wir keine Blicke und Fragen fürchten müssen.
*
Zurück an meinem Schreibtisch werfe ich einen Blick in Richtung Max’ Büro. Hinter der Glasscheibe sitzt er, perfekt wie immer. Der König im Glaskasten, ein Reich aus Worten, Kopfzeilen und Halbwahrheiten. Ein Mann mit Macht. Mit dem Blick eines Erzählers, der weiß, wann das Ende kommt, aber es für sich behält. Als Chefredakteur von Panorama ist er der Dirigent eines Orchesters aus Tastaturen und Stimmen. Ein kluger, charismatischer Mann mit diesem gewissen Blick, der selbst die nichtssagenden Sätze auflädt, als wären sie Teil einer Geschichte, die nur er kennt.
Er bemerkt meinen Blick, hebt kurz den Kopf und wendet sich für einen Augenblick vom Bildschirm ab. Ein kaum wahrnehmbares Heben des Mundwinkels. Fast nichts. Der Schatten eines Lächelns. Dann wieder nichts. Nur der Bildschirm, nur Arbeit, nur Schweigen. Ein Schatten, mehr war es nicht. Aber manchmal, wenn das Licht günstig fällt und ich den Atem anhalte, kann selbst ein Schatten ein Versprechen sein. Oder eine verhängnisvolle Lüge …
Kapitel 2
München, 2020
Lilly
Als ich die Wohnungstür öffne, trete ich in einen Sonnenstrahl, der wie ein Lichtmesser durch das Wohnzimmerfenster den Parkettboden schneidet. Warm, goldgelb, friedlich. Ein Trugbild. Licht, das lügt.
Ich stelle meine Tasche auf dem Schrank unter der Garderobe ab, neben der Schale mit den alten Schlüsseln. Großmutter hatte diesen Platz für solche Dinge vorgesehen. Ihr Mantel hängt nach wie vor dort. Dunkelgrau, aus der Form geraten, jetzt unberührt.
Für einen flüchtigen Moment überkommt mich das Gefühl, alles sei wie früher. Als hätte die Zeit einen Sprung gemacht. Als würde Großmutter gleich aus der Küche kommen und sich die Hände an der Schürze abwischen, mit einem sanften Lächeln, das eine tiefere Bedeutung transportierte als Worte.
Ich spüre fast ihre Wärme, rieche den Duft von Jasmin und Tee, höre in Gedanken den Klang ihrer Stimme. Aber sie kommt nicht. Stattdessen ist da nur diese Stille. Dicht, greifbar, fast lebendig.
Ich gehe langsam durch die Wohnung. Jeder Schritt ist vertraut, und doch ist nichts mehr vertraut. Alles wirkt verändert, als hätte jemand heimlich die Luft ausgetauscht. Die Möbel stehen noch an ihrem Platz, die Kissen bewahren die Erinnerung an eine Person, die dort saß. Und doch fehlt etwas. Etwas, das nicht zurückkehrt.
Dann ist er wieder da, dieser eine Tag vor fünf Jahren, als ich nach Hause kam und keine Antwort bekam …
*
„Großmutter, ich bin zu Hause!“ Die Worte hallten durch den Flur wie ein Echo aus einem anderen Leben.
Aus der Küche strömte der Duft von Pellkartoffeln, eine ihrer Lieblingsspeisen. Der Geruch löste ein vertrautes Hungergefühl in mir aus, ein wohliges Ziehen im Magen. Doch etwas stimmte nicht. Ich spürte es, bevor ich es sah.
Ich legte meine Tasche ab, zog die Schuhe aus, noch gefangen in der Illusion eines gewöhnlichen Abends. Doch mit jedem Schritt legte sich eine feine, kribbelnde Nervosität auf meine Haut. Ich griff zum Handy: eine neue Nachricht. Mein Interview mit Delphine de Vigan war bestätigt. Ein Lob vom Chefredakteur. Ein Gruß von Coco. Ich hatte Großmutter so viel zu erzählen.
„Großmutter?“
Keine Antwort. Nur ein leises Zischen. Und der beißende Geruch von verbranntem Essen. Dann das schrille Kreischen des Rauchmelders, ein alarmierender Schrei in der Stille. Ich ging in die Küche und fand sie auf dem Boden, neben dem Herd. Die Holzkelle noch in der Hand, als würde sie Halt suchen.
Was danach geschah, verschwimmt. Drei Wände in undefinierbarem Beige, eine Reihe blauer Klappstühle, ein Tablett mit lauwarmem Kaffee, das eine freundliche Krankenschwester wortlos abstellte. Am Ende dieses Flurs lag Großmutter. In einem fremden Zimmer, an medizinische Geräte angeschlossen, kämpfte sie um ihr Leben.
Ich setzte mich auf einen der unbequemen Stühle, sprang gleich wieder auf und ging zur Glastür der Intensivstation. Durch das Fenster blickte ich in den leeren Korridor. Die Tür am Ende blieb verschlossen.
Ich redete mir ein, dass keine Nachricht eine gute Nachricht sei. Großmutter war eine Kämpferin. Sie hatte ihren Mann und ihren Sohn überlebt, nicht, um an einer banalen Hirnblutung zu sterben. Ihr Geist, so scharf, so kreativ, so einfallsreich, konnte sie nicht im Stich lassen. Sie konnte mich nicht verlassen. Wir waren ein Team. Eine Einheit.
Großmutter war der feste Anker in meinem Leben. Mama hatte sich längst in ein neues Leben geflüchtet. Freunde kamen und gingen. Aber Großmutter, sie war die Konstante. Die Zuflucht. Der Trost. Die Stimme, die mich auffing, wenn ich fiel.
Dann öffneten sich die Türen. Kalt sammelte sich etwas in meinem Bauch, eine Vorahnung, namenlos und schwer. Ich sprang auf, als der Arzt auf mich zukam. Sein Gesicht war müde, fast durchsichtig. Und es sagte mehr, als Worte je könnten. Die Welt hielt den Atem an. Ich auch.
Ich starrte vor mich hin. Nicht auf etwas. Nicht versunken in Gedanken. Leer. Der Schmerz war da, spürbar, umfassend, wie eine zweite Haut. So groß, dass nichts anderes Platz fand. Kein Trost, kein Bild, kein klarer Satz. Und doch war alles in mir Gefühl. Roh, flackernd, ungeordnet. Traurigkeit, ja, aber auch Unglaube, still, unbeweglich. Die Angst vor dem Endgültigen, vor dem, was sich nicht zurücknehmen lässt.
Ich ließ es nicht zu. Im seelenlosen Wartezimmer fühlte ich mich deplatziert. Vielleicht musste man sich hier fehl am Platz fühlen. Und doch war es mehr. Ich wusste: Ab jetzt war alles anders. Hier endete das Leben, das ich kannte. Und etwas Neues begann. Etwas Fremdes. Unerwünschtes. Ein Leben ohne Großmutter.
Der bloße Gedanke daran war wie ein Raum ohne Türen. Ein abgeschlossenes Inneres, ohne Ausweg, ohne Fenster, ohne Licht. Die Zeit stand still. Nur die Welt draußen bewegte sich weiter, hinter Glas, in einem Rhythmus, der nicht mehr zu meinem passte.
*
„Lilly?“
Selbst mein Name klang fremd. Zu lebendig. Zu sehr Alltag. Er passte nicht in dieses sterile Weiß, nicht in diese neue Wirklichkeit, die ich nicht gewählt hatte und die doch nun mein Leben war. Erst als ich eine Berührung an meinem Arm spürte, hob ich den Blick.
Max stand vor mir. Sein Gesicht war offen, weich, durchzogen von einem Mitgefühl, das mich irritierte. Er passte nicht hierher, nicht mit seiner stillen Präsenz, nicht mit seiner Wärme.
„Mein Beileid, Lilly. Soll ich jemanden für dich anrufen?“
„Ich kenne hier niemanden. Nur meine Großmutter.“ Meine Stimme war nur ein Hauch. „Mein Vater ist tot. Meine Mutter lebt mit ihrer neuen Familie im Ausland.“
Max setzte sich neben mich. Er schwieg.
„Meine Großmutter ist mein Ein und Alles.“
Ich konnte den Satz nicht beugen. Nicht ins Vergangene zwingen. „Sie ist ein Teil meines Lebens.“ Ich hielt inne. „Ich weiß nicht … Ich weiß nicht, wie …“
Dann kam der Schmerz. Ohne Ankündigung. Nicht leise. Nicht tastend. Ein Riss. Ein Bruch. Ein Strom von Tränen, der alles mit sich riss. Nur die nackte, ungefilterte Wahrheit blieb.
Max legte seinen Arm um mich. Er hielt mich. Ich weinte lautlos, haltlos, erschöpft, und verabschiedete mich von Großmutter. Von meinem alten Leben. Von der Sorglosigkeit. Für einen Moment war Max das Einzige, was mich hielt, an der Schwelle zu einem anderen Dasein.
*
Seit diesem Tag ist viel geschehen. Manchmal frage ich mich, ob ich seitdem einfach durch eine andere Realität gehe. Eine, in der die Farben blasser sind, die Stimmen leiser, die Schatten länger. Heute war wieder so ein Tag. Etwas in mir pocht, namenlos, unter der Oberfläche.
Ich gehe durch die Wohnung, und das Licht streift ein altes Foto auf dem Sideboard. Großmutter. Ihr Blick ist ruhig, fast wissend. Ich drehe es um. Heute bin ich betrübt über den Ausdruck im Gesicht. Und während ich hier stehe, in diesen vertrauten vier Wänden, überkommt mich etwas Unerklärliches.
Etwas in mir flüstert: „Du bist nicht allein, Lilly.“
Ich weiß, Großmutter, antworte ich in Gedanken.
Kapitel 3
München, 2020
Lilly
Endlich Sonne.
Ein seltener Gast in diesem endlosen Übergang zwischen März und November, der sich in diesem Jahr weigert, eine Entscheidung zu treffen.
Coco hebt das Gesicht in die Wärme, schließt die Augen und lächelt, als läge sie am Strand in der Karibik, mit einem Cocktail in der Hand. Doch wir sind nicht in der Karibik. Wir sitzen auf einer kalten Steinbank, umgeben von den Betonfassaden des Arabella-Parks und der tristen Leere der Mittagspause. Statt eines gläsernen Versprechens mit Strohhalm halten wir beide ein lieblos verpacktes Sandwich in der Hand.
Kaum hat Coco das Wort „Sonne“ ausgesprochen, verzieht sie sich, als hätte sie sich gekränkt, hinter das höchste Gebäude.
„Welche Sonne?“, frage ich und beiße in mein Sandwich, das nach Pappe schmeckt.
Coco verzieht das Gesicht. „Jetzt sei nicht so“, sagt sie leise. „Es ist Mai. Im Wonnemonat hat man die Sonne auf der Haut zu spüren, nicht in der Wetter-App. Stattdessen Novembergrau, Regen, Trostlosigkeit. Als hätte das Jahr seine Jahreszeiten verloren und sich in einen einzigen, endlosen Herbst verwandelt. Ich würde alles geben, um jetzt in der Karibik zu sein.“
Sie nimmt den letzten Bissen, knüllt die Verpackung zusammen und wirft sie zielsicher in den Mülleimer. „Welche Bank müsste ich dafür ausrauben, Lilly? Könntest du dir das mit deinem Panorama-Gehalt leisten?“
Ich verdrehe die Augen. Nur die schuldenfreie Eigentumswohnung meiner Großmutter bewahrt mich vor echter Existenzangst. Eine Weile sagen wir nichts.
Die Bürosklaven der umliegenden Banken und Investmentfirmen strömen an uns vorbei. Menschen in Maßanzügen, mit glänzenden Schuhen, auf dem Weg zu etwas Wichtigem. Oder sie tun zumindest so.
Ich deute mit dem Kinn auf sie. „Und wir? Wir fragen zum hundertsten Mal dieselben Leute dieselben belanglosen Dinge.“
Coco grinst schief. „Yep, und die Antworten ändern sich auch nicht.“
„Es ist nicht das, wovon ich geträumt habe.“
„Dann wach auf, Lilly“, sagt sie nüchtern.
Ich lache kurz, aber in diesem Lachen liegt nichts Heiteres. Sie hat recht. Jedes Jahr dieselben Künstler, dieselben Fragen, dieselben Textbausteine. Dabei wollte ich Geschichten erzählen, recherchieren, Bedeutendes schaffen. Stattdessen schreibe ich über Serienstarts, Netflix-Tipps und müde Theaterpremieren. Das Einzige, das mich bei Panorama hält, ist Max. Aber selbst das fühlt sich oft an wie ein Wartesaal. Ohne Uhr, ohne Garantie.
Coco trinkt einen Schluck Wasser. „Du brauchst einen Job, der deinen Verstand nicht beleidigt.“ Sie blickt mich an. „Ich weiß, dass du nur seinetwegen bleibst.“
Meine Schultern verkrampfen sich. „Er wird sich scheiden lassen“, murmele ich.
„Natürlich. Das sagen sie alle. Nur tun sie es nie.“
„Er liebt mich.“
„Das ist kein Versprechen, Lilly.“
Ich mag es nicht, wie eindeutig sie ist. Wie mühelos sie mich durchschaut. „Komm, gehen wir“, sage ich abrupt, greife meine Tasche und stehe auf, als könnte ich das Thema mit einer Bewegung auslöschen.
Coco folgt mir.
Im Gebäude drücke ich wortlos den Aufzugknopf. Der Edelstahl spiegelt unsere Gesichter. Meines: blass. Ihres: angespannt, ein Hauch von Wehmut liegt darauf. Für einen Moment tut sie mir leid.
Coco: groß, blond, Anfang fünfzig, Ehemann, zwei erwachsene Söhne. Sie besitzt eine Lebensklugheit, die sie mit bewundernswerter Großzügigkeit teilt. Manchmal erinnert sie mich mehr an die Mutter, die ich nie wirklich hatte, als an eine Freundin. Doch auch die besten Ratschläge erleichtern manche Entscheidungen nicht. Ich verfluche den Tag, an dem ich ihr mein Herz ausgeschüttet habe.
Niemand in der Redaktion weiß von Max und mir. Zumindest hoffe ich das. Es soll ein Geheimnis bleiben. Doch jedes Geheimnis wird leichter, wenn man es teilt. Liebe ist nicht planbar. Sie folgt keiner Regel. Sie trifft uns dort, wo wir es nicht erwarten, verändert sich, verformt sich, stirbt manchmal. Auch Max ist kein Einzelfall. Viele Menschen leben in gescheiterten Ehen. Nur begann seine Geschichte des Scheiterns vor mir.
Unsere Geschichte begann leise. Beiläufig. An einem dieser Abende, an denen es draußen längst dunkler war als drinnen …
*
Ich war neu bei Panorama, meine Großmutter war vier Monate tot, das Haus, das sie mir hinterlassen hatte, war kein Zuhause mehr. Es lag still da, leer und kalt, als hätte das Leben sich heimlich, auf Zehenspitzen, davongestohlen. Ich konnte mich kaum überwinden, zurückzugehen.
Max saß hinter seiner Glaswand. Ich tat so, als wäre ich beschäftigt. Als das Licht gedimmt wurde, fielen unsere Vorwände gleichzeitig.
Wir gingen gemeinsam zum Aufzug.
„Du weißt, dass du erst ab Viertel nach acht Überstunden bezahlt bekommst“, sagte er, ohne mich anzusehen.
„Ich weiß.“
„Und dass ich dir deshalb keine Beförderung, kein höheres Gehalt anbieten kann.“
„Auch das weiß ich.“
„Warum bleibst du dann?“
„Warum nicht?“, murmelte ich, blickte in die verspiegelte Aufzugtür. Es war nicht gelogen. Nur unvollständig.
Als ich ihn ansah, erkannte ich, dass er die Lücken verstand. Seit dem Tod meiner Großmutter war meine Wahrnehmung auf ihn eine andere. Seine Stille war keine Distanz. Sie war Anerkennung. Gegenwärtig, ohne zu fordern. Und genau das hat mich berührt.
Als wir durch die verlassene Halle gingen, sah der Nachtportier nicht einmal auf. Alles war in Lautlosigkeit getaucht. Draußen empfing uns die Kälte wie ein scharfer Hauch.
„Was für ein eisiger Wind“, sagte Max, zog den Kragen seiner Jacke höher. Hinter uns fiel die Tür ins Schloss. Dumpf, endgültig.
Ich zog die Kapuze hoch. Mein Magen knurrte.
„Ich kann dir keine Beförderung anbieten, Lilly,“, sagte er, „aber vielleicht einen Teller Pasta. Ein Glas Wein. Ein bisschen Licht, bevor wir in unsere leeren Wohnungen zurückkehren.“ Seine Augen funkelten.
„Eine warme Mahlzeit klingt besser als Tiefkühlpizza“, antwortete ich. „Mein leeres Haus kann warten. Deins vermutlich auch.“
Er berührte meinen Ellbogen. Leicht. Beiläufig. Zärtlich.
Die Brasserie war warm, gedämpft, zeitlos. Der Klang von Besteck und Stimmen waberte wie Erinnerung. Draußen glitt der Abend regungslos am Fenster vorbei. Der Kellner füllte unsere Gläser mit der Routine eines Schauspielers in einer oft wiederholten Szene.
„Meine Frau besucht mit Jesse ihre Schwester in Nürnberg“, sagte Max. „Sie sind Zwillinge. Zwei Sätze, die nur zusammen Sinn ergeben.“
Wir schwiegen, während die Vorspeisen kamen. Es war kein trennendes Schweigen, sondern ein verbindendes. Wir aßen langsam, als könnten wir den Moment ausdehnen. Als wäre Reden ein Risiko.
Als die Teller abgeräumt wurden, lehnte Max sich leicht zurück. Sein Blick ruhte auf der Tischkante, als suchte er dort die richtigen Worte.
„Ich weiß, dass du eine schwere Zeit durchmachst“, sagte er. Seine Stimme ruhig, fast zu ruhig. „Wenn du reden willst, ich höre dir zu. Wirklich.“
Ich nickte. Ob ich sprechen konnte, wusste ich nicht. Der Kloß in meinem Hals war kein Schmerz. Es war Weichheit. Unerwartet.
„Meine Mutter lebt im Ausland“, begann ich. „Seit Jahren. Sie ist mir fremd geworden. Wir sehen uns kaum. Und wenn doch, dann ist da mehr Vergangenheit als Gegenwart.“
Max sagte nichts. Sein Blick blieb weich, still.
„Mein Vater starb kurz vor meiner Geburt. Mom war jung. Sie lernte jemanden kennen und zog danach um. Ich blieb bei meiner Großmutter. Vernünftig, sagten alle.“
Ich lächelte, ohne Freude. „Ich habe Halbgeschwister. Freundlich, höflich. Aber sie gehören zu einem anderen Leben. Nicht zu meinem.“
Max nickte kaum merklich und sagte leise: „Ich hatte keine Großmutter, die mich hielt. Nur Eltern, die sich trennten, als ich fünf war. Meine Schwester war jünger, sie hat es kaum gespürt. Ich aber alles.“
Ich stellte mir den kleinen Max vor. Wach, voller Lärm.
„Ich dachte, sie lieben mich nicht mehr“, fuhr er fort. „Sonst wären sie geblieben.“
„So denken Kinder“, sagte ich. „Auch wenn sie es nie sagen.“
„Gerade deshalb.“
Er hob sein Glas, trank, ließ es sinken. „Mein Vater blieb in München. Anfangs holte er uns. Dann zog seine neue Freundin ein. Neue Regeln. Meine Mutter schickte uns nicht mehr hin. Ich konnte nichts tun. Kinder haben keine Hand am Steuer.“
Ich nickte.
„Jedes Wochenende spielte ich Fußball. Es war Flucht und eine Ausrede. Besser als das Schweigen auf der Couch meines Vaters, während die neuen Kinder um Aufmerksamkeit rangen.“
Ich fragte nicht weiter. Manche Geschichten offenbaren sich in ihren Leerstellen.
„Heute sehen wir uns dreimal im Jahr“, sagte er nach einer Weile. „Geburtstag, Ostern, Weihnachten, Anlässe, die man mit Familie verbindet. Ich nenne es höfliche Pflicht.“ Keine Bitterkeit lag in seiner Stimme. Nur Müdigkeit. „Ich möchte vermeiden, dass es meinem Sohn einmal genauso geht.“
Wir blieben noch eine Weile sitzen. Das Glas in der Hand, den Blick auf dem Tisch, das Herz irgendwo dazwischen. Als wir später in die Nacht hinaustraten, sprach keiner von uns. Die Kälte war geblieben oder wir fühlten sie nicht.
Vor meiner Haustür blieb Max stehen. „Danke für diesen Abend, Lilly“, sagte er, beugte sich vor und küsste mich auf die Wange. Ein Hauch. Fast nichts. Und doch blieb etwas. Als er sich abwandte, wusste ich: Ich würde ihn vermissen.
Drinnen bemerkte ich, dass meine Hände zitterten. Vielleicht vor Erregung. Vielleicht vor Angst. Vielleicht vor einer Wahrheit, die ich nicht erkennen konnte.
Kapitel 4
München, 2020
Lilly
Am Freitagnachmittag gleicht die Redaktion einem Bienenstock. Überall summen Stimmen, klappern Tastaturen, schrillen Telefone. Die Luft riecht nach Kaffee, Reststress und Wochenende. Einige Kolleginnen hetzen noch, als würden sie gegen die Zeit selbst kämpfen, andere greifen bereits nach Taschen, rücken Stühle zurück, flüchten ins Wochenende.
Coco gehört, wie immer, zur zweiten Kategorie. Sie steht an meinem Schreibtisch und wirft ihre Tasche über die Schulter. „Hast du am Wochenende schon etwas vor?“, fragt sie.
„Aber ja. Morgen Abend ein Date mit Nicolas Sparks und Sonntagmorgen Frühstück im Bett mit mir.“
„Nicht schlecht. Falls dir der Sinn nach Gesellschaft steht: Samstagabend bei uns. Ganz ungezwungen. Sag einfach Bescheid.“ Coco lacht auf, warm und kurz.
Es ist ein verlockendes Angebot. Eines, das Geborgenheit verspricht. Aber ich weiß jetzt schon: Ich werde es ausschlagen. Inmitten ihrer Familie würde ich mich verlorener fühlen als allein in einem überfüllten Restaurant.
Hinter meinem Bildschirm beobachte ich Max in seinem gläsernen Büro. Konzentriert. Beherrscht. Zu kontrolliert. Wann lässt er endlich los? Wann reißen wir die Fassade ein?
Als hätte er meinen Blick gespürt, hebt er kurz den Kopf. Dann zeigt er beiläufig auf einen Stapel Ausdrucke. Eine stumme Einladung. Ich erhebe mich.
Als ich sein Büro betrete, macht mein Herz einen kleinen, unvernünftigen Satz. „Hast du Lust, am Sonntag in die Kunsthalle zu gehen?“, fragt er, ohne den Blick vom Bildschirm zu nehmen. „Ich habe zwei VIP‑Karten für die Ausstellung ‚Zarenzeit‘ in der Kunsthalle. Prunk, Schmuck, Mode, Geschichte. Möchtest du mitkommen?“
Mein Herz antwortet schneller als mein Verstand. „Ja. Sehr gern.“
„Dann elf Uhr. Haupteingang, Theatiner-Straße.“ Er schiebt mir die Karten zu und hebt die Stimme: „Schönes Wochenende, Lilly.“
Ich nicke. Für Außenstehende sieht es wie eine sachliche Übergabe aus. Nur wir wissen es besser.
*
Ein Sonntagmorgen mit einem strahlend blauen Himmel. Der erste Tag des Jahres, an dem ich in ein Sommerkleid schlüpfen kann. Eine Jeansjacke und weiße Sneakers machen mein Outfit komplett. Ich kann es kaum glauben, dass ich mit Max in die Kunsthalle gehen werde.
Vor dem Spiegel im Flur schweift mein Blick zum gerahmten Foto hinter mir an der Wand. ‚Was machst du nur, Lilly?‘ lese ich in den Augen meiner Großmutter und sehe ihren missbilligenden Blick.
„Ich weiß“, sage ich. „Ich weiß, dass es dir nicht gefällt. Ich halte mich an ordentliche Normen und Werte, habe nie einen Stift aus der Redaktion mit nach Hause genommen oder bin nie fünf Kilometer pro Stunde schneller als erlaubt gefahren. Wie konnte ich nur in diese Situation geraten?“
In dem Moment vibriert mein Handy, eine Nachricht von Max: „Der Termin heute muss leider verschoben werden.“ Wir melden uns.
Meine Freude auf den bevorstehenden Tag verwandelt sich in eine große Enttäuschung. Ich starre auf die Anzeige. Das war es dann. Kein Besuch der Kunsthalle. Kein Spaziergang. Kein Max. Nur wieder eine stille, bittere Leerstelle. Als ich jetzt das Foto meiner Großmutter anschaue, sehe ich in ihrem Blick eine Mischung aus Mitleid und Zufriedenheit.
Ich lasse das Handy fallen, atme einmal tief durch. Dann kicke ich die Turnschuhe in die Ecke. Sekunden später ziehe ich sie wieder an. Nein. Ich lasse mir diesen Tag nicht nehmen. Nicht von ihm. Die VIP‑Tickets wandern in die Tasche. Ich gehe.
*
Die Straßenbahn rattert unter mir. Am Max-Monument steige ich aus und lasse die Touristenschar an mir vorbeiziehen. Die Isar glänzt. Auch am Morgen ist die Stadt belebt: Kulturschnüffler aus der Provinz, lärmende Familien und verliebte Pärchen. Es scheint, als wäre ich die Einzige, die allein unterwegs ist. Wie ist es möglich, sich in einer Stadt voller Menschen so allein und einsam zu fühlen?
Eine Mutter mit ihrer Tochter überholt mich beim Plaudern. Sie tragen farbenfrohe Einkaufstaschen. Was würde meine eigene Mutter jetzt wohl gerade machen? Vielleicht ist sie in Sankt Petersburg auch mit ihrer Tochter einkaufen. Vielleicht sitzen sie alle zusammen beim Brunch in ihrer luxuriösen Diplomatenresidenz. Vielleicht denkt sie an mich. Ich frage mich, ob meine Mutter mich diesen Sommer wieder besuchen wird und ob ich mir da was wünsche.
Ich blicke auf die glitzernde Oberfläche der Isar. Die Sonne streichelt mein Gesicht, meine Hände ruhen auf dem warmen Brückengeländer. Der Malachit in dem goldenen Ring, den ich einst von meiner Großmutter bekam, fühlt sich warm an. Ich fahre mit dem Finger über die Maserung des Steins. Er lebt. Und in ihm lebt etwas von ihr, als ob die Verbindung zu meiner Großmutter durch den Ring greifbar wäre. Von der Sonne und meinen Erinnerungen ermutigt, beschließe ich, meiner Mutter heute Abend eine Nachricht zu schicken.
Mit dem VIP‑Ticket gehe ich an der Warteschlange vorbei und betrete die Ausstellung: gedämpftes Licht, schwere Stoffe, funkelnde Juwelen. Stille. Geschichten hinter Glas. Porträts von Menschen, die das Leben der Auserwählten gelebt haben. Die Welt der Romanows: Zaren, Fürsten, Grafen, Skandale. Ballkleider, Juwelen, Schmuckstücke. All das schafft einen Eindruck von einem Lebensstil, der heute undenkbar wäre. Insbesondere, weil dieser Lebensstil nur einem kleinen Teil der Bevölkerung zugänglich war und der Rest hart und unter schlechten Bedingungen arbeiten musste und in Armut lebte. Die Unvorhersehbarkeit des Schicksals hat mich schon immer fasziniert. Welche Macht bestimmt, ob man als Schornsteinfeger oder als Prinz geboren wird, in einem brasilianischen Slum oder am Hof eines Zaren? Meine Gedanken wandern zu Fragen, auf die ich nie eine Antwort bekommen werde.
Ich zwinge mich zurück ins Hier und Jetzt. Die Kleider in den Vitrinen sind atemberaubend schön. Kleine Schilder daneben erzählen ihre Geschichte. Die Frauen, die sie einst trugen, gibt es längst nicht mehr. Ebenso wenig gibt es die Musiker, die auf diesen Bällen spielten, oder die Näherinnen, die jede Perle, jeden Streifen Spitze auf diese Kleider nähten.
Ein Kleid zieht mich besonders in seinen Bann. Es ist ein Traum aus türkisfarbenem Chiffon, Seide und Tüll, mit feinen Stickereien und Zierperlen. In der Mitte befindet sich ein großer, aquamarinfarbener Schmetterling mit ausgebreiteten Flügeln. Dem Schild zufolge wurde das Kleid vom Pariser Modesalon Jeanne Paquin entworfen und angeblich 1914 nur ein einziges Mal von Gräfin Alexandra Oblenskaja auf einem der letzten rauschenden Bälle vor Ausbruch der Revolution getragen.
Über Jahrhunderte hinweg war die Familie Oblenskaja mit den Romanows verbunden: durch Blut, Politik und verschwiegene Skandale. Gräfin Alexandra, lese ich, war eine Nichte des Fürsten Felix Scheremetew, dessen Palais einst als Zentrum der Petersburger Kulturszene galt.
Aufgrund seiner Stoffe und der Verarbeitung war das Kleid zweifellos ein Vermögen wert. Meine Hand greift nach meinem Kleid und einen Moment lang beneide ich Alexandra um ihr Glück. War sie wirklich glücklich? Nur weil sie schöne Kleider trug und auf vornehmen Bällen tanzte? Wer war Alexandra, als der Glanz verging? Wie endete ihre Geschichte? Mit Kerzenlicht und Champagner? Oder mit Dunkelheit und Flucht? Wer bin ich, wenn Max nicht mehr zu mir kommt?
Ich gehe weiter, streife durch die Räume wie durch ein fremdes Leben. Die Gesichter auf den Porträts blicken mich an, unnahbar und zugleich seltsam vertraut. Hinter dem Gold und der Pracht liegt dieselbe Zerbrechlichkeit, die auch ich mit mir trage.
Ich bleibe vor einer Vitrine mit einem kleinen Rubinen-Diadem auf dunklem Samt stehen. Daneben liegt ein vergilbtes Schwarz-Weiß-Foto: eine junge Frau mit aufrechtem, fast trotzigem Blick: unbekannte Hofdame, vermutlich 1913. Kein Name, keine Geschichte. Nur Glanz und Andeutung.
Mein Spiegelbild in der Vitrine ist verschwommen und überlagert von Schmuck, Schatten und Geschichte. Für einen Moment sehe ich mich nicht als Journalistin, nicht als Geliebte, nicht als Enkelin. Nur eine junge Frau. Suchend. Tastend. Allein.
Langsam gehe ich weiter. Nicht mehr auf der Flucht vor der Enttäuschung, sondern auf der Suche nach dem, was bleibt, wenn das Versprechen zerfällt und sich die Träume verlieren.
Eine ältere Dame, elegant, mit silbergrauem Haar, Seidentuch und Brille, steht neben mir. Sie betrachtet das Foto der unbekannten Hofdame mit leicht erhobenem Kopf.
„Sie hat sich nicht versteckt“, sagt sie ruhig.
„Kannten Sie sie?“, frage ich.
„Nein“, antwortet sie. „Es ist ihre Haltung. Ihre Entschlossenheit. Sie war nicht einfach nur eine Schmuckträgerin. Sie wusste, was sie wollte.“
Ich weiß nicht, was die alte Dame meint. Vielleicht ist es nur eine unkonventionelle Art der Kommunikation. Vielleicht ist es mehr. Sie starrt unentwegt auf meine Hand.
„Übrigens ist es gut“, sagt sie nach einer Weile, „dass Sie hierhergekommen sind, auch wenn die Person, mit der Sie eigentlich hierherkommen wollten, nicht an Ihrer Seite ist.“
Ich will etwas sagen, aber sie hebt leicht die Hand. „Ich sehe es an Ihren Augen. Der Schritt war heute Morgen sicher schwer. Aber Sie sind trotzdem gegangen. Nur das zählt.“
Ich schlucke. Sie sieht wieder auf meine Hand. Auf den Ring. Ich ziehe die Finger unwillkürlich enger an mich heran.
Sie spricht weiter, ruhig, beinahe bedauernd. „Der Ring war nicht für Sie bestimmt. Und schon gar nicht, um von Ihnen getragen zu werden.“
Ein Kribbeln läuft mir über den Rücken. „Wie bitte?“
„Er bindet. Er erinnert. Er zieht an, was längst verloren geglaubt war.“ Sie lächelt jetzt. Zum ersten Mal. Es ist ein warmes, freundliches Lächeln.
„Woher wissen Sie von diesem Ring?“ Meine Stimme ist leiser, als ich es mir wünsche.
Die alte Dame hebt kaum merklich die Schultern. „Ich habe ihn schon einmal an einer anderen Hand gesehen. Und ich weiß, was danach kam.“
Ich will etwas sagen, aber sie unterbricht mich, ohne mich anzusehen.
„Hüten Sie, was Sie bewahren wollen. Aber manches will einfach nicht erinnert werden.“
Dann geht sie. Nicht hastig. Nicht theatralisch. Sie geht einfach in die nächste Halle, verschwindet zwischen Glas und Gold.
Ich bleibe einen Moment fassungslos bei dem Foto der namenlosen Hofdame stehen. Obwohl die Begegnung mit der alten Dame so kurz war, hallt sie nach. Nicht laut. Nicht greifbar. Als ob etwas in Bewegung geraten wäre. Etwas, das auf mich gewartet hat. Mit einem Ring an meinem Finger, der vielleicht mehr ist als ein Erinnerungsstück.
Kapitel 5
Sankt Petersburg, 1914
Alexandra
„Du hättest eine andere Farbe wählen sollen.“
Dónyas Blick glitt kühl und unnachgiebig über das Kleid. Es war am Vortag aus Paris eingetroffen und stand mitten in Alexandras Zimmer, als wolle es sich, sorgfältig auf dem zur Verfügung gestellten stummen Diener drapiert, in Szene setzen. Wie ein Versprechen an eine Nacht, die noch nicht begonnen hatte.
Das Pariser Modehaus Paquin hatte nichts dem Zufall überlassen. Das Ballkleid war ein Bekenntnis, ein Meisterwerk aus türkisfarbener Seide und zartem Tüll. Der Stoff fiel wie Wasser, lautlos, kostbar. Jede Bewegung erzeugte fast den zarten Flügelschlag eines gewaltigen, azurblauen Schmetterlings, eine kostbare, mit Perlen und Kristallen besetzte Applikation, in Tüll gebettet. In der schrägen Nachmittagssonne schimmerte das Kleid elegant, zurückhaltend und unaufdringlich, mit einer Art stiller Überlegenheit.
Alexandra musste nicht in den Spiegel sehen, um sich darin zu erkennen. In ihrer Vorstellung war sie längst dort: ihre Hand auf der des jungen Fürsten Juri Gagarin, ein Lächeln, ein Blick, der Tanzsaal, ein Abendessen, ein Flüstern vielleicht. Die zarte Vorahnung von etwas, das noch nicht wahr, aber wahr werden könnte.
„Mit deinem dunklen Haar, den dunklen Augen … Du hättest Grüntöne wählen sollen. Türkis- und Blautöne lassen dich älter wirken. Madame Paquin hat dich gewarnt.“
„Ja, das hat sie“, sagte Alexandra. Dennoch hatte sie sich mit Bedacht und Instinkt für die Pastelltöne entschieden. Und es keine Sekunde lang bereut. Sie hätte es laut aussprechen können, aber wozu? Dónya war ein Schatz, gewiss, aber ein Schatz, der seine Meinung für das einzig Wahre hielt. Es hatte Jahre gedauert, bis Alexandra erkannt hatte, dass es klüger war, zu schweigen, als zu widersprechen. Zeit, die sie lieber mit Puschkin verbrachte, mit ihrem Tagebuch, mit Gedanken an Juri. Doch all das war nicht möglich, solange Dónya sie mit ihrer Anwesenheit beglückte.
Barco, der gestreifte Kater, trat, mit dem gemächlichen Gang eines Aristokraten, in den Raum und ging zielstrebig auf das Kleid zu.
„Oh.“ Dónya saß plötzlich aufrecht. Barco war jung, wild, ein junger Kater mit Krallen. Wenn er beschloss, seine Laune an dem zarten Stoff auszulassen, wären sie machtlos. Beide hielten den Atem an. Doch der Kater beschnupperte und umrundete es würdevoll und verschwand, offenbar auf der Suche nach bedeutenderen Dingen wie einer Mahlzeit in der Speisekammer.
„Pff“, machte Alexandra leise. „Bei Barco weiß man nie, was als Nächstes kommt. Ich will gar nicht daran denken, was wäre, müsste ich morgen in einem Kleid aus der letzten Saison zum Ball gehen. Das wäre eine Katastrophe! Ich vermute, dass Prinzessin Golatowa sämtliche Kleider der letzten drei Jahre katalogisiert hat. Ihr Verhalten wird mit zunehmendem Alter immer eigenartiger. Ich bin mir sicher, dass sie dich darauf ansprechen würde, wenn du dasselbe Ballkleid zweimal trägst. Sie genießt es, diese alte Hexe.“
Doch Dónya war längst mit ihren Gedanken woanders. Sie hatte sich auf dem grünen Sofa ausgestreckt und spielte nervös mit dem Spitzenärmel ihres Kleides.
„Wenn du einen der Golatowa-Söhne heiratest, bekommst du sie als Schwiegermutter gratis dazu, ohne Rückgaberecht. Ich darf nicht daran denken.“ Sie schüttelte sich. „Ich würde viel lieber einen Romanow heiraten. Die Familie ist so groß, dass es dort noch genügend unverheiratete Männer gibt. Oder besser noch…“
Sie schaute über Alexandra hinweg, ins Unsichtbare, das nur sie allein sehen konnte. Ihr Gesicht wurde weich, verträumt. „Den Bruder des französischen Thronanwärters. Wenn die Monarchie zurückkommt, werde ich die Schwägerin des Königs.“
„Es ist nicht gesagt, dass sie zurückkommt“, murmelte Alexandra, griff nach dem Buch auf dem Beistelltisch, ein stiller Protest, eine Rettung. „Außerdem ist der Bruder des Thronanwärters nicht besonders hübsch. Eher hässlich. Und er soll Männer lieben.“
„Wirklich? Wie schade.“
Dónya seufzte. Sie war zwei Jahre älter als Alexandra, zweiundzwanzig, aber in mancher Hinsicht ein Mädchen geblieben: ein Mädchen, das von Verehrern träumte wie andere von Abenteuern. Sie setzte all ihre Hoffnungen auf den Ball im Fontanka-Haus, den glanzvollsten der Saison. Die Scheremetews wussten, wie man Feste gab, die im Gedächtnis blieben. Nur der Winterpalast übertraf sie. Zumindest früher. Seit dem Maskenball 1904 war dort nichts mehr gewesen. Der Zar hatte andere Sorgen. Europa stand in Flammen.
Alexandra überlegte, dass Männer sich traditionell mehr für Krieg als für Frieden interessieren. Jetzt, da Deutschland Russland den Krieg erklärt hatte, trugen sie ihre Uniformen mit einem Stolz, der sie wie Kinder erscheinen ließ. Selbst ihr Vater, dessen militärische Laufbahn kaum mehr als eine Anekdote war, stand plötzlich wieder aufrecht in seiner Uniform.
„Schwester?“ Dónya sah sie an, eine Mischung aus Vorwurf und Triumph. „Du hörst nicht zu. Deine Gedanken schweifen ab. Du bist verliebt!“
„Bin ich nicht.“
„Also hörst du zu?“
„Auch nicht.“
„Oh! Dann hast du meine Frage also gehört? Und darf ich?“
Was auch immer Dónya gefragt hatte, Alexandra wusste es nicht. Aber ein Geständnis wäre fatal. Dónya würde sie wochenlang aufziehen. Oder es Freunden und ihrer Mutter sagen.
„Ja“, sagte Alexandra knapp.
„Ja, ich darf?“
„Du hast mich verstanden.“
„Ausgezeichnet.“
Dónya sprang auf, tänzelte hinüber zu Alexandras Schminktisch. Dort stand das lackierte Schmuckkästchen, schwarz glänzend wie ein Geheimnis. Sie öffnete es, nahm eine Diamantkette heraus und legte sie sich um den Hals.
„Was tust du da?“
„Ich leihe mir deine Diamanten für den Ball. Weil du es mir erlaubt hast.“ Mit dieser letzten Spitze verließ sie schnell den Raum.
Barco kreuzte ihren Weg im Türrahmen, beachtete sie nicht weiter und trottete zur Fensterbank, wo eine Pflanze auf sein Interesse stieß.
„Barco, nicht“, sagte Alexandra mit resignierter Stimme. „Kater fressen keine Pflanzen. Kater fangen Mäuse. Und davon gibt es hier genug.“
Er sah sie an. Einen Moment lang. Mäuse? Dann fang sie doch selbst, wenn sie dir derart bedeutsam sind, las Alexandra in seinen Augen.
Was war nur los mit allen? Dónya, die listig und leichthin ihren Schmuck nahm. Barco, der sein eigenes Gesetz lebte. Und sie? Sie stand dazwischen. Wie üblich. Zwischen Licht und Schatten. Zwischen dem, was sie sollte, und dem, was sie wirklich wollte.
Ein tiefer Seufzer. Die Uhr auf dem Kaminsims schlug fünf. Der Klang hallte nach, als käme er aus einem anderen Haus.
Zeit, sich umzuziehen, dachte sie. Und Zeit, eine Entscheidung zu treffen.
Kapitel 6
München, 2020
Lilly
„Die Ausstellung in der Kunsthalle war wunderschön, Max.“
Es ist Montagabend. Max sitzt auf dem Sofa und hat den Arm locker um meine Schulter gelegt. Seine sonst so lebhaften Augen wirken heute stumpf. Die Schatten darunter erzählen von schlaflosen Nächten. Obwohl ich ihn liebe und seine Nähe will, spüre ich das Schweigen zwischen uns stärker als seine Berührung.
„Die Atmosphäre wurde so gut eingefangen. Als würde man in eine andere Welt eintauchen, wenn man den Saal betritt.“
„Ich wusste, dass sie dir gefallen würde.“
Widerwillig löst er sich von mir und greift nach seinem Handy. Zehn nach acht. Die Zahlen leuchten rot auf dem Display, fast wie eine Warnung, ein stummes Versprechen, bald aufbrechen zu müssen.
„Es hätte mir noch besser gefallen, wenn du dabei gewesen wärst.“ Ich bereue die Worte sofort. Ich will nicht klingen wie eine nörgelnde, bedürftige Geliebte. Aber es ist zu spät.
„Ich konnte wirklich nichts machen“, sagt er. „Sandra ging es nicht gut, der Termin mit ihrer Mutter wurde verschoben und Jesse konnte ich nicht allein lassen. Auch wusste ich nicht, wie ich mich so kurzfristig hätte herausreden können.“
„Ich verstehe.“ Ich folge ihm in den Flur. Er zieht seine Jacke an, betrachtet sich im Spiegel und prüft, ob unsere Liebe sichtbare Spuren hinterlassen hat.
Ich verstehe … Wie oft habe ich diese drei Worte in den vergangenen Jahren gesagt? Ich verstehe, dass er für seinen Sohn mehr Zeit haben möchte und Scheidungen kompliziert sind. Ich verstehe, dass wir vorsichtig sein müssen, dass ich keine Ansprüche stellen darf, verstehe, dass es besser ist, im Schatten zu bleiben. Ich verstehe all dies, nur nicht, wie ich in diese Rolle geraten bin.
„Wir sehen uns morgen.“ Er küsst mich sanft. „Schreibst du einen Artikel über die Ausstellung?“
Ich nicke. Die Tür fällt ins Schloss. Ich eile in die Küche, um ihm nachzusehen. Als ich am Bild meiner Großmutter komme, senke ich den Blick.
*
„Ich geh’ eine rauchen“, sagt Coco, zieht ein Päckchen Zigaretten aus ihrer Tasche und lässt ihren Stuhl zurückrollen. „Komm, begleite mich.“
Ich starre auf den Bildschirm. Der Cursor blinkt ungeduldig hinter einem Satz, der zu viel und zu wenig sagt. Die Sätze wollen nicht fließen. Sie sind bedeutungslos und leer.
„Wo auch immer deine Gedanken sind, sie sind nicht hier“, sagt Coco in dem Glashaus und zündet sich eine Zigarette an. „Und sicher nicht bei der Ausstellung.“
Ich trete einen Schritt zurück, weiche dem Rauch aus. „Ich weiß nicht. Ich möchte dieses Mal etwas anderes. Kein Standardstück. Aber es ist, als wären meine Gedanken in einer Blechdose eingesperrt und ich finde den verdammten Öffner nicht.“
„Dann finde ihn.“ Coco bläst den Rauch aus wie eine Mahnung.
„Ein türkisfarbenes Kleid in der Ausstellung geht mir nicht aus dem Kopf. Das zarte Flirren des Stoffs, das Gewicht von Geschichte, der azurblaue Schmetterling. Es blieb erhalten, trotz Kriegen, Zeit und Vergessen. Wer war diese Frau, die es getragen hat? Wie sah ihr Leben nach diesem Ball aus? Ist es nicht verrückt, dass ihr Kleid sich heute in einem Museum befindet, während sie längst tot ist? Das verfolgt mich.“
„Woher weißt du, dass es wirklich ihr gehörte?“
„Ihr Name stand auf dem Hinweisschild: Gräfin Alexandra Oblenskaja. Getragen 1914 auf einem Ball bei den Scheremetews.“
„Das war das Jahr, in dem der Erste Weltkrieg ausbrach. Und sie geht tanzen?“
„Ich schätze, der Krieg hatte auf das Leben der Reichen anfangs wenig Einfluss. Aber dass ein Kleid so viel überdauert hat … und wir können es uns anschauen.“ Ich streiche über mein Kleid von Zara. Kaum vorstellbar, dass es in hundert Jahren in einem Museum landet. Getragen von Lilly Falkenberg, junger Journalistin mit ehrgeizigen Träumen. Kein Schild mit meinem Namen. Keine Spur, die bleibt.
„Dann finde es heraus“, sagt Coco.
„Was?“
„Wer diese Frau war. Und was aus ihr wurde. Mach eine Geschichte daraus. Nicht für unsere Website. Schreib etwas Großes.“
„Und wer wartet auf mich? Die Zeitung Die Zeit, GEO, Spiegel History?“
„Niemand wartet auf dich, Lilly.“ Coco drückt die Zigarette aus. „Aber vielleicht solltest du dich selbst mal daran erinnern. Du wolltest hier nur vorübergehend arbeiten.“
„Das war, bevor …“
„Du dich auf Max eingelassen hast“, beendet Coco den Satz, dreht sich um und geht.
Ich bleibe, atme den Rauch der Wahrheit ein.
*
Ich verlasse das Büro. Frühling liegt über der Stadt, aber mir ist kalt. Als die Aufzugtür sich öffnet, trete ich zur Seite. Sehe sie.
„Hallo, Lilly.“
„Hallo, Sandra. Besuchen Sie Max?“
„Ja. Meine Mutter und ich waren gerade im Krankenhaus. Ich dachte, ich schaue kurz vorbei.“
„Geht es Ihrer Mutter nicht gut?“
Sie schüttelt den Kopf. „Wir hatten einen Ultraschalltermin. Ich bin in der 16. Woche.“ Sie legt die Hand auf ihren Bauch und lächelt.
Es dauert zu lange, bis ich reagiere. „Oh. Glückwunsch.“
„Danke. Ich glaube, da entlang, richtig?“
Ich nicke. Sandra nimmt den Gang nach rechts in Richtung Redaktion. Ihr langer blonder Pferdeschwanz schwingt bei jedem Schritt hin und her. Ich bleibe zurück, in einer Wüste aus Enttäuschung. Sand. Hitze. Kein Wasser. Keine Richtung.
Gedanken schießen mir durch den Kopf: Max’ Versprechen, unsere Gespräche, meine Fantasien von einem gemeinsamen Später. Alles, was davon übrig bleibt, ist eine monumentale Lüge. Sandras Babybauch hat einen Strich durch meine Träume gezogen. Noch vor 10 Minuten war der Mangel an Inspiration mein größtes Problem, jetzt hätte ich viel gegeben, wenn es dabei geblieben wäre. Die Türen des Aufzugs öffnen sich erneut. Eine Horde Büroangestellter strömt heraus, laut, lebendig. Ich bleibe stehen, überlege und gehe zurück ins Büro.
Zuerst treffe ich in der Redaktion auf Coco. Sandra sitzt in dem Glashaus auf seinem Schreibtisch, lächelnd, redend, neben seiner Stille.
„Lilly, lass es“, flüstert Coco. „Es bringt nichts. Mach keine Szene.“
„Ich? Niemals. Keine Szene. Nur Konsequenz.“
Als Sandra die Redaktion wieder verlassen hat, betrete ich sein Glashaus. Max’ Schultern zucken.