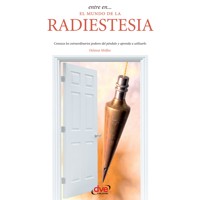Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Durch einen Zufall – oder Schicksal? – landet Conrad Conradi in einer Flugmaschine mit Fallschirmspringern. Obwohl das Ganze einem Hasardspiel gleichkommt, ist er von nun an infiziert. Nach erfolgreich absolviertem Trainingsunterricht ist es so weit: Der erste freie Fall steht bevor. Während Conrad am Flugplatz darauf wartet, das Go für die Drei-Uhr-Maschine zu erhalten, folgt ihm der Leser durch seine Gedanken und Tagträume an fremde Orte, lernt die verschiedensten Menschen sowie Schicksale kennen, und wagt schließlich den Schritt ins Unbekannte. »Die Drei-Uhr-Maschine« regt dazu an, auf sich selbst zu vertrauen, Neuem gegenüber aufgeschlossen zu sein und seine eigenen Grenzen zu hinterfragen. Der Roman zeigt, wie Neugier, Humor und Fantasie das Leben bereichern.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 280
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Helmut Müller (s. Titelbild) ist in Lüneburg aufgewachsen, er lebt seit einigen Jahren in Schleswig-Holstein. Bereits als Jugendlicher versuchte er, das rätselhafte Weltgeschehen zu begreifen, wozu ein einziges Menschenleben keineswegs reicht. Er fühlt sich dem Freundeskreis der Sokratiker zugehörig: »Warum ist …?« »Ich weiß, dass ich nichts weiß …«
Eher zufällig absolvierte er eine Ausbildung als Berufstaucher mit Meisterabschluss. Fünf Jahre war er als Bergungstaucher in der Welt unterwegs, bis er in Hamburg Bauingenieurwesen studierte.
In dieser Berufskombination war er rund 25 Jahre als Experte für maritime Bauwerksprüfung und Schiffs-Havarieschäden tätig und verfasste um die 1500 Gutachten.
Zwölf Jahre war er begeisterter Privatpilot (PPL). Nach »Nine Eleven« unternahm er in den USA mit gecharterten »Cessna 172« mehrere Cross-Country-Flüge. Per Fahrrad, Luftmatratze und Zelt tourte er von Hamburg nach Bregenz oder quer durch Skandinavien. Einige komisch-verwickelte und explosive Reisenotizen warten darauf, als Geschichten aufgeschrieben zu werden.
»Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wir es nicht wagen, ist es schwer.«
Lucius Annaeus Seneca
Inhalt
Vorwort
San Francisco
Vorfeldzirkus
Der Schreiner
Gero
Der Nordpfeil
Dana Lora
Grotten-Alex
Kopfkino
FC Condor
Psycho-Jo-Jo
Rückschau
Der Tanzlehrer
Der Hörsaal
Fabian
10 Automaten
Der Eiffelturm
Die Freigabe
Knut
Haie in der Sahara
Warten
Grenzerfahrungen
Trinkgelage
Eva und Hertha
Danksagung
Vorwort
Liebe Lesefreunde, das Buch in euren Händen ist mein erstes.
Einen literarischen Mont Blanc werdet ihr nicht finden, war auch nie beabsichtigt. Es möchte augenzwinkernd daran erinnern, dass die meisten von uns einmal naiv ihren Weg gesucht und dabei kaum ein Fettnäpfchen ausgelassen haben. Niemand ist perfekt, alle machen Fehler, Laune der Natur seit Menschengedenken.
Wie gelingt es, unser eigenes Unvermögen und das der anderen nicht pauschal zu verurteilen? Aus Fehlern zu lernen? Patzer mit Humor zu nehmen und das Beste daraus zu machen? Was wollen und können wir erreichen? Wo sind unsere Grenzen?
Das mit kurzen Essays gestrickte Buch will neugierig machen auf »Fremdes«, das in Wahrheit gar nicht fremd ist, wenn wir unseren eigenen Überzeugungen vertrauen und folgen.
Conrad Conradi, unser Romanheld, lässt sich gern auf Neues und Menschliches ein. Stress, Verwicklungen und Problemen begegnet er mit patenten Ideen. So möchte auch das Buch Vorurteile und Ängste abspecken und Freiräume schaffen für Courage, Fantasie, Spontaneität und Humor, denn mutiges Handeln ist oft besser als Lamentieren.
Conradis Geschichten sind wahr oder nicht, man mag ihnen glauben oder nicht. Letztlich folgen sie gezielt dem Countdown der Story »DIE DREI-UHR-MASCHINE«.
Viel Spaß beim Lesen:-)
In Verbundenheit
Helmut Müller
San Francisco
Sonntagmorgen, 9 Uhr, im Juni 2010. Das fahle Knittergesicht im Spiegel sah Dr. Frankensteins Zombie Boris Karloff ähnlich, aber nicht mir.
»Niemals bin das ich! Never!«
Lamentieren brachte nix, außer mir war keiner da. Ungläubig starrte ich in den Spiegel. Das Monster, das da zurückglotzte, war tatsächlich ich.
»Mein Gott, Conradi!«
Die grellweißen Kacheln verstärkten das Neonlicht im Badezimmer noch. Das Gesicht einer unrasierten Leiche blickte mich fahl an. Leichen sehen scheiße aus, besonders ungeschminkte.
»Du siehst wie eine Geröllhalde aus!«
Ich flüchtete in die Dusche, dort gab es keinen Spiegel.
Danach eierte ich wie bekifft durch die Wohnung, schrammte frontal an die halboffene Küchentür, verbrühte mir mit viel zu heißem Kaffee die Zunge und suchte überall nach dem blöden Schlüsselbund, obwohl der wie immer von innen in der Haustür steckte – mir fehlten mehrere Stunden Schlaf.
Keine allzu gute Ausgangslage für mein Vorhaben.
Mit zwei angebräunten Bananen und einer Kiste Mineralwasser bestieg ich um 10 Uhr lustlos meinen Volvo und fuhr los. Gute Tage fingen sicher anders an. Aber ich hatte Fabian versprochen zu kommen.
Mein Magen meldete sich unmissverständlich. Doch auf die sonntägliche Frühstückszeremonie hatte ich leider verzichten müssen, wie eine Strafe fühlte sich das an. Ja, Juliane und ich liebten unsere freien Tage, sie waren uns heilig. Wir genossen es, wenn der Duft von frischen Brötchen, Früchten und Kaffee durch die Zimmer vagabundierte und unwiderstehlich Appetit machte. Wenn Juliane im Nachthemd liebevoll den runden Marmortisch deckte. Nur sonntags kam das filigrane, mit Blümchen verzierte Porzellan auf den Tisch, das sie von ihrer Großmutter geerbt hatte. Und nur sonntags gab’s gekochte Eier, von freischarrenden Hühnern, wie der Händler vom Wochenmarkt uns versicherte.
Zu diesen Gelegenheiten kam auch die Teakholz-Salzmühle auf den Tisch, gefüllt mit grobkörnigem Salz aus Portugal.
Unsere Frühstückszeremonie konnte Stunden dauern, das Mittagsessen fiel dann meist aus.
Auch lief ich unrasiert in ausgeleierten Jogginghosen herum. Telefone wurden ausgeschaltet, die Uhren ignoriert. Keine Macht für Störer – Zeit für Entschleunigung!
Das losgelöste Herumtrödeln einmal pro Woche, das tat uns gut, und seit wir zusammen unter einem Dach lebten, ergo seit etwa einem Jahr, hielten wir uns daran.
»Ereignisse werfen ihre Schatten voraus«, mahnt der Volksmund, und zuweilen ist da ja etwas dran. Okay, heute war Sonntag. Stress und Druck waren so unnötig wie die Brandblasen auf meiner Zunge. Erstens war ich seit Tagen Strohwitwer, und wenn ich zweitens im Bett geblieben wäre?
Na wenn schon – alles war freiwillig, ich war zu nichts verpflichtet. Ich überlegte, wo ich ein passables Frühstück bekommen könnte, von unserem Lieblingsbäcker natürlich.
Die mit Tomaten, Basilikum und Mozzarella belegten Baguettes von der Stadtbäckerei schmeckten zwar gut, aber sie aus ’ner Pappe herausfummelnd futtern – eher nicht so mein Ding. Zudem war ich müde wie ein Koalabär und eigentlich zu nichts nütze.
Umkehren? Eine Ausrede erfinden?
Einfach absagen. Dann zurück in die Koje und richtig ausschlafen.
Kaubewegungen durchbluten und erfrischen das Hirn, meint der Volksmund. Also massierte ich meine Hirnschale mit Kauen, und siehe da, es half, mein Brummschädel wurde samt Inhalt leichter, die Verknotungen ließen fühlbar nach.
Ich griff nach der Wasserflasche, die links der Lehne ihren festen Platz hatte. Schraubverschluss abfingern und Wasser marsch. Frisches Wasser ist gut gegen fast alle Unpässlichkeiten.
O ja, das ist wahr!
Die Kohlensäure löste eine Lawine wohltuender Rülpser aus. Gut, dass ich allein fuhr. Erwachsene ernten vorwurfsvolle Blicke, wenn sie rülpsen.
Wenn Babys rülpsen und knattern, dann schwärmen ihre Muttis verzückt: »Ei, ei, wie fein, ein süßes Bäuerlein.«
Dabei tut Rülpsen und Blähen auch Erwachsenen gut, weil es die Verdauung fördert und gute Laune macht.
Als ich das sympathische Gesicht im Rückspiegel sah, musste ich schmunzeln. Nein, es war nicht die Zombiefratze von vorhin! Das wiederbelebte Gesicht gehörte definitiv mir! »Hey, alter Junge! Alles wieder okay?«
An Werktagen war die Bundesstraße 206 oft rammelvoll. Besonders der Lastverkehr, von Lübeck hin zur A7, war heftig explodiert, der Lkw-Maut geschuldet. Aber Sonntagsfrüh war freie Fahrt. Tausende Brummis mussten in den Depots bleiben.
Was machte der Verrückte da hinter mir? »Pass auf, Blödmann!«
Es war ein beleibter Senior, der da rotgesichtig hinterm Steuer thronte. Das dottergelbe Cabrio, ein 1960er-Porsche, klebte wie Vogeldreck an meiner Heckscheibe. Der Typ fuhr offen und setzte zum Überholen an und bremste plötzlich wieder ab.
Idiot!, dachte ich und behielt ihn im Visier.
Das Mädchen auf dem Beifahrersitz mochte süße 16 sein. Es war aufgedröselt wie eine Schaufensterpuppe. Der Kerl am Steuer war um Lichtjahre älter.
Schickimicki-Papa mit modebewusster Tochter? Eher nein, sendete mein erwachendes Kleinhirn.
Stolzer Großvater mit flügger Enkelin? Ja, vielleicht, aber Opas tragen doch keine Harlekinklamotten …
Frisch getraut vielleicht? Quark! Der Clown war jenseits der 65. Vielleicht hatte er ein Glückselixier oder dopaminhaltige Pillen intus, um der Kleinen zu imponieren.
Viagra-Konsument mit Mondfischgesicht! Nein, das war jetzt wirklich unfair. Sie war vermutlich eine Reisebegleiterin, seine Muse für erotische Inspirationen. Reisebegleitungen kann man heute per Mausklick im Internet ordern wie ein Paddelboot oder eine Kreuzfahrt in der Business Class.
Abgehobene High Society nehmen ihre Reisebegleitung in Berlin oder New York in Empfang. Auf Hawaii oder in London wird sie der Agentur zurückgegeben oder frisch getauscht. Hormonbeflügelnde Schmusegirls und -boys sind weltweit zu haben, für alle Anlässe, eine Frage des Bankkontos, nicht der Moral.
Die beiden hatten sich ihre Golfkappen bis an die Augenbrauen runtergezogen, so hatte frontaler Fahrtwind keine Chance, sie wegzublasen.
Die Straße war nach vorn und hinten frei. Erneut setzte er zum Überholen an. Doch wieder bremste er abrupt, beinahe mit Blechkontakt.
»Was für ein Vollblutspinner …«
Endlich gab er Gas, diesmal richtig, und mühelos wie ein Pfeil zog der gelbe Porsche an mir vorbei, und beide winkten mir fröhlich zu.
Als ich ihre Handküsschen erwiderte, hatte ich schlappe 150 Stundenkilometer auf der Nadel. Wie guten Freunden winkte ich ihnen hinterher.
Oh, lá, lá, geteilte Freude schießt ins Gemüt wie Traubenzucker ins Blut! Das fühlte sich wie eine wohltuende Kopfmassage an, mit warmem Öl aus exotischen Nüssen.
Irgendwie hatte das optisch ungleiche Paar recht. Es war super drauf, ich dagegen nicht – bis jetzt. Ihre alberne Freude wirkte ansteckend, mein schrulliger Bock war plötzlich verschwunden, ich konnte wieder positiv denken. Ich musste über mich schmunzeln – ja, doch, es würde ein richtig guter Tag werden.
Blind drückte ich den Button. »Radio Nora, die besten Hits im Norden«, behauptete der Sender pausenlos über sich.
Beim Autofahren höre ich gern mal rockige Oldies. Viele der alten Songs sind noch solide Handarbeit, Kunst, an dem synthetischen Studiogebräu haftet immer eine Art Blutleere.
Oh nee, wirklich Scott McKenzie? Ja, McKenzie, eindeutig, der Hippie-Halbgott.
»If you’re going to San Francisco … be sure to wear some flowers in your hair …«
Die Paradieshymne kam im richtigen Moment, sie kam rüber wie Edelschokolade. McKenzies Stimme brachte die Seele zum Rocken. Ja, der Dino-Song törnte mich noch immer an. Samtene Erotik. Sonnige Verheißung. Text und Melodie glühten wie fließende Lava.
Wehmütig lauschte ich der lange nicht gehörten Glücksballade, und meine Lippen sangen leise mit. Gänsehautfeeling. Freude. Tränen der Rührung, als wenn einem die Engel übers Herz pieseln.
Jetzt die Hommage mit den himmlischen Glocken, musikalisch umarmt von McKenzies leidenschaftlich beschwörendem Gesang: »Such a strange vibration, there’s a whole generation with a new explanation …«
Wirbel für Wirbel stieg wohlig kribbelnde Wärme in mir hoch, bis in die Nackenhaare. Wie von selbst kam mir der Text zurück, ich sang dröhnend mit, wie damals, als Mr. McKenzie den ganzen Erdkreis mit seiner Paradieshymne beschenkte, damals, als ich noch ein Teenager war …
Plötzlich fühlte ich mich stark wie ein Elefant.
McKenzie sei nur zufällig auf Sendung, sagte Jakob Clemens, der eloquente Moderator. Er habe einer Hörerin den Musikwunsch ihres Gatten erfüllt. Der so Beschenkte arbeite als Meeresbiologe auf der Insel Helgoland. Dort, so ließ die Frau die Hörer wissen, sei der Hummerbestand dramatisch eingebrochen. Ihr Liebster, der jetzt wohl zuhöre, forsche mit anderen Wissenschaftlern nach den Ursachen. Die Hummerpopulation solle wieder angeschoben werden …
Unvermittelt brach der Moderator das Interview mit der redseligen Frau ab: »Wir kommen gleich mit der Oldie-Hitparade zurück, liebe Hörerinnen und Hörer. Radio Nora unterbricht mit einer aktuellen Info für Verkehrsteilnehmer, die auf der A7 unterwegs sind. In Höhe Kaltenkirchen erwarten Sie elf Kilometer Stop-and-go in beiden Richtungen, die Polizei empfiehlt, den Bereich wie folgt zu umfahren« und so weiter …
Ich drückte den Button – das Radio schwieg.
Bis zum Flugplatz brauchte ich heute gerade mal 20 Minuten. An Werktagen dauert die Fahrt manchmal doppelt so lang.
Hinter dem Segeberger Forst, gleich rechts nach der Baumschule, tauchte die Blecharmada auf. An Wochenenden reichten selbst 1000 Parkplätze nicht aus, und bei Flugschauen wurden sogar die Rad- und Gehwege mit Autos zugestopft.
Für die lauernden Abschleppgeier ein sattes Fressen! Die Ablöse kostete Parksünder um die 200 Euro, Fahrzeugschäden gab’s gratis dazu; ein Persilschein für legalisierte Abzocke. Nur wochentags war auf dem Megaparkplatz immer genug Platz, dann lauerten die Geier anderswo ihren Opfern auf.
Ohne zu zögern bugsierte ich den Volvo in die Lücke, die das Womo eben frei gemacht hatte. Skandinavisches Modell, das Teil hätte mir echt gefallen können.
Jetzt erst mal zu Eva.
Bei Eva, ihr korrekter Name war Evamaria, gab’s neben aktuellem Klatsch und Tratsch auch einen ordentlichen Cappuccino.
Im Umfeld von Evas Imbissoase blinkten an die 30 herausgeputzte Motorräder: modifizierte Harleys, bärige BMWs und ein paar PS-starke Japaner. Die dazugehörigen Lederjacken hatten Evas Imbiss zu ihrem Meetingpoint auserkoren. Hier traf man sich. Hier war man wer. Hier bei Eva konnte jeder jedem zeigen, was der Motorradkult ihm wert war.
Aber auch aus einem anderem Grund war der eher unbedeutende Sportflugplatz zum Magneten mutiert: Hier wurde das legendäre »Werner-Rennen« zelebriert. Ein bebender Rockevent. Premiere für jährliche Nachbeben. Seit dem Megaevent von 1988 ist es für Freaks ein Novum, wenigstens einmal im irdischen Bikerleben hierher gepilgert zu sein. Doch halt, die vielen Leute kamen nicht nur wegen der lockeren Atmosphäre.
Dass hier Tag für Tag etwas los war, war eindeutig Evas delikater Aura geschuldet. Seit sie hier das Zepter schwang, ließen sich auch prominente Biker blicken, Politiker sogar. Man erkannte sie erst, wenn sie ihre Helme abgenommen hatten. Auch Abgeordnete möchten gerne mal ’ne simple Grillwurst futtern. Manche Promis wie Peter Maffei gaben Autogramme. Evas illustres Bratrefugium an der B206 war zum absolut angesagten Treffpunkt geworden.
Was jedoch die Hygiene betraf, o meine Güte, da durfte man nicht pingelig sein. Hochpeinlich war arg untertrieben. Leider fehlte es an sanitären Anlagen. Das für den Imbissbetrieb nötige Wasser wurde per Gartenschlauch hergeleitet. Zum Händewaschen für die Gäste reichte es nicht. Doch für mitgebrachte Hunde stand immer ein Napf frisches Wasser parat.
Da menschliche Bedürfnisse sich nicht abschaffen lassen, haben Vorbesitzer ein mobiles Klo aufgestellt, als Provisorium, nur für wenige Wochen. Das war vor x Jahren. Aber das gallegrüne Kackkabinett stand noch immer da. Ein bisschen von Paletten getarnt, doch der Geruch verriet wohin man gehen musste, wenn es sich nicht mehr vermeiden ließ.
Das Klo-Manko wurde von den Gästen billigend oder missbilligend in Kauf genommen. Zum Glück war es zum Blockhaus nicht weit, allerdings kosteten die Klobesuche einen Euro. Als Alternative galt der Segeberger Forst, besonders für müssende Männer. Zwei Gehminuten … warum also meckern. Für Tausende Fliegen war das Plumpsklo Heimat und ein Paradies auf Erden.
Meist jobbten bei Eva zwei gutaussehende studentische Aushilfen. Eine reichte mir mit dem Lächeln einer Flugbegleiterin den heißen, rustikalen Henkelpott durch: »Zweifünfzig, bitte.«
Vergleiche mit klassischem Cappuccino erübrigten sich von selbst, doch wer dachte hier schon an so was.
»Das Klopapier ist alle!«, kreischte eine Frauenstimme.
»Kommt!«, rief die Jobberin und warf einen Gegenstand in Richtung Plumpsklo.
Ein Mann in roter Lederjacke fing ihn auf und klopfte diskret gegen die Tür. Eine schlanke Hand schnellte hervor, grabschte zu, und weg war sie, die weiße Rolle.
»Bist du bald fertig?«, rief gereizt eine andere Frau. Sie trat von einem Bein aufs andere. »Ich muss da ganz dringend mal rein!«, wimmerte sie. Doch das Klo schwieg beharrlich.
Also stieg das agile Weib über den zwei Meter hohen Maschendrahtzaun und verschwand hinter den Büschen; was ist denn schon dabei, wenn’s so heftig kneift …
Sekunden später tauchte sie panisch wieder auf, die Unterwäsche noch auf Halbmast.
So schnell konnte keiner pinkeln, so viel war klar.
Dann sah ich ihn, den muskulösen Rottweiler, dessen Job es war, die Hangars zu bewachen und mit seinen Reißzähnen zu verteidigen.
Der riesige Rüde drohte mit barbarischem Knurren und ließ sein furchterregendes Waffenarsenal aufblitzen.
Einige Leute kicherten blöde.
Beherzte warfen dem Tier Wurstreste vor die wütende Schnauze. Aber der Rottweiler ließ sich nicht wirklich ablenken. Er verschlang zwar alles, aber ohne das Knurren zu unterbrechen.
Die schockierte Dame hatte indessen den Maschendrahtzaun return überwunden und fiel ihrem Begleiter in die Arme. Noch immer kicherten die Leute. Es war wirklich eine komische Szene. Der Hund bleckte unmissverständlich seine Zähne und zog sich, ohne jede Eile, ins Unterholz zurück. Nein, der Frau ist, bis auf den Schock, nichts geschehen.
Auf diesen Wachhund konnte der Besitzer wahrlich stolz sein.
O nein, verdammt noch mal nein! Das konnte doch nicht wahr sein!
Die unsichtbare Wolke kam völlig überraschend dahergeweht. Sie generierte Abscheu und Ekel in den Gesichtern der Anwesenden. Man griff sich an den Hals und würgte. Biker sattelten auf und fuhren davon. Kein Zweifel, die Massenflucht hatte etwas mit Evas grünem mobilen Klo zu tun.
»Was für eine ekelhafte Pestilenz!«
Im Nu löste sich die eben noch fidele Menschentraube auf. Nur Eva und ihre Aushilfen harrten aus; die Damen mussten sich dringend etwas einfallen lassen …
Wie sich später herausstellte, war der Fäkalientank geborsten. Normaler Verschleiß? Rache der Vorbesitzerin? Böser Streich?
Eva würde das nie genau erfahren. Jedoch sollte das peinliche Fiasko für sie ein folgenschweres Nachspiel haben.
Höchste Zeit, mich beim Manifest blicken zu lassen. Immerhin war ich zum Springen hier, und das lief nur mit Check-in beim Manifest. Mein erster Freifall stand bevor, vorausgesetzt, es kam nichts Unvorhergesehenes dazwischen. Tatsächlich konnte bei Top-Sprungwetter wie heute alles Mögliche einen hässlichen Strich durch die Rechnung machen.
Meine wenigen Utensilien waren schnell zusammengerafft; das Auto verriegelte sich automatisch. Zum Manifest waren es nur zweihundert Schritte. Bis dahin würde der nasale Härtetest nicht reichen.
10:35 Uhr. Gut, dass ich noch im Zeitpuffer war.
Das Buch wäre unvollständig, wenn Evas erstaunliche Karriere unter den Tisch fiele. Wir werden sie im letzten Kapitel erzählen.
Vorfeldzirkus
Auf der kurzgeschorenen Graslandebahn, dem sogenannten Vorfeld, durfte nur in Not- oder Ausnahmefällen gelandet werden, was selten vorkam. Zuweilen übten hier die SAR-Piloten Rettungsmanöver.
Im Sommer war das Refugium für den Fallschirmsport reserviert.
In Sichtweite zum Manifest waren riesige Planen ausgelegt, auf denen die benutzten Fallschirme inspiziert und gepackt wurden. Die orange markierte Packzone war fürs Publikum tabu. Wer das ignorierte, musste mit einer roten Karte rechnen.
Die aus zig Komponenten bestehenden Textilflieger wurden von den Springern in voller Länge und Breite ausgelegt, sodass sie von allen Seiten untersucht werden konnten. Nähte, Leinen, Schlaufen, Mechanismen und Systeme mussten filigran auf Schwachstellen geprüft werden.
Besucher sahen gern dabei zu. Erstaunlich, wie das Leinengewirr gebündelt, gestaucht und zu immer kleineren Päckchen gefaltet wurde. Angesichts der Materialmasse verblüffte es nicht nur Gäste, wie viel Gedrösel in den Rückencontainer hineinging.
Am Ende der Packprozedur knieten die Packer auf den Bündeln und kneteten sie zusammen, bis sie im Rucksack, dem POD (Parachute Opening Device), verstaut waren; nur die Öffnungsringe blieben draußen.
Scherz unter Fallschirmspringern: »Packfehler machst du nur einmal …!«
Unzähligen Unfällen zufolge waren nur lizensierte Packer packberechtigt. Von uns Azubis vorgepackte Schirme galten als »closed«, bis sie von zwei autorisierten Packern gecheckt und als »cleared« signiert worden waren.
Durch Einführung des zunächst kritisierten CCS (Cross-Control-System) sank die Unfallrate infolge von Packfehlern fast auf null.
Zu viele Unfälle waren passiert, meist mit tödlichem Ausgang.
Damit war von einem auf den anderen Tag Schluss.
Ein Meilenstein im Fallschirmsport.
Das imposante XXL-Blockhaus gleich neben dem Vorfeld war für alle Aktiven und Gäste die ultimative Anlaufstation. Es ähnelte einer oligarchen Villa irgendwo im Outback Kanadas.
Die Architekten wollten kunstvolle Extravaganz und die Betreiber Umsatz und maximalen Gewinn. Beide Grundideen waren richtig, weil jeder, der hier aufkreuzte, ein paar Euro ausgab.
Fallschirmspringer mussten nach ihrer Anmeldung beim Manifest im Voraus zahlen, ein Schelm, wer Übles dabei denkt …
30 Euro pro Lift, mit einer Zehnerkarte gab’s ein alkoholfreies Getränk gratis.
Auf dem Vorfeld spielte sich neben der operativen Gerätepflege das soziale Mit- und Gegeneinander ab. Hier hatte man alles im Blick, hier ging es familiär zu, hier klagte man kollektiv über Wartezeiten, lauschte auf Lautsprecherdurchsagen, und last but not least ging’s auch um »sehen und gesehen werden«.
Kontaktsuchende brauchten nur das Wetter anzusprechen, und schon begannen endlose Palaver.
Tatsächlich war die Wettersituation Stimmungsbarometer Nummer eins. Einfach alles drehte sich in den Springerforen der Welt um das Wetter, genau gesagt um Sprungwetter.
Einerseits ließen sich verpatzte Sprünge wunderbar auf Mistwetter abwälzen. Andererseits fraß es kostbare Zeit und vermieste einem die Freude.
Warten auf optimales Sprungwetter konnte beim Meridian 53° Tage, manchmal Wochen dauern. Hangover-Days versauten jedem die gute Laune. Das war dann die Zeit für Querelen und Begleichung noch offener Rechnungen, aber auch für Trinkgelage.
Skydiver brauchten neben einer Top-Ausrüstung noch drei wichtige Dinge: Geduld, Geduld und Geduld.
Nur die Gastronomie freute sich an Hangover-Days über klingende Kassen. Den Vorfeldvergleich eines englischen Fliegermagazins konnte man gelten lassen: »Skydive locations are like extraordinary circus worlds!«
Der Schreiner
11:50 Uhr. Westseitig am Vorfeldrand hatte ich »Platte« gemacht, Walter war etwas später dazugekommen: Badetuch ausbreiten, Sachen drumherum verteilen – fertig. Von hier aus war alles Geschehen gut zu überblicken. Die verstreuten Tageslager gab’s alle paar Meter, die besten waren schnell besetzt. Zuerst war jede Menge Platz, dann rückten einem die Nachzügler immer näher auf die Pelle.
Walter war vor einer Weile zum Duschen gegangen und bislang nicht zurückgekehrt. Hing er in der Warteschlange fest?
In den Duschkabinen waren auch die Toiletten untergebracht oder umgekehrt. Eine, auch zwei der vier Kabinen waren meist defekt, weshalb die intakten auch in Grüppchen blockiert wurden. Dann kam es draußen zu gereizten Belagerungszuständen. Vielleicht hatte Walter das Pech gehabt.
Indessen kniete ich auf dem Gras und suchte vergeblich eine saubere Stelle auf meinem Badetuch. Kurzerhand zog ich mir den am wenigsten dreckigen Zipfel lichtabweisend über das Gesicht.
So auf dem Rücken liegend, ließ ich mich in den Schlummermodus fallen. Walter würde jeden Moment auftauchen und, wie es seine Art war, mich mit dem neuesten Tratsch versorgen.
Wenn ich so dalag und döste, schlief ich keineswegs. Stattdessen war ich hellwach für alles, was um mich herum vorging. Dösen war gut zum Akkuaufladen; erholsam wie Meditation. Augen schließen, Klappe halten und das Denken abschalten, das funktionierte fast überall.
Während mein Akku neue Energie speicherte, schaute ich gelassen Kopfkino. Beim Kopfkinoschauen erschienen mir Erinnerungsfilme, ohne Vor- und Nachspann, Überraschung pur.
Die virtuelle Leinwand tat sich in der Stirnmitte auf, direkt über der Nasenwurzel. Ajna-Chakra nennen die Hindus die Stelle über der Nasenwurzel. Das Ajna-Chakra ist für sexuelle Triebe zuständig, die es zu beherrschen gilt, heißt es. Hindufrauen und -männer punktierten sich mit einem farbigen Mal, meist tiefrot bis orange. Das rituelle Mal zwischen den Augenbrauen konnte im Hinduismus alles Mögliche bedeuten. Placeboeffekt? Wer wusste das schon genau.
Das Badetuch störte meinen Geruchssinn empfindlich, es hätte längst in die Wäsche gehört. Die von den Flugzeugen emissierte Lärmkulisse musste ich eh ignorieren, ebenso meinen Durst. Walter würde gleich mit Eistee zurückkommen, suggerierte ich mir.
Kaum hatte ich die Gesichtsmuskeln entspannt, ging es los, mein privates Kopfkino.
Mein verstorbener Opa erschien – wie immer quicklebendig. Er arbeitete im Garten und lief in seinen schiefgelaufenen Clogs herum. Auf dem Kopf thronte der hoffnungslos zerknautschte Lederhut. Vor sich her balancierte er die Blechschubkarre, die mit frisch gesägtem Brennholz beladen war. Die Radnabe quietschte und jaulte nach ein paar Tropfen Öl.
Ich kannte diese Gartenszenerie zur Genüge. Heute nicht so mein Ding, ich wollte abschalten. Aber ich wartete eine Sekunde, wie es diesmal weitergehen würde, weil kein Movie wie das vorherige war. Das Kopfkino kam jedes Mal anders daher, in immer neuen Varianten. Die Zeit spielte keine Rolle. Ganze Episoden konnten in Sekunden durchlaufen sein. Die Movies endeten abrupt, sobald sich die Augen öffneten oder wenn die Hauptmuskulatur bewusst bewegt wurde.
Im Kopfkino war es Sommer. Ich war etwa zwölf und verbrachte einen Teil der Ferien bei meinen Großeltern. Mein Opa und ich saßen auf umgedrehten Blecheimern unter dem Kirschbaum. Wir futterten kiloweise knackige Knubberkirschen. Die Kerne spuckten wir in die Blechschubkarre; so wurden die Treffer akustisch mit »bang« bestätigt.
Mein Opa erzählte gern seine alten Geschichten, manchmal auf Plattdeutsch, was ich so halbwegs zu sprechen lernte. Seinen Geschichten gingen oft Sprüche wie dieser voran: »Wenn du das Ziel erreicht hast, geh weiter, weil das Beste erst noch kommt.«
Nein, einen tieferen Sinn konnte ich damals nicht begreifen, aber einige seiner Sprüche sind bis heute hängen geblieben.
Das Kopfkino schien spannend zu werden, es gab keinen Grund, es vorzeitig abzuschalten.
Also, mein Opa war gelernter Möbelschreiner mit Meisterbrief. Er arbeitete in einer Fabrik, die altdeutsche Wohnmöbel herstellte. Leider waren diese nicht mehr in Mode, sodass er seine Brötchen anderswo verdienen musste.
Nur halbherzig bewarb er sich um die freie Stelle am Theater zu Lübeck, als Kulissenbauer, der das Schreinerhandwerk können sollte. Prompt bekam er den Job und bestand auch die dreimonatige Probezeit. Doch so richtig wohl fühlte er sich dort zunächst nicht. Die Arbeitszeit war an die aktuellen Spielpläne gebunden, sodass er an den Wochenenden und Feiertagen Bühnendienst machen und oft bis nachts bleiben musste.
Doch aus Vorbehalten wurde bald Begeisterung. Immerhin hatte ausgerechnet er, mein Super-Opa, die von 30 Mitbewerbern begehrte Anstellung bekommen. Und diese sollte sein bisher beschauliches Leben dramatisch verändern.
Irgendwann war der Intendant zu ihm in die Kulisse gehuscht und hatte ihn bekniet, für einen erkrankten Darsteller einzuspringen. Nur eine simple Nebenrolle sei das. Er stünde doch schon lange genug hinterm Vorhang und wisse, wie so was gehe. Er persönlich wie auch die Regie trauten ihm das locker zu – mehr noch, genau er sei der Richtige.
Billiger Köder, leicht durchschaubar, doch der so Geschmeichelte biss an. Insgeheim hoffte er, dass man ihn in Ruhe lassen würde, sobald sein Antitalent offenbar wurde.
Im Nu wurde eine perfekt sitzende Butlerrobe aufgetrieben, und bereits in der Abendvorstellung agierte mein Opa das erste Mal in seinem Leben nicht hinter, sondern auf der Bühne, inmitten der von ihm kreierten Kulissen.
Er sollte den umtriebigen Butler Gottfried mimen, welcher mit der nymphomanischen Beatrice Gräfin von Brunn ein heimliches Tête-à-Tête pflegte.
Die Schrittfolgen, Gesten und Dialoge kannte er als Backstage längst auswendig: »Zu Diensten, Herr Graf! Schlafen Sie wohl, Gnädigste! Gute Nacht, edler Herr, werde die Hunde zur Nacht noch einmal ausführen.«
Drei Mal musste er auf der Bühne erscheinen.
Im ersten Akt sollte er im Jagdsalon die gläserne Vasenattrappe von der Kommode nehmen und sie ungelenk fallen lassen, sodass sie zerbrach. Dann sollte er sich im Rückwärtsgang drei Mal vor der Gräfin von Brunn verneigen, ganz tief runter, bis es in den Knien wehtat.
Im zweiten Akt sollte Gottfried forsch ans Salonfenster schreiten und ratlos um sich blicken. Er sollte die Vorhänge zuziehen und dabei den Fensterriegel demonstrativ öffnen, damit derselbe Hallodri zu Mitternacht hurtig ins Bettchen der schmachtenden Gräfin steigen konnte.
Für den leidenschaftlichen Background sorgte ein Stöhn-Tonband, das die Requisite im Sexshop erworben hatte.
Als der infame Lump im dritten und letzten Akt der Komödie durch das manipulierte Fenster zurückstieg, wo er mit den Hosenträgern hängen bleiben sollte, musste er sich vom gehörnten Grafen mit der Hundeleine jagen und prügeln lassen, bevor er stolpernd – aber ohne zu fallen – durch die offene Salontür fliehen sollte; verfolgt von zwei abgerichteten, echten Beagles.
»Fantastisch! Herrlich! Großartig! Genial, einfach great!«
»Besser hätte man den Butler nicht spielen können, Herr Conradi! Wir müssen das feiern, unbedingt, mein lieber Conradi! Mein guter Conradi, mein bester, mein allerbester Conradi!«
Die maßlose Euphorie des Intendanten war meinem Opa höchst peinlich. Aber den lauwarmen Sekt irgendeiner Billigmarke musste er wohl oder übel trinken.
»Prost, mein guter Conradi! Sie haben soeben mit Bravour die Abendvorstellung gerettet. Das Theater ist Ihnen allerhöchsten Dank schuldig!«
»Prost unserem edlen Retter!«
Das Gefolge hob die Gläser und rühmte ihn, den Helden des Tages. Ja, auch das Ensemble sei von seinem Debüt begeistert gewesen. Endlose Schmeicheleien, nur einige schienen neidisch.
Der überfallartige Rummel war meinem Opa unheimlich und suspekt. Er glaubte erst, man wollte ihn veräppeln. Aber auch die Hauptrollen lobten sein Talent. Also hat Großvater sich feiern lassen, schließlich war es ja nur eine einmalige Ausnahme.
Doch am Folgetag rückte der »Herr Direktor«, wie die Bühnenarbeiter den Intendanten anzusprechen hatten, damit heraus, dass er den Gottfried doch bitte, bitte auch noch über die verbleibende Spielzeit mimen solle. Neubesetzung sei so schnell nicht möglich, das könne er sich doch denken.
Im Übrigen sei er, Philip Conradi, ein Geschenk des Himmels.
Er würde dem Theater einen bombastischen Dienst erweisen, was man ihm nie vergessen werde … und was den Kulissenbau betreffe, dafür habe man bereits eine Lösung gefunden.
»Das war wie ein Asteroideneinschlag!«, sagte Großvater später. »Mir war schwindlig, ich hätte mich in Luft auflösen mögen.«
Mit letzter Courage hatte er das Angebot dann abgelehnt und dem Herrn Direktor mit weichen Knien erklärt: »In der Kulisse kann ich tausend Illusionen generieren. Nebel, Regen, Schnee, alles kein Problem, Herr Direktor, wirklich nicht! Aber als Schauspieler, Herr Direktor, auf der Bühne vor Publikum spielen, Herr Direktor, das kann und mag ich nicht!«
Doch der mutige Fluchtversuch lief voll ins Leere. So schnell gab der Intendant alias Herr Direktor nicht auf.
»Und ob Sie das können, mein Guter! Sie müssen sogar, mein Bester! Wir haben doch nur Sie! Sie werden unser Theater doch nicht im Stich lassen wollen, lieber Conradi?!«
Mein Opa wollte damals auf der Stelle kündigen … Doch irgendwie gelang es dem Ensemble, den frisch gekürten Joker zu überreden, er möge doch erst mal annehmen – mit dem Vorbehalt, jederzeit aufhören zu dürfen.
Aufhören? Kündigen!
Dazu war es, o seltsame Fügung, nicht gekommen.
Nach zwei Dutzend Gottfrieds bekam er weitere Röllchen und Rollen, und nach einem Jahr gehörte er fest zum Ensemble.
Seine Zeit als Kulissenmeister war Geschichte.
Ja, mein Opa war einfach köstlich, ein Unikum. Ich werde ihn nie vergessen.
Doch neue Bilder zogen auf, gedankenschnell. Clownerien aus meiner Kindheit. Wenn Opa und ich trübsinnige Dramen in fetzige Kabaretts verwandelten – wow. Das interfamiliäre Publikum hielt sich brüllend die Bäuche und verlangte nach Zugaben.
Als Staffage reichten uns Tücher, Sofakissen, Hüte, Stöcke und Omas alte Lippenstifte.
Kaiser Nero ließ sich besonders gut persiflieren, weil Opa eine Saftpresse mit Kurbel besaß, die er als Leierkasten entfremdete. Beim Drehen der Kurbel sang er so erbärmlich wie Sir Peter Ustinov in seinem berühmten Historienfilm. Und wenn Opa Herbert Grönemeyers gehüstelten Song »Wann ist ein Mann ein Ma-ha-hann« imitierte, machten sich alle beinah in die Hosen.
Mein Rücken meldete sich unangenehm, einige Wirbel taten mir weh. Ich drehte mich etwas zur Seite und – aus! Das Kopfkino erlosch im selben Augenblick.
Ja, die Erinnerungen an meinen Opa generierten Melancholie, weil er vor zwei Jahren gestorben war – im Alter von 88.
Er war mein bester Freund, mein kluger und väterlicher Mentor. Er war mein Till Eulenspiegel, mein vertrauter Beistand und weiser Ratgeber. So, wie er war, wollte ich auch einmal werden.
Nach schwerer, Gottlob nur kurzer Krankheit ist er eines Morgens nicht mehr aufgewacht. Als ich an seinem Bett traurigen Abschied nahm, sah ich in seinem Schelmengesicht, dass er vollkommen mit sich im Reinen war. Es war das Gesicht eines Träumenden, eines mit Dank erfüllten Menschen.
Walter?!
Wo mochte er sich herumtreiben?
Egal, Opas Story war noch nicht ganz zu Ende, der Dös-Modus noch nicht erkaltet. Ich schloss erneut die Augenlider, und – wie auf Knopfdruck lief das Kopfkino weiter. Neue, andere Bilder kamen daher, aber nur flackernd, weil auf dem Runway so schrill gebremst wurde.
Okay, Springerforen sind keine Sanatorien und gewiss keine Orte zum Dösen oder Akkuaufladen … als ich dies dachte, rasten die neuen Bilder unaufhaltsam weiter!
»Den größten Gewinn hab ich meinen Niederlagen und Gegnern zu verdanken«, hörte ich meinen Großvater sagen. Dieser weise Satz ist mir bis heute geläufig, weil ich glaube, ihn verstanden zu haben.
Ein paar Jahre nach dem Quereinstieg ins Bühnenmetier erkrankte mein Opa. Er wurde alkoholkrank, mit verheerenden Folgen.
Aus dem harmlosen Weinchen unter Freunden wurden Flaschen. Opa trank zu allen Anlässen, auch zu nichtigen. Und wenn er erst zu trinken angefangen hatte, war er außerstande, aufzuhören. Er konnte das Trinken nicht wie andere beenden, es war ihm nach dem ersten Glas einfach nicht möglich, es bei diesem zu belassen. Fast immer wurden Exzesse daraus.
Blackouts und Alkoholvergiftungen waren die schrecklichen Folgen.
Hinzu kam, dass er heimlich trank und glaubte, es würde keiner merken. Sein Weinkonsum nahm immer größere Ausmaße an. Wer ihn auf seine Fahne ansprach, bekam zu hören, dass er Kräuterpastillen lutschen müsse, zur Pflege der angegriffenen Stimme.
Was für ein Unsinn!
Sogar auf der Bühne erschien er eines Abends besoffen, und der verstolperte »Herzog von Cardigan« war nicht improvisiert, wie das amüsierte Publikum glaubte. Es waren die Promille, die ihn mehr und mehr zum Popanz machten.
Obwohl mein Opa längst nicht mehr zu beneiden war, spukten ein paar intrigante Figuren um ihn herum, Pharisäer, die den Entgleisten grausam verhöhnten. Der Fiesheit Gipfel war, dass man ihm kurz vor dem Auftritt ein Gesöff gegen Lampenfieber reichte, und der verdammte Narr trank es, weil er nicht imstande war zu widerstehen. Die Gutmenschen amüsierten sich diabolisch, wenn mein Opa seinen Text nicht mehr auf die Reihe brachte. Und so verkam seine Komödiantenkarriere zur Farce, zum peinlichen Versteckspiel, was den Weinkonsum noch weiter steigerte.
Die Alkoholkrankheit hatte ihn bald fest im Griff.
Wir machten uns große Sorgen, und im Theater war man ratlos, machtlos und bald auch böse, sehr böse sogar. Für das Theater war er zum Risikofaktor geworden. Ein labiler Mime war nicht zu gebrauchen. Das Ende seiner Laufbahn war nur noch eine Frage der Zeit.
Mein Opa brauchte dringend professionelle Hilfe.
Erst nach der zweiten donnernden Abmahnung bröckelte sein Widerstand allmählich. Für das Theater war er zur Belastung geworden, aber auch für sich selbst.
Eine Therapie könnte die Misere vielleicht beenden, ließ man ihn unmissverständlich wissen, er möge sich dafür entscheiden, und zwar unverzüglich.
Widerwillig begab er sich in eine »Klinik für Suchttherapie«, als Privatpatient, von der Krankenkasse bezuschusst. Der Klinik im Harz, bei Braunlage, sagte man einen sehr guten Ruf nach, was sich bestätigen sollte.
Im Grunde, so die erste Diagnose, habe er nur einen winzigen Strickfehler in seiner DNA.
»Ich bin ein abhängiger Säufer«, wagte mein Opa vehement zu widersprechen, weil er sich unglücklich fühlte und miserabel.
Nein, dozierten die Ärzte, man müsse seine genetischen Anlagen nicht zwangsweise hinnehmen. Man könne sie quasi umerziehen, wenn man erkannt habe, dass sie schädlich sind. Philip Conradis Trinkverhalten habe höchstwahrscheinlich genetische Ursachen. Eine Laune der Natur, wenn er so wolle. Abhilfe sei möglich und dringend nötig.
Wenn er sich von seinem Trinkzwang lösen wolle, müsse er sich ohne Wenn und Aber auf die Therapie einlassen. Er müsse den Therapeuten vertrauen, vor allem aber sich selbst.