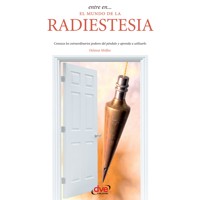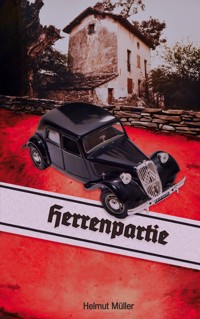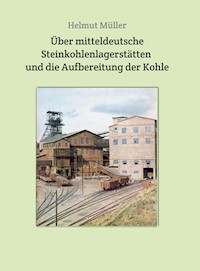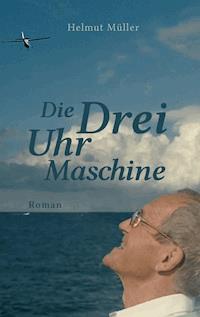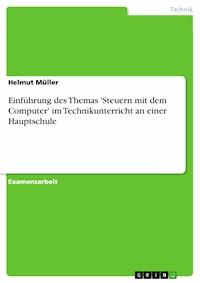Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Im Mai 1944 hat der Krieg längst den Sprung vom südlichen auf das nördliche Ufer des Mittelmeers gemacht. Carolyn Chandler, die seit einem halben Jahr als Korrespondentin für Zeitschriften des American Red Cross kreuz und quer Nordafrika bereist hat, folgt ihm. Sie freut sich auf Europa, auch von hier aus wird sie ihre Leserinnen und Leser in Artikeln über US-Hospitäler und die tagtägliche Arbeit in Einrichtungen der US-Truppenbetreuung informieren. Doch mehr noch als in "normalen" Zeiten tragen in Zeiten des Krieges menschliche Pläne die Gefahr des Scheiterns in sich. Als die Militärmaschine, auf der Carolyn in Tunesien einen Platz ergattern konnte, auf einem Feldflugplatz auf Sardinien einen Zwischenstopp einlegt, überkommt sie, gesundheitlich angeschlagen wie sie ist, die Ahnung unvorhergesehener Ereignisse.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 431
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Helmut Müller
Milk Run
Gabi, Judith und Mathieu, Dank Euch für die Ermutigung und praktische Hilfe.
Thanks to Dan, far away and yet very close, and fast whenever help was needed.
Inhaltsverzeichnis
I ABSCHIED VON AFRIKA
Bizerta
Helen
B-25 Mitchell
Dunkle Flecken
ARC-Clubmobil
II MILK RUN
Erdbeeren
III KORSIKA
Campo del Oro
Ajaccio
In Bartolis Aiglon
Aitoni
Familienpension Les Asphodèles
Feuer und Schatten
IV LIBECCIU
Al
Mite at the Mike
Ship Deathwind
Nebel und Fels
IABSCHIED VON AFRIKA
BIZERTA
Am Spätnachmittag des 8. Mai 1944, einem Montag, traf Carolyn Chandler in Bizerta ein. Sie war fast ein Jahr lang als Korrespondentin des Amerikanischen Roten Kreuzes in Nordafrika von Marokko bis Ägypten unterwegs gewesen und hatte Berichte und Stimmungsbilder in die Staaten geschickt, mit denen sie ihren Landsleuten zu Hause Eindrücke von den Schwierigkeiten und Erfolgen der amerikanischen Truppen beim Kampf um die Befreiung Nordafrikas von den Deutschen vermittelte, von Kriegsschauplätzen auf einem Kontinent, der vielen daheim so fremd war, wie die Oberfläche eines unbekannten Planeten. Natürlich nahmen in ihrer Berichterstattung Schilderungen der vielfältigen Aktivitäten des ARC, des American Red Cross, bei der Betreuung der Truppen einen besonders breiten Raum ein.
Und nun, wo der der Schwerpunkt des Krieges sich nach Norden, nach Europa, verlagerte, folgte sie ihm und befand sich auf dem Weg nach Neapel. Die USS Lincoln, das Lazarettschiff, mit dem sie in Algier ihre Fahrt begonnen hatte, war in Bône und später noch an den Docks von Tabarka vor Anker gegangen. Dort hatte man Patienten und vor allem medizinisches Material an Bord genommen. Damit war die Verlegung der Feldhospitäler von Nordafrika nach Italien im Großen und Ganzen abgeschlossen. Sie wurden nun dringend in größerer Nähe zu den Kämpfen in Europa gebraucht. In Bizerta würde die Lincoln allerdings auch noch Patienten aufnehmen, die drüben in Italien weiterhin stationär untergebracht werden mussten. Man hatte mit ihrer Verlegung warten müssen, bis dort die entsprechenden Kapazitäten bereit standen. Da das Eintreffen dieser letzten Verwundeten aus dem Hinterland sich hinziehen konnte, war der Zeitpunkt des Auslaufens des Lazarettschiffs Lincoln aus dem Hafen von Bizerta ungewiss.
Also hatte Carolyn beschlossen, hier von Bord zu gehen und ihre Reise nach Neapel per Flugzeug fortzusetzen. Der Flugplatz Sidi Ahmed lag ja nur ein paar Meilen südlich von Bizerta, und sie war zuversichtlich, dass sich ohne Schwierigkeiten ein Platz in einer Militärmaschine finden lassen würde, die sie nach Neapel oder wenigstens erst einmal bis nach Korsika mitnehmen könnte. Und außerdem wollte sie sich in Bizerta noch mit Helen Schaefer, einer Freundin, treffen, bevor auch das 41. Feldlazarett, in dem Helen als Krankenschwester arbeitete, nach Italien verlegt wurde.
Auf diese flexible Art der Reiseplanung mit all ihren unvorhergesehenen Änderungen und Überraschungen hatte sie sich als Korrespondentin eingestellt, und auch dass der Zufall dabei immer wieder eine große Rolle spielte, beunruhigte sie nicht weiter. Im Gegenteil: Mit der Zeit waren solche Unvorhersehbarkeiten für sie zur Normalität geworden, aus denen sie das Beste zu machen versuchte. Zu manchen ihrer gelungensten Reportagen hatten gerade solche spontanen Änderungen ihrer Reisepläne den Anstoß gegeben.
Während die Lincoln in Sichtweite zur nordafrikanischen Küste Kurs auf Bizerta hielt, schien den ganzen Tag über die Sonne von einem wolkenlosen Himmel, und so war es trotz der stetig landeinwärts wehenden Brise für diese Jahreszeit auf See schon angenehm warm gewesen. Deshalb, und auch um der Enge und der drückenden Luft in den niedrigen Räumen unter Deck zu entgehen, wo sich die üblichen Lazarettgerüche mit den Dünsten aus der Schiffskombüse mischten, hatte Carolyn von irgendwoher einen der raren Liegestühle ergattert und sich an einem windgeschützten Platz an Deck so komfortabel wie möglich eingerichtet: im Rücken die schützenden Deckaufbauten, vor sich die Reling und dahinter die offene See. Ihren Hausrat – so nannte sie ihre wenigen Gepäckstücke –, hatte sie um sich herum verteilt. Das waren: ein großer Segeltuchkoffer, ein kleinerer Handkoffer aus Leder und ein kleiner olivgrüner Kleiderbeutel, ihre Musette-Bag. Nur für den schwarzen, flachen Kasten, in dem sich ihre sorgsam gehütete Underwood befand, hatte sie zwischen der Rückenlehne ihrer Liege und der Schiffswand einen besonders geschützten Platz ausgewählt. Die zierliche Schreibmaschine war ein Geschenk ihres Vaters und abgesehen von einem klaren Kopf war sie ihr wichtigstes Arbeitsinstrument. Die hütete sie wie ihren Augapfel.
Sie hatte den Rückstand in ihrem Notizbuch, das gleichzeitig ihr Tagebuch war, aufgearbeitet und genoss nun den wunderschönen Tag von ihrem Platz aus wie einen Ferientag. Zwischendurch beobachtete sie die beruhigend monoton vorüberziehende Küstenlinie, bis ihr die Augen zufielen.
Als sich später trotz des leichten Seegangs ein wenig Hunger bei ihr einstellte, machte sie sich seufzend auf die Suche nach etwas Essbarem. Auch darin hatte sie sich eine gewisse Routine angeeignet, und so gelang es ihr, sich eine karge Mahlzeit zusammenzustellen. Die bestand aus einem großen Becher Kaffee aus der Schiffsküche und dem, was sie sich aus einer K-Rat zusammenstellte. K-Rat – das war die allgemein verbreitete respektlose Bezeichnung für die „K-Rationen“, die graubraunen Schachteln mit der Einsatzverpflegung der US-Army. Die hatte man ihr freundlich lächelnd mit der Entschuldigung zugeschoben, dass unerwartet viele Patienten an Bord gekommen seien, die es zuerst einmal zu versorgen gelte.
Als ihr mit anbrechendem Nachmittag das gleißende Licht der Sonne und die glitzernden Reflexe der Meeresoberfläche unangenehm wurden, half ihr ein freundliches Besatzungsmitglied beim Umzug in den Schatten der Deckaufbauten auf die Backbordseite. In der blendenden Helligkeit hatten sich wieder die ersten Anzeichen des lästigen Kopfwehs bemerkbar gemacht. Diese Anfälligkeit für Kopfschmerzen hatte sie früher nicht gekannt. Doch seit Beginn des Frühjahrs war sie wiederholt von migräneartigen Beschwerden heimgesucht worden. Dazu hatte sich mit dem typischen Hitzegefühl auf Wangen und Stirn auch noch ein Sonnenbrand angekündigt. Wenigstens dem hoffte sie durch ihren Platzwechsel noch entgehen zu können.
Aber schon lange bevor das Schiff sich dem Hafen von Bizerta näherte, war sie dann doch wieder an ihren alten Platz auf der nun gar nicht mehr so sonnigen Steuerbordseite zurückgekehrt.
Und da stand sie nun an die Reling gelehnt und hielt Ausschau nach den Hafenanlagen von Bizerta. Sie hatte ihren blaugrauen ARC- Uniformmantel über die Schulten geworfen und ihre Unterarme ruhten bequem auf dem gerundeten Handlauf der Reling. Da die Luft sich schon merklich abgekühlt hatte, war es wieder angenehm, durch die Kleidung hindurch die wärmenden Strahlen der Sonne auf der Haut zu spüren. Die hatte Anfang Mai schon merklich an Kraft gewonnen, aber dennoch konnte es jetzt am Spätnachmittag auch hier in Nordafrika noch frisch werden, zumal der Wind, der inzwischen gedreht hatte und nun ablandig seewärts wehte, zum Abend hin böig auffrischte.
Mit der mörderischen Sommerhitze und den Staubstürmen, die sie vom vergangenen Jahr her noch in Erinnerung hatte, ebenso mit den Wolken bläulich glitzernder Fliegen und dem Gestank der Abwässer in den Gräben und austrocknenden Pfützen war glücklicherweise erst wieder mit Beginn des Sommers, also ab dem Ende des Monats zu rechnen. Wenigstens diese Unannehmlichkeiten würden ihr erspart bleiben, denn nach Nordafrika, da war sie sich sicher, würde sie nicht mehr zurückkehren.
Doch beklagt hatte sie sich wegen des ungewohnten Klimas und den damit verbundenen Beschwernisse oder wegen größerer und kleinerer Entbehrungen selbstverständlich nie. Das hätte gegen ihre Grundsätze verstoßen. Schließlich hatte sie sich dem ARC aus freiem Willen als Korrespondentin zur Verfügung gestellt und war ein halbes Jahr nach der Operation Torch, der Landung der Truppen ihres Landes bei Casablanca im November des vergangenen Jahres, in Marokko eingetroffen. Seit dieser Zeit hatte sie die amerikanischen Einheiten begleitet. Auch wenn es ihr nicht in den Sinn gekommen wäre, über das, was sie tat, viele Worte zu verlieren, hielt sie ihre Korrespondententätigkeit für das Amerikanische Rote Kreuz dennoch für ihre patriotische Pflicht. Dazu kam, dass sie ja beileibe nicht die einzige Frau war, die einen solchen Entschluss gefasst hatte. Im Gegenteil. Immer wieder staunte sie, beinahe täglich an den unwahrscheinlichsten Orten und in allen möglichen Situationen auf Frauen zu stoßen, die sich wie selbstverständlich verpflichtet hatten, ihr Land im Kampf gegen die Nazis zu unterstützen. Sie organisierten, sie heilten, transportierten und sie alle waren davon überzeugt, einen ihren Beitrag dazu leisten zu können, der Barbarei, die vom Deutschen Reich ausgegangen war und sich bis über die Grenzen Europas hinaus bedrohlich auszubreiten begann, ein Ende zu bereiten. Diese Überzeugung teilte Carolyn, und die klang auch unüberhörbar immer wieder aus den Berichten heraus, die sie für die vielen Leser und Leserinnen der Rot-Kreuz-Zeitschriften in den Staaten verfasste.
Und dennoch erinnerte sie sich nur mit Unbehagen an den vergangenen Sommer und den darauffolgenden Herbst und Winter. Begonnen hatte es gleich bei ihrer Ankunft im Frühjahr 1943 mit der Malaria. Wie alle anderen Amerikaner um sie herum hatte auch sie ihre tägliche Dosis Atebrin gegen diese unheimliche Krankheit einnehmen müssen, eine – wenn auch lästige – Nebensächlichkeit. Aber immerhin: Malaria! Diese Krankheit hatte sie bis vor kurzem nur vom Hörensagen und aus Zeitschriftenberichten über die Tropen gekannt. Und nun grassierte dieses Übel hier, um sie herum, und nicht nur hier, sondern wie sie erfahren hatte, auch drüben in Südeuropa, auf Sizilien und Korsika und wer weiß wo sonst noch.
Atebrin wurde als Ersatz für das knapp gewordene Chinin eingenommen, und egal wo man hinhörte, gab es über dessen angebliche oder tatsächliche Nebenwirkungen viel Gerede. Man munkelte, dass es deshalb sogar immer wieder zu Fällen von offener oder heimlicher Einnahmeverweigerung kam. Carolyn jedoch schluckte ihre Pillen, diszipliniert und in der vorgeschriebenen Dosis. Aber das hielt sie nicht davon ab, sich anfangs immer wieder vor den Spiegel zu stellen und verstohlen ihr Gesicht nach der berüchtigten gelben Tönung des Teints zu untersuchen, einer der angeblichen Nebenwirkungen dieses Medikaments. Als die sich glücklicherweise nicht einstellten, hatte sie, halb erleichtert und halb über sich selbst amüsiert, ihre Bedenken bald wieder vergessen.
Ihre Verdauungsprobleme ließen sich leider nicht so einfach übergehen, die schienen ernsterer Natur zu sein. Ihr Magen, vielleicht war es aber auch der Darm oder manchmal auch beides gleichzeitig, so genau ließ sich das nicht feststellen, hatten bald nach ihrer Ankunft in Marokko zu rebellieren begonnen. Das ging dann eine ganze Weile so. Mal brachte sie das mit der Umstellung auf ihre neue Art zu Reisen in Verbindung, dann wieder schob sie es auf die Widerstände, mit denen ihr Körper empört auf die klimatischen und all die anderen Umstellungen und Zumutungen Afrikas reagierte. Mit dieser Erklärung hatte sie sich eine Zeitlang selbst ein wenig beruhigen können. Diverse Medikamente taten wohl auch das Ihrige dazu, dass diese Beschwerden mit der Zeit allmählich nachließen und sie sie nach einer Weile vergessen konnte.
Nicht geschwunden aber war ihre mal offene, dann wieder untergründige Angst vor all den anderen und zum Teil unheimlichen Gefahren, die in dieser fremden Welt um sie herum lauerten, den Infektionen und Seuchen, denen ihr durch lebenslange Hygiene wohlbehüteter Organismus wenig entgegenzusetzen hatte. In diesem Punkt ging es ihr nicht viel anders als vielen ihrer Landsleute auch.
An die katastrophalen hygienischen Zustände, an den Schmutz und den Gestank, mit denen sie in den Armenvierteln jenseits der europäisch geprägten Stadtzentren und auf dem flachen Lande immer wieder konfrontiert wurde, konnte oder wollte sich einfach nicht gewöhnen, die schockierten sie immer wieder aufs Neue. So konnte ihr zum Beispiel der Anblick von Fliegenschwärmen, die sich auf den Märkten auf dem offen ausliegenden Fleisch niederließen und es mit einem krabbelnden grün- und blaugolden glitzernden Pelz überzogen, den Appetit für den ganzen Tag verderben.
Überhaupt – diese Fliegen! Sie waren eine wahre Geißel Gottes. Wie ein Fluch stürzten sich unerbittlich auf Menschen und Tiere, quälten sie unablässig auf der Suche nach Körpersäften an Mund und Augen, so dass ihre Opfer nur noch resigniert mit automatenhaften Abwehrbewegungen reagieren konnten. Besonders leid taten ihr Esel und Schafe in ihren Pferchen oder an den Rändern der Straßen, denen sich die Insekten wie dunkle Ränder um die Augen legten, um dort ihren Durst zu stillen. Bei Annäherung stiegen sie in Wolken aus den Abwassergräben und Feldlatrinen auf, um sich im nächsten Moment schon wieder auf den Verbänden der Verwundeten in den Hospitälern oder auf Lebensmitteln in den Kantinen niederzulassen. Wen wunderte es da, dass ganze Krankenreviere nur von Männern belegt waren, die an Diarrhö und anderen Magen-Darminfektionen litten, von denen sie scheinbar aus dem Nichts heraus befallen worden wurden.
Und da die übliche, normale Hygiene nicht mehr auszureichen schien, war es nur verständlich, dass die schockierten Amerikaner Zuflucht zu den bewährten chemischen Hilfsmitteln nahmen. Das taten sie an dieser anderen, unheimlichen Front des Krieges, indem sie Chlor, DDT und Desinfektionsmittel aller Arten einsetzten, und das oft auch im Übermaß. Die Folge davon wiederum war, dass an windstillen, heißen Tagen die aus dem Wüstenboden gestampften, akkurat angelegten Zeltstädte der Feldhospitäler, die Truppenunterkünfte und Nachschubdepots wie fremde Planeten unter ihrer eigenen Atmosphäre brüteten, deren Hauptanteile aus Chlorgeruch, den Dieselabgasen der Stromaggregate, aus Benzindunst und sonstigen undefinierbaren chemischen Aromen bestanden.
Aber mit all dem war es ja nun vorbei, denn Carolyn folgte, wenn auch in gehörigem Abstand, dem Krieg, der Afrika hinter sich gelassen hatte und wie eine Wetterfront über das Meer in kühlere Zonen weitergezogen war und nun auf Sizilien und dem italienischen Festland Fuß gefasst hatte. Noch im Sommer des vergangenen Jahres, nach der Invasion der Alliierten auf Sizilien, und wenig später, nach deren Landung bei Salerno, hatte man einen Großteil der verwundeten Soldaten nach Tunesien zurückgebracht. Doch dann hatte sich der Vormarsch der Amerikaner und Briten in Süditalien festgefahren. Die Kämpfe entlang der Gustavlinie, besonders am Monte Cassino, waren sehr verlustreich gewesen. Als sich dazu noch das Landungsunternehmen bei Anzio und Nettuno nördlich von Neapel zu einem Fehlschlag zu entwickeln schien, war es nicht mehr möglich, den anschwellenden Strom von Verwundeten und Verstümmelten in die Einrichtungen in Nordafrika zurück zu transportieren. Und als auch die Kapazitäten der Hospitäler im Süden des italienischen Stiefels nicht mehr ausreichten, hatte man damit begonnen, die afrikanischen Feldlazarette und Hospitäler nach Norden, in größere Nähe zu den Kampfzonen in Italien zu verlegen. Diese Operation, die nach einem komplizierten und schwer durchschaubaren System und mit unvermeidlichen Pannen abgelaufen war, stand nun endlich vor ihrem Abschluss.
Jetzt also hielt Carolyn an der Reling der Lincoln inmitten einer bunt gemischten Gruppe von plaudernden und rauchenden Krankenschwestern, Ärzten und gehfähigen Patienten Ausschau nach dem Hafen von Bizerta, der allmählich ins Blickfeld zu rücken begann. Um sich vor dem auffrischen Wind zu schützen, der vom Land herüberwehte, hielt sie ihren Mantel mit der Hand in Höhe des Kragens zusammen. Soweit die locker sitzende ARC-Uniform dies erkennen ließ, war die mittelgroße Enddreißigerin schlank und von eher zierlichem Wuchs. Sie trug ihr lockiges, braunes Haar kurz. Zusammen mit ihren dunklen Augen und den klaren und gleichzeitig weichen Gesichtszügen verlieh ihr das ein fast südländisches Aussehen.
Carolyn Chandler gehörte zu den Menschen, die auch eine Uniform nicht verunstalten konnte, weil die Eigenart ihrer Person, ihre Ausstrahlung die entpersönlichende Wirkung aufhob, auf die die Gleichförmigkeit jeder Uniform letzten Endes ja abzielt. Abgesehen davon, dass sie natürlich verpflichtet war, ihre Uniform im Dienst zu tragen, war dies für sie auch eine Selbstverständlichkeit. Schließlich war diese Äußerlichkeit Ausdruck der Verpflichtung, die sie eingegangen war und die sie gleichzeitig mit all den Männern und Frauen um sie herum verband, die wie sie für ihr Land in einem Krieg standen, den ihnen Diktatoren aufgezwungen hatten und den sie zusammen für die Sache der Freiheit siegreich beenden würden. Aber wie manchen ihrer Landsleute widerstrebte es auch ihr, diese Überzeugung mit hohlem Pathos nach außen zu kehren. Für sie war das eben eine Sache, die getan werden musste, ein Job, den man gut und entschlossen zu erledigen hatte. Punktum!
Dafür gab jeder sein Bestes und ging die täglichen Widrigkeiten nach Möglichkeit mit trockenem Humor und einer Portion Flapsigkeit an.
„Benito finito, next Hirohito!“ war eine der vielen Parolen, in denen diese Grundstimmung, wenn auch ein wenig großsprecherisch, zum Ausdruck kam. Die Achse der Diktatoren musste zerschlagen werden? Na schön, dann mal los! Aber bitte, nach Möglichkeit ohne unnötigen Überschwang!
Und klar, respektieren musste man die Uniform, aber sie deshalb gleich lieben? Das nun auch wieder nicht! Bei Zivilkleidung war das eine ganz andere Sache. Ihr dunkelrotes Sommerkleid zum Beispiel, das mit den schmalen Trägern, das so leicht und glatt auf der Haut lag, dass sie es fast nicht spürte, das liebte Carolyn tatsächlich sehr. Sie hatte es zuletzt bei dem Familienausflug im Frühjahr 1943 getragen, erinnerte sie sich. Das war kurz vor ihrer Abreise nach Nordafrika gewesen.
Damals hatte Dad die ganze Familie – ihre Mutter, den jüngeren Bruder und sie selber – ins Auto gesteckt und war mit ihnen rüber nach Atlantic City gefahren. Zum Baden war das Wasser natürlich noch zu kalt gewesen, und so hatten sie stattdessen wie früher am Strand Ball gespielt, hatten viel miteinander geplaudert und gelacht und ein herrliches Picknick gehabt. Doch nach diesen unbeschwerten Stunden schien sich jeder von ihnen in Gedanken mit der bevorstehenden Trennung zu beschäftigen. Gegen Abend, als sie Arm in Arm über die Holzbohlen der endlosen Strandpromenade schlenderten, hatten sie nachdenklich geschwiegen. Die Dämmerung hatte bereits eingesetzt, und die großen Kugelleuchten säumten in regelmäßigen Abständen den breiten Steg aus Holzbohlen wie eine Kette milchig schimmernder Vollmonde. Als mit der hereinkommenden Flut der von See her wehende Wind kühler, wurde, da hatte Dad ihr wortlos seine Jacke umgehängt.
Das war wenige Tage vor ihrer Einschiffung nach Afrika gewesen. Verständlicherweise hatte die bevorstehende Trennung ihre Stimmung gegen Abend doch getrübt. Als sie später in Dad’s dunkelblauem Ford Victoria saßen und sich auf den Weg zu einem Abschiedsessen in einem Diner irgendwo in der Stadt machten, waren sie alle erleichtert gewesen. Und während des Essens hatte sich die trüber Stimmung wieder verflüchtigt. Ohne dass es dafür einen bestimmten Grund gegeben hätte, war eine fast ausgelassenen Heiterkeit aufgekommen und sie hatten eine Weile darin gewetteifert, einander mit Scherzen und im Erzählen besonders lustiger Erinnerungen aus ihrer Familiengeschichte zu übertreffen. Als sie wieder etwas ernster geworden waren, versuchten sie einander mit guten Gründen in der Überzeugung zu bestärken, dass dieser Krieg eigentlich nicht mehr lange dauern konnte. Ihre Trennung, versicherte man einander, konnte nur noch von kurzer Dauer sein, alles werde glimpflich enden.
Oh ja, so etwas wie Liebe zu der weichen, leichten Kleidung des Friedens – das gab es. Gegenüber der strengen und praktischen Kleidung des Krieges blieb es für Carolyn beim Respekt. Doch dieser Respekt, der war, ihrem Naturell entsprechend, durchsetzt mit einer Spur freundlicher Respektlosigkeit.
So hatte sie sich zum Beispiel von Anfang an über ihre biedere Uniformjacke mit den vielen aufgesetzten Taschen amüsiert. Steckte man beispielsweise in die in Hüfthöhe aufgesetzten unnötig großen Außentaschen etwas, das nur ein wenig dicker war als ein Blatt Papier, so standen die gleich geradezu wichtigtuerisch ab wie kleine, seitlich umgehängte Brotbeutel und bescherten der so uniformierten Trägerin eine lächerlich ausladende Beckenregion. Und je nach Ausprägung der weiblichen Rundungen des Oberkörpers und dem jeweils individuellen Sitz der Jacke konnten die markanten Knöpfe, die die Klappen der Brusttaschen verschlossen, gelegentlich sogar zu anzüglichen Scherzen Anlass geben. Nüchterner und fast elegant wirkte dagegen der in weiten Falten bis über die Knie fallende, ebenfalls blaugraue Rock. Die helle Bluse, deren weiten, weichen Kragen man offen und über den Kragen der Jacke gelegt trug sowie die naturfarben hellen Seidenstrümpfe nahmen der strengen Kleidung glücklicherweise ebenfalls etwas von ihrer praktischen Nüchternheit und ließen erahnen, wie die manchmal vielleicht schon etwas bejahrteren Uniformträgerinnen wohl in weniger ernsten Zeiten, etwa als Schulmädchen, ausgesehen haben mochten. Und an den soliden schwarzen Schuhen gab es gar nichts auszusetzen, die hatte Carolyn bald schätzen gelernt. Sie waren zugleich fest und bequem und wirkten trotz ihrer halbhohen stabilen Absätze nicht klobig. Dazu kam, dass in ihnen auch ihre empfindlichen Füße – denn mit einer solchen Empfindlichkeit war Carolyn leider gestraft – auf den langen und manchmal beschwerlichen Wegen, die sie zurückzulegen hatte, trotzdem gut aufgehoben waren.
Sie fischte aus ihrer Manteltasche das kleine, zerknitterte Schächtelchen mit der letzten Chesterfield, einem Überbleibsel aus einer K-Ration, und ließ sich von einem neben ihr stehenden Krankenpfleger Feuer geben, wobei der das brennende Streichholz umständlich mit der hohlen Hand gegen den vom Land her wehenden Wind schützen musste. Obwohl das Schiff bei seinem Einlaufen in den Hafen einen Bogen von fast neunzig Grad beschrieben hatte und so die Steuerbordseite, an der Carolyn stand, wieder von der tiefstehenden Sonne beschienen wurde, wollte es nun endgültig nicht mehr richtig warm werden. Also entschloss sie sich, vollends in ihren Mantel zu schlüpfen.
Inzwischen hatte sich die „Lincoln“ noch mehr dem Land genähert und zog nun in einem Abstand von nur wenigen hundert Metern an der Küste vorbei. Auf dem etwas höher gelegenen Teil des Ufers oberhalb des Strandes zog sich schon seit einer Weile ein Gewirr ineinander verschachtelter weißer Häuser hin, die zu einem etwas ärmlicheren Vorort Bizertas zu gehören schienen. Schon von See aus waren auch hier deutlich Spuren der Zerstörungen zu erkennen, die die Bombardierungen und die Kämpfe um Bizerta und seine Hafenanlagen im letzten Frühjahr an ihnen hinterlassen hatten. Irgendwo hier hatten sich die letzten Reste des deutschen Afrikakorps vor genau einem Jahr verschanzt, bevor es kapitulierte. Während der Tage davor waren das Stadtgebiet und der Hafen von Bizerta tagelang von der US Army Air Force bombardiert worden. Und die hatte, wie man so schön sagt, ganze Arbeit geleistet und zusammen mit der Innenstadt und den Hafenanlagen eben auch die ärmlichen Wohnhäuser dort drüben zu einem großen Teil beschädigt oder ganz zerstört. An manchen der kleinen Häuser mit den flachen Dächern waren die Außenwände teilweise oder ganz eingestürzt und gaben den Blick in das dahinter liegende Innere frei, in dem sich mit tiefen Schatten schon die Nacht ankündigte. Die Menschenleere und die einsam aufragenden Mauerreste sowie der in Haufen und Wällen herumliegende Trümmerschutt ließen diesen Teil von Bizerta als unbewohnte Ruinenstadt erscheinen. Kein Wunder, das unter dem Eindruck dieses Anblicks Unterhaltungen und gelegentliches Gelächter an der Reling für eine Weile verstummten.
Nachdem die Lincoln langsam eine lange Mole umfahren hatte und eine tiefer in den Hafen hineinführende Wasserstraße kreuzte, drosselte sie ihre Fahrt und glitt in das große Hafenbecken. Dort hielt das Schiff auf einen von mehreren Piers zu, der noch nicht ganz von Schiffen aller Art belegt war. Auch hier im Hafen fielen zuallererst die Zerstörungen durch die Bombardierungen ins Auge. Die Kaimauer im Hintergrund, auf die die Piers rechtwinklig zuliefen, war an mehreren Stellen kraterförmig aufgebrochen. Ihre Trümmer waren teilweise ins Hafenbecken gestürzt und ragten nun an manchen Stellen über die Wasseroberfläche empor. Um den Kai wieder benutzbar zu machen, hatte man die durch die Bomben gerissenen Lücken provisorisch mit massiven Bohlenkonstruktionen überbrückt. Auch die Piers im Hintergrund wiesen an manchen Stellen klaffende Löcher auf, und auch hier hatte man sich in der Eile mit Überbrückungen aus dicken Balken beholfen, um die Schiffsanleger wenigstens wieder notdürftig nutzen zu können.
Erst beim Näherkommen erkannte Carolyn, dass es sich bei einigen der an den Kais liegenden Schiffe um Wracks handelte, deren Aufbauten und Bordwände an manchen Stellen rauchgeschwärzt waren und in deren Metall Geschossgarben und Bombensplitter gezackte Löcher in allen Größen gerissen hatten. Manche der Frachter lagen wie müde Tiere auf der Seite, andere reckten in grotesker Schräglage Bug oder Heck gen Himmel. Soweit sie noch lesbar waren, verrieten ihre Namen, dass es sich bei den meisten von ihnen um ehemalige italienische Transportschiffe handelte, die Rommels Truppen mit Nachschub versorgt hatten, bevor ihnen hier endgültig der Rückweg abgeschnitten worden war.
Im Hintergrund, jenseits der Kaimauer, schloss eine Reihe langgezogener mehrstöckiger Gebäude den Hafenbereich zur Stadt hin ab. Ihre Erbauer hatten offensichtlich versucht, ihnen mit Arkaden aus maurischen Bögen auf allen Stockwerken und anderem Zierrat ein möglichst orientalisches, nordafrikanisches Aussehen zu geben. Doch von dieser dürftigen Pracht war wenig übrig geblieben. Die Galerien der oberen Stockwerke waren größtenteils weggebrochen und hoch bis zu den ebenfalls beschädigten Dächern klafften große Lücken.
Der Hafen machte einen überfüllten, unübersichtlichen Eindruck. Wo immer sich eine freie Stelle geboten hatte und der Zustand der Hafenanlagen es erlaubte, hatten amerikanische und britische Lazarett- und Transportschiffe angelegt. Erstere um Menschen, medizinisches Material und Fahrzeuge für die Verschiffung nach Italien aufzunehmen, andere, um Fracht zu laden, die aufgetürmt in langgezogenen Hügeln auf den Hafenkais zur Verschiffung bereit lag, Nachschubmaterial für die Truppen in Italien. Zwischen den Kistenstapeln, deren helles Holz sich von der langsam dunkler werdenden Umgebung des Hafens abhob und längs der akkurat zu langgezogenen Pyramiden aufgereihten Treibstofffässer, ebenso wie am Fuße der mit riesigen dunkelgrünen Planen bedeckten Berge von undefinierbarem technischen Gerät herrschte ein verwirrendes Hin und Her von Soldaten und Fahrzeugen. Lastwagen kamen an oder fuhren ab, und über all dem schwenkten die Ladekräne der Frachter mit gleichmäßigen und ruhigen Bewegungen ihre langen Arme hin und her, hievten Lasten an Bord der Schiffe und versenkten sie in deren offenen Bäuchen.
Jetzt also war sie in Bizerta! Carolyn Chandler schnippte den Rest ihrer Zigarette über Bord und sah dem glühenden Punkt nach, der vom Wind in einem Bogen zum Schiff zurückgetrieben wurde, wo er dicht an der Bordwand im trüben Hafenwasser vollends erlosch und längs des schwarzen Schiffsbauchs zum Hecks trieb, wo er sich in dem Unrat, der das Wasser bedeckte, verlor. Für einen Moment schien es Carolyn, als habe sie auf dem kleinen weißen Stummel noch die rote Spur ihres Lippenstifts erkannt. Mit einer schnellen Bewegung streifte sie sich einen Tabakkrümel von der Unterlippe und wandte sich fröstelnd von der Reling ab.
Inzwischen hatten um sie herum an Deck Unruhe und Bewegung zugenommen. Die kleinen und größeren Gruppen, die an der Reling stehend ebenfalls die Einfahrt in den Hafen beobachtet hatten, lösten sich auf. Und auch für Carolyn war es höchste Zeit, sich für die Landung fertig zu machen. Die wenigen Minuten, die ihr noch blieben, bis die Lincoln an der freien Anlegestelle weiter vorne an der Kaimauer festmachen würde, wollte sie schnell nutzen, um noch einmal die Bordtoilette aufzusuchen. Da konnte sie vor dem Spiegel ihr Make-up auffrischen und ihre Frisur in Ordnung bringen. Denn wo immer auch sie sich den Tag über an Deck aufgehalten hatte – der Wind schien ihr überall hin gefolgt zu sein, war ihr beharrlich durch die Haare gefahren und hatte ihr die Locken ins Gesicht geweht. Das musste sie in Ordnung bringen. Und ganz zum Schluss, schon in der Drehung weg vom Spiegel, würde sie, wie immer und so ganz nebenbei, mit einem geübtem Griff den richtigen Sitz ihrer Uniformkappe mit dem angedeuteten Schild und der Schleife mit dem Rot-Kreuz-Emblem korrigieren. Doch, unternehmungslustig sollte sie schon sitzen, die Kappe, leicht nach links gekippt und ein klein wenig auf den Hinterkopf geschoben.
HELEN
Als das Lazarettschiff anlegte, zeigte es sich, dass das Chaos im Hafen sogar noch größer war, als es aus der Ferne den Anschein gehabt hatte. An den beschädigten Stellen der Kais oder zwischen den aufgetürmten Materialstapeln waren immer wieder Engstellen, an denen sich Fahrzeuge aller Größen stauten, die entweder beladen zu den Schiffen hinstrebten oder entladen das Hafengelände verlassen wollten. Die Knäuel aus Menschen und Fahrzeugen ließen sich dort nur langsam unter Hupkonzerten und unter viel Geschrei auflösen. Kleine Kisten wurden unter lauten Rufen der Stauer von den Ladepritschen der Lastwagen auf Rollbänder gehievt und verschwanden rumpelnd in den Bäuchen der Frachtschiffe, während über allem, lautlos und ein wenig bedrohlich, große Lastenbündel und sogar Fahrzeuge in den Verladenetzen der Schiffskräne schwebten.
Die ersten Verwundeten standen oder lagen auf Tragen an Land auch schon bereit. Die schwerer Verletzten unter ihnen wurden, von Pflegern gestützt, über die schwankende Gangway auf das Schiff gebracht, während die Gehfähigen gruppenweise und von weißgekleideten Krankenschwestern begleitet an Bord kamen.
Und über all dem Hin und Her, über den Rufen der Männer und dem Gehupe und dem Motorenlärm der Lastwagen erhoben sich die spitzen Schreie der Möwen, die in Schwärmen über dem Hafen von Bizerta, der eigentlich ihr Hafen war, kreisten und flatterten. Sie ließen sich nur zu kurzen Ruhepausen auf den Deckaufbauten der Schiffe nieder, stoben gleich darauf wie auf ein geheimes Zeichen schrill lärmend wieder auf und ließen sich nach ein paar Rundflügen über dem Hafen weiter entfernt erneut, aufgereiht wie Perlen auf einer Kette, auf dem First einer Lagerhalle nieder. Dort verweilten sie dann eine Zeitlang, manche von ihnen standsicher auf einem Bein, immer jedoch wachsam.
Vor dem Krieg hatte Carolyn als Einkäuferin für Macy’s, das große Versandhaus in den USA, gearbeitet. Dabei hatte sie auf verschiedenen Kontinenten zu tun gehabt und mit der Zeit eine eher nüchterne Einstellung zum Reisen gewonnen. Nach einer Seereise jedoch war das Einlaufen in einen Hafen für sie immer noch ein besonderer und erwartungsvoller Moment geblieben.
Dieses Mal jedoch mischte sich bei ihr in die gehobene Stimmung auch leise Besorgnis. Würde Helen, eine Krankenschwester vom 41. Feldlazarett und ihre Freundin, sie hier vom Hafen abholen können? So hatten sie es zwar in einem Telefongespräch vereinbart, aber nun kamen ihr Zweifel. Konnte Helen sie vor Einbruch der Dunkelheit in diesem Chaos überhaupt noch finden? Und woher, um alles in der Welt, woher konnte sie überhaupt wissen, wo und wann die Lincoln anlegte? Was, wenn sie sich verfehlten? Wie sollte sie in dieser verlassenen Ruinenstadt, in diesem Trümmerhaufen, in den Bizerta verwandelt worden war, bei einbrechender Nacht eine Unterkunft finden? Wie es schien, hatten sie einen alles andere als idealen Treffpunkt vereinbart. Und hatten sie denn die näheren Umstände ihres Treffens überhaupt genau genug abgesprochen? Nicht einmal darin war sich Carolyn mehr sicher. Von einem markanten Treffpunkt war in ihrem hastigen Telefongespräch jedenfalls nicht die Rede gewesen. Sie seufzte und musste einen inneren Widerstand überwinden, um ihren sicheren Platz auf dem Lazarettschiff aufzugeben und in dieses Gewühlt dort unten einzutauchen.
Aber nachdem sie die Lincoln verlassen hatte und auf dem Pier stand, war sie doch angenehm überrascht und erleichtert, wie einfach und schnell alles geklappt hatte. Zwei Krankenpfleger stritten sich fast darum, ihr Gepäck vom Schiff über die Gangway an Land tragen zu dürfen und ihr im Gedränge etwas Platz zu schaffen. Carolyn musste sich nur um den kleinen schwarzen Koffer mit ihrer Schreibmaschine kümmern, den hatte sie natürlich nicht aus der Hand gegeben. Als sie wieder festen Boden unter den Füßen hatte und sich in dem Trubel um sie herum zu orientieren versuchte, war sie schon zuversichtlicher. Sie stellte ihr Sachen ab und schob sicherheitshalber die Underwood noch ein bisschen näher an den ausgebauchten großen Segeltuchkoffer mit seinen zwei verblichenen roten Querstreifen heran.
Gerade als sie im Begriff war sich aufzurichten, hörte sie auch schon Helen, die laut ihren Namen rief und mit ihrer klaren Stimme den Lärm um sie herum mühelos übertönte. Während sie sich von der Reling herab noch in dem Gewimmel von Fahrzeugen und Menschen unter ihr zu orientieren versucht hatte, hatte ihre Freundin sie bereits entdeckt. Über das ganze Gesicht strahlend und winkend und mit ihrem auf ihre störrischen blonden Locken nach hinten gerückten unvermeidliche Schiffchen kam sie durch das Gewirr von Menschen und Kisten auf Carolyn zu: Helen Schaefer aus dem jetzt so fernen Illinois, die der Krieg zum 41. General Hospital verschlagen hatte und mit der sie eine Freundschaft verband, seit sie die junge Krankenschwester im Herbst bei der Errichtung des Feldkrankenhauses bei Bizerta eine Woche lang Tag für Tag bei deren Arbeit begleitet hatte.
Carolyn hatte damals an einem großen Bericht gearbeitet, einer Reportage, die von all den Schwierigkeiten handeln sollte, mit denen die Krankenschwestern, Ärzte, Pfleger und die Bautruppen zu kämpfen hatten, bis sie auf irgendeinem gottverlassenen, kahlen Hügel auf der anderen Seite des Atlantiks, in Nordafrika, endlich ein funktionierendes Feldhospital eröffnen konnten. Sie hatte die Idee gehabt, diesen Bericht in Form eines bebilderten Tagebuchs zu verfassen. Stellvertretend für das ganze Team sollte in dessen Mittelpunkt eine klar umrissene, sympathische Person stehen. So hätten ihre Leserinnen und Leser die Möglichkeit, die sympathische junge Krankenschwester Helen Schaefer eine Woche lang bei ihren verschiedenen Arbeiten zu begleiten und all die unvermeidlichen kleinen und großen Triumphe und Rückschläge mitzuerleben, die mit ihrer täglichen Arbeit in so einem Field Hospital verbunden waren. Auf diese Weise, hoffte sie, würden die Menschen in den Staaten besser verstehen, was Tag für Tag im Schatten der großen weltbewegenden Nachrichten, abseits des Kriegsschauplatzes an kleinen Heldentaten vollbracht wurde. Den krönenden Abschluss schließlich sollte die Aufnahme des ersten Kranken in das neu errichtete Feldhospital bilden. Dass dann gerade dieser Soldat nicht mit irgendeiner dramatischen Verwundung eingeliefert wurde, sondern nur an der verbreitet grassierenden Diarrhö litt, nahm der Sache leider etwas von ihrem Glanz, machte dafür jedoch das Ganze doch auch wieder realistischer. Es waren ja gerade diese und andere Infektionen bis hin zu den verbreiteten Geschlechtskrankheiten – dieses ein wenig heikle Thema allerdings sparte sie in ihren Berichten für ihre Leserinnen und Leser in den Staaten dann doch lieber aus – obwohl es ein ernsthaftes Problem war, mit dem sich die Truppe und das Sanitätspersonal tagtäglich herumzuschlagen hatten.
Obwohl Helen stolz gewesen war, in dieser Story die Rolle der Hauptperson zu spielen, verfolgte sie das Tun der ARC-Korrespondentin an ihrer Seite in den ersten Tagen trotzdem mit leisem Argwohn. Ob es denn wirklich nötig sei, wollte sie wissen, auch über die Pannen, die Provisorien und die vielen Notbehelfe zu schreiben, mit denen sie in der Anfangsphase des Aufbaus zu kämpfen hatten? Würde das bei den Lesern zu Hause nicht einen falschen Eindruck davon vermitteln, was sie hier wirklich taten? Besonders für Fachleute stünden sie womöglich wie Stümper da, wenn die läsen, mit welchen einfachen Mitteln sie sich hier manchmal behelfen und improvisieren mussten.
„Also das solltest du vielleicht besser nicht bringen“, schlug sie Carolyn dann halb im Spaß vor oder riet ihr: „Hör mal, das ist doch nicht so wichtig, könnte man das nicht auch einfach weglassen?“ Und so ganz nebenbei war sie außerdem besorgt, dass die manchmal unfeine oder schlechte Ausdrucksweise, die ringsum Tag für Tag gang und gäbe war und der auch sie sich ein wenig angepasst hatte, in den Texten, die ihre Freundin verfasste, allzu wörtlich auftauchen könnte. Das hatte vielleicht mit ihrem religiösen Hintergrund zu tun, mit der methodistischen Erziehung, die sie in ihrer Jugend genossen hatte. Das vermutete Carolyn jedenfalls. „Schreib das bloß nicht wortwörtlich in deine Geschichte rein, hörst du? Das ist zu drastisch. Schreib’s doch irgendwie anders, na, du weißt schon, eben besser. Du weißt doch, wie ich es wirklich gemeint habe!“, wandte sie hier und da ein. Aber den meisten dieser Zensurversuche, wie sie Helens Einwände lachend übertrieben nannte, hatte Carolyn tapfer widerstanden. Letzten Endes war es auch gar nicht so schwer, ihre Freundin davon überzeugen, dass die Leser zu Hause in den Staaten bestimmt Verständnis dafür haben würden, dass man sich beim Errichten eines Field Hospitals mit über tausend Betten am Ende der Welt, dazu noch in einem Krieg, einfach nicht immer gesittet oder damenhaft ausdrücken konnte. Im Gegenteil, gerade eine ungekämmte und ehrliche Sprache würde die Leute zu Hause am ehesten ansprechen. Die meisten von ihnen redeten ja wohl selber auch gerade so, wie ihnen der Schnabel gewachsen war. Das hatte die junge Krankenschwester schließlich überzeugt.
Dass die Lazarettleitung der ARC-Berichterstatterin Carolyn Chandler für die Zeit ihres Aufenthalts beim 41. General Hospital ausgerechnet die viel jüngere Krankenschwester Helen Schaefer als ständige Begleitperson zugewiesen hatte, war ein Zufall gewesen. Aber die beiden hatten recht schnell Sympathie für einander empfunden.
Helen stammte aus Bloomington, Illinois. Sie war die Älteste von drei Geschwistern und hatte nach ihrem Highschool-Abschluss eine Schwesternschule besucht und sich nach dem erfolgreichen Ende ihrer Ausbildung zum Dienst in einem US-Feldhospital beworben. Für sie war es selbstverständlich, dass sie jetzt, wo ihr Land sich im Krieg befand, mit ihren Fähigkeiten in den Streitkräften gebraucht wurde. Wenn alles vorbei war, würde sie mit all den Erfahrungen, die sie bei der praktischen Arbeit gemacht hatte, Medizin studieren und Chirurgin werden. Das stand für sie fest. Der Krieg wäre ja bestimmt bald vorbei, und mit 24 oder 25 Jahren war sie ja noch längst nicht zu alt für ein Studium. Dass sie bei ihrer praktischen Arbeit schon viel dazugelernt hatte, würde sie sich durch die Army bestätigen lassen. Der fehlende College-Abschluss war da doch bestimmt kein Problem.
„Wenn man mit all dem hier klargekommen ist, da packt man doch das College und später die Universität bestimmt mit links, oder?“ Da war Carolyn ganz ihrer Meinung und hatte sie in ihren Zukunftsplänen bestärkt. Denn sie war überzeugt, dass Helen klug war, und konnte sich die junge Frau mit ihrer zupackenden und optimistischen Art sehr gut in dem Beruf einer Ärztin vorstellen. Lachend, aber doch auch halb ernsthaft, hatte sie ihr versprochen, drüben in den Staaten ihre beste Patientin werden zu wollen.
Und so hatte die ARC-Korrespondentin Carolyn Chandler den Aufbau des 41. General Hospitals, das ein paar Meilen südlich von Bizerta eingerichtet wurde, sozusagen vom ersten Spatenstich an begleitet. Anfangs hatte es an vielem gefehlt, sogar an Sitzgelegenheiten. Wie allen anderen auch war den beiden nichts anderes übrig geblieben, als ihren kargen „Mampf“ (Originalton Helen) – er bestand anfangs nur aus dem, was die K-Rationen, die „K-rats“ (wieder Helen) hergaben – mit „plattem Hintern“ (nochmal Helen) im Freien auf dem Boden sitzend zu sich zu nehmen. Und in den ersten Nächten, noch bevor die Unterkünfte standen, lagen sie damals in ihren Schlafsäcken am Hang eines Hügels unter freiem Himmel und rauchten vor dem Einschlafen immer noch mal eine „letzte“ Chesterfield, selbstverständlich nur wegen der Moskitos, wie sie sich gegenseitig versicherten. Und während sie schweigend rauchten, bewunderten sie abwechselnd die unglaublichen Massen flimmernder Sterne am Nachthimmel über ihnen und die samtschwarze, schwach glitzernde Fläche des Sees von Bizerta, der sich vom Fuß der Anhöhe, auf der sie lagen, nach Osten hin ausdehnte. Irgendwann hatten sie es aufgegeben, in dem unglaublichen Gedränge der funkelnden Lichter dort oben die vertrauten Sternbilder ihrer Heimat wiederzuentdecken. Wie sollte das auch möglich sein? Es war doch klar, dass hier in Afrika, so weit weg von zu Hause, auch die Sternbilder fremd sein mussten.
Das war in den ersten Septemberwochen des Jahres 1943 gewesen, und auf dem Flugfeld von Sidi Ahmed auf der Ebene zwischen dem Seeufer und dem Fuß des Höhenzugs, der sich zur Stadt hinzog, starteten und landeten damals bis spät in die Nacht hinein die Bombenflugzeuge und Transportmaschinen der Alliierten, die die Landung der Truppen bei Salerno oder sonst irgendwo auf dem „Stiefel“ (wieder Helen) unterstützten. Damals hatte sie das auf- und abschwellende Motorengeräusch der startenden und landenden Flugzeuge bis in den Schlaf hinein verfolgt. Aber daran konnte man sich schließlich irgendwie gewöhnen, und außerdem waren sie von der Plackerei tagsüber einfach zu müde, um sich davon lange gestört zu fühlen.
Die Tage auf dem Höhenzug über dem See von Bizerta, dessen östliches Ufer bei Tageslicht nur als feiner Strich über der schimmernden Fläche auszumachen war, waren heiß und staubig, und Trinkwasser war eine rationierte Kostbarkeit. Es musste in Tankwagen von weither geholt werden, war lauwarm und roch selbstverständlich stark nach Chlor. Der dunkle Tankwagen, der alle paar Tage das kostbare Nass über die Piste den Hang heranschaffte, wurde jedes Mal mit Erleichterung begrüßt.
Carolyn hatte sich während ihres Aufenthalts beim 41. Feldlazarett von Anfang an nicht auf die Rolle einer passiven Beobachterin beschränkt, sondern sich soweit wie möglich an allen Arbeiten, die anfielen, beteiligt. Nachdem sie sich abends so gut es ging erfrischt und gegessen hatte, suchte sie sich mit ihrer Underwood abseits von den anderen in einem der fertiggestellten Feldhäuser ein Plätzchen, wo sie bei behelfsmäßiger Beleuchtung an ihrer Story arbeiten konnte. Für sie war das weniger eine Arbeit sondern vielmehr ein willkommener Ausgleich zu den ungewohnten körperlich anstrengenden Tätigkeiten während des Tages.
Es gefiel ihr, die Menschen, von denen ihre Texte handelten, mal behutsam und detailliert zu schildern, dann aber auch wieder herzhaft zu typisieren. Sie sollten für die Leser als Personen sozusagen greifbar und zu Charakteren werden, wie sie ihnen täglich auch auf ihrem Weg zur Arbeit oder in der Nachbarschaft begegnen konnten. Vieles von dem, was die Leute drüben in den Staaten über den Krieg lasen und hörten, war ja schon kompliziert und verwirrend genug. Umso mehr liebte man dann an den GI-Joes und den WAC-Mädels, den Frauen vom Women’s Army Corps, über die Carolyn schrieb, deren einfache Geradlinigkeit oder den Humor, mit dem sie auch in nicht alltäglichen Situationen zurechtkamen. Außerdem versuchte sie trotz des ernsten Hintergrunds, den alle ihre Berichte und Stories aus dem Kriegsgebiet natürlich hatten, den Akteuren einen möglichst optimistischen Zug zu geben. Deshalb streute sie in ihre Texte heitere Episoden ein und lockerte ihre Geschichten mit kurzen Dialogen und manchmal sogar mit kleinen, witzigen Skizzen auf den freien Seitenrändern auf, die sie ihren Geschichten ein wenig ungelenk und aus dem Stegreif beigab.
Es war klar gewesen, dass sie eine Arbeitsuniform brauchen würde, und so hatte man ihr auf der Kleiderkammer gleich nach ihrer Ankunft eine mattgrüne Feldbluse und eine ebensolche Arbeitshose samt einer abgegriffenen Feldmütze mit einem großen, gekrümmten Schild ausgehändigt. Nur waren die Sachen für sie in passender Größe einfach nicht aufzutreiben gewesen. Es schien, dass sie für die Army einfach zu zierlich gebaut war, und so saßen die Kleidungsstücke ein wenig luftig an ihr. Aber was machte das schon! Wichtiger war doch, dass sie, wenn auch nur eine Zeitlang, nach außen hin als ein Teil des Teams auftrat. Und so hatte sie die Sachen, so wie sie waren, während ihrer Zeit beim 41. Gen. Hospital gerne getragen.
Während der ersten Tage wuschen Helen und sie ihre persönliche Kleinwäsche in einem Stahlhelm, den ein erfinderischer Mensch umgedreht auf einem wackeligen Dreibein befestigt hatte. Danach mussten sie ein abgeschirmtes Plätzchen finden, an dem sie und die anderen Frauen des Teams eine Leine spannen und ihre Wäsche aufhängen konnten. Denn die armen Kerle um sie herum sollten ja nicht unnötig in Verlegenheit gebracht werden, war man sich in geheuchelter Fürsorglichkeit einig. Doch das hinderte sie nicht daran, während der Arbeiten oder in den Pausen dazwischen immer wieder mal halblaut freundliche Respektlosigkeiten über die sie umgebende Männerwelt und deren gelegentliche Merkwürdigkeiten auszutauschen.
Dann wieder kämpften sie Seite an Seite entnervt gegen die Schwärme der aufdringlichen Fliegen an, mit denen sie sich manchmal um jeden Bissen streiten mussten, den sie in den Mund stecken wollten. Und immer wieder hatten sie ihre letzten Zigaretten miteinander geteilt, die sie nach sorgfältigem Suchen doch noch in einer der vielen tiefen Taschen ihrer Arbeitsanzüge entdeckten.
Als sie einmal gegen Ende ihres Aufenthalts beim General Hospital 41 Helen, die sonst so gerne lachte, mit geröteten Augen hinter der Waschbaracke entdeckte, in ihrer rechten Hand einen Brief, dem man ansah, dass er schon einmal zerknüllt und dann wieder glattgestrichen worden war, hatte Carolyn sich einfach neben sie gesetzt und die jüngere Frau eine Weile wortlos in den Arm genommen. Die hatte über den Inhalt des Briefes nicht reden wollen, aber allein Carolyns Anwesenheit und ihre verständnisvolle Geste halfen schon. Denn als Helen nach einer Weile aufstand, sich mit dem Handrücken die Tränen von den Wangen gewischt und ihr Schiffchen zurechtgerückt hatte, blieb sie, bevor sie um die Ecke des Feldhauses verschwand, noch einmal stehen, drehte sich zu Carolyn um und lächelte ihr zu.
Und jetzt also kam Helen strahlend auf ihre Freundin zu, und gleich darauf lagen sie sich lachend in den Armen.
„Carolyn, ach Carol, wie freu’ ich mich, dass du kommen konntest! Wie schön, dass es geklappt hat und wir uns noch einmal sehen können! Stell dir mal vor, du kommst gerade noch rechtzeitig! Wir sind ja fast schon drüben in Italien! Ein paar Tage später und wir hätten uns glatt verpasst! Als ich gehört habe, dass du kommst, war es für mich klar, dass ich dein Empfangskomitee sein würde.“ Und etwas ernster: „Schade nur, dass du uns eigentlich nie bei unserer richtigen Arbeit erlebt hast. Es ist aber auch wie verhext! Immer erwischst du uns im vollem Durcheinander. Damals warst du beim Aufbau dabei und jetzt wieder beim Abbau! Aber ob du es nun glaubst oder nicht, wir haben in der Zwischenzeit tatsächlich auch ein paar Verwundete zusammengeflickt und Kranke geheilt – und nicht mal wenige, kann ich dir sagen. Das 41. hat sich auf Kopf- und Rückgratverletzungen spezialisiert, weißt du“, fügte sie ernst hinzu. „Schlimme Sachen waren dabei, das kann ich dir sagen, schlimme Sachen.“ Beide schwiegen eine Weile.
„Tja, es sieht wirklich ganz so aus, als ob das unser Schicksal ist, Helen“, antwortete Carolyn. „In Italien wird es uns bestimmt genauso ergehen“, griff sie den Faden auf. „Denn wenn wir uns demnächst vielleicht in Neapel wiedersehen, werdet ihr euch da ja auch erst mal wieder neu einrichten müssen, oder?“
„Ach wo, Carol, in Neapel packen wir gar nicht erst aus! Wir sollen doch gleich weiter nach Norden verlegt werden. Offiziell wissen wir davon noch nichts, aber es ist ein offenes Geheimnis, dass das 41. in Rom eingesetzt wird. Wir hängen hier abwechselnd in jeder freien Minute am Radio, und es sieht so aus, als ob es in Anzio endlich bald weitergehen wird. Na und dann kann es nur noch Tage dauern, bis die Deutschen auch aus Rom ‘rausfliegen.“ Helen war von dieser Aussicht regelrecht begeistert. „Man sagt, Rom soll die schönste Stadt der Welt sein. Ach, Carol, ich bin ja so gespannt! Und überhaupt – Italien!“, setzte sie ein wenig schwärmerisch hinzu.
Nun ja, es war eben alles in Bewegung. Wenn schon nicht in Neapel, würde man sich eben in Rom wiedersehen. Was machte das für einen Unterschied?
Dass Carolyn Chandler noch einmal beim 41. Feldhospital aufgetaucht war, hatte allerdings nicht nur mit ihrer Anhänglichkeit zu tun, sondern seinen ganz praktischen Grund auch darin, dass es von hier nur ein Katzensprung zum Flugplatz Sidi Ahmed unten am See von Bizerta war. Und von dort wiederum war es nur ein Hüpfer nach Italien. Ein freier Platz in einer Militärmaschine nach Neapel oder nach Korsika, einer Zwischenstation sozusagen, würde hier einfach zu bekommen sein. Dass sich ihr Reiseplan außerdem noch mit einem Besuch bei ihren Freunden und vor allem mit einem Treffen mit Helen verbinden ließ, freute sie natürlich besonders.
Während sie Carolyns Gepäck zu Helens Wagen trugen, berichtete sie weiter, dass das General Hospital fast schon komplett aufgelöst und nach Neapel verlegt worden sei. Bis auf eine kleine Nachhut, die aus wenigen Schwestern und Ärzten sowie einigen abkommandierten GIs bestand, die ihnen bei den Abbauarbeiten zur Hand gingen, befand sich das gesamte Personal schon drüben, in Italien.
Dass gerade Helen sie vom Hafen abholte, freute Carolyn wirklich besonders. Seit sie vor einem Jahr damit begonnen hatte, ihre Berichte in die Heimat zu schicken, war sie einer Vielzahl von Menschen begegnet. Meist war sie mit ihnen nur dienstlich, manchmal aber auch menschlich in einen lockeren oder engeren Kontakt getreten, bevor man sich wieder aus den Augen verlor. Immer wieder transportierte sie ihre wenigen Habseligkeiten, ihren kleinen Haushalt, wie sie es nannte, von einem Ort zum nächsten, packte ihren Koffer mal aus und verstaute ihre Sachen bald darauf wieder – nur um irgendwo anders dasselbe Spiel zu wiederholen. Bei diesem manchmal turbulenten Leben war es für sie besonders wichtig, in dieser jungen Frau aus Illinois eine Freundin gefunden zu haben.
Ganz neu war das alles für sie ja nicht gewesen. In ihrem Beruf als Einkäuferin für Macy’s hatte sie sich bereits vor dem Krieg an das Reisen gewöhnt, doch mit ihrer jetzigen Situation ließ sich die frühere, etwas bequemere und ruhigere Tätigkeit in Friedenszeiten doch nicht so recht vergleichen. Mit den Belastungen und Einschränkungen, die der Krieg sowieso schon mit sich brachte, hatte sie einigermaßen umzugehen gelernt. Nur waren mit den häufigen, manchmal schnell aufeinander folgenden Ortswechseln ja auch ständig wechselnde menschliche Kontakte verbunden, und das unablässige Auftauchen und Verschwinden neuer Gesichter ließ sie manchmal mit einem Gefühl der Einsamkeit zurück.
Dazu kamen die unvermeidlichen kleineren oder größeren Pannen und Unvorhersehbarkeiten, wie sie in einem Krieg auch hinter der eigentlichen Front normal waren, und auf die oft auch wieder überraschende, glückliche Wendungen folgen konnten. Solche seelischen Wechselbäder hatte sie zu Beginn ihrer Korrespondententätigkeit noch als aufregend und belebend empfunden. Doch seit einiger Zeit spürte sie immer mehr, wie solche Turbulenzen, je nach der Tagesform, in der sie sich befand, sie mal mehr, mal weniger belasteten. Zustände innerer Angespanntheit wechselten mit Müdigkeit ab. Auch beobachtete sie an sich manchmal eine scheinbar grundlose, gesteigerte Nervosität und unvermittelt auftretendes Kopfweh. Alles das und auch die Wetterfühligkeit, unter der sie früher eigentlich nie gelitten hatte, führte sie auf die unsteten, unvorhersehbaren Situationen und Wechselfälle zurück, die nun schon seit längerer Zeit ihr Leben bestimmten.
Dazu kam das ungewohnte Klima. Auf Tage voller Gluthitze konnten im Sommer Tage folgen, an denen sich der Libecciu zu regelrechten Staubstürmen auswuchs und unablässig an den Nerven zerrte. Dann wieder konnten in manchen Nächten weiter im Landesinneren die Temperaturen bis in die Nähe des Gefrierpunktes fallen.
Im letzten Herbst hatte sie erlebt, wie schier endloser Regen manche der trostlosen, graubraunen Küstenregionen in Algerien und Tunesien in unpassierbare Sümpfe verwandelte. Lastwagen waren bis zu den Achsen im Schlamm stecken geblieben und in manchen Feldhospitälern konnten Ärzte und Schwestern nur auf Umwegen oder auf unsicheren, schwankenden Bretterstegen in die Krankenreviere gelangen. Carolyn hatte mit Schrecken erlebt, wie in den Herbst- und Wintermonaten solche sintflutartigen Wolkenbrüche die Trockentäler des Atlasgebirges im Handumdrehen in reißende Ströme verwandelten, die Schotterpisten samt Fahrzeugen mit sich rissen.
Doch tapfer hatte sie sich vorgenommen, sich wegen all dieser kleinen und größeren Katastrophen nicht allzu viele Gedanken zu machen. Solange sie hier war, ließ sich daran sowieso nichts ändern, und im Vergleich zu dem, was viele der Einheimischen um sie herum ihr Leben lang zu ertragen und zu erleiden hatten, ging es ihr ja immer noch gut. Sie hätte es für taktlos und beschämend gehalten, über ihre eigenen Befindlichkeiten allzu viele Worte zu verlieren. Stattdessen bemühte sie sich, diese Unannehmlichkeiten, die ihr manchmal mehr, dann wieder weniger zu schaffen machten, wie einen ständig im Hintergrund mitlaufenden, störenden Dauerton hinzunehmen, an den man sich einfach gewöhnen musste. Mit ein wenig Glück gelang es ihr, den für eine Weile zu überhören. Ein, zwei Zigaretten und ein Kaffee, manchmal auch ein Gespräch konnten da schon ein wenig helfen. Und für hartnäckigere Fälle hatte sie immer einen Vorrat an Aspirin griffbereit.
Während die beiden Frauen sich auf dem Pier im Hafen von Bizerta unterhielten, hatten sie zusammen den schweren Koffer und den Rest von Carolyns Gepäck zu Helens Dodge getragen. Auf der Schutzplane, die von der Ladefläche bis über das Führerhaus des kleinen Lastwagens gespannt war, prangte auf dem Dach und an den Seiten groß das aufgemalte rote Kreuz im weißen Kreis. Doch unter der dicken, graugelben Staubschicht, die es überzog, war es allerdings kaum noch zu erkennen.
„Na dann los, wie damals!“, rief Helen, als sie auf „eins und zwei und drei!“ das schwerste Gepäckstück, den großen Segeltuchkoffer, mit Schwung gekonnt auf die Ladefläche hievten. Dann schwang sie sich geübt auf den Fahrersitz ihres türlosen Gefährts, ließ ihre Hände auf dem großen Lenkrad ruhen und beobachtete lächelnd ihre Freundin beim Einsteigen. Und es war auch wirklich sehenswert, wie Carolyn ein wenig umständlich nacheinander zuerst ihr schwarzes Schreibmaschinenköfferchen, danach ihre Musette-Bag und ganz zuletzt die lederne Handtasche sorgfältig im engen Fußraum des Fahrzeugs verstaute. Erst dann erklomm sie den Beifahrersitz und strich mit einer flinken Bewegung den Rock unter sich glatt, bevor sie sich hinsetzte. Und dann holte sie zu guter Letzt ihre lederne Handtasche doch wieder aus dem Fußraum unter sich hervor und stellte sie auf ihrem Schoß ab.