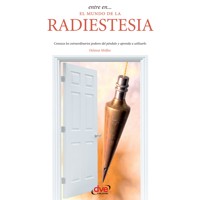Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als der junge Rottenführer Franz Seiler im Sommer 1943 mit einem geheimen Einsatzkommando der SS nach Korsika kommt, hat er nach seinen Erlebnissen an der Ostfront und in Tunesien alle Illusionen über den Krieg verloren und innerlich bereits mit dem Nationalsozialismus gebrochen. Da der Auslandsnachrichtendienst in Berlin dem italienischen Achsenpartner und Besatzer Korsikas zunehmend misstraut, soll eine in Zivil und mit falschen Papieren eingeschleuste SS-Einheit angesichts der drohenden Landung der Alliierten die Übernahme der Insel durch das Deutsche Reich vorbereiten oder für den Fall des Misslingens wenigstens korsische Kollaborateure für den Aufbau einer Fünften Kolonne gewinnen. Franz Seiler fällt die Aufgabe zu, seine Vorgesetzten in einem Citroën Traction Avant bei ihren Erkundungen kreuz und quer über die Insel zu fahren und das Fahrzeug einsatzbereit zu halten. Die Fahrten durch die atemberaubenden Landschaften der Mittelmeerinsel und die Beschäftigung mit dem beeindruckenden Fahrzeug lassen Franz' Absicht zu desertieren mehr und mehr in den Hintergrund treten. Als dann jedoch der Rommelschatz, das den Juden Tunesiens geraubte Gold, ins Spiel kommt, gerät Franz Seiler in tödliche Gefahr und wird zur Entscheidung gezwungen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1406
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Judith, Gabi und Dan
Inhaltsverzeichnis
Julien, Montagne de Cagna, 9. Mai 1944
Franz, 4. Juli 1943
Walther Graff, Grosseto, 6. Juli 1943
Weinhandel „Maison Alain Schmitt et Frères“
Fabianis Haus, 11. Juli 1943
Porto Vecchio, 12. Juli 1943
Im Wald, Juli / August 1943
Gedankenspiele – Nerven I
Nerven II
Asco
Signore Borletti, 28. Juli 1943
Quenza, Anfang August 1943
Dr. Miese
Unter Schraubern
Ajaccio
Letzter Einsatz
Turm und Äpfel
Kreuzpeilung und Blitze
Epilog
JULIEN, MONTAGNE DE CAGNA, 9. MAI 1944
Julien konnte die Stimmen der Schäfer schon hören, noch während er sich an der Quelle unterhalb Naseos erfrischte. Sie drangen durch den Wald bis zu ihm herab und er schloss aus ihren Rufen und ihrem Gelächter, dass sie gerade angekommen sein mussten und nun dabei waren, ihre Maulesel zu entladen. Er war am frühen Vormittag von San Gavino aus aufgebrochen und hatte jetzt, am Nachmittag, den größten Teil der Wegstrecke zurückgelegt, die er sich vorgenommen hatte. Die Berge waren ihm von klein auf vertraut, und so hätten ihm die wenigen Stunden des Anstiegs keine Schwierigkeiten bereitet. Doch an diesem Tag hatte Julien schon nach kurzer Zeit gespürt, dass sich ein Wetterumschwung anbahnte und beschlossen, sich beim Anstieg nach Naseo Zeit zu lassen.
Bald nach seinem Aufbruch vom Haus seiner Schwester war vom Meer her eine schleierartige Bewölkung aufgezogen. Sie bedeckte von Südwesten her nach und nach den ganzen Himmel, und obwohl das Licht der Sonne sich eintrübte, schien es in der diesig werdenden Luft doch mehr zu blenden als sonst. Zwar verlief der Weg die meiste Zeit durch den Wald, der den Osthang des Vivaggio-Tales bedeckte, doch unter dem Dach, das die Kronen der Pinien über dem Pfad bildeten, stand die Luft still und so hatte die dumpfe Hitze im Laufe des Tages ständig zugenommen. Der schwache Südwestwind, der ab den Mittagsstunden aufgekommen war, hatte keine Erleichterung gebracht, vielmehr hatte die Feuchtigkeit, die er vom Meer her mitbrachte, die Hitze im Gegenteil sogar noch drückender werden lassen.
Nun, wo der Nachmittag schon vorangeschritten war, und er nicht mehr weit zu gehen haben würde, beschloss Julien, auf der steinernen Einfassung, die die Quelle von drei Seiten wie ein Becken umgab, noch ein Weilchen sitzen zu bleiben und sich auszuruhen. Nachdem er seinen Durst gestillt hatte, verlor er sich, wie es seine Gewohnheit war, in den Anblick des fließenden Wassers. Es trat sanft bewegt als glitzerndes Rinnsal aus einer Spalte zwischen zwei gerundeten Steinen hervor, sammelte sich in einer handtellergroßen, flachen Vertiefung, die jemand irgendwann in den Fels geschlagen hatte und lief über dessen bemooste Kante in ein größeres, natürliches Becken ab. Von dort suchte es sich zwischen kräftigen dunkelgrünen Stängeln der Wasserminze und über Granitschotter seinen Weg talabwärts.
Julien atmete auf. Versunken in die Betrachtung der unaufhörlich und gleichförmig aus dem Felsen tretenden, klaren Flüssigkeit genoss er die Kühle, die zu ihm vom Wasser her aufstieg und ihn die Anstrengung des Anstiegs vergessen ließ. Zusammen mit der kühleren Luft des kleinen Gewässers verbreitete die Minze ihren erfrischenden Duft, und während er reglos und mit leerem Blick dem gleichförmigen Plätschern lauschte, mit dem der dünne Wasserstrahl in den klaren Tümpel am Fuß des Steins eintauchte, verlor Julien das Gefühl für das Verstreichen der Zeit.
Als er sich später wieder erhob, war ihm, als ob er wieder zu sich käme. Es fiel ihm schwer sich von diesem Ort zu trennen und die letzten hundert Meter Wegs durch den Wald bergauf zu gehen, dorthin, von wo immer noch die Rufe und das Gelächter der Männer zu hören waren. Er hatte es nicht besonders eilig, mit ihnen zusammenzutreffen. Sicher, freundlich waren sie und sie stellten ihm meist auch die gleichen harmlosen Fragen, auf die er ausweichende oder nichtssagende Antworten geben konnte. Aber manchmal passierte es ihm dennoch, dass er ihnen eine Antwort schuldig bleiben musste. Das machte ihn dann verlegen. Und auch bei ihren gut gemeinten, unbeholfenen Scherzen gelang es ihm nicht immer mitzulachen.
Nach dem kurzen Aufstieg trat er aus dem Schatten der Bäume auf die kleine, ebene Fläche, die eine Art Vorplatz vor dem eigentlichen Zugang zu dem kleinen Dorf Naseo bildete, dessen niedrige Steinhäuser und die grob ummauerte Marienstatue wie zufällig und in großen Abständen voneinander über die freie Hangfläche verstreut waren.
Anfangs bemerkte ihn keiner der vier Schäfer. Bis auf eines hatten sie die Tiere schon von ihren Lasten befreit und die mitgebrachten Vorräte – Sättel, Körbe, Kästen und Bettrollen – vor einer der Steinhütten aufgehäuft. Und während die anderen Maulesel schon auf den Grasflächen zwischen den Häusern des Sommerdorfes grasten, waren die Männer vollauf damit beschäftigt, das letzte, widerspenstige Maultier an den Zügeln niederzuhalten und zu beruhigen, während sie gleichzeitig seinen Huftritten auszuweichen versuchten. Bei dem Tier hatten sich die Befestigungsriemen des Packsattels gelockert, sodass sich das hölzerne Gestell samt seiner Last nach einer Seite hin verschoben hatte und zu kippen drohte.
„Wir bekommen Besuch, seht doch mal, wer da kommt!“, rief der erste, der ihn erblickte. „Es ist Julien!“ Und zu Julien, der sich gebückt hatte und den Hunden, die freudig bellend auf ihn zu gestürmt waren, den Nacken kraulte: „Hör mal Julien, du kommst gerade rechtzeitig, um uns ein wenig zu helfen! Du siehst ja, dieses störrische Biest hat der Libecciu, dieser verdammte Wind, völlig verrückt gemacht!“ – „Na hör mal, Jean-Claude, wo denkst du hin?“, lachte ein anderer. „Siehst du denn nicht, dass Jules im Dienst ist? Er ist bewaffnet, er macht seinen Streifengang durch die Montagne!“ Allgemeines, beifälliges Gelächter. Doch ernst gemeint war der Hilferuf des ersten Schäfers auch nicht, der Umgang mit aufsässigen Vierbeinern gehörte für die Hirten schließlich zum Alltagsgeschäft und so gelang es ihnen bald, das Tier zu besänftigen.
Julien kannte jeden einzelnen von ihnen. Sie alle stammten aus Sotta, einem kleinen Ort in der Küstenebene, und waren hochgekommen um alles für den sommerlichen Aufenthalt mit ihren Herden vorzubereiten, mit denen sie die nächsten drei oder vier Monate hier oben verbringen würden. Bevor sie in ein paar Tagen ihre Familien und die Schafe aus der Ebene nachholten, verstauten sie die Vorräte an Mehl, Wein, Konserven und den anderen Dingen des alltäglichen Bedarfs in den Hütten.
Ohne ihre Arbeit für eine ausführlichere Begrüßung zu unterbrechen, machten die Männer sich daran, das schief hängende Packgestell zu entladen und Körbe, Säcke und Pakete zu den anderen Vorräten zu schaffen.
Julien war die gutmütigen Scherze der Männer gewohnt, und hatte nicht geantwortet, sondern nur verlegen vor sich hin gelächelt und den Trageriemen seiner Schrotflinte auf der Schulter zurechtgerückt. Die Schäfer erwarteten auch gar keine Reaktion von ihm. Sie kannten den hochgewachsenen Mann mit dem mächtigen dunklen Vollbart und seine merkwürdigen Gewohnheiten und waren daher nicht sonderlich überrascht, ihn hier oben anzutreffen. Ab und zu lief man sich eben über den Weg.
Julien Santini, Sohn der Santinis in Giannuccio, war in den Dörfern rund um die Montagne de Cagna, dem kleinen Gebirgszug im Süden Korsikas, eine vertraute Erscheinung. Mittelalt, etwas schlaksig und vornübergebeugt gehend, war er mit seinem vollen lockigen Haar, in das sich ein paar graue Strähnen mischten, so etwas wie ein Teil der Landschaft. Im Lauf der Jahre hatte man gelernt, mit seinen Merkwürdigkeiten umzugehen. Die Fragen nach dem Woher und Wohin beantwortete er meist freundlich, wenn auch ausweichend und mit einem vagen Achselzucken. Das war’s dann und damit gab man sich zufrieden. So war Jules eben, wie immer ohne ein bestimmtes Ziel, einfach nur irgendwohin unterwegs.
Während seine Gefährten sich mit dem Muli und letzten Vorräten auf den Weg zu den Steinhütten des Dorfes gemacht hatten, war der älteste der Hirten bei Julien zurückgeblieben. Noch schnaufend nach dem Gerangel mit dem Maultier nahm er seine Schirmmütze ab und trocknete mit einem grauen Sacktuch umständlich zuerst Stirn und Nacken, bevor er bedächtig daranging, auch das lederne Schweißband an der Innenseite seiner verstaubten Mütze trocken zu reiben.
„Also was ich noch sagen wollte, Jules“, wandte er sich jetzt in ernsterem Ton an Julien, „warum bleibst du eigentlich über Nacht nicht einfach hier bei uns? Du willst doch nicht etwa heute noch partout nach da oben, oder?“, und er machte eine Kopfbewegung in Richtung der Bergspitzen der Montagne de Cagna, von denen in dem Dunst, in den sie getaucht waren, nur noch schemenhafte Umrisse zu erkennen waren. „Sieh doch selbst, da braut sich ein schönes Mistwetter zusammen. Bleib besser hier und iss was mit uns. Und irgendein Strohsack für die Nacht findet sich sicher auch noch. Kannst morgen früh ja immer noch weiterziehen.“
Tatsächlich hatte sich der Himmel rundum schon stark bezogen und die ersten schweren Tropfen des einsetzenden Regens hinterließen zu Füßen der Männer kleine, dunkle Trichter im Staub. „Na und dann denk nur mal an deine Flinte, Jules! Ihre Läufe werden mit Regenwasser volllaufen und deine Munition, sag mal, Munition, die hast du doch wohl dabei, oder? Also deine Munition im Rucksack, die wird bestimmt auch nass, die kannst du anschließend wegwerfen.“ Doch ganz ernst waren die letzten Einwände des Alten wohl nicht gemeint, denn er hatte dabei geschmunzelt.
Doch Julien hielt nichts mehr zurück. Er begann unruhig zu werden. Es machte ihn nervös, dass der Alte nicht zu begreifen schien, dass er nicht bleiben konnte, dass er weitermusste. Nein, bei den Schäfern, in einer ihrer Hütten wollte er auf keinen Fall bleiben. Es hatte für ihn überhaupt nichts Verlockendes, den Rest des Tages und dazu noch den ganzen Abend mit den Männern zu verbringen, dicht an dicht mit ihnen um eine offene Feuerstelle zu hocken und sich die immer gleichen Gespräche über ihre Tiere, ihre Familien und den üblichen Dorfklatsch anzuhören. Denn diese immer gleichen Themen waren es nun einmal, um die es sich meist drehte. Julien wusste schon im Voraus, welchen Verlauf die Unterhaltungen nehmen würde.
Und sollte ihnen einmal der Gesprächsstoff ausgehen, würden sie sich bestimmt auf ihn besinnen, auf Jules, der da schweigend in ihrer Mitte saß. Dann würde einer von ihnen einen Scherz machen, sich vielleicht mit einer scheinbar ernst gemeinten Frage an ihn wenden oder sich nach seinen Erlebnissen erkundigen, nach seinem Woher und Wohin. Und egal, welche Antwort er darauf gäbe, die Runde würde alles, was er darauf antwortete, mit herablassend-freundlichem Interesse, mit Heiterkeit oder gar schallendem Gelächter quittieren. Nein, heute jedenfalls wollte er nicht der Quell für ihre einfachen Belustigungen sein. Er musste ja weiter, wollte für sich sein. Nur so konnte er ungestört mit sich Zwiesprache halten und mit seinen Gedanken ins Reine kommen.
Einfach war das sowieso niemals, denn selbst wenn er für sich allein war, fiel es ihm meist schon schwer genug, seiner Gedanken Herr zu werden, sie zu ordnen und zu lenken. Die kamen wie Fremde zu ihm und verließen ihn wieder, wann und wie sie wollten. Was sollte er da noch mit dem Gerede der anderen anfangen, mit dem die einfach so auf ihn eindrangen? Sie kamen ihm in die Quere und verwirrten ihn noch mehr.
Deshalb trieb es ihn trotz des Regens, der inzwischen eingesetzt hatte, weiter. Er freute sich auf den schmalen, ebenen Pfad, der gleich hinter Naseo begann und durch den Kiefernwald zum Col de Tonneri führte. Den liebte er besonders und freute sich darauf, auf den dicken Polstern von Kiefernnadeln seine Schritte federn zu lassen.
Als er einige Zeit später aus dem Wald wieder ins Freie hinaustrat, füllte das Regenwasser bereits die kleineren Mulden des nun steinigen Weges und floss in Rinnsalen und kleinen Kaskaden über die Flächen aus rötlichem Granit den Hang hinab. An den Stellen, an denen die letzten Regenfälle feinen Kies und Kiefernnadeln zu kleinen Staustufen zusammengeschoben hatten, begannen sich schon tiefere Pfützen zu bilden. Bald darauf hatte Julien den Pass von Tonneri erreicht.
Der Wind, der aus dem Tal schräg und böig von Südwesten herauffegte, ließ das Gebüsch auf der Passebene wild hin und her schwanken und fuhr Julien heftiger durchs Haar. Doch der merkte es nicht. Er war stehen geblieben, um eine Entscheidung zu treffen. Eigentlich hatte er in Richtung des Monte Tignoso weitergehen und zur Ebene von Ovace aufsteigen wollen. Doch so, wie das Wetter sich entwickelte, war das unmöglich. Dafür war der Weg einfach zu lang, auch zu steil und zu mühselig. Und was noch wichtiger war, beim Aufstieg über die offene Flanke des Monte Tignoso wäre er noch stärker Regen und Wind und vielleicht sogar den Blitzen eines Gewitters ausgesetzt. Doch nach Naseo umkehren und dort mit den Schäfern in deren Hütte die Nacht verbringen, wollte er auch nicht. Also beschloss er, dem Weg noch ein Stück weit bergauf durch den Wald in Richtung der Punta di Monaco zu folgen. Auf halben Weg gab es am Rand der großen Lichtung in der Nähe des Baches von Barba Porcata eine Hütte, die meistens leer stand. In ihr würde er für die Nacht Schutz finden. Am nächsten Morgen, wenn das Wetter sich beruhigt haben würde, konnte er von dort aus in ein paar Stunden immer noch über die Flanke des Monte Tignoso sein Ziel erreichen, die große Ebene am Fuß der Punta d’Ovace. Nachdem er diesen Entschluss gefasst hatte, tauchte er mit großen Schritten linker Hand in den heftig vom Wind bewegten Kiefernwald ein.
Hier boten ihm die dicht stehenden Bäume etwas Schutz vor Wind und Regen, und da der Pfad nicht zu verfehlen war, konnten sich seine Gedanken selbständig machen. Sie eilten ungeduldig davon, eilten schon die Strecke voraus, die am nächsten Morgen auf ihn wartete und kehrten mit vertrauten Bildern zu ihm zurück. Da war zuerst die große Lichtung, an deren oberem Rand er den Pfad wechseln musste. Der kreuzte kurz darauf einen kleinen Bach und danach eine sumpfige Fläche. Dieser Maultierpfad wurde seltener begangen, er stieg unvermittelt steil bergan und wand sich eine ganze Weile durch Wald und Gestrüpp, die aus dem Felsgewirr der unwegsamen Bastion von Baliri hervorwucherten. Hatte er das hinter sich, musste er sich nach rechts halten und einer Abzweigung in Richtung des abgeflachten Gipfels des Monte Tignoso folgen.
Auf diesem Teil des Anstiegs gab Stellen, an denen es nicht einfach war, den Pfad überhaupt noch zu erkennen. Immer wieder schien er unter umgestürzten Bäumen, im Felsengewirr oder üppig wucherndem Nieswurz und hüfthohen Farnen endgültig zu enden. Dann wieder war er streckenweise von einem Bachbett kaum zu unterscheiden. Und kurz bevor man es geschafft und endlich die Ebene erreicht hatte, war da noch, sozusagen als letzte Prüfung, der Arm eines Blockmeeres zu queren, das wie ein erstarrter Sturzbach von der Höhe der Ebene von Ovace talwärts herabströmte.
War dieses Gewirr aus wankenden Felsen und lauernden Spalten glücklich überwunden und die Kante zur Plaine d’Ovace überschritten, hatte das Steigen im unwegsamen Gelände ein Ende und man trat in einen uralten Tannenwald ein, in dessen Wipfeln an manchen Sommertagen das Brausen von Myriaden von Schwebfliegen wie eine unablässig dröhnende Glocke hing. Hatte man sich durch diese Dickung aus gestürzten oder vom Wind verdrehten Tannen und vermoderndem Totholz einen Pfad gebahnt, war man endgültig auf der freien Ebene angekommen und konnte aufatmen.
Jedes Mal, wenn Julien sein Ziel erreicht und all die Unannehmlichkeiten des Aufstiegs hinter sich hatte, blieb er ein Weilchen am Waldrand stehen. Und während er wieder zu Atem kam, ließ er seinen Blick über die freie Fläche schweifen, die nun vor ihm lag. Vor ihm und nach beiden Seiten hin erstreckte sich die Plaine d’Ovace wie ein gewundener See oder der weit geschwungene Bogen eines breiten Flusses, den eine schützende Mauer aus schroffen Türmen von Felsburgen und dichtem Wald rahmten. Frisches Gras und kleine Inseln blühenden Gebüschs bedeckten die stille Fläche, die sich jedes Mal wie unverhofft vor ihm öffnete.
Dieser Anblick war für Julien Santini Belohnung und Rätsel zugleich. Es waren nicht allein die unberührte Schönheit und Einsamkeit dieses unzugänglichen und menschenfernen Hochtals, die ihn immer wieder dorthin zogen. Es gab noch einen anderen, tiefer liegenden Grund für die Faszination, die es auf ihn ausübte. Das spürte Julien nur undeutlich und ahnte nur in besonderen Momenten, dass es zwischen dieser freien, offenen Fläche im Mittelpunkt des steingewordenen Chaos der Montagne de Cagna und seiner eigenartigen seelischen Verfassung eine geheimnisvolle Ähnlichkeit gab.
Wenn er sich immer wieder seinen Weg durch das Labyrinth dieser verlassenen Landschaft bahnte und ihm manchmal dabei beinahe die Orientierung verloren zu gehen schien, wenn es dann kaum ein Durchkommen gab und sich dann unverhofft doch wieder überraschende Passagen und Freiräume auftaten, fühlte er, dass er bei diesen Streifzügen durch die äußere Wildnis den verwirrenden und unergründlichen Bezirken seiner Seele nahe kam und schöpfte für Augenblicke Zuversicht. Klare Rechenschaft konnte er sich über diesen geheimnisvollen Zusammenhang, der da zu bestehen schien, nicht geben. Und warum auch? Ihm genügte es, wenn er keuchend in dem scheinbar weglosen Gelände einen Durchgang fand, wenn er den gefahrvollen Aufstieg und die Schatten des Urwalds hinter sich gelassen hatte und die sanfte, überschaubare Ebene sich vor ihm öffnete. Zugleich mit der Weite ihres Anblicks taten sich ihm die kaum getrübten, friedlicheren Bereiche seiner Seele auf. So war es eben, und in diesen Momenten, in denen er aufatmend Herr seiner Gedanken und Gefühle war, die ihm nun nicht mehr entglitten, war er vorübergehend beinahe glücklich.
*
Als Julien sein Ziel, die winzige Hütte von Barba Porcata, erreicht hatte, stieß er mit einem Fußtritt die klemmende Holztür auf. Aus dem dunklen Innern schlug ihm muffiger Dunst entgegen, zu dem sich der Geruch der kalten Feuerstelle und der modrige Duft von über Jahre verrottenden Schütten aus Farnwedeln mischten. Als er gebückt in den dunklen Raum eintrat, war er froh, dem Regen entronnen zu sein. Er zog die widerstrebende Tür hinter sich zu und ließ deren Riegel in die Auskerbung des steinernen Türpfostens fallen. Endlich im Trockenen! Wählerisch durfte man nicht sein. Immerhin bot dieses niedrige Loch Schutz vor dem Unwetter draußen.
In der Ecke gegenüber dem Eingang ertastete er einen Haufen leidlich trockener Farnwedel. Es fand sich sogar eine grobe Decke, die jemand liegen gelassen hatte. Hier würde er seinen Schlafplatz einrichten. Seinen Rucksack, das Gewehr und seine nasse Jacke hängte er über sich an den dicken Ästen auf, die die Decke der Hütte bildeten. Er war zufrieden, mehr brauchte er für eine Nacht nicht. Durch die geschlossene Tür konnte er hören, wie draußen die Sturmböen in Stößen um die Ecken der Hütte fuhren und in den Wipfeln der Kiefern zischten. Wieder einmal hatte sich alles zum Besten gewendet.
Irgendwann mitten in der Nacht schreckte er schweißgebadet hoch. Die trockene Luft lastete auf seiner Brust. Es war, als hätte sie sich mit der schwarzen Dunkelheit um ihn herum verbündet, um ihm den Atem zu nehmen. Julien lauschte. Draußen war es ruhiger geworden. Regen und Wind schienen nachgelassen zu haben. Aber die Luft! Er brauchte unbedingt frische Luft!
Sein Atem ging schnell und stoßartig. Noch benommen, tastete er sich auf allen vieren zum Eingang vor. Als er den Riegel hochdrückte und die Tür aufstieß, packte sie der Wind und schlug sie krachend gegen die Außenwand der Hütte. Julien rappelte sich vollends auf und sicherte das aus ungehobelten Brettern zusammengefügte, schwere Türblatt mit einer Drahtschlinge an einem Pflock an der Außenmauer, den jemand zu diesem Zweck in eine Fuge des grob geschichteten Mauerwerks getrieben hatte.
Schon vor Stunden, als es am Abend bei Naseo zu regnen begonnen hatte, war der warme, böige Südwestwind aufgekommen und hatte sich inzwischen zu einem regelrechten Sturm gesteigert. Unermüdlich hatte er vom Meer her Regenwolken herangetrieben und an den nackten Flanken der Berge und bewaldeten Abhänge der Berge niedergehen lassen. Auf deren Rückseite fuhr er hangabwärts über Wälder und Felsklippen in die Täler hinein. So als habe er sich bei diesem Spiel mit der Zeit verausgabt, hatte er sich nun zu einem starken Wind abgeschwächt.
Und jetzt, kurz nach Mitternacht, trieben die Wolken zwar noch immer eilig aus südwestlicher Richtung heran, aber zwischen ihnen taten sich schon größere Lücken auf, durch die die ersten Sterne blitzten. Die Bäume am Rande der Lichtung, auf der Juliens Unterschlupf stand, schwankten schon weniger heftig und das auf- und abschwellende Zischen, mit dem der Wind durch ihre Nadeln fuhr, klang beruhigender. Auch die vorgelegten schweren Fensterläden der Hütte klapperten leiser und nur noch in größeren Abständen.
Julien war mit all den Winden und Stürmen, die im Lauf des Jahres seine Insel heimsuchten, aufgewachsen, er war von Kindheit an mit ihnen vertraut. Im Wechsel der Jahreszeiten fielen sie ziemlich regelmäßig aus verschiedenen Himmelsrichtungen über Korsika her, und da sie seit Urzeiten bekannt waren, hatte man ihnen eigene Namen gegeben, die etwas mit ihren jeweiligen Eigenschaften zu tun hatten.
So war dieser Sturm, der sich schon tags zuvor mit feuchter, drückender Wärme angekündigt hatte und nun am Abklingen war, der Libecciu. Von Afrika, von wo er herkam, hatte er bei seinem Weg über das Meer all die Wassermassen aufnehmen können, die nun schon seit Stunden als Regen über den Flanken der Berge, über Felsburgen und den Wäldern niedergingen und in unzähligen Rinnsalen über Felskanten und Klippen bergab sprangen, sich zu Bächen und Flüssen vereinigten und wieder ins Meer zurückkehrten.
Julien tastete sich an der Wand entlang zurück zu seinem Schlafplatz. Obwohl die Tür der Hütte nun weit offenstand, reichte der schwache Schimmer des Nachthimmels nicht aus, um in dem dunklen Raum Einzelheiten erkennen zu können. Es schien im Gegenteil, als sei die Dunkelheit, die sich nun in die entfernteren Ecken der Hütte verkrochen hatte, dort sogar noch undurchdringlicher geworden.
Doch zu Juliens Erleichterung strömte jetzt wenigstens ein wenig frische Luft durch die offene Tür herein. Zwar verhießen Türen, die nachts offenstanden, nichts Gutes, waren immer eine Gefahr, aber er hatte ja gar keine Wahl. Wie hätte er denn dem Druck, mit dem die stickige, trockene Luft auf ihm lastete, anders begegnen sollen? Und dann war da zu allem Übel ja auch noch dieser feine Staub! Der stieg bei den allerkleinsten Bewegungen, die er machte, aus dem Haufen trockener Farnwedel unter ihm und vom Boden auf und schwebte anschließend um ihn in der Luft herum. Und als sei das noch nicht genug, strichen durch irgendwelche hinterhältigen Ritzen und Spalten zwischen den Blöcken des Mauerwerks auf geheimnisvollen Wegen Luftzüge und verteilten diesen Staub, der fein war wie Puder, in der ganzen Hütte.
Trotzdem war es so besser, und Julien atmete auf. Er lag wieder rücklings und mit geschlossenen Augen auf seinem Lager und dehnte beim Einatmen seinen Brustkorb so weit er konnte. Mit jedem Atemzug trank er die feuchte Nachtluft, die von draußen hereinströmte, regelrecht in sich hinein. So dauerte es nicht lange, bis sein Herzschlag sich beruhigte und er wieder gleichmäßiger atmete.
Von seiner Ecke aus schaute er durch das aus dem Dunkel geschnittene hellere Rechteck der Türöffnung hinaus ins Freie. Doch trotz der Ruhe, die er wiedergefunden hatte, vergaß er nicht, wachsam zu bleiben. Denn jetzt, wo er die Tür hatte öffnen müssen, hieß es, besonders auf der Hut zu sein. An Schlaf war da nicht mehr zu denken. Aber dafür war er diesen Druck los, diesen Alb, der auf seiner Brust gehockt und ihm in der Dunkelheit die Luft genommen hatte. Der feuchte, kühle Wind, der bis in seine Ecke hereinwehte und ihm sanft über Gesicht und Hände strich, hatte ihn vertrieben.
Und dann war da ja auch noch die freie Sicht nach draußen. Sie ließ ihn die Enge des Raumes und die Last des Daches und der viel zu tiefhängenden Decke vergessen und gab ihm das Gefühl, als könne er zusammen mit der frischen Luft, die über die Berge zu ihm gekommen war, gleichzeitig auch die Weite da draußen einatmen.
Der Blick durch das fahle Rechteck der offenen Türe reichte weit hinaus auf die dunkle Masse der Wälder, die sich an dem Bergrücken über der gegenüberliegenden Seite des Tales hinaufzogen und auf die ziehenden Wolken darüber. Dort drüben lag Naseo. Julien wusste, dass er sogar noch weiter schauen könnte, wenn er nur wollte,
Er lächelte vor sich hin. Dass er mit seinem inneren Auge dort sein konnte, wo er wollte, das war sein großes Geheimnis. Niemand durfte wissen, dass er manchmal dieses Auge von sich lösen und es losschicken konnte, irgendwohin, weit weg. Zum Beispiel über die Horizontlinie dort drüben und noch weiter, hinab über die waldigen Abhänge bis nach Piscia, ach was! – sogar noch weiter, bis hinunter in die Ebene, bis nach Sotta oder sonst wo hin. Auf diese Fähigkeit war er stolz und behielt sie für sich. Wenn die im Dorf davon wüssten, würden sie ihn vielleicht zuerst zwar darum beneiden. Aber wie er sie kannte, würde es nicht lange dauern, bis entweder sie selbst oder der Arzt in Ajaccio irgendeinen Weg fände, ihm zuzusetzen, ihm diese seltene Fähigkeit streitig zu machen und sie ihm zu nehmen. Das würden sie gewiss tun, denn sie würden seine Gabe fürchten, weil sie nicht wollten, dass er hinter dem, was sie zu wissen glaubten und worüber sie so klug daherreden konnten, manchmal das Wichtigere sah, das ihnen wiederum verborgen blieb, ihnen, die ihm großzügig mal dies und mal jenes erklärten wollten!
Aber heute, wo er spürte, wie der Libecciu an ihm zerrte, wollte Julien solchen Gedanken nicht nachgehen. Heute durfte er von seiner geheimen Fähigkeit nicht Gebrauch machen. Bei der Unruhe, die der Libecciu verbreitete, war es besser, wenn er seine Gedanken nicht sich selbst überließ, sie nicht ihre eigenen Wege gehen ließ. Heute war es besser, wenn er seine Ruhe bewahrte. Wie leicht könnte es passieren, dass sein inneres Auge sich selbständig machte und ihn gegen seinen Willen an Orte führte, ihm Dinge und Bilder zeigte, die ihn nur ängstigen und aus der Fassung bringen mussten. In dieser Nacht, in der in der Natur alles in Bewegung war, musste er versuchen, ruhig zu bleiben und durfte nur das an sich heranlassen, was er direkt vor Augen hatte.
Da war zum Beispiel Naseo. Von da drüben war er vor ein paar Stunden hergekommen. Noch zu Beginn der Nacht hatte er die Lage des Weilers an den wenigen schwach flimmernden Lichtpünktchen erkennen können. Doch schon vor Stunden hatten die Schäfer in ihrer Hütte die Lampen heruntergedreht und die hellen Pünktchen waren wie die letzten Funken eines erlöschenden Feuers verschwunden und in der dunklen Masse des Waldes versunken wie die letzten Lichter eines untergehenden Schiffes in der schwarzen See. So weit es der Türrahmen erlaubte, streifte sein Blick über den Hang des langgezogenen Bergrückens auf der anderen Talseite. Der Wald bedeckte ihn von oben bis unten wie eine schwarze Masse. Auch wenn der Sturm nachgelassen hatte, war er immer noch stark genug, die Wipfel der zahllosen Bäume in eine sanft wogende Fläche zu verwandeln.
Waren das, was der Wind dort drüben in trägen Wellen unablässig den Hang hinauftrieb, gar nicht wogende Baumwipfel, sondern riesige Wellen, die der Wind auf der Oberfläche der bewegten See vor sich hertrieb? Sollte Naseo also doch versunken sein, als die dort drüben die Lichter verschwanden? Diese Möglichkeit erwog er so ruhig, dass er über sich selbst erstaunt war.
Während er seine Blicke gemächlich über die nächtliche Landschaft schweifen ließ, zerfiel die Wolkendecke zusehends und löste sich in einzelne, kleiner werdende Wolkeninseln auf. Immer wenn der Mond vorübergehend hinter den Wolken verschwand, wanderten drüben Verdunkelungen aus dem Tal in die Höhe und legten sich über die hellen Partien. Julien konnte sich von diesem unablässigen Wechsel von Hell und Dunkel, dem Schauspiel, das dort drüben einen Seegang vortäuschte und ihn einlullen wollte, nicht lösen.
Und doch entging ihm die schleichende Änderung nicht, die sich trotz dieser Gleichförmigkeit vollzog. Allmählich verbreiterten sich die wandernden Streifen und Flecken des bleichen Mondlichts, wuchsen zu Flächen zusammen, und die nachtschwarzen Anteile der Wolkenschatten wurden kleiner und kleiner.
Ohne dass es ihm bewusst wurde, ergriff Julien in diesem Ringen zwischen Licht und Schatten Partei für die Helligkeit. Gab es Rückfälle, sodass zwischendurch doch einmal längere Abschnitte der Verschattung den gegenüberliegenden Hang bedeckten, verursachte ihm das Unbehagen, das sich erst wieder legte, wenn das Mondlicht und mit ihm die hellen Flächen wieder die Oberhand gewannen und zeitweise sogar siegreich den ganzen Hang beherrschten. Dann atmete er erleichtert auf.
Die heller werdende nächtliche Landschaft, das ruhigere Gleiten der durchscheinenden Wolken vor dem Vollmond und das weichere Zischen des Windes in den Baumwipfeln nahmen die letzten Reste von Anspannung von ihm. Er streckte Arme und Beine lockerer von sich, gähnte und glitt in einen Zustand traumähnlicher Benommenheit hinüber.
Der volle Mond hatte den höchsten Punkt seiner Bahn bereits überschritten und die scharf ausgeschnittene Raute aus Licht, die wie der helle Wiedergänger eines Schattens durch die offene Tür in das dunkle Geviert der Hütte fiel, wanderte behutsam über die Falten der groben Wolldecke, die der hagere Mann über seine Beine gebreitet hatte. Nachdem der Lichtfleck über die Hände des Schlafenden geglitten war, verließ er ihn und begann unendlich langsam, die aus grobem Gestein gefügte Wand neben der reglosen Gestalt abzutasten, bis schließlich auch der letzte schmale Lichtstreifen, der gerade noch in der Türfüllung hing, sich auflöste und irgendwohin in die Nacht verschwand.
Als Julien nach einiger Zeit wieder aufwachte und die Augen aufschlug, wusste er nicht, was ihn geweckt hatte oder wie viel Zeit vergangen war. Da sein Schlaf oberflächlich gewesen war, konnte es auch eine der letzten kurzen Phasen ungewohnter Stille gewesen sein, die der abflauende Sturm wie Atempausen zwischen seinen schwächer werdenden Anläufen einlegte.
Und mit der Stille waren auch die kleinen Geräusche der Nacht zurückgekehrt. Er lauschte auf den eintönigen Ruf einer Eule, der von weit her kam und auf den, wie es meist war, ebenso schwach, eine andere antwortete. Von irgendwoher aus der Dunkelheit des Raumes war regelmäßig und langsam wie das Ticken einer Wanduhr das Geräusch tropfenden Wassers zu hören. Wie eine schwache Erinnerung an das vorausgegangene Toben des Libecciu klapperte draußen von Zeit zu Zeit sachte die Tür gegen die Mauer der Hütte. Der südöstliche Horizont war gleichförmig dunkel, bis zum Morgenanbruch würde also noch viel Zeit vergehen.
Plötzlich zuckte Julien zusammen. Irgendwo aus dem Dunkel hinter ihm drang, kaum hörbar, verstohlenes Rascheln an sein Ohr. Er hörte, wie Steinchen raschelnd auf die trockenen Blätter am Boden fielen, Sand, der aus den Fugen zwischen den Steinen der Wände rieselte. Doch als dieses Geräusch sich zu verstärken schien und näherkam, war Julien alarmiert. Er lauschte angespannt mit weit geöffneten Augen und aufgerissenem Mund in die Dunkelheit. Mehr noch als dass er sie hörte, fühlte er, wie sich überall um ihn herum in der Hütte eine leise, rastlose Unruhe bemerkbar machte. Ihm war, als könne er die feinsten Geräusche ohne den Umweg über das Gehör direkt über seine Haut wahrnehmen.
Mäuse! Aber natürlich, warum war nicht gleich darauf gekommen? Das waren Mäuse. Es konnte gar nicht anders sein, denn die waren ja überall. Und diese Hütte mit ihren Unmengen von getrocknetem Farn, der hier schon seit Jahren Schicht auf Schicht verrottete, die mussten sie ja geradezu lieben. Dazu die Mauern mit ihren unzähligen Lücken und Höhlungen, die ihnen Unterschlupf boten – hunderte von ihnen oder mehr musste es hier geben! Und da hatte er nichts Besseres zu tun gewusst, als gerade hier Schutz zu suchen, sich zwischen sie zu legen, sich ihnen auszuliefern! Jetzt waren sie bestimmt schon ganz in seiner Nähe, waren ihm so nahe, dass ihm der muffige Geruch ihrer kleinen, grauen Körper in die Nase stieg. Und dazu der widerliche Gestank ihrer Ausscheidungen, die sie überall hinterließen. Sogar während sie fraßen ließen sie sich gehen. Das hatte er nun davon, dass er unvorsichtig gewesen war! Natürlich, sie hatten seine Unvorsichtigkeit ausgenutzt, hatten zuerst mit ihren großen Ohren auf seine Atemzüge gelauscht, hatten geduldig gewartet, bis er eingeschlafen und ihnen wehrlos ausgeliefert war. Sie hatten ihn beäugt, denn als Tiere der Nacht, die sie waren, konnten sie auch in der Finsternis sehen. Und nun rückten sie von allen Seiten näher und näher heran, bedrängten ihn, versteckten sich in den Falten der Decke über seinen Beinen und warteten. Sie hatten ihn schon immer belästigt, so weit er zurückdenken konnte. Doch warum nur? Was hatte er ihnen eigentlich getan? Nichts! Und er? Unbesonnen hatte er durch die offene Tür nach draußen geglotzt, hatte seine Gedanken doch wieder sich selbst überlassen, anstatt sie zu bewachen und sich in Acht zu nehmen. Wie dumm von ihm! Hätte er seine Gedanken beieinander gehabt und kontrolliert, hätte er wissen können, dass diese Biester hier in ihrer Hütte schon seit langem auf ihn warteten. Und jetzt war es passiert, jetzt lag er hier in der Falle und sie starrten ihn mit ihren kleinen Augen, die wie winzige schwarze Glassplitter glitzerten, von überall her reglos an und warteten auf ihre Chance, den nächsten Fehler, den er machen würde.
Wäre er da draußen im Wald, stünden die Dinge anders. Ja, im Wald, da hätte er bleiben sollen, trotz des Regens. Zwar war man auch da nicht ganz sicher, aber dort waren wenigstens die Eulen! Die sahen alles, besonders in der Dunkelheit. Mit dem starren Blick ihrer großen Augen hätten die über seinen Schlaf gewacht und hätten, wie schon so oft, schützend ihre weichen Schwingen über ihn gebreitet, um ihm die ekelhaften Tiere vom Leib zu halten. Sie jagten die Mäuse in den Wäldern, gewährten ihnen keinen Pardon. Wann sah man schon mal eines von diesen kleinen Biestern in den Wäldern? Hier jedoch? Warum nur hatte er daran nicht gedacht? Warum nur machte er immer wieder solche Fehler?
Juliens Atem ging jetzt stoßweise, er begann einem trockenen Schluchzen zu ähneln. Von Ängsten und Selbstzweifeln geplagt warf er sich auf seinem Lager unruhig hin und her. Was hätte er denn aber auch anderes tun können, als sich hier in dieses staubige, erdrückende Mauseloch zu verkriechen? Vögel verbargen sich bei einem solchen Unwetter doch auch irgendwo im Wald. Wie hätten sie ihn da beschützen können?
Seine Unruhe und Angst steigerten sich und gingen nun in Wut über. Er schlug mit der flachen Hand neben sich auf das Polster aus trockenem Kraut, zuerst einmal, dann in ganz schneller Folge noch mehrere Male hintereinander. Doch dadurch stieg um ihn herum nur noch mehr Staub in unsichtbaren Wolken auf! Er konnte ihn fühlen und riechen. Also noch ein Fehler! Weiter so, Jules! Aber wehren musste er sich doch. Vielleicht hatte er ja sogar welche von ihnen erwischt, hatte wenigstens ein paar von den besonders heimtückischen, die sich unter der Schicht von trockenem Laub und Farnwedeln schon an ihn herangearbeitet hatten, erschlagen.
Es hielt ihn nicht mehr am Boden. Mit einem Ruck warf er die zerschlissene Decke von seinen Beinen, spannte seinen Körper an und sprang ruckartig auf. Seine knochigen Finger ballten sich zu Fäusten. Er langte über sich ins Dunkel. Wenigstens hatte er den Leinwandsack mit dem Proviant und seine Schrotmunition gesichert. Er stieß gegen seinen Rucksack, der wie ein großer Tropfen über ihm sachte im Dunkeln pendelte. Das immerhin war klug gewesen, dass er ihn vorausschauend mit den Trageriemen an einem Dachsparren aufgehängt hatte. Damit wenigstens hatten sie kein Glück bei ihm gehabt, diese kleinen, huschenden Teufel! Julien kicherte vor sich hin und fuhr sich mit den Fingern zufrieden durch den Bart. Nein, kein Glück bei ihm, jedenfalls nicht immer! Oder doch? Sie kletterten ja auch! Dann wären bestimmt auch welche im Sack! Es verschlug ihm den Atem, Ekel schnürte ihm den Hals zu. Und sein Gewehr? Er tastete er über den glatten Kolben seiner Flinte. Doch was konnten sie der Waffe schon anhaben? Die wenigstens war vor Mäusen sicher.
Andererseits – man wusste nie! Bei der Vorstellung, wie eine Maus, im Lauf seiner Schrotflinte verschwand, schüttelte es ihn und er verzog angewidert das Gesicht. Nichts wie raus hier! Er machte gebückt einen Schritt zu Türöffnung hin und stieß dabei mit dem Kopf gegen seinen Rucksack. Den riss er an sich, auch seine Büchse und hastete dann durch den niedrigen Eingang der Hütte nach draußen ins Freie.
Nach der stickigen Schwärze da drinnen war die Helligkeit vor der Hütte für ihn wie eine Befreiung. Der Vollmond stand schon tief hinter den Kronen der Bäume. Lange würde es nicht mehr dauern, bis die runde Scheibe aus fleckigem Silber hinter der Punta di Monaco verschwunden wäre, die sich mit ihren Konturen als schwarzer Klotz über dem Wald abzeichnete.
Julien machte ein paar Schritte auf den Waldrand zu. Alles um ihn herum war vom Regen durchtränkt. Nasse Farnwedel streiften seine Beine, Nässe glitzerte im Mondlicht auf Gräsern und Kräutern und auf dem Boden vor ihm zeichnete sich das Geäst der Baumkronen im Mondlicht als wirres Muster aus Licht und Schatten ab. Voller Freude stellte er fest, dass die Eule plötzlich irgendwo über ihm, wieder ganz in seiner Nähe war. Ihr eintöniger Ruf, dieser helle, klagende Ton, schien jetzt aus einem der Bäume am Rande der Lichtung zu kommen. Das war ein gutes Zeichen! Ja doch, auf sie war Verlass!
Julien atmet tief durch. Mit zitternden Fingern, doch gleichzeitig auch gelassen knöpft er seine Hose auf und beginnt, auf diese kleinen Nager zu pissen, die ihm unvorsichtigerweise gefolgt sind und nun um ihn herum auf dem Boden wuseln. Und während er das tut, wird er von einem Lachanfall geschüttelt, stößt zwischendurch gepresst klingende Schreie und knappe Anweisungen aus: „Immer auf die Mäuse!“, ruft er und lobt sich selbst: „Richtig so, nur drauf!“ Keine von denen darf ihm entgehen. Er freut sich über seinen Urinstrahl, der im Mondlicht glitzert. Den schwenkt er hin und her. Nein, keins der Viecher soll ihm entgehen! Zielend ruckt er mit dem Unterleib hin und her, von einer Seite auf die andere, und während er das tut, vollführt er zusätzlich kleine Sprünge, vor, zurück und zur Seite. Hier trifft er eine Maus mit vollem Strahl, dort erwischt er eine andere gerade noch, bevor sie entkommen kann. „Immer drauf! Und du da? Na, was ist mit dir? Worauf wartest du? Sitzt einfach da und glotzte ihn an, das Viech! Also: draufhalten!“
Für jemanden, der Julien aus einiger Entfernung beobachtet hätte, sähe es aus, als beschriebe da jemand im Mondlicht auf dem freien Platz vor der Hütte die geheimnisvollen Figuren eines unbekannten, ekstatischen Tanzes. Zwischendurch hält er ein paarmal kurz inne und bleibt schließlich mit leisem Bedauern stehen als er merkt, dass der Urinstrahl endgültig versiegt ist. Der Tanz, der ja in Wirklichkeit ein Kampf war, hat ihn angestrengt.
Gerade als er keuchend und mit unbeholfenen Fingern seine Hose zuknöpft, zeichnet sich plötzlich für ein paar Sekunden das Schattengewirr der Kiefernäste vor seinen Füßen und um ihn herum schärfer und dunkler vom Boden ab. Ein Lichtschein, heller als das Mondlicht, fällt aus der Höhe von jenseits des Waldes unter der Punta di Monaco durch die Wipfel der Bäume, sodass Julien einen verrückten Augenblick lang die Vorstellung heimsucht, die Sonne sei aufgegangen und stehe nun hoch am Himmel.
Doch Sonnenstrahlen um diese Zeit? Er fängt diesen Gedanken sogleich ein. Wie sollte das denn möglich sein, ein Sonnenaufgang mitten in der Nacht? Auch ist dieses Leuchten zu plötzlich ausgebrochen, noch dazu aus der falschen Richtung. Denn dieser Lichtblitz, und ein Blitz ist es tatsächlich gewesen, der alles um ihn herum für einen Moment beinahe taghell erleuchtet hat, der war ja von Westen gekommen, von jenseits der Punta di Monaco. Also muss zwischen dieser riesigen Felsburg und den Hütten von Presarella, die sich auf der kleinen Ebene hinter dem großen Felsklotz befinden, etwas Geheimnisvolles geschehen sein. Was immer es auch war, mit dem Sonnenaufgang konnte es nichts zu tun haben, soviel ist Julien klar, der in einer Art Schreckstarre immer noch auf dem Platz vor der Hütte verharrt und damit beschäftigt ist, an seiner Hose zu herumzunesteln.
Die vertrauten Umrisse des großen Berges oberhalb der Bäume heben sich noch für kurze Zeit scharf wie ein Scherenschnitt von einer riesigen Wolke aus Licht ab, die hinter der Punta di Monaco zu schweben scheint. Und dann, noch bevor Julien seine wild herumwirbelnden Gedanken fassen und ordnen kann, trifft ihn etwas anderes, ein Geräusch, ein Donnerschlag, so laut, wie er noch nie einen gehört hat, und unter dessen Wucht er sich zusammenkrümmt und sein Gesicht in der Armbeuge verbergen muss. Kurz danach erreicht ihn die Druckwelle. Sie lässt die Luft um ihn herum erbeben und erschüttert seine Bauchdecke, seinen Magen. Er steht wie erstarrt, den Mund wie zu einem lautlosen Schrei aufgerissen und lauscht diesem ungeheuerlichen Geräusch hinterher, das, nachdem es über ihn hergefallen ist, in unheimlicher Geschwindigkeit über ihn hinweg von Berg zu Berg durch die nächtliche Landschaft springt, bevor sein Echo gebrochen zu ihm zurückkehrt und sich in der Nacht verliert.
Noch während er lauschend dasteht, hat sich die anfängliche blendende Helligkeit hinter der Silhouette der Punta di Monaco zu einem düsteren Orangerot abgedunkelt. Da steht es für Julien fest, dass hinter dem Berg ein Feuer brennen muss, und zwar ein Feuer von einer solchen Größe, das er vergeblich in der Landschaft dort drüben, die er gut kennt, unterzubringen versucht. Während sich das Leuchten weiter zu einem dunklen Rot abschwächt, steigen die ersten dicken Rauchschwaden hinter dem dunklen Klotz der Punta di Monaco auf, wälzen sich über den Berggipfel und verschlucken seine Konturen.
Indem Julien sich den Rucksack umhängt und den Riemen seiner Schrotflinte über die Schulter wirft, folgt er weniger einem klaren Gedanken, sondern gehorcht eher einem inneren Zwang. Er weiß nur, dass er jetzt da hinauf muss, zu dieser Felsburg, hinter der es immer noch geheimnisvoll leuchtet. Er wird den Berg halb umgehen, um auf die Ebene von Presarella zu gelangen, wo er das Geheimnis dieses Feuers lüften wird.
Den Weg nach dort oben kennt er gut, er ist ihn oft gegangen, auch nachts. Allerdings hatte er sich da immer Zeit lassen können. Nach der geheimnisvollen Erscheinung aus Feuer und Donner trägt ihm der Wind jetzt, während er bergan hastet, auch noch Brandgeruch zu. Zuerst nur ab und zu und andeutungsweise, dann ununterbrochen und immer durchdringender. Ein paarmal versucht er, die Serpentinen, die der Pfad an besonders steilen Stellen beschreibt, abzuschneiden, will sich kriechend am Hang hocharbeiten. Aber das ist riskant. Oft muss er am Boden oder an Wurzeln nach Halt suchen, um nicht zu stürzen und nicht immer hat er damit Erfolg. Dort, wo er ins Leere greift, krallt er sich in den durchtränkten, weichen, Waldboden, kommt auf losem Gestein fast zu Fall oder rutscht auf glitschigen Baumwurzeln ab. Doch selbst wenn er könnte, würde er nicht umkehren. Er muss einfach weiter. Also rafft er sich immer wieder auf und hastet bergan.
Die Regenmassen, die während der letzten Stunden über den Bergen niedergegangen sind, fließen nun aus der Höhe ab. Sie haben die Barba Porcata, die in den trockenen Monaten kaum mehr als ein Rinnsal ist, in einen Wildbach verwandelt, und der kommt ihm jetzt rauschend und schäumend in seiner eng eingeschnittenen Schlucht vom Col du Monaco her entgegen. Julien zögert, bevor er das gefährlich angeschwollene Wildwasser durchwatet, das ihm jetzt bis zu den Knien reicht. Fast hat er schon die Böschung am anderen Ufer erreicht, als er auf einem Stein ausrutscht. Er kämpft um sein Gleichgewicht, taumelt, seine Hände greifen ins Leere. Für ein paar Sekunden fürchtet er, er könnte in das tosende Wasser zurückfallen und bergab mitgerissen werden. Doch mit letzter Kraft gelingt es ihm, sich vorwärts auf das rettende Ufer zu werfen. Und noch während er auf allen vieren höher aufs Trockene kriecht und sich in Sicherheit bringt, hat er den durchstandenen Schrecken genauso schnell wieder vergessen, wie der über ihn gekommen ist.
Nachdem er endlich keuchend und stolpernd den Rand des Waldes und damit die Talkante erreicht hatte, war er auch mit seinen Kräften so gut wie am Ende. Auf der freien Fläche fiel ihn der Wind heftiger an. Der Fels unter seinen Füßen war nackt und gerundet und bot seinen Schritten wenig Halt. So konnte es nicht ausbleiben, dass Julien auf dem regennassen Gestein ausrutschte und zu Fall kam. Im ersten Moment glaubte er, sich ernsthaft verletzt zu haben und blieb einfach liegen. Aber als das Stechen im Bein nachließ und er wieder etwas zu Atem gekommen war, rappelte er sich auf und überquerte die kleine Talsenke am Fuß des Berges. Auf die Schmerzen am geschrammten Schienbein und in dem überdehnten Knöchel achtete er da schon nicht mehr.
Inzwischen hatte der Regen zwar nachgelassen, doch die Grasmatten am Fuß der Punta di Monaco hatten sich so mit Wasser vollgesogen, das unter seinen Tritten emporspritzte. Er hinkte an dem alten Backofen der Bergerie de Monaco vorbei, einem kleinen rundlichen Hügel aus hellem Gestein in dem schwarz das Ofenloch gähnte. Diesmal konnte er sich an diesem freundlichen Ort keine Verschnaufpause gönnen. Der Brandgeruch, der ihn schon die ganze Zeit begleitet hatte und immer stärker geworden war, war jetzt wichtiger, der erregte ihn und zog ihn weiter.
Rauch war für Julien nicht einfach nur Rauch. Er war mit dem Rauch von Holzfeuern groß geworden und mit den verschiedenen Arten von Holzrauch kannte er sich aus. Er konnte den Rauch, mit dem an regnerischen Tagen das harte Holz der Steineichen in den Öfen der Häuser verglühte und träge und missmutig über die Dächer und durch die engen Gassen des Dorfes schlich, von dem milderen, würzigeren Rauch unterscheiden, der an windstillen, sonnigen Wintermorgen wie eine zarte, milchige Scheibe über den Häusern und an den Hängen rund um das Dorf lag. Ganz besonders liebte er den Duft des brennenden Pinienholzes, der oben in den Bergen graublau von den offenen Feuern vor den Bergerien aufstieg, wo die Schäfer die gesäuerte Schafsmilch in den bauchigen Kesseln erwärmten, um sie in Brocciu zu verwandeln.
Doch mit dem Rauch dieses Feuers, das da hinter der Punta di Monaco brennt, hatte es etwas Besonderes auf sich. Der war für ihn etwas Neues, und sein strenger Geruch faszinierte und ängstigte ihn zugleich. In dem beunruhigenden Gemisch von Gerüchen kam ihm nur der Geruch von verbranntem Öl und Benzin bekannt vor. Den bitteren Dunst von blasig verbrennendem Plexiglas oder den schwarzen Gestank qualmend verschmorenden Gummis kannte er nicht und konnte nichts mit ihm anfangen, ganz zu schweigen von diesem Anderen, das da auch noch war. Das erroch er weniger als dass er es erahnte oder befürchtete. Es stieg aus einer verschütteten Ecke seiner Erinnerungen auf und machte ihm Angst. Dieser Geruch lag wie ein kaum vernehmbarer, dunkler Unterton unter all dem, was er durch Nase oder Haut oder auch nur intuitiv witterte oder vielleicht auch nur zu wittern glaubte, der Geruch verkohlten Fleisches. An ihn erinnerte er sich, und er ließ ihn entsetzt und mit stechenden Lungen innehalten.
Er blieb ein paar Meter unterhalb der Stelle stehen, wo die Quelle am Fuß der Punta di Monaco unter Felsblöcken und zwischen Sträuchern aus dem Berg austrat. Ihr Wasser durchzog mit verzweigten Rinnsalen und sumpfigen Tümpeln das kurze, harte Gras der Matten rundum. Hier hatte der starke Regen vollends einen kleinen Sumpf entstehen lassen, sodass der Boden unter Juliens Schritten federnd und glucksend nachgab.
Da er nicht anders konnte, blieb er stehen und ließ an einem trockeneren Platz achtlos Rucksack und Flinte zu Boden gleiten, warf sich keuchend zu Boden und blieb bäuchlings im nassen Gras liegen. Er tauchte sein glühendes Gesicht mehrmals in das kühle Wasser einer kleinen, wassergefüllten Mulde und trank dann in langen Zügen. Nachdem er seinen Durst gestillt hatte, blieb er noch ein Weilchen reglos liegen. Da ihn hier unten, so dicht über dem nassen Boden der Rauch nicht mehr so sehr bedrängen konnte, wurde er ruhiger. Doch bevor er weitergehen konnte, musste erst das harte, schnelle Pochen nachlassen, mit dem sein Herz durch den Brustkorb hindurch direkt gegen den Boden unter ihm klopfte. Julien streifte mit dem Gesicht mit langsamen Bewegungen ein paarmal über das kurze, feste Gras, einmal mit der rechten, dann wieder mit der linken Wange. Er genoss die feuchte Kühle und das sanfte, streichelnde Kratzen der Halme auf der Haut. Alles das war ihm vertraut und beruhigte ihn, ebenso der leicht modrige Geruch des Wassers um ihn herum und die welligen Unebenheiten des Bodens, die sich von unten an seinen Körper schmiegten. Die Anspannung und Angst, die das Unbekannte hinter dem Berg zuerst mit Licht und Donner und jetzt mit diesen Gerüchen in ihm ausgelöst hatte, fielen allmählich von ihm ab.
Dennoch ging er nicht gleich weiter. Stattdessen erhob er sich nur halb und verharrte noch eine Zeitlang in der Hocke, wobei er begann, mit dem Oberkörper sachte vor und zurück zu schaukeln und seine Finger gedankenverloren durch den Bart gleiten ließ. In dieser Haltung konnte er am besten mit sich zu Rate gehen. Einzelne Gedanken ließen sich so besser im Auge behalten und wenn es ihm dazu noch gelang, sie zu zwingen, sich langsamer zu bewegen, konnte er sie beobachten und lenken.
Sein Entschluss stand bald fest: Er würde die Punta di Monaco an ihrer Südseite umrunden und sich von Westen, von der Ebene von Presarella her, dem Unbekannten, das da auf ihn wartete, nähern, was immer es sein mochte. Wenn er dabei vorsichtig vorging, konnte er es wagen.
Nachdem er diesen Entschluss gefasst hatte, erhob sich Julien ruhig, warf seinen halbleeren Rucksack schwungvoll auf den Rücken und zog die Tragriemen zurecht. Als er das Brot und der Klumpen Rauchfleisch auf seinem Rücken spürte, merkte er, wie hungrig er war und ihm fiel ein, dass er schon lange nichts mehr gegessen hatte. Aber das konnte er später nachholen, wenn er sein Ziel erreicht hatte.
Als er sich nach seiner Schrotflinte bückte, bedauerte er, dass er sie vorhin achtlos in das nasse Gras geworfen hatte. Ohne viel Erfolg fuhr er mehrmals mit dem Ärmel seiner Jacke über den Lauf der Waffe. Dann betätigte er mit einem leichten Druck seines Daumens den Arretierungshebel und kippte den Doppellauf nach vorne ab. Es verstand sich von selbst, dass die Flinte in dieser Situation geladen sein musste. Aus den Tiefen seiner Hosentasche kramte er zwei Schrotpatronen hervor. Deren Hülsen waren zwar etwas feucht, aber das war nur äußerlich, den stabilen, gewachsten Pappkartuschen konnte die Nässe nichts anhaben. Er schob sie in die Patronenkammern und schwenkte den Lauf wieder nach oben, sodass die Verriegelung von Lauf und Schaft mit einem knackenden Geräusch einrastete. Er liebte diese immer gleichen kurzen, präzisen Bewegungen und Geräusche und die kaum merkliche Erschütterung, die er mit dem Einrasten der Verriegelung in seiner Hand spürte. Seine Finger glitten an dem kühlen Doppellauf der Flinte entlang und ertasteten die eingravierten verschlungen Linien der Pflanzenornamente.
Er lächelte. Natürlich würde er weitergehen! Er war doch nicht wehrlos! Sicher, vorsichtig musste er bleiben und auf alles gefasst sein, das schon, aber wehrlos war Julien Santini nicht. Endlich war er wieder ganz ruhig geworden, war wieder ganz bei sich selbst. Er atmete mehrere Male tief durch und dehnte dabei selbstbewusst den Brustkorb. Was immer es auch sein mochte, jetzt war er bereit, es mit dem Unbekannten aufzunehmen, das hinter der Felsburg, der Punta di Monaco, auf ihn wartete.
Der Mond, den der Berg bisher verborgen hatte, war nun wieder da. Er stand schon schräg über der kleinen Ebene von Presarella und Julien konnte den schmalen Tierpfad, der sich als klarer, schmaler Streifen vor ihm abzeichnete, gut erkennen. Ihm folgte er in einer Art zockelndem Trott. Und nachdem er größere und kleinere Felsen und Buschinseln am Fuß des Berges umrundet hatte, war er endlich an dessen Südseite angekommen.
Aber auch von hier aus war das Feuer selbst noch nicht zu sehen, da große Felsblöcke und hohes Gebüsch die Sicht darauf verstellten. Doch sein Widerschein beleuchtete eindrucksvoll das Blockgewirr am Fuß des Berges und die träge aufsteigenden Rauchwolken. Nachdem er den halben Weg zu den Hütten von Presarella zurückgelegt hatte, bog Julien von dem bequemen Pfad nach rechts ab, um sich von hinten, von Westen her, der gewaltigen Pyramide aus Granitblöcken zu nähern. Hier gab es nicht einmal mehr einen Tierpfad und so konnte er sich nur mit großer Mühe einen Weg durch das Gewirr aus Gestrüpp und efeubewachsenen Felsen bahnen. Die klobigen Felsblöcke in allen Größen waren die ersten Vorboten des Blockmeeres, das sich von hier unten über den Fuß der Felsburg bis zu deren Gipfel erstreckte. Und als ob das an Hindernissen noch nicht genug wäre, wucherte aus diesem chaotischen Untergrund, wo immer die Spalten zwischen den Felsen es erlaubten, zähes, dorniges Gestrüpp hervor.
Julien war auf der Hut. Er wusste, dass unter verdorrtem Geäst und dicken Packen trockenen Laubs im Verborgenen tiefe Spalten und Löcher lauerten. Doch umgehen ließ sich dieses tückische Chaos nicht, und so kam er hier nur sehr langsam voran. Ragte dann hier und da auch noch unverhofft ein haushoher Felsen vor ihm auf, musste der umständlich umgangen werden, besonders dann, wenn die Spalten zwischen denen riesigen Kugeln so breit und tief waren, dass er sie nicht zu überspringen wagte. Vor diesen Spalten – es waren kleine Abgründe! – musste er sich besonders in Acht nehmen. Deshalb, und weil er gezwungen war, in immer kürzeren Abständen stehen zu bleiben, um zu Atem zu kommen und um gleichzeitig den immer stärker werdenden, beißenden Geruch des fremdartigen Feuers einzusaugen, kam er nur sehr langsam voran.
Noch bevor er drüben am Berghang die ersten Flammen zu Gesicht bekam, hatte sich deren Widerschein an den weiter oben liegenden Felsblöcken noch verstärkt. Eigentlich hatte er ein einzelnes, großes Feuer erwartet. Aber als er endlich die ganze Szenerie überblicken konnte, war er überrascht, dass sich stattdessen mehrere mittelgroße und sogar einzelne kleinere Brandherde hangaufwärts über eine ziemlich große Fläche verteilten. Auf den ersten Blick sah es so aus, als brennte dort eine Vielzahl von Lagerfeuern, um die sich schemenhaft Gruppen von Gestalten drängten. Doch Julien wusste, dass das Steingewirr dort drüben seine Sinne zu täuschen versuchte.
Noch bevor die Wolkendecke wieder aufriss und er sich mit eigenen Augen vollends von dem überzeugen konnte, was er ja eigentlich wusste, hatte er durchschaut, dass er diese Szenerie am Berghang nur mit etwas Vertrautem belebt hatte, um ihr ihre beunruhigende Rätselhaftigkeit zu nehmen. Und als gleich darauf das Licht des Mondes auf der Felsburg lag und sich ihre Blöcke aus hellem Granit deutlicher abzeichneten, war klar, dass sich dort tatsächlich kein lebendes Wesen aufhielt. Rundliche Felsen hatten zusammen mit dem Wind, der das spärliche Buschwerk bewegte, Leben vortäuschen wollen. Dennoch betrachtete Julien die verstreuten, flackernden Feuer mit wachsendem Unbehagen. In einem Moment zogen sie sich zusammen, als wollten sie sich wegduckten, schienen fast zu verschwinden, um gleich darauf wieder zu erscheinen und ruhiger und umso stärker aufzuflackern.
Was er da sah, erinnerte ihn an die Wandmalereien und Bilder im Inneren der Kirche des Nachbarortes von Giannuccio und an die Eindrücke, die sie auf sein kindliches Gemüt gemacht hatten. Lange genug hatte er sie in seiner Kindheit und Jugend Sonntag für Sonntag während der Predigten wieder und wieder anschauen müssen. Sei es, weil die Predigten des Priesters gar zu monoton und unverständlich waren und ihn mit seinen eigenen düsteren Gedanken allein ließen oder aber aus anderen, tiefer liegenden und ernsteren Gründen, die mit seinem leicht erregbaren Gemüt zu tun hatten, vertiefte er sich so während der sonntäglichen Messen immer wieder mit wollüstigem Entsetzen in die unbeholfen ausgeführten bildlichen Darstellungen biblischer Szenen um ihn herum.
Im Halbdunkel der Kirche sah er da in schlicht naiver Darstellung und in düsteren Farben Abbildungen von Männern und Frauen, deren weißlich schimmernde Körper, ganz oder teilweise entblößt, von blutroten Flammen umlodert wurden. Menschliche Gestalten reckten da mit flehenden Gesten und jammervollen Mienen hilfesuchend ihre Arme zu einer Gruppe heller Gestalten empor, die aus sicherer Entfernung und gelassen das grauenhafte Schauspiel beobachteten. Manches Mal, wenn er sich zu sehr in das Geschehen an den Wänden vertiefte, meinte Julien sogar, wie von weit her, ihre klagenden Stimmen hören zu können.
So hatte er über die Jahre hinweg Sonntag für Sonntag Zeit genug gehabt, sich während der Messen in diese Szenen hineinzuphantasieren. Die freudlosen, monotonen Melodien der Liturgie und das dumpfe Murmeln der Betenden hatten hierzu den passenden klanglichen Hintergrund abgegeben. So war es nur natürlich, dass im Laufe der Jahre die Szenen des Fegefeuers und die angsterregenden Veranschaulichungen des Jüngsten Gerichts zu festen Bestandteilen seiner seelischen Landschaft geworden waren, die an Angstvisionen sowieso schon nicht gerade arm war. Solche oder ähnliche Bilder konnten dann aus den nichtigsten Anlässen unverhofft wie Visionen über ihn kommen und sich zwischen ihn und die äußere Wirklichkeit schieben.
Zwar war die Szenerie dort drüben am Berg menschenleer, es gab da weder arme Sünder im Fegefeuer noch einen weißbärtigen Weltenrichter samt himmlischem Gefolge, der sich an deren Qualen zu weiden schien. Doch sonst glich sie bis in Einzelheiten den altvertrauten, einfachen Bildern von dieser Vorhölle, die ihn von Kindheit an begleitet hatten.
Wenn Julien merkte, dass ihm eine Situation zu entgleiten und auf eine seelische Entgleisung zuzusteuern drohte, hatte er im Lauf der Zeit gelernt, wie er sich manchmal selbst helfen konnte. Und so gelang es ihm auch jetzt, mit Mühe und schwer atmend, in dem Kampf gegen die sich ankündigende Rückkehr seiner Albträume die Oberhand zu behalten. Das Wichtigste war, dass er zuerst einmal den Atem unter Kontrolle brachte, das war die Grundlage. Dann konnte er darangehen, seine Blicke in den Griff zu bekommen und sie zurückholen. Denn die hatten bereits begonnen, sich selbständig zu machen und irrten ziellos in dem rätselhaften Chaos zwischen Felsen, Feuern und Rauch herum. Als ihm das gelungen war konnte er das Bild, das sich ihm dort drüben bot, in seinen Einzelheiten erfassen.
Da waren zuerst diese Feuernester. Manche von ihnen saßen direkt oben auf den Felsblöcken oder auch zwischen ihnen, andere, deren Widerschein die Felsen von unten her beleuchtete, loderten unsichtbar in der Tiefe, in den Spalten und Höhlen zwischen den übereinander gehäuften Felsen. Manchmal schlugen von dort unten Flammen empor und sanken gleich wieder in sich zusammen. An ihrer Stelle drängten dann Wolken schwarzen Rauchs empor, die sich windend und drehend, wie dunkle Fahnen, über der Flanke des Berges aufstiegen. Der Wind, der jetzt schwächer in Böen von Südwesten her über die Ebene von Presarella heranfuhr, riss von den brennenden oder glühenden Gerippen der kleinwüchsigen Eichen und immergrünen Büsche glühende Zweige und Blattwerk und nahm sie als aufstiebende Funkenwolken ein Stück bergaufwärts mit, bevor sie im nächtlichen Himmel verglühten. Für einen Augenblick schien es Julien, als stiegen Feuer und Rauch nicht nur aus den Spalten und Klüften auf, sondern kämen von tiefer her, aus dem Inneren des Berges, so, als habe der sich in einen Vulkan verwandelt, und begänne nun an seinen Flanken auszubrechen.
Als er fühlte, wie seine mühsam zurückgewonnene Klarheit und Besonnenheit wieder verloren zu gehen drohte, verharrte er wie erstarrt. Er wusste wohl, dass hinter diesem bestürzenden Schauspiel, das sich ihm da in gerade einmal zweihundert Metern Entfernung bot, die vertraute Welt seiner Alpträume auf ihn lauerte, doch sich davon loszureißen war ihm dennoch schwer.
Nachdem er eine längere Zeit gebannt hinübergestarrt hatte, siegte endgültig seine Neugier und er beschloss, sich dem rätselhaften Ort vorsichtig zu nähern. Um zu einem günstigeren Beobachtungsposten näher am Berg zu kommen, musste er noch einmal in das weglose Gestrüpp der Macchia eintauchen. Also warf er sich aufs Neue in das federnde und nur widerwillig nachgebende Gesträuch des Buschwaldes, das ihn vergeblich zurückzuhalten versuchte. Er verfluchte die hohen Erikabüsche, deren filigrane Wedel sich mit Regenwasser vollgesogen hatten und ihn schon bei der leichtesten Berührung ihrer Äste mit kleinen Schauern kalten Wassers überschütteten. Doch darauf konnte er ebenso wenig Rücksicht nehmen wie auf das Brennen der Schramme über seinem rechten Auge, die ihm eine Brombeerranke gerissen hatte. Erst als ihm das mit Schweiß vermischte Blut brennend ins Auge lief, blieb er stehen und wischte es mit dem Jackenärmel achtlos weg.