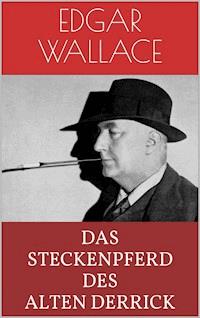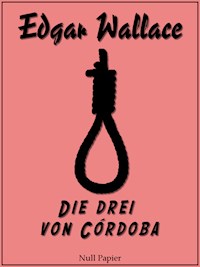
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Edgar Wallace bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
Die drei Gerechten jagen Verbrecher, die der Justiz entkommen sind. Sie sind Richter und Henken in einem. Ihr nächstes Ziel ist Mr. Black, ein Mann, der schon vieles auf dem Kerbholz hat: Erpressung, Diebstahl und Mord. Aber Black nimmt die Warnungen nicht ernst – sein Fehler. Spannend von der ersten bis zu letzten Zeile, nach bester britischer Krimitradition. Null Papier Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 252
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edgar Wallace
Die drei von Córdoba
Edgar Wallace
Die drei von Córdoba
(The Just Men Of Cordova)Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected]Übersetzung: Ravi Ravendro 2. Auflage, ISBN 978-3-954183-30-2
null-papier.de/katalog
Inhaltsverzeichnis
Die Edgar Wallace-Sammelband
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Edgar Wallace bei Null Papier
Die drei von Córdoba
Sammelband
Der Frosch mit der Maske
Der grüne Bogenschütze
Der Zinker
Die Bande des Schreckens
Der unheimliche Mönch
Die seltsame Gräfin
Das indische Tuch
Das Gesetz der Vier
und weitere …
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Die Edgar Wallace-Sammelband
Sammelband
Der Hexer · Neues vom Hexer · Der Frosch mit der Maske · Das Gasthaus an der Themse · Bones
Und über 100 andere Romane und Geschichten
null-papier.de/wallace
1
An einem der Marmortische des ›Café del Gran Capitán‹ in Córdoba saß ein Herr, der viel Zeit zu haben schien. Er war von großer Gestalt und hatte einen gepflegten Bart. Die Blicke seiner ernsten grauen Augen schweiften scheinbar absichtslos die Straße entlang. Ab und zu nippte er an seinem Kaffee und trommelte mit seinen schlanken weißen Händen einen Wirbel auf der Tischplatte.
Er trug einen schwarzen Anzug; sein gleichfalls schwarzer Mantel hatte einen Samtkragen. Die Krawatte war von schwerer schwarzer Seide, die gutgeschnittenen Beinkleider wurden durch Lederstege unter den spitzauslaufenden Schuhen gestrafft, wie es in gewissen Kreisen der Caballeros beliebt war.
Er hätte Spanier sein können, denn graue Augen traf man dort unten häufig an. Die ausgelassenen Irländer, die damals mit den Besatzungstruppen Wellingtons ins Land gekommen waren, hatten sich ja gar nicht so selten mit den feurigen Mädchen von Andalusien verheiratet.
Er sprach ein tadelloses Spanisch, und auch die Art, wie er den wehleidig flehenden Bettler behandelte, der auf ihn zuhumpelte und ihn mit ausgestreckten verkrüppelten Fingern um ein Almosen bat, zeugte von seiner südländischen Abstammung.
»Im Namen der Jungfrau und der Heiligen und des allmächtigen Gottes flehe ich Sie an, Señor, geben Sie mir ein paar Céntimos.«
Der Herr an dem Tisch richtete seine Blicke auf die ausgestreckte Hand.
»Gott wird dir helfen«, sagte er dann in dem Küstenarabisch, das in Spanisch-Marokko gesprochen wird.
»Wenn mir der Himmel ein Leben von hundert Jahren schenken sollte«, erwiderte der Bettler mit monotoner Stimme, »so will ich doch niemals aufhören, für Ihr Wohl zu beten.«
Der Herr in dem Mantel betrachtete jetzt den Alten.
Der Bettler war ein Mann von mittlerer Größe und hatte scharfgeschnittene Gesichtszüge. Sein Kopf war durch einen großen Verband entstellt, der auch das eine Auge bedeckte. Seine Füße waren unförmige Klumpen, mit vielen Bandagen umwickelt. In seinen schmutzigen Händen hielt er einen Stock.
»Señor«, wimmerte er, »ein paar Céntimos können mich von den schrecklichen Hungerqualen befreien. Sie werden diese Nacht keinen Schlaf finden, wenn Sie an den armen, kranken Greis denken, der sich hungrig auf seinem Lager wälzt.«
»Geh in Frieden«, sagte der vornehme Herr geduldig.
»O Erhabener«, seufzte der Bettler wieder, »bei dem Knäblein, das auf dem Schoß der Mutter ruhte« – bei diesen Worten bekreuzigte er sich –, »bei allen Heiligen und dem wundertätigen Blut der Märtyrer, ich flehe Sie an, lassen Sie mich nicht am Wege verhungern, wenn ein paar Céntimos, die Ihnen nicht soviel bedeuten wie der Rand unter dem Fingernagel, mir den Magen mit Essen füllen könnten.«
Der Herr an dem Marmortisch ließ sich nicht erschüttern; ruhig trank er seinen Kaffee aus.
»Geh mit Gott«, sagte er nur.
Aber der Alte zögerte immer noch. Hilflos sah er die Straße auf und ab, dann blickte er in den dunklen, kühlen Raum des Cafés. Am anderen Ende saß ein Kellner nachlässig an einem Tisch und las den ›Heroldo‹.
Der Bettler beugte sich vor und streckte langsam die Hand aus, um einige Kuchenkrümel vom nächsten Tisch aufzulesen.
»Kennst du Doktor Essley?« fragte er plötzlich in perfektem Englisch.
Der andere schaute nachdenklich auf.
»Nein, ich kenne ihn nicht. Warum?« entgegnete er in der gleichen Sprache.
»Du solltest seine Bekanntschaft machen, er ist interessant.«
Weiter sagte der Bettler nichts; er drehte sich um und schlurfte langsam davon.
Der vornehme Herr beobachtete neugierig, wie er sich dem nächsten Café zuwandte. Dann klatschte er laut in die Hände. Der Kellner, der inzwischen über seiner Zeitung eingenickt war, fuhr in die Höhe und nahm die Zahlung und das übliche Trinkgeld entgegen.
Obgleich sich der Himmel wolkenlos zeigte und die Sonne schien, war es in den blaugrauen Schatten der Straße noch empfindlich kalt in diesen ersten Vorfrühlingstagen.
Der Herr erhob sich vom Tisch, ergriff einen Zipfel seines faltigen Mantels und warf ihn sich leicht über die Schulter. Dann ging er langsam hinter dem Bettler her.
Sein Weg führte ihn durch winklige Straßen, die so eng waren, daß die Wagennaben tiefe Rinnen in die Mauern der Häuser gegraben hatten, wenn sich zwei Fuhrwerke begegnet waren.
In der Calle Paraíso holte er den alten Mann ein; er ging an ihm vorüber und bog in eine der Gassen ein, die zu der San-Fernando-Kirche führten. Gemächlich ging er dort hinunter; dann wandte er sich der Carrera del Puente zu und gelangte bald in den Schatten der Kathedrale, die ursprünglich als Moschee errichtet worden war.
Unentschlossen blieb er vor den offenen Toren zu den Höfen stehen; er schien im Zweifel zu sein, wohin er sich wenden sollte. Schließlich drehte er sich um und ging zur Calahorrabrücke hinunter, die den Fluß mit ihren sechzehn Bogen schnurgerade überspannte. Sie stammte noch aus der Zeit der Mauren und war von diesen erbaut. Als er die Mitte der Brücke erreicht hatte, lehnte er sich über das Geländer und schaute lässig auf die angeschwollenen gelben Fluten des Guadalquivir hinab.
Heimlich aber beobachtete er, wie der Bettler auf ihn zuhumpelte. Es dauerte sehr lange, denn der Alte kam nur langsam von der Stelle. Endlich stand er an seiner Seite und hielt ihm die Hand entgegen. Seine Haltung war die eines gewöhnlichen Bettlers, aber seine Sprache die eines gebildeten Engländers.
»Manfred«, sagte er ernst, »du mußt diesen Essley sehen. Ich bitte dich aus einem ganz bestimmten Grund darum.«
»Wer ist denn das?« Der Bettler lächelte.
»Ich muß mich zum größten Teil auf mein Gedächtnis verlassen. Die Bibliothek in meiner armseligen Wohnung ist etwas beschränkt. Aber ich habe die dunkle Erinnerung, daß er Arzt in einer Vorstadt Londons ist. Scheint ein kluger Kopf zu sein.«
»Und was macht er hier?«
Gonsalez, der sich hinter der Maske dieses unscheinbaren Bettlers verbarg, lächelte wieder.
»Hier in Córdoba lebt ein Doktor Cajalos. In die vornehme Umgebung des Paseo del Gran Capitán, wo du deine luxuriöse Wohnung hast, dringt natürlich kein Gerücht aus der Unterwelt von Córdoba. Hier«, – er zeigte auf die baufälligen Dächer und die schmutzigen, schiefen Häuser am anderen Ende der Brücke – »im Campo de la Verdad, wo die Leute mit zehn Peseten die Woche zufrieden leben können, kennt man den Doktor Cajalos. Er wird in allen Häusern und Familien verehrt – ein bewunderungswürdiger Mensch, der mit seiner Kunst Wunder vollbringt. Er macht die Blinden sehend, entlarvt durch seine Macht die Schuldigen, bereitet unfehlbare Liebestränke, bespricht Warzen und Geschwüre.«
»Selbst in der Gegend des Paseo del Gran Capitán wird er geachtet.« Manfred zwinkerte mit den Augen. »Ich habe ihn selbst aufgesucht und um Rat gefragt.«
Der Bettler war ein wenig erstaunt.
»Du bist tüchtiger, als ich dachte«, sagte er bewundernd. »Wann warst du bei ihm?«
Manfred lachte leise.
»Vor einigen Wochen stand in einer bestimmten Nacht ein Bettler vor der Haustür des Arztes auf der Straße und wartete geduldig auf das Wiedererscheinen eines geheimnisvollen Besuchers, der sich bis zur Nasenspitze in seinen Mantel eingehüllt hatte.«
»Ja, ich kann mich besinnen.« Gonsalez nickte. »Es war ein Fremder aus Ronda, und ich war neugierig. Hast du beobachtet, daß ich ihm folgte?«
»Ich sah dich von der Seite«, entgegnete Manfred ernst.
»Warst denn du der Fremde?« fragte Gonsalez, aufs höchste überrascht.
»Ja. Ich verließ damals Córdoba, um nach Córdoba zurückzukommen.«
Gonsalez schwieg einen Augenblick.
»Ich gebe mich geschlagen«, sagte er dann. »Du kennst also Doktor Cajalos. Begreifst du nun, warum ein gewöhnlicher englischer Arzt nach Córdoba kommt? Essley ist auf dem schnellsten Wege und ohne Aufenthalt mit dem Algeciras-Expreß gereist. Morgen früh bei Tagesanbruch wird er Córdoba auf dieselbe eilige Weise wieder verlassen. Er ist hierhergekommen, um Doktor Cajalos zu konsultieren.«
»Poiccart ist hier; er interessiert sich auch für diesen Essley – und zwar so sehr, daß er sich, den Reiseführer in der Hand, friedlich von Fremdenführern umherführen läßt, die ihm ja doch nur ungenaue Auskunft geben können.«
Manfred strich seinen kleinen Bart, und seine klugen Augen hatten wieder denselben ernsten, nachdenklichen Ausdruck wie vorher, als er Gonsalez von seinem Platz im ›Café del Gran Capitán‹ aus nachgesehen hatte.
»Ohne Poiccart würde das Leben langweilig sein«, sagte er.
»Ja, da hast du recht – o Señor, mein ganzes Leben soll Ihrem Lobe geweiht sein, und meine Gebete für Sie sollen wie Weihrauchwolken zum Throne des Allmächtigen emporsteigen.«
Er verfiel plötzlich wieder in seinen jammernden Tonfall, denn ein Polizist der Guardia Municipal näherte sich ihnen und warf einen mißtrauischen Blick auf den Bettler, der mit ausgestreckter Hand erwartungsvoll dastand.
Manfred schüttelte den Kopf, als der Polizist herankam.
»Geh in Frieden.«
»Du Hund«, rief der Polizist und packte den Bettler mit rauher Hand an der Schulter, »du Sohn eines Diebes, mach, daß du fortkommst, damit deine übelriechende Gegenwart nicht die Nase dieses hohen Herrn beleidigt!«
Er stemmte die Arme in die Seite und sah dem davonhinkenden Krüppel nach, dann wandte er sich an Manfred.
»Wenn ich diesen Lumpen nur eher gesehen hätte, Señor, hätte ich Sie schon längst von ihm befreit.«
»Es ist nicht der Rede wert«, erwiderte Manfred in herkömmlicher Weise.
Der Polizist strich sich mit der einen Hand den kleinen Schnurrbart.
»Ich habe es nicht leicht, die reichen und freigebigen Caballeros vor diesen Kerlen zu bewahren …«
Manfred ließ ein Geldstück in die Hand des Polizisten gleiten.
Der Mann ging bis zum Ende der Brücke neben ihm her. Sie blieben dann plaudernd an dem Hauptportal der Kathedrale stehen.
»Sie sind wohl nicht aus Córdoba, Señor?«
»Aus Malaga«, erwiderte Manfred ohne Zögern.
»Meine Schwester war mit einem Fischer in Malaga verheiratet«, erzählte der Polizist. »Ihr Mann ist ertrunken. – Sind Sie schon einmal in Gibraltar gewesen?«
Manfred nickte. Er blickte interessiert auf eine Gesellschaft von Touristen, denen die Pracht der Puerta del Perdón gezeigt wurde.
Einer der Fremden löste sich von der Gruppe der übrigen und kam auf sie zu. Er war ein Mann von mittlerer Größe und kräftiger, untersetzter Gestalt. In seinem Wesen lag eine sonderbare Zurückhaltung, und in seinem Gesicht drückte sich eine gewisse melancholische Ruhe aus.
»Können Sie mir den Weg zum Paseo del Gran Capitán sagen?« fragte er in schlechtem Spanisch.
»Ich gehe selbst dorthin«, erklärte Manfred höflich. »Wenn Sie mich begleiten wollen …«
»Ich wäre Ihnen zu großem Dank verpflichtet«, entgegnete der andere.
Manfred dankte dem Polizisten nochmals, dann gingen die beiden Männer davon.
Sie sprachen über die verschiedensten Dinge, über das Wetter und den schönen Anblick der Kathedrale.
»Du mußt mitkommen und Essley sehen«, sagte der Tourist plötzlich unvermittelt in perfektem Spanisch.
»Erzähle mir doch etwas von ihm«, erwiderte Manfred. »Im Vertrauen gesagt – du hast meine Neugierde geweckt.«
»Es ist eine wichtige Angelegenheit«, entgegnete Poiccart ernst. »Essley ist Arzt in einer Vorstadt von London. Ich habe ihn seit Monaten beobachtet. Er hat nur eine kleine, recht unbedeutende Praxis; augenscheinlich ist das nicht sein Hauptberuf. Außerdem hat er eine merkwürdige Vergangenheit. Er hat in London studiert und ist gleich nach dem Examen mit einem gewissen Henley nach Australien gegangen. Henley war ganz heruntergekommen und im Examen durchgefallen, aber die beiden waren gute Freunde. Das erklärt wahrscheinlich auch, daß sie zusammen auswanderten, um ihr Glück in der Fremde zu suchen. Essley stand völlig allein, und Henley hatte nur einen reichen Onkel irgendwo in Kanada, den er aber niemals gesehen hatte. Sie kamen in Melbourne an und gingen ins Innere des Landes. Sie wollten in den neuen Goldfeldern ihr Heil versuchen, die damals gerade erschlossen wurden. Drei Monate später kam Essley allein dort an – sein Freund war unterwegs gestorben!
Er scheint in den nächsten drei oder vier Jahren keine Praxis begonnen zu haben. Ich habe seine Wanderungen von einem Goldsucherlager zum anderen verfolgen können. Er arbeitete ein wenig und verspielte dann wieder alles. Er wurde allgemein ›Doktor S.‹ genannt – wahrscheinlich eine Abkürzung für ›Essley‹. Erst als er nach Westaustralien kam, machte er den Versuch, sich als Arzt niederzulassen. Seine Praxis war nicht gerade groß, aber sie brachte ihm doch etwas ein. Nach einiger Zeit verschwand er jedoch aus Coolgardie, und erst acht Jahre später tauchte er in London wieder auf.«
Inzwischen hatten sie den Paseo del Gran Capitan erreicht. Die Straßen waren jetzt belebter.
»Ich habe ein paar Zimmer hier gemietet«, sagte Manfred. »Komm mit und trink eine Tasse Tee bei mir.«
Seine Wohnung lag über einem Juwelierladen in der Calle Morería. Die Räume waren schön ausgestattet.
»Besonderen Wert habe ich auf Bequemlichkeit gelegt«, erklärte Manfred, als er aufschloß. Gleich darauf setzte er einen silbernen Kessel auf eine elektrische Kochplatte.
»Der Tisch ist ja für zwei gedeckt?« fragte Poiccart erstaunt.
»Ich erwarte Besuch«, erwiderte Manfred lächelnd. »Manchmal wird unserem lieben Leon das Bettlerleben lästig, dann kommt er als repräsentables Mitglied der Gesellschaft mit der Bahn in Córdoba an, um den Luxus des Lebens wieder einmal zu genießen – und mir seine Geschichten zu erzählen. Aber ich möchte gern noch mehr von Essley hören, lieber Poiccart, ich interessiere mich sehr für ihn.«
Der ›Tourist‹ setzte sich in einen tiefen und bequemen Sessel.
»Wo war ich doch gleich stehengeblieben? Ach ja – Doktor Essley verschwand aus Coolgardie und tauchte dann acht Jahre später in London wieder auf.«
»Unter außergewöhnlichen Umständen?«
»Nein, das gerade nicht. Er wurde damals von einem neuen Gewaltigen der Londoner Geschäftswelt lanciert.«
»Etwa von Oberst Black?« fragte Manfred stirnrunzelnd.
»Ja. Diesem Mann verdankt Essley seine Praxis. Er erregte zum erstenmal meine Aufmerksamkeit –«
Es klopfte an der Tür, und Manfred hob warnend den Finger. Er ging hin und öffnete. Der Portier stand draußen, die Mütze in der Hand. Hinter ihm, ein wenig weiter unten auf der Treppe, war ein Fremder zu sehen – anscheinend ein Engländer.
»Señor, ein Herr möchte Sie sprechen.«
»Ich stehe zu Ihren Diensten«, antwortete Manfred, indem er den Besucher auf spanisch anredete.
»Ich kann leider nicht gut Spanisch«, sagte der Mann auf der Treppe.
»Wollen Sie bitte näher treten?«
Manfred sprach nun englisch.
Der Fremde stieg langsam herauf.
Er war etwa fünfzig Jahre alt, hatte langes graues Haar und buschige Augenbrauen. Sein stark hervortretender Unterkiefer machte sein Gesicht nicht gerade einnehmend. Er trug einen schwarzen Anzug und hielt einen breitkrempigen, weichen Filzhut in der behandschuhten Hand.
Als er eingetreten war, blickte er forschend von einem zum andern.
»Mein Name ist Essley«, stellte er sich dann vor.
Er zögerte etwas bei dem doppelten S, so daß das Wort zischend und hart klang.
»Essley«, sagte er noch einmal, als ob er eine besondere Genugtuung bei der Wiederholung seines Namens empfände.
Manfred wies mit der Hand auf einen Stuhl, aber der Fremde schüttelte den Kopf.
»Ich möchte mich nicht setzen«, sagte er schroff. »Wenn ich geschäftlich verhandle, stehe ich lieber.«
Er sah argwöhnisch auf Poiccart.
»Ich möchte Sie in einer privaten Angelegenheit sprechen«, sagte er mit einer gewissen Betonung.
»Mein Freund genießt mein volles Vertrauen«, entgegnete Manfred.
Essley nickte unwillig.
»Ich habe gehört, daß Sie Kriminalwissenschaftler sind und auch eingehende Kenntnisse über Spanien besitzen.«
Manfred zuckte die Schultern. In der Rolle, die er augenblicklich spielte, genoß er einiges Ansehen als wissenschaftlicher Schriftsteller. Er hatte unter dem Namen ›de la Monte‹ ein Buch ›Modernes Verbrechertum‹ veröffentlicht.
»Als ich dies erfuhr, reiste ich nach Córdoba«, erklärte Dr. Essley. »Ich habe hier zwar noch andere Dinge zu erledigen, aber die sind nicht so wichtig.«
Er sah sich jetzt doch nach einem Sessel um. Manfred bot ihm einen an, und sein Besucher nahm Platz, indem er sich mit dem Rücken zum Fenster setzte.
»Mr. de la Monte, Sie besitzen eine umfassende Kenntnis des Verbrechens.«
Der Doktor lehnte sich vor und faltete seine Hände über dem Knie.
»Ich habe ein Buch darüber geschrieben, aber das besagt noch nicht unbedingt, daß ich große Kenntnisse besitzen muß«, erwiderte Manfred.
»Das habe ich befürchtet«, entgegnete der andere barsch. »Ich war auch besorgt, daß Sie vielleicht nicht Englisch sprächen. Nun möchte ich eine offene Frage an Sie richten, und ich erwarte von Ihnen eine ebenso offene Antwort.«
»Soweit ich dazu imstande bin, will ich sie Ihnen gerne geben.«
Das Gesicht des Arztes zuckte nervös.
»Haben Sie jemals etwas von den ›Vier Gerechten‹ gehört?«
Es trat eine kurze Pause ein.
»Ja, ich habe von ihnen gehört.«
»Sind sie in Spanien?« fragte der Doktor mit schriller Stimme.
»Das weiß ich nicht genau. Warum fragen Sie?«
»Weil ich …« Der Arzt zögerte. »Nun, ich interessiere mich für die Leute. Man sagt, daß sie Verbrechen aufspüren, die die Gerichte nicht bestrafen. Sie … sie … töten ihre Opfer auch – wie?«
Seine Stimme war noch schärfer geworden, und er kniff die Augenlider so weit zusammen, daß er nur noch durch Schlitze zu sehen schien.
»Es ist bekannt, daß eine solche Organisation besteht«, antwortete Manfred, »und man weiß auch, daß die ›Vier Gerechten‹ sich mit ungesühnten Verbrechen beschäftigen – und daß sie Strafen verhängen.«
»Auch – die Todesstrafe?«
»Sie wenden auch die Todesstrafe an«, erwiderte Manfred ernst.
»Und dabei laufen sie frei herum?« Dr. Essley sprang erregt auf und gestikulierte heftig mit den Händen. »Sie laufen frei herum und werden nicht bestraft? Bei allen modernen Methoden der Polizei kann man sie nicht fassen? Sie wagen es, sich selbst zu Richtern aufzuwerfen und andere Leute zu verurteilen? Wer hat ihnen das Recht dazu gegeben? Es gibt doch noch Gesetze, und wenn sich jemand gegen sie vergeht –«
Er hielt plötzlich inne, zuckte die Schultern und sank schwer in seinen Sessel zurück.
»Soweit ich erfahren habe«, fuhr er nach einer Weile fort, »bilden sie keine Macht mehr. Sie sind in allen Ländern geächtet – alle Polizeibehörden haben Steckbriefe gegen sie erlassen.«
Manfred nickte.
»Das stimmt«, sagte er höflich, »aber ob sie keine Macht mehr haben, das kann nur die Zeit lehren.«
»Es sind drei.« Der Doktor schaute bei diesen Worten schnell auf. »Für gewöhnlich finden sie noch einen vierten – einen Mann, der großen Einfluß hat.«
Manfred nickte wieder.
»Das habe ich auch gehört.«
Dr. Essley rückte unruhig in seinem Sessel hin und her. Man sah deutlich, daß er nicht die gewünschte Auskunft oder Versicherung erhalten hatte und nun stark beunruhigt war.
»Und sie sind in Spanien?« fragte er.
»Man sagt es.«
»Sie sind nicht in Frankreich, nicht in Italien, nicht in Deutschland, in keinem der skandinavischen Länder«, rief Dr. Essley. »Sie müssen in Spanien sein.«
Eine Weile brütete er schweigend vor sich hin.
»Verzeihen Sie«, sagte Poiccart, der bis dahin still zugehört hatte, »Sie scheinen sich außerordentlich für die ›Vier Gerechten‹ zu interessieren. Nehmen Sie bitte meine Frage nicht übel – warum liegt Ihnen soviel daran, ihren Aufenthaltsort zu erfahren?«
»Es ist reine Neugierde«, erwiderte der Arzt schnell. »In gewisser Beziehung studiere ich nämlich auch das Verbrechen – wie Mr. de la Monte.«
»Da sind Sie aber ein erstaunlich eifriger Student«, meinte Manfred.
»Ich hatte gehofft, daß Sie in der Lage sein würden, mir zu helfen«, fuhr Essley fort, ohne Manfreds anzügliche Bemerkung zu beachten. »Aber ich habe nur von Ihnen erfahren, daß die ›Vier Gerechten‹ in Spanien sind, und auch das ist weiter nichts als eine Vermutung.«
»Vielleicht sind sie auch gar nicht in Spanien«, sagte Manfred, als er seinen Besucher zur Tür begleitete. »Vielleicht existieren sie nicht einmal. Ihre Furcht ist wahrscheinlich völlig unbegründet.«
Der Doktor fuhr herum. Er war kreidebleich geworden.
»Furcht?« Essley atmete schnell. »Sagten Sie etwas von Furcht?«
»Es tut mir leid«, antwortete Manfred lachend, »vielleicht kann ich mich englisch nicht so korrekt ausdrücken.«
»Warum sollte ich sie denn fürchten?« fragte der Doktor gereizt. »Ihre Worte waren wirklich unglücklich gewählt. Ich brauche mich weder vor den ›Vier Gerechten‹ noch vor sonst jemand zu fürchten.«
Er stand keuchend in der offenen Tür. Mit sichtlicher Anstrengung riß er sich zusammen; er zögerte noch einen Augenblick und verabschiedete sich dann mit einer steifen Verbeugung.
Er ging die Treppe hinunter, trat auf die Straße und eilte zu seinem Hotel hinüber. An der Ecke stand ein Bettler, der müde die Hand hob.
»Um Gottes und der Heiligen willen«, wimmerte er.
Fluchend schlug Essley mit seinem Stock nach der Hand, traf sie aber nicht, denn der Bettler war außergewöhnlich schnell. Gonsalez war zwar bereit, alle mögliche Unbill auf sich zu nehmen, aber Narben und Striemen wünschte er keinesfalls an seinen zarten Händen zu haben.
*
Als Essley in seinem Zimmer angekommen war, schloß er die Tür ab und ließ sich in einen Sessel fallen, um nachzudenken. Er verwünschte seine eigene Torheit – es war ein wahnsinniger Fehler, die Fassung zu verlieren, selbst in Gegenwart eines so unbedeutenden Menschen wie dieses spanischen Dilettanten, der etwas von Kriminalwissenschaft verstehen wollte.
Der erste Teil seiner Aufgabe war beendet – er mußte sich eingestehen, daß er keinen Erfolg gehabt hatte. Aus der Tasche seines Mantels nahm er einen Reiseführer für Spanien und blätterte darin, bis er den Stadtplan von Córdoba fand. An der gleichen Stelle lag noch ein anderer Plan in dem Band; er war anscheinend von jemand gezeichnet worden, der besser mit der Örtlichkeit selbst als mit der Kunst des Kartenzeichnens vertraut war.
Von Dr. Cajalos hatte er zum erstenmal durch einen spanischen Anarchisten gehört, den er auf seinen merkwürdigen nächtlichen Streifzügen durch London getroffen hatte. Nachdem er mit dem Mann eine Flasche Wein getrunken hatte, erzählte dieser von den ans Wunderbare grenzenden Kräften des Hexenmeisters von Córdoba und erwähnte dabei Dinge, die das lebhafteste Interesse des Arztes fanden. Er hatte daraufhin einen Briefwechsel mit Dr. Cajalos begonnen, und nun war er hier, um ihn persönlich aufzusuchen.
Essley schaute auf die Uhr. Es war beinahe sieben. Er wollte erst zu Abend speisen und sich dann umziehen. Schnell wusch er sich, doch drehte er trotz der hereinbrechenden Dunkelheit das Licht nicht an. Dann ging er in den Speisesaal.
Er saß an einem Tisch für sich allein und vertiefte sich sofort in eine englische Zeitschrift, die er mitgebracht hatte. Ab und zu machte er bei der Lektüre Notizen in ein kleines Buch, das neben seinem Teller lag. Seine Aufzeichnungen standen aber weder in Beziehung zu dem Artikel, den er las, noch zu den medizinischen Wissenschaften; sie handelten vielmehr von der finanziellen Seite eines Plans, der ihm eben in den Sinn kam.
Nach dem Essen bestellte er noch Kaffee. Dann erhob er sich, steckte das kleine Notizbuch in die Tasche, nahm die Zeitschrift und ging auf sein Zimmer zurück. Dort drehte er das Licht an und zog die Vorhänge zu. Er stellte einen kleinen Tisch unter die Lampe und holte aus seinem Koffer eine Menge engbeschriebener Blätter, die er vor sich ausbreitete. Auch sein Notizbuch holte er wieder hervor. Er arbeitete mehrere Stunden. Dann hielt er plötzlich inne, als ob er von einem unsichtbaren Wecker an seine Verabredung erinnert worden wäre.
Schnell packte er die Papiere fort, zog einen Mantel an und drückte sich den weichen Filzhut tief ins Gesicht. Er verließ das Hotel und schlug den Weg nach der Calahorrabrücke ein. Die Straßen, die er durchschritt, lagen einsam und verlassen da; er zögerte nicht im geringsten, denn er hatte seinen Plan vorher eingehend studiert.
Er tauchte in einem Gewirr von engen Straßen unter, und erst am Eingang einer dunklen Sackgasse hielt er einen Augenblick an. Eine düstere Straßenlampe im Hintergrund machte die Gasse noch unheimlicher. Zu beiden Seiten erhoben sich hohe, fast fensterlose Häuser, deren Türen in finsteren Nischen lagen. Nach kurzem Zaudern klopfte Essley zweimal an eine Tür zur Linken.
Sie öffnete sich sofort geräuschlos.
Wieder zögerte er.
»Treten Sie ein«, sagte eine Stimme auf spanisch, »Sie brauchen sich nicht zu fürchten.«
Essley ging hinein, und die Tür schloß sich hinter ihm.
»Kommen Sie mit.«
Der Doktor konnte in der Dunkelheit nur undeutlich die Gestalt eines kleinen alten Mannes wahrnehmen. Er ging weiter und wischte sich dabei den Schweiß von der Stirn.
Der alte Mann knipste eine Lampe an, und Essley betrachtete ihn nun genauer. Er war zwergenhaft klein. Ein ungepflegter, langer weißer Bart bedeckte seine Brust; der Kopf war völlig kahl, so glatt wie eine Kugel. Das schmutzige Gesicht, die unsauberen Hände, die ganze Erscheinung zeugten davon, daß er kein Freund von Wasser war.
Ein paar schwarze, tiefliegende Augen funkelten den Doktor an. Die vielen kleinen Lachfältchen um die Augenwinkel deuteten an, daß er auch lustig sein konnte. Das war also Dr. Cajalos, ein Mann, der in Spanien berühmt war.
»Nehmen Sie Platz«, sagte Dr. Cajalos. »Wir wollen in Ruhe miteinander sprechen. Für später hat sich eine vornehme Dame angemeldet, die mich konsultieren will.«
Essley ließ sich nieder, und Dr. Cajalos setzte sich auf einen hohen Schemel. Er bot einen sonderbaren Anblick mit seinen herunterhängenden kleinen Beinen, seinem steinalten Gesicht und seinem kahlen, glatten Schädel.
»Ich schrieb Ihnen über gewisse toxikologische Experimente –«, begann Essley, aber Dr. Cajalos unterbrach ihn.
»Sie kommen wegen eines Mittels, das ich bereitet habe«, sagte er. »Es ist ein Präparat aus …«1
Essley sprang auf. »Ich … ich habe … Ihnen davon nichts geschrieben«, stammelte er.
»Der grüne Teufel hat mir das erzählt; ich unterhalte mich oft mit den Bettlern, und da erfahre ich vieles von Bedeutung«, erwiderte Dr. Cajalos ernst.
»Ich dachte –«
»Sehen Sie her!«
Der Alte kletterte behende von seinem hohen Schemel herunter und ging in eine dunkle Ecke des Zimmers, wo einige Kisten standen. Essley hörte ein scharrendes Geräusch. Nach einiger Zeit kam Dr. Cajalos mit einem zappelnden Kaninchen zurück, das er an den Ohren gepackt hatte.
Mit der freien Hand entkorkte er eine kleine grüne Flasche und stellte sie auf den Tisch. Dann nahm er eine Feder, tauchte sie bedächtig in die Flüssigkeit und berührte mit ihrer Spitze vorsichtig die Nase des Kaninchens, die jedoch kaum benetzt wurde.
Sofort wurde das Tier ohne irgendwelchen Krampf steif, als ob durch die Berührung plötzlich alles Leben aus dem Körper gewichen sei. Cajalos verschloß die Flasche und warf die Feder in den Ofen, der in der Mitte das Raumes stand und mit Holzkohle geheizt wurde.
»Es ist ein Gift«, sagte er zu Essley, »das ich entdeckt habe.«
Er legte das vergiftete Kaninchen seinem Besucher vor die Füße.
»Señor«, sagte er stolz, »nehmen Sie das Tier und untersuchen Sie es; stellen Sie alle nur irgend möglichen Proben damit an – Sie werden nicht die geringste Spur des Alkaloids entdecken können, durch das es getötet wurde.«
»Das stimmt nicht«, entgegnete Essley, »denn es bleibt eine Zusammenziehung der Pupille, und die ist ein absolut sicheres Zeichen.«
»Suchen Sie doch danach! Sehen Sie sich doch die Augen des Tieres an!« rief der Alte triumphierend.
Essley untersuchte das Kaninchen, aber er konnte selbst dieses sonst so untrügliche Merkmal nicht finden.
*
Eine dunkle Gestalt drückte sich draußen dicht an die Wand und lauschte. Der Mann stand an dem Fensterladen und hielt ein Hörrohr ans Ohr. Das andere Ende, das von einer Gummihülle umgeben war, preßte er gegen den hölzernen Fensterladen.
Eine halbe Stunde stand er fast reglos dort, dann zog er sich leise zurück und verschwand im Schatten der Orangensträucher, die in der Mitte des langen Gartens standen.
Gleich darauf wurde die Haustür aufgeschlossen; Dr. Cajalos geleitete seinen Besucher wieder auf die Straße.
»Die Teufel sind mächtiger als je«, sagte der Alte und kicherte unheimlich. »Es werden sich bald verschiedene Dinge ereignen, mein Lieber!«
Essley erwiderte nichts. Er war begierig, wieder ins Freie zu kommen, und zitterte vor Ungeduld, als der Alte die schwere Tür öffnete. Nachdem sie sich endlich aufgetan hatte, eilte er auf die Straße.
»Leben Sie wohl!« sagte er.
»Sie auch, mein Freund!« entgegnete der Alte und schloß lautlos die Tür.
In der ersten Auflage dieses Buches wurde der Name des Giftes genannt. Es ist dem Autor aber von verschiedenen Seiten bedeutet worden, daß es nicht wünschenswert erscheine, den genauen Namen anzugeben. Der Autor hat sich diesen Vorstellungen nicht verschließen können. Das Gift ist den Augenärzten wohlbekannt, und seine Wirkung ist in diesem Buch richtig beschrieben. <<<
2
Die Firma Black & Gram genoß in der Londoner City ein gewisses Ansehen. Was Gram betraf, so war er ein Mensch ohne Tadel – ein edelmütiger Mann und ein großzügiger Wohltäter. Aber Black beklagte sich mit einiger Entrüstung, daß Gram ihn durch seine verrückte Freigebigkeit eines Tages noch ruinieren werde.
Gram erlaubte seinem guten Herzen, seinen Verstand zu regieren; er war zu weich und nachgiebig als Geschäftsmann. In der City beurteilte man Gram daher skeptisch; man verglich ihn mit einer gutmütigen alten Dame. Aber Black kümmerte sich nicht weiter darum, sondern lächelte nur geheimnisvoll zu all den Anzüglichkeiten, die er zu hören bekam, und fuhr fort, über seinen Kompagnon zu klagen. Er mißbilligte Grams offensichtliche Anstrengungen, trotz der vielen Gerüchte, die über Oberst Black im Umlauf waren, für einen guten Ruf der Firma zu sorgen.
Diesen Titel hatte sich Black selbst beigelegt, obgleich er in der Rangliste des Heeres nicht geführt wurde. Auch in den umfangreichen Verzeichnissen von Ehrentiteln der amerikanischen Armee fand man seinen Namen nicht.
Die Firma Black & Gram hatte sich ursprünglich auf den Handel mit Effekten und Aktien beschränkt. Sie empfahl ihren Kunden bestimmte Papiere, und die Leute kauften oder verkauften je nach dem Rat, den die Firma gab. Nach einer gewissen Zeit erhielten sie dann von Black & Gram ein höfliches Schreiben, worin bedauert wurde, daß ihr bei der Firma hinterlegter Betrag erschöpft sei. Gleichzeitig wurden die Kunden dringend aufgefordert, ihre Verbindlichkeiten, die auf nicht näher erklärte Weise entstanden waren, so schnell wie möglich zu regeln.