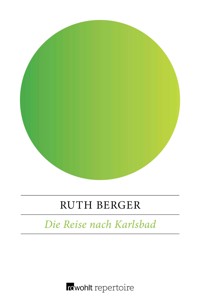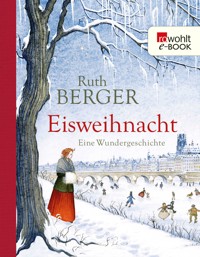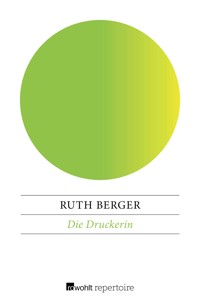
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Liebe, Mord und Kabbala Blume Liebes, die Druckerwitwe aus angesehener Rabbinerfamilie, war schon immer eigensinnig. Und jetzt hat sie sich in den Kopf gesetzt, ausgerechnet den menschenscheuen Außenseiter Nate zu heiraten, der sie auf unerklärliche Weise fasziniert. Zu spät erfährt sie, dass er mit einem schrecklichen Kainsmal gezeichnet ist. Hat Nate, früher ein vielversprechender junger Gelehrter, wirklich den Sohn des Menachem Mendel erschlagen, des großen Meisters der Kabbala?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 559
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Ruth Berger
Die Druckerin
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Liebe, Mord und Kabbala
Blume Liebes, die Druckerwitwe aus angesehener Rabbinerfamilie, war schon immer eigensinnig. Und jetzt hat sie sich in den Kopf gesetzt, ausgerechnet den menschenscheuen Außenseiter Nate zu heiraten, der sie auf unerklärliche Weise fasziniert. Zu spät erfährt sie, dass er mit einem schrecklichen Kainsmal gezeichnet ist. Hat Nate, früher ein vielversprechender junger Gelehrter, wirklich den Sohn des Menachem Mendel erschlagen, des großen Meisters der Kabbala?
«Eine wunderbare Kriminalgeschichte aus ferner Zeit.» Der Tagesspiegel
Über Ruth Berger
Ruth Berger ist Historikerin und lebt in Frankfurt. Als Ausgleich zu ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit hat sie angefangen, historische Romane zu schreiben – mit großem Erfolg: Über ihr Buch «Die Reise nach Karlsbad» urteilte die BRIGITTE: «Ruth Berger lässt das frühe 19. Jahrhundert so schön lebendig werden, dass man Karlsbad gar nicht mehr verlassen will. Wann kommt die Fortsetzung?»
Inhaltsübersicht
1
Es ist Jahrmarkt in Kamenka und die Stadt quillt über vor Menschen. Die Herbergen sind überfüllt, man schläft dicht an dicht auf den bloßen Bodendielen, auf den Bänken und Tischen, in den Gängen, dass kein Durchkommen ist vor lauter Leibern und Bündeln und Körben, und die Luft in den Räumen steht stickig und schwer, gesättigt mit dem Dunst von Schweiß, Knoblauch und Branntwein. In den Höfen und Ställen drängen sich Pferde und Ochsen zwischen den Wagen, es grunzt und schnaubt, wiehert und röhrt, Mist bedeckt jede freie Stelle. Der frische riecht noch, der von gestern und vorgestern ist schon getrocknet, denn es hat nicht geregnet, und bald wird man ihn als Brennmaterial einsammeln können. Das Kleinvieh zum Verkauf, Hühner, Gänse und Ziegen, nehmen die Händler oft mit in den Gastraum. Die einzige Schänke ist von Mittag bis Mittag geöffnet, und wer woanders keine Unterkunft gefunden hat, verbringt hier die Nächte. Am Rand der Stadt, hinter den Festungsmauern an der Straße gen Osten, hat ein fahrendes Bordell aufgemacht, dessen Besitzer, ein Hüne mit einer silberbeschlagenen Pistole im Gürtel, allmorgendlich Münze für Münze die Einnahmen des Vortags durchzählt, Kupfer, Silber und Gold genau taxiert und sich ausrechnet, ob es wohl reichen wird bis zum nächsten Jahrmarkt, drei Wochen später in Winniza, und er genügend zurücklegen kann für den langen Winter, der ihn an einen festen Standplatz bindet und die Einkünfte auf ein mickriges Geklecker reduziert.
Seine Kundschaft hier in Kamenka ist, wie üblich am südlichen Dnjestr, ein sehr gemischtes Völkchen. Wenn man im Jahrmarktsgetümmel durch die Straßen wandert, hört man Judendeutsch, Ukrainisch und Polnisch. Spitzt man die Ohren, mischen sich noch Tatarisch, Rumänisch und einiges andere Kauderwelsch darunter. Wer was spricht, erkennt man oft schon an der Tracht. Trotz der Hitze der letzten Tage haben sich Einheimische wie Zugereiste prächtig herausgeputzt. Jeder trägt die Insignien seiner Nation und seines Standes in mehreren Schichten am Körper; selbst die Pelzhüte der Juden und Kosaken dürfen nicht fehlen.
Im größten Trubel am Marktplatz quält sich eine Frau mit einem Kind an der Hand durch die Menge, auch sie gekleidet, wie es eigentlich nur am Feiertag angemessen wäre. Ihre Haube ist aus Brokat und reich mit Blütenmustern in Hellgelb, Grün und Rosa bestickt, dazwischen funkeln Perlen und Rubine. Um den Hals trägt sie eine Goldkette, an der ebenfalls Rubine prangen. Ihre blaue Joppe glänzt und ist an den Ärmeln und am Kragen mit Spitze besetzt, ihre Schürze aus Batist mit Stickereien und Bändern verziert. Es ist Blume Liebes, die Druckerin, Witwe des Abraham Abusch Drucker, mit ihrem Sohn Eisik. Halbwegs wohlhabend ist sie, besitzt ein Haus als Mitgiftgut aus dem Erbe ihrer Mutter sowie die Presse und Lettern von ihrem verstorbenen Mann. Ihre Druckerei mag klein sein, aber sie ist immer voll ausgelastet, sodass ihr nächster Konkurrent, der Friedel Ostrer flussaufwärts in Jampol, schon manchen Fluch über sie gesprochen hat. Auch ist sie aus angesehener Familie: Ihr Vater war einmal Richter zu Nikolsburg, ihr Großvater mütterlicherseits war der Autor der berühmten Schrift Me’or Enajim, das ist: Erleuchtung der Augen, und ein herausragender Gelehrter. Grund zu Stolz aber hat sie dennoch wenig, und manch einer verübelt ihr, wie sie erhobenen Hauptes und geschmückt wie eine Herrin über den Markt spaziert, das Mal ihrer Schande an der Hand. Der Eisik nämlich wird die Druckerei seiner Eltern nicht übernehmen können, geschweige denn ein Gelehrter werden wie so viele seiner Vorfahren. Er kann nicht einmal lesen, obwohl er schon acht, neun Jahre alt ist, denn er ist schwachsinnig. Man sieht es gleich, er ist ein typischer Fall, mit groben Gesichtszügen und einer zu kurzen, platten Nase, kleinen, schielenden Augen, die zur Nase hin von schräg verlaufenden Lidern begrenzt werden, und offenem Mund, aus dem manchmal die Zunge hervorlugt und der Speichel trieft. Hölzern bewegt sich sein plumper Körper, während er von seiner Mutter durchs Gedränge geschoben und gezogen wird. Einmal will er nicht weiter, lässt sich, wo er steht, auf die Erde nieder und stiert mit weinerlich verzogenem Gesicht nach unten. Die Leute müssen sich um das Hindernis herumquälen und schimpfen lauthals. Dabei gelten ihre Flüche weniger dem nichtsnutzigen Kind als seiner Mutter, die es gewähren lässt, statt ihm mit ein paar Schlägen das Herumsitzen auszutreiben. Blume Liebes aber weiß, dass sie ihren Sohn nach einer Ohrfeige erst recht keinen Schritt mehr vorwärts bringt. Obwohl ihr der Schweiß am Körper klebt, spricht sie ruhig zu ihm und gönnt ihm eine kurze Pause, bevor sie ihn mit sanfter Gewalt wieder auf die Beine holt. Er greint, während sie ihn weiterzieht, und fängt nach zehn Schritten laut an zu heulen. Blume beißt die Zähne zusammen und treibt ihn stetig voran. Was soll sie tun, sie kann nicht mitten im Getümmel zwischen den Marktständen stehen bleiben, bis es Mittag schlägt, bloß weil es ihrem behäbigen Kind zu viel ist, mehr als ein paar Dutzend Schritte am Stück zu gehen.
Was aber, muss man sich fragen, hat Blume Liebes am zweiten Tag des Jahrmarktes zwischen den Ständen und Wagen am Platz vor der großen Synagoge zu suchen, noch dazu mit ihrem blöden, lallenden Sohn am Rockzipfel? Warum verlässt sie ihre Werkstatt, wo sich zur Messezeit alle Stunde jemand einfindet, der ihr gleich ein ganzes Schock Bücher abkauft oder mehr, und wo sich im Laufe einer Woche so viele druckfertige Manuskripte ansammeln, dass sie auf ein halbes Jahr Arbeit damit hat? Will sie die Verhandlungen mit Käufern und Auftraggebern ihrem Pressmeister überlassen? Sie hat doch Magd und Lehrjungen, die ihr holen könnten, was auf dem Markt zu besorgen ist. Denn einkaufen will Blume, deshalb ist sie unterwegs, und sie weiß auch genau was: Strümpfe. Nicht irgendwelche, sondern gute, warme Filzstrümpfe für den Winter, lange bis übers Knie, und von einem ganz bestimmten Händler, der sie auch selbst herstellt. Bei dem hat sie im Jahr zuvor, da er am Ende der Messewoche die übrig gebliebene Ware von Haus zu Haus feilbot, ein Paar solcher Strümpfe erworben. Aus denen wird ihr Junge bald herausgewachsen sein, deshalb will sie ihm neue kaufen und gleich welche für sich selbst dazu, denn die alten haben sich sehr bewährt.
Doch dass sie jetzt Herzklopfen hat beim Abschreiten der Stände auf der Suche nach dem richtigen, kann an den Strümpfen nicht liegen. Daran wird wohl eher der Strumpfwirker schuld sein, auf den sie, das muss sie sich zugeben, im letzten Jahr ziemlich ein Auge geworfen und ihn dummerweise bis heute nicht vergessen hat. Warum, weiß sie selbst nicht, so ein grobschlächtiger, ungebildeter Mann, wie die einfachen Handwerker eben sind, rasiert noch dazu, mit einer kurzen Joppe und einem Gürtel drum. Bevor er den Mund auftat, hatte sie ihn für einen Goi gehalten. Eine Schönheit war er auch sonst nicht gerade, dunkle Haut wie ein Zigeuner, eine Spur schief im Gesicht, oder vielleicht war es nur die Nase, die krumm geraten war, und lange, tatarische Augen. Dafür besaß er einen Zug um den Mund, wenn er sprach, der es ihr antat, und eine sehr weiche, warme Stimme für einen so groben Klotz von einem Mann. Deshalb ließ sie sich zwischen Tür und Angel von ihm bezirzen, kaufte ihm Strümpfe für Eisik ab, die der gar nicht nötig hatte, und schwatzte fast eine Stunde mit ihm über dieses und jenes. Erst als sie merkte, dass die Nachbarin missbilligend herübersah, verabschiedete sie sich freundlich, aber bestimmt von dem Mann und verschloss ihre im Sommer sonst stets offene Tür fest hinter sich.
Jetzt, ein Jahr später, ist sie also auf der Suche nach ihm, auch wegen Eisik, sagt sie sich, oder vor allem wegen Eisik (und nebenbei der Strümpfe natürlich!). Denn ihr ist angenehm aufgefallen, wie der Strumpfwirker beim Anblick ihres Sohnes nicht zurückschreckte, sondern ganz ungezwungen mit ihm redete, als sei er ein gewöhnlicher kleiner Junge. Es kommt sehr selten vor, dass ein Mann, sei es ein Fremder oder ein Bekannter, freundlich zu Eisik spricht, ja überhaupt einmal das Wort an ihn richtet. So dumm er auch ist, er merkt dennoch, wie man ihn meidet. Im letzten Jahr hat sie gespürt, dass ihm die Ansprache des Strumpfhändlers wohl getan hat, und will ihm darum dieses Jahr dasselbe Erlebnis wieder verschaffen. Bisher allerdings vergeblich, denn sie ist hin und her und kreuz und quer gelaufen, mit dem immer wieder plärrenden Eisik im Schlepptau, der nicht weiß, dass sie ihm Gutes tun will, und hat den Gesuchten doch nicht finden können. Er scheint in diesem Jahr nicht gekommen zu sein.
Gerade als sie meint, die Suche aufgeben und unverrichteter Dinge in ihre Werkstatt zurückkehren zu müssen, sieht sie ihn kaum zehn Schritte vor sich mit seinem Bauchladen im Getümmel stehen. Kein Zweifel, er ist es, doch Blume bleibt erst einmal erschrocken stehen. Er sieht so anders aus als erwartet. In dem langen Jahr ist sein Gesicht, seine Gestalt ihrer Erinnerung langsam entglitten und zu einem Phantasiebild geworden, dem der Mann vor ihr nur noch vage ähnelt.
Mit einem Mal reißt sich Eisik los, läuft zu Blumes Erstaunen flink voraus und macht strahlend vor dem Strumpfhändler Halt. Der erkennt ihn, scheint’s, sofort, beugt sich samt seinem Laden zu ihm hinab und schüttelt ihm mit übertriebener Geste die Hand, wie es die großen deutschen Kaufleute miteinander halten. «Wie gehen die Geschäfte, Reb Eisik?», hört Blume, die inzwischen herangekommen ist, den Strumpfhändler fragen. Darauf erhält er natürlich keine Antwort, aber Eisik grinst ihn selig an, als hätte man ihm ein unerhörtes Kompliment gemacht. «Waren die Strümpfe dick genug», fährt der Mann fort, «dass Ihr warme Füße hattet im letzten Winter?» – «Wame Füße, ga nich fiert», antwortet Eisik, und Blume ist überrascht und ein wenig stolz, dass ihr Sohn gleich erfasst hat, worum es geht.
«Dann willst du sicher wieder ein Paar kaufen?»
«Kaufen», bestätigt Eisik.
«Und diesmal gleich noch welche für mich dazu», mischt sich Blume ein, die findet, der Strumpfwirker könne allmählich auch ihr einmal etwas Beachtung schenken. Jetzt endlich richtet er sich wieder gerade auf, blickt sie an, ohne den Kopf zu drehen, und grüßt sie mit einem Augenaufschlag.
«Friede sei mit Euch, Frau Druckerin», sagt er nach einem Zögern. «Es ist gut, dass Ihr jetzt kommt, wo ich noch eine gute Auswahl bei mir hab. Letztes Jahr waren’s ja bloß die Reste.»
Die nächsten Minuten vergehen mit Aussuchen. Der Strumpfwirker setzt seinen Laden am Boden ab und hält, was in Frage kommt, Eisik an die nackten, dreckigen Füße. Auch Blume will er probeweise anhalten, was er ihr empfiehlt, doch sie will ihm ihre Füße nicht zeigen und greift sich nach Augenmaß das Richtige heraus.
«Die sind gewiss zu klein für Euch», entscheidet der Strumpfwirker und will sie ihr wieder aus der Hand nehmen, doch Blume lässt sich das nicht gefallen.
«Nein», sagt sie bestimmt und wahrheitsgemäß, «ich habe sehr kleine Füße, die sind mir sogar noch ein Stück zu groß.»
Er spöttelt etwas von übertriebener Eitelkeit, da lüpft sie doch Rock und Schürze, schlüpft aus ihrem linken Schuh und lässt ihn für einen Augenblick ihren Fuß sehen. Er muss zugeben, dass sie Recht hat, und sie behält ihre beiden schwarzen Strumpfpaare triumphierend in der Hand.
Da Eisik schon ausgestattet ist, geht es jetzt ans Bezahlen. Blume zählt dem Mann jede Münze einzeln in seine rissige und schwielige große Hand. «Das wäre einer zu viel», behauptet er, als sie fertig ist, und schiebt Blume einen Groschen zwischen die Finger. Der Einkauf ist erledigt, auch ein neuer Kunde hat sich mittlerweile eingefunden und interessiert sich für Strümpfe, doch Blume mag sich noch nicht endgültig von dem Strumpfwirker verabschieden. Da hat sie eine ganz alberne Eingebung.
«Könnt Ihr mir einen kleinen Gefallen tun?», fragt sie ihn, während er sich schon dem neuen Kunden zuwendet.
«Wenn ich kann, will ich gerne», sagt er mit seiner warmen, sanften Honigstimme, ganz ohne Ungeduld.
«Darf ich für einen Moment Eisik bei Euch stehen lassen? Ich hab nämlich noch eine andere Besorgung zu machen, und mit ihm ist bei diesem Gedränge das Durchkommen schwer.»
«Lasst ihn nur bei mir, ich kann ihn so lang als Lehrling anstellen.»
Von wegen, denkt sich Blume, die Kunden wird dir sein Anblick vergraulen. Aber sie findet es sehr charmant, dass er so tut, als wüsste er das nicht, und zieht nach ein paar Dankesworten von dannen.
Sie hat sich selbst überrumpelt mit ihrer Idee, und es fällt ihr zunächst nichts ein, was sie kaufen könnte. Irgendetwas muss es aber sein, denn sie hat den Verdacht, man werde sie, wenn sie Eisik abholt, danach fragen. Schließlich entscheidet sie sich für Tuch, aus dem sie ein neues Kleid schneidern lassen will, wenn sie auch, bei Licht besehen, so dringend keines braucht. Aber man freut sich doch immer über ein neues Kleid, denkt sie sich, die Geschäfte waren gut in letzter Zeit und ich habe nur ein Kind zu versorgen, ich kann es mir leisten.
Lange muss sie suchen, bis sie etwas gefunden hat, denn das erste Beste will sie nicht nehmen. Wenn sie schon kauft, was sie nicht benötigt, so soll es ihr wenigstens gefallen. Am Ende nimmt sie einen dicken Atlasstoff, entsetzlich teuer (sie wird später die Magd zum Bezahlen schicken müssen, so viel Geld hat sie nicht bei sich), in einem dunklen Lilaton, von dem sie weiß, dass er ihr schmeichelt.
Als sie sich mit dem Stoff unterm Arm auf den Weg zurück zum Strumpfhändler macht, ist fast eine Stunde vergangen, so kommt es ihr jedenfalls vor, und das schlechte Gewissen plagt sie. Niemals hätte sie Eisik dem Fremden so lange aufhalsen dürfen. Was kann während ihrer Abwesenheit nicht alles vorgefallen sein! Allerlei Unannehmlichkeiten malt sie sich aus, die er verursacht haben könnte. Vielleicht ist er sogar auf der Suche nach ihr weggelaufen und im Getümmel verloren gegangen!
In Sichtweite vom Strumpfladen fällt ihr ein Stein vom Herzen, denn was beobachtet sie nun? Wie ihr Eisik mit der einen Hand dem Strumpfwirker am Arm hängt und mit der anderen, einen höchst wichtigen und selbstzufriedenen Ausdruck im Gesicht, einem Kunden Wechselgeld auszahlt. Das muss ihm sein neuer Freund zuvor fertig abgezählt in die Hand gegeben haben, denn rechnen kann Eisik nun wirklich nicht.
«Habt tausend Dank», sagt sie, endlich ganz herangekommen, dem unfreiwilligen Kinderpfleger, «ich muss mich bei Euch entschuldigen, ich wollte eigentlich nur kurz wegbleiben.»
«Und dann hat es doch länger gedauert? Macht nichts, ich freue mich über Gesellschaft, ich hab so selten welche. – Und was habt Ihr noch gekauft?», fragt er unvermittelt, als sie sich mit dem glücklichen Eisik an der Hand verabschieden will.
Blume präsentiert den Atlas. «Für ein Kleid», erläutert sie.
«Schön», bemerkt der Strumpfwirker, nachdem er den Stoff zwischen den Fingern gerieben hat, «die Farbe passt gut zu Eurer Haut», wobei er Blume so offen ins Gesicht sieht, dass sie sich plötzlich schämt. «Aber ziemlich teuer», setzt er noch hinzu und grinst: «Vielleicht hatte ich vorhin doch nicht so Unrecht mit der Eitelkeit.»
«Soll ich schlechten Stoff kaufen, wenn ich mir auch guten leisten kann?», fragt Blume leicht verärgert, denn Eitelkeit wird ihr häufig vorgeworfen, ohne dass sie sich selbst für eitler hält als andere Menschen. Und einen primitiven Strumpfwirker in so unwürdiger Aufmachung geht das alles schon mal gar nichts an.
«Nein, sollt Ihr nicht», sagt er jetzt beschwichtigend, «und wenn Ihr’s Euch leisten könnt, freue ich mich für Euch. Die Geschäfte gehen demnach gut?»
«Es geht, danke. Wenn Ihr den Jahrmarkt meint, so ist es noch zu früh, um zu wissen, wie viel er mir bringen wird. Doch das letzte Jahr hatten wir, dem Herrn sei Dank, ein sehr gutes Auskommen, was ich mit Gottes Hilfe auch für dieses hoffe.»
«Welches Buch hat Euch denn so viel eingebracht? Außer Eurem Kalender, meine ich natürlich, den Ihr sicher jedes Jahr gut verkauft.»
Der Angeber, denkt Blume, die überzeugt ist, dass er nicht mal lesen kann. Aber anscheinend hat er sich nach ihr erkundigt, um jetzt eine Kenntnis ihres Druckgeschäfts vorgeben zu können. Sie findet das rührend und antwortet ihm brav. Ein Wort gibt das andere, es ist genau wie im letzten Jahr, und bald hat er sie mit seiner samtenen Stimme in ein langes Gespräch verwickelt; seine Kundschaft bedient er nebenbei mit Handzeichen. Sie erzählt von ihrer Arbeit, von den Schwierigkeiten mit dem gewalttätigen Ballenmeister im Frühjahr; er spult gekonnt Anekdoten ab, von denen er sicher nicht alle selbst erlebt hat – und schließlich schlägt es Mittag. Blume durchfährt es wie ein Blitz, dass sie hier seit einer halben Ewigkeit steht und nun wirklich nicht mehr länger vor aller Augen mit einem fremden Mann parlieren kann, während es bei ihr zu Hause inzwischen wahrscheinlich drunter und drüber geht. Hastig verabschiedet sie sich. Im Weggehen dreht sie sich noch einmal um. «Falls ich Euch nächstes Jahr wieder aufsuchen will: Wie heißt Ihr eigentlich?»
«Nate Deutsch», antwortet er.
«Von wo?», fragt sie.
«Aus Raschkov.»
In großer Eile schiebt und zieht Blume jetzt ihren müden und widerwilligen Sohn nach Hause. Wunderlich ist ihr zumute, ob vor Glück oder eher im Gegenteil, das weiß sie nicht, und sie hat auch keine Zeit, darüber nachzudenken. Als sie ihre Werkstatt betritt, wartet dort schon ein sehr junger Gelehrter mit Flaumhaar ums Kinn, rosigen Wangen im bleichen, zarten Gesicht und gekräuselten Schläfenlocken bis auf die Hüften, in den Händen ein dünnes Manuskript voll talmudischer Haarspaltereien, von dem er glaubt, dass sie es in Hoffnung auf guten Verkauf ohne Zuzahlung in Druck legen wird.
2
In dieser Nacht, im Bett, denkt Blume an den Strumpfwirker, und es überkommt sie eine heiße Wollust. Zuerst wehrt sie es ab, versucht, das Bild des Mannes aus ihrem Geist zu verbannen, doch es kehrt wieder und wieder zurück. Schließlich lässt sie sich gehen und gibt sich ihrer Lust hin, stellt ihn sich dabei noch mit Bedacht vor, wie er ihr nah und näher kommt und dies und jenes mit ihr tut, zieht die Sache gekonnt in die Länge und kostet die Früchte ihrer Sünde bis zur Neige aus. Als sie endlich fertig ist damit, liegt sie ganz still, schwer atmend, mit klopfendem Herzen, aber Ruhe in allen Gliedern. Da spürt sie, wie ihr die Augen voll Tränen stehen. Rasch wischt sie sie fort. Sie kommen wieder. Tränen des Bedauerns, denkt sie, dass er nicht wirklich bei ihr war, und der Sehnsucht nach einem Mann, denn seit sieben Jahren hat sie keinen mehr gehabt.
Dann schilt sie sich töricht, ruft sich Abraham Abusch ins Gedächtnis, den Verstorbenen, an dem sie mehr Last hatte als Freude. So etwas will sie wieder haben? Gewiss, kein wirklich schlechter Ehegatte war ihr der Abusch, ganz so, wie man es von einem gebildeten Jüngling aus wohl angesehener Familie erwartet. Das Geld hat er weder verspielt noch versoffen, sein Weib hat er weder mit Flüchen belegt noch geschlagen. Aber er hat ihr auch keine Liebe angetan über das Maß des unbedingt Gebotenen. Kein Kosewort kam über seine Lippen in neun Jahren, mit keiner Zärtlichkeit hat er sie je bedacht außer zum Zwecke des Beischlafs, und selbst dann nur sparsam, was eben vonnöten war, um sich selbst zu erregen. Wenn er mit ihr schlief, streng nach Vorschrift und Kalender, wandte er alle Mühe auf, sie wissen zu lassen, dass es nicht aus Liebe zu ihr, sondern aus Liebe zu Gott geschah. Um fromme Kinder zu zeugen zum Lobpreis des Herrn, um des Gebotes «Seid fruchtbar und mehret euch» willen hat er ihr beigelegen, wie es einem Frommen geziemt, der nicht seinem Fleisch, sondern seinem Schöpfer ergeben ist. Preisen und lieben hätte Blume ihn deshalb müssen und hätte es vielleicht auch getan, wenn es denn mit den frommen Kindern geklappt hätte. Aber leider wurde nichts daraus, und er machte ihr Vorhaltungen, erst leise und säuerlich, dann laut und bitter. Zu Beginn ihrer Ehe wurde und wurde sie nicht schwanger. Als sie dann endlich, nach Jahren, empfing, hielt sich das Kind nicht bei ihr und ging vor der Zeit ab; zweimal geschah das, einmal im vierten Monat und einmal im sechsten. Die schlimmste, grausamste Enttäuschung kam, nachdem sich doch noch alles zum Guten zu wenden schien. Sie hatte empfangen, sie hatte es ausgetragen bis zum guten Ende, es war ein Junge. Die Freude war groß, den bedenklichen Blick der Hebamme übersah man. Der Beschneider nahm Abusch beiseite nach der Zeremonie. Man wollte nicht glauben, was er orakelte, musste sich aber im Lauf des ersten Jahres eingestehen, dass er Recht behielt. Sie hatte einen Idioten geboren.
Das war schlimmer, als kein Kind zu haben, eine Schande sondergleichen, erklärte ihr Abusch. In seinen Augen überstieg dieser Schlag bei weitem das gewöhnliche Maß an Leid, das die irdische Existenz mit sich bringt, stellte ihn noch schlechter als diejenigen vom Schicksal Gepeinigten, die nur Töchter haben, denen die Kinder reihenweise sterben, bis keines mehr übrig bleibt, oder die gleich gar keine bekommen. Warum sollte gerade er so bestraft werden, der von Jugend an nach bestem Wissen und Gewissen Gott gedient hatte, der kein Gebet, keinen Segensspruch versäumte, winters wie sommers seinen Schlaf unterbrach für die mitternächtlichen Riten, der den Frauen nicht nachsah, mit der eigenen nur auf heilige, keusche Weise verkehrte und sich nichts sehnlicher wünschte als einen Sohn, der es ihm gleichtun könne. Nein, Blume allein war schuld an dem schändlichen, stumpfsinnigen Balg, daran ließ er keinen Zweifel, denn er selbst konnte es ja nicht sein. Es sei bekannt, giftete er sie bitter an, als er sie einmal über ihr Unglück weinen sah, dass für die geistige Formung des Kindes an der Mutter mehr gelegen sei als am Vater. Ihre Gedanken bei der Empfängnis, ihre Führung, ihr Denken und Fühlen während der Tragzeit prägten dem Kind einen unauslöschlichen Stempel auf. Wenn sie einen sabbernden Idioten geboren hatte, dann beweise dies Nachlässigkeit oder Sünde zuvor. Wahrscheinlich sei sie unkeusch gewesen, habe böse, liederliche Gedanken gehabt oder den Branntwein heimlich krügeweise in sich gekippt.
Blume leugnete, einen Fehler begangen zu haben, trotzig, verletzt, verzweifelt. Insgeheim aber wusste sie, dass er Recht hatte mit seiner Anschuldigung. Sie allein war schuld an Eisiks tumbem Hirn und schlaffem Körper, denn sie war im Halbschlaf gewesen, als sie ihn empfing. Abusch pflegte sie am Schabbat nach Mitternacht zu wecken, um seine Ehepflicht zu erfüllen, wie es empfohlen wird von den Ärzten und Gelehrten. Blume, aus dem tiefsten Nichts geholt durch seine Berührungen, fiel es schwer, binnen der wenigen Minuten, bis Abusch in sie eindrang, ganz wach und konzentriert zu werden. Oft genug ließ sie seine Begattung in dösiger, mehr oder minder wollüstiger Schlaftrunkenheit über sich ergehen, in der sich Traum und Wirklichkeit mischten. So wirr und leer ihr Hirn war, so schlaff und müde ihr Körper, so musste notwendig auch das Kind geraten, das sie hervorbrachte in einem solchen Moment. Bis heute fragt sie sich, wie sie derart fahrlässig sein konnte, eine gebildete Frau, die sie ist. Schuldig gemacht hat sie sich gegenüber Eisik und ihrem Mann, doch dass sie sich schuldig fühlte, machte ihr die Bitterkeit und eisige Kälte Abuschs nicht erträglicher. Sie hoffte, ein gnädiger Gott werde in Anerkennung ihrer Reue das Kind früh sterben lassen, wie so viele sterben in den ersten Jahren, doch ausgerechnet dieses gedieh prächtig und wurde dick und rund. Sie nahm das als Zeichen, die Pflege des Idioten sei ihr zur Strafe auferlegt, und ließ es zu, dass er, der unschuldig an seinem und ihrem Unglück war, ihr lieb wurde. Eine Weile trug sie sich mit der Hoffnung, alles wieder gutmachen zu können mit einem weiteren Sohn, einem gescheiten, wohl gestalteten, und mühte sich ab, mit den besten, frömmsten, wachesten Gedanken dies zu erreichen, wenn ihr Abusch in immer größer werdenden Abständen beiwohnte. Aber bevor es ihr gelang, starb Abusch, elendiglich, an einem verklemmten Bruch. Nun war es endgültig, dass es nichts mehr zu heilen gab. Sie hatte Abuschs Leben verpfuscht und damit auch das ihre, die Schuld würde sich nicht mehr abwaschen lassen.
Dennoch brachte ihr der Witwenstand Erleichterung. So viel besser, so viel leichter war ihr ohne Abuschs bittere, anklagende Kälte, dass sie bis heute nicht wieder geheiratet hat.
Wie Blume so liegt in der Finsternis, denn der Mond ist noch nicht aufgegangen, da erahnt sie mit einem Mal auf dem Bettpfosten eine Gestalt, klein, schief, zusammengekauert. Schnell schließt sie die Augen und öffnet sie kurz darauf wieder. Die Gestalt ist noch da, kauert noch immer schief auf dem Bettpfosten. Sie zeichnet sich deutlicher ab, jetzt, wo sie entdeckt ist. Blume vermeint, ein Gesicht zu erkennen, eine Fratze, groß wie ein Katzenkopf, die ihr breit und verschlagen zugrinst, mit einer winzigen schiefen Nase und spitzen, abstehenden Ohren zu beiden Seiten des kahlen Schädels. Die Augen sind wie zwei schmale Schlitze.
Schauer laufen ihr über den Rücken, eine Mordsangst packt sie, und sie wagt nicht, sich zu rühren. Gerne würde sie die Augen schließen, um die Kreatur nicht mehr ansehen zu müssen. Doch wenn sie dann unbemerkt näher käme? Wenn sie ihr plötzlich auf der Brust säße? Nicht auszudenken. Schlotternd liegt sie, den Dämon unverwandt im Blick, bis der Mond herauskommt, die Gestalt in seinem Licht durchscheinender und durchscheinender wird und sich schließlich auflöst.
Tief atmet sie durch, sieht dann, auf ihren linken Ellenbogen gestützt, hinüber zu Eisik, der ruhig schläft, als sei nichts gewesen. Hörbar seufzend, sich selbst beruhigend durch den Klang ihrer Stimme, wendet sie ihre verschwitzte Bettdecke auf die trockene Seite und lässt sich wieder auf das Kissen fallen. Sie weiß sehr gut, wer die Gestalt war: Ihr eigenes Kind, halb Dämon, halb Mensch, das sie vor zwei Stunden oder weniger hervorgebracht hat mit dem Inkubus, dem sie sich hingegeben hat, weil er die Schwächen seiner Opfer aus ihren Gedanken liest und ihr in der Gestalt von Nate, dem Strumpfwirker, erschien.
Nach einer Weile steht sie auf und wäscht sich die Hände, legt sich wieder und spricht halblaut, damit Eisik nicht aufwacht, das Schma-Gebet, bevor sie endlich einschläft.
Am Morgen, noch während sie die Kleider antut, fasst sie einen Entschluss. Eine Frau, sagt sie sich, der vom Gedanken an einen primitiven, schwarzhäutigen, grobschlächtigen Strumpfwirker das Geschlecht so heiß und glitschig schwillt wie ihr, die braucht einen Mann im Haus, daran gibt es nichts zu rütteln. Sie wird zu Süßel Schächter gehen, die gemeinsam mit ihrem Mann Ehen vermittelt gegen eine kleine Summe, gleich heute wird sie gehen, denn die Jahrmarktwoche scheint ihr die rechte Zeit dafür zu sein.
Zuvor aber muss sie hohe, edle Kundschaft bedienen, und merkt gerade noch rechtzeitig, was ihr blüht, um die Magd mit Eisik nach oben zu schicken.
Zwi Hirsch Tschernobyler ist gekommen, der bedeutende, berühmte Kabbalist, der die Klause in Jampol leitet, Nachfolger des Menachem Mendel aus Jampol. Er ist im offenen Pferdewagen angereist. Mit Gefolge steht er vor Blumes Haus, hager, eisgrau, nobel, der schwarze Pelzhut beschattet das Gesicht. Neben sich hat er seinen Adlatus, den Nachum Sofer oder Schreiber, im Gegensatz zu ihm klein, dicklich und mit flammend rotem Bart. Beider Stimmen dringen durch Fenster und offene Tür in die Werkstatt, als sie auf dem Wagen beraten. Blume sieht hinaus und erkennt sie sofort. Ein schlimmer Schreck durchfährt sie, fast gerät sie in Panik, weil sie ahnt, die Männer wollen zu ihr.
Jahre ist es her, Abusch lebte noch, da hat sie den berühmten Zwi Hirsch Tschernobyler selbst in Jampol aufgesucht. Vorher kannte sie ihn nicht persönlich, aber sie hatte sein Buch gedruckt, und das brachte sie auf die Idee. Nicht irgendein Buch nämlich, sondern das herausragende Ginat Schoschanim oder Der Liliengarten, ein wundersames, poetisches Gebilde in zwei Bänden voll arkanischer Weisheit und voller Geheimnisse, das die Kabbala auf eine neue Stufe gehoben und seinen Autor zur Lichtgestalt des Jahrhunderts gemacht hat. Blume hat es gelesen, schwer und unergründlich wie es ist, da sie es setzen musste. Kapitel für Kapitel oder vielmehr Lilie für Lilie – denn so hießen die Kapitel: gelbe Lilie, rosa Lilie und so weiter – hat sie erst ganz gelesen und dann gesetzt, denn ein solches Buch kann man nur fehlerfrei aus dem Manuskript übertragen, wenn man eine Ahnung hat, worum es geht.
Wenn mir jemand helfen kann, dachte sich also Blume, als das Unheil mit Eisik geschehen war, dann der große Weise, der Autor von Ginat Schoschanim, Hirsch Tschernobyler, der seinesgleichen nicht hat in unserer Generation. Abusch hieß ihr Vorhaben gut, und sie machte sich nach Jampol auf mit Eisik, der noch ein Säugling war, dem man aber schon ansah, was einmal aus ihm werden würde.
In Jampol ließ man sie eine Woche nicht zum Tschernobyler vor. Er bete und lerne unentwegt, müsse allein sein mit Gott oder sich um seine Schüler und Adepten kümmern, ihre Seelen heilen, seine Lehre weitergeben für die kommenden Generationen. Unmöglich könne er selbst für Kranke und Notleidende sorgen, es schade ihm, wenn er sich so weit in die Dinglichkeit hinabbegebe, ja, er könne kaum sprechen als in der heiligen Sprache. Weil er trotzdem helfen und niemanden abweisen wolle, habe er Gefährten abgestellt, die sich um das einfache Volk mit seinen Bitten um Rat, Hilfe und manchmal auch Geld kümmern sollten.
Für Fälle wie Blumes war Nachum Sofer, der Rotbart, zuständig, der sich Ba’al Schem Tov oder Beherrscher der magischen Namen nannte. Er war also ein Kräuterdoktor und Verfertiger von Amuletten. Einen solchen, fahrenden, hatte sie vor Monaten schon konsultiert, wie daneben eine christliche Baderin und einen berühmten tatarischen Heiler. Für einen gewöhnlichen Ba’al Schem war sie nicht nach Jampol gekommen, damit konnte sie sich nicht zufrieden geben in ihrer Not und in ihrer Hoffnung auf den großen Meister, die Quelle des Lichts, die Leuchte des Exils. Sie versteifte sich. Die Nächte verbrachte sie in der Herberge, doch beim ersten Sonnenstrahl fand man sie vor dem Haus des Tschernobylers auf der Bank, mit ihrem Sohn auf dem Arm, im Gebet. Sie blieb, bis die Sterne leuchteten.
«Ich rief zum Herrn in meiner Not, und er antwortete mir, ich schrie aus dem Bauch der Hölle, und du hörtest meine Stimme», war das Schriftwort, das sie häufig sprach in dieser Woche, und sie dachte sich: Wenn man als einfacher Mensch die Gottesgegenwart selbst anrufen kann um Hilfe in der Not, um wie viel mehr dann einen Menschen von Fleisch und Blut, gerade dann, wenn er den göttlichen Sphären näher steht als andere. Hartnäckig saß sie, Tag für Tag, flehte jeden der ein- und ausgehenden Schüler an, er möchte ihr Zutritt bei seinem Meister verschaffen, war ein Ärgernis mit ihrem triefmäuligen, schlaffen Säugling im Arm, ließ sich nicht vertreiben, nicht mit Worten und nicht mit Gewalt, und nicht abspeisen mit einem Amulett des Nachum Sofer.
Sieben Tage ließ man sie warten. Am achten führte sie Nachum, verdrossen von ihrem Anblick und zermürbt von ihrem Starrsinn, herein zu dem großen Mann. Er empfing sie in einem Saal, ganz in Weiß gewandet, auf einem erhöhten purpurnen Sessel an der östlichen Wand sitzend, den schwarzen Bart bis zu den Knien. Zur Rechten und zur Linken waren Schüler aufgereiht. Blume warf sich vor ihm auf den Boden. «Sprich!», sagte er, müde und herrisch zugleich.
Sie wusste nicht, wo anfangen. Als Blume Liebes stellte sie sich vor, denn Namen sind wichtig, haben geheime Bedeutungen, enthalten Buchstaben, die man verdrehen und vertauschen und ersetzen kann durch andere nach den Regeln. Vielleicht konnte er ihr Segen erwirken durch den Namen, indem er ihn mit der Konzentration seiner heiligen Seele drehte und wandelte und erhob und zurückführte zu einer Quelle des Lichts. Den Namen des Kindes, das sie nicht hatte hineinnehmen dürfen, nannte sie auch. Aber sie wagte nicht zu sagen, dass sie die Frau von Abraham Abusch Drucker aus Kamenka sei und das Manuskript von Ginat Schoschanim in Händen gehalten und gesetzt habe. Sie sprach von der Krankheit des Kindes, davon, dass sie fürchte, sie trage Schuld daran, und bat um eine Bußverordnung für sich selbst und Heil und Segen für ihren Sohn.
Der Tschernobyler wurde ungeduldig während ihrer langen, stotternden Worte, denn er war schon fertig mit seiner Diagnose.
«Weib», sagte er, «was erzählst du mir lang und breit, auf deiner Stirn sehe ich sie klar und deutlich geschrieben, die Sünde, weshalb du ein Kind von der Anderen Seite zur Welt gebracht hast mit nichts als einer Triebseele im Leib.»
Hier hielt er inne, als wolle er nicht mehr weitersprechen, Blume in einer verschreckten Unsicherheit zurücklassend, in der sie kaum zu atmen wagte.
«Was war es, Meister, ich bitt Euch, sagt es mir», hauchte sie schließlich.
«Du hast», sagte er ihr laut und vernehmlich vor zwanzig, dreißig Zuhörern, seinem Gefolge, «mit deinem Mann auf unnatürliche Weise verkehrt.»
Ein Raunen ging durch den Saal. Blume war sprachlos. Auf unnatürliche Weise? Nie, nie hatte Abusch so etwas mit ihr getan, Abusch, der immer nur nach dem Gesetzbuch mit ihr schlief vom Anbeginn ihrer Ehe, der alle Regeln der Keuschheit und Frömmigkeit auf den Punkt einhielt, der ihr niemals einen Kuss, eine Berührung, einen Blick gegeben hatte, die nicht den strengsten Vorschriften Genüge taten. Abusch, der lieber den Märtyrertod gestorben wäre, als sein Zeichen der heiligen Beschneidung in einen unreinen Ort zu stecken, ausgerechnet er sollte auf unnatürliche Weise mit ihr verkehrt haben? Das stand auf ihrer Stirn geschrieben? Es war absurd.
«Aber das stimmt nicht», entfuhr es Blume, als sie die Blicke der Schüler auf sich spürte, belustigt manche, verächtlich andere.
Da erhob sich der Tschernobyler von seinem Sitz, lang, hager, edel von Angesicht, Eis in den Augen, und herrschte sie an:
«Wage nicht zu leugnen, Unwürdige!»
Blume fiel wie vom Schlag getroffen in sich zusammen und machte sich ganz klein, die Stirn auf den Boden gepresst, die Hände schützend über dem Kopf gefaltet. Sie begann zu weinen.
«Schafft sie hinaus», hörte sie ihn sagen, «Nachum soll ihr eine Bußverordnung geben und ein Amulett schreiben.»
Dann fühlte sie sich an beiden Armen hochgehoben. Tränenüberströmt und willenlos ließ sie sich nach draußen führen.
Kein Wunder also, dass ihr heute der Schweiß ausbricht, als sie denselben Tschernobyler im Wagen vor ihrer Tür stehen sieht, mit mittlerweile ergrautem Bart und noch noblerem Äußeren. Alsbald steigt Nachum Sofer vom Wagen und kommt zur offenen Tür herein. Wie gewohnt schickt ihn der Alte vor. Blume empfängt ihn stehend. Sie reibt nervös die Hände an der Schürze.
«Ihr seid Abraham Abusch Druckers Witwe?», begrüßt er sie.
«Ja», sagt Blume mit klarer, lauter Stimme und blickt ihm ins Gesicht. Sie will mit Würde durchstehen, was sich nicht vermeiden lässt.
«Ich bin Nachum, der Ba’al Schem aus Jampol, Ihr könntet von mir gehört haben.»
«Ja», sagt Blume einsilbig. Erkennt er sie nicht, oder will er sie nicht erkennen?
«Draußen auf dem Wagen sitzt mein Freund, unser Meister Zwi Hirsch aus Tschernobyl. Ich komme in seinem Auftrag. Euer Mann hat vor elf, zwölf Jahren sein Buch gedruckt, Ginat Schoschanim. Wisst Ihr davon?»
«Ja», bestätigt Blume und fügt stolz an: «Ich habe es selbst gesetzt.»
«Ihr habt es gesetzt? Dieses schwere, komplizierte Werk? Aus dem Manuskript?»
«Woraus sonst», antwortet Blume.
«Wie sollte das möglich sein? Ihr könnt doch nicht einmal die heilige Sprache!»
«Ich kann die heilige Sprache nicht schlechter als Ihr», antwortet Blume auf Hebräisch.
«Nun», sagt Nachum, aus dem Konzept gebracht, «es sei, wie es sei, jedenfalls hat der Meister es noch zweimal in Druck gegeben seitdem, einmal in Frankfurt an der Oder, einmal in Zolkiew, nachdem die Rechte Eures Mannes abgelaufen waren, versteht sich. Leider haben ihm die beiden neuen Ausgaben nicht gefallen, Fehler über Fehler hat er gefunden, es ist kein leichtes Werk, da kann es auch dem besten Setzer passieren, dass er etwas missversteht, ähem – kurz und gut: Die erste Ausgabe, die von Eurem Mann, war von allen die beste, so gut wie fehlerfrei, noch dazu ein schönes, klares Druckbild, und da jetzt die letzte, aus Zolkiew, schon wieder ausverkauft ist, denn die Nachfrage ist groß, soll ich Euch fragen, ob Ihr zufällig die alten Druckformen noch habt?»
Blume verkneift sich ein Lachen.
«Leider nein», antwortet sie und erläutert das Selbstverständliche: «So viele Lettern hat kein Drucker, dass er es sich leisten könnte, ein dickes Buch bis zu Ende zu drucken, ohne eine Form aufzulösen, und sämtliche Formen danach noch aufzuheben! Wenn man eine Lage gedruckt hat, das heißt acht oder zwölf oder sechzehn Seiten, schließt man gleich die Formen wieder auf, säubert die Lettern und legt sie in den Kasten. Aber was macht es, dass die alten Formen nicht mehr da sind, ich kann ja einen Neudruck nach der alten Vorlage machen, das wird wesentlich schneller gehen als damals aus dem Manuskript.»
«Nun gut, wenn Ihr die erste Ausgabe ohnehin selbst gesetzt habt … Ihr könntet es sofort neu auflegen, in ganz derselben Aufmachung wie damals?»
«Wenn Ihr mir eine Druckgenehmigung besorgt, denn es scheinen ja andere noch Rechte zu besitzen, der Chaim Segal in Zolkiew jedenfalls. Dann werde ich natürlich ein neues Titelblatt machen, dass man den neuen Druck nicht mit der alten Ausgabe verwechselt, aber sonst wird alles fast genauso aussehen. Sagt mir nur, wie viele Exemplare Ihr glaubt, dass es sein müssten, und wie viele Ihr mir selbst en gros abnehmen wollt. – Aber muss es denn Buchstabe für Buchstabe die alte Ausgabe sein? Gibt es nicht doch etwas zu verbessern? Wir hatten ein Vorabexemplar dem Autor zur Korrektur geschickt, aber nie eine Errataliste von ihm bekommen.»
«Na ja, es waren wie gesagt kaum Fehler drin. Aber das könnt ihr gleich mit ihm selbst besprechen.»
Nachum läuft hinaus auf seinen kurzen Beinen, erstattet Bericht beim Tschernobyler, gestikuliert, nickt, streicht sich durch den roten Bart. Dann steigt der große Meister selbst vom Wagen, langsam, fast gebrechlich, und schreitet feierlich und gemessen auf ihre Tür zu, Nachum folgt ihm mit zwei Schritt Abstand. Erst als er eintritt, sieht sie sein Gesicht, hagerer, vergeistigter als früher, die Augen tief in schattigen Höhlen, der Bart eisgrau. Wieder hat sie den Impuls, sich vor ihm auf die Knie zu werfen, und würde es tun, hielte nicht die Angst sie ab, er werde sie erkennen, wenn er sie gebeugt auf dem Boden sähe. Stattdessen weist sie ihm unter Ehrbezeugungen einen Stuhl an und bleibt selbst stehen.
Nur kurz wird verhandelt, man ist sich schnell einig. Blume bringt Feder, Papier und Tinte, und Nachum setzt den Kontrakt auf. Ein unangenehmer Moment, denn Blume muss ihren vollen Namen sagen. Als Nachum ihn grübelnd nachspricht, während er ihn zugleich mit sicheren, schönen Strichen schreibt, ist sie sicher: Jetzt erinnern sich beide, wer sie ist. Doch keiner von ihnen lässt sich etwas anmerken.
Blume ist froh, als es vorüber ist und die beiden Männer draußen den Wagen besteigen. Da sieht sie, höflich an der Tür wartend, wie der Tschernobyler Nachum etwas zuraunt und dann allein zu ihr zurückkommt.
«Einen Augenblick noch, Druckerin», sagt er ihr, «ich muss noch etwas mit Euch besprechen.»
Blume wird seltsam im Magen. Sie bittet ihn herein.
«In der ersten Ausgabe», sagt er ihr vertraulich, «fehlte ein Abschnitt im zweiten Hauptstück, nicht Eure Schuld, zwei, drei Manuskriptseiten, die ich Eurem Mann versehentlich nicht gegeben hatte, denn ich hatte noch bis ganz zum Schluss daran gearbeitet und sie dann vergessen. Ob Ihr sie diesmal aufnehmen könnt?»
Das bedeutet einige Mehrarbeit, die Blume nicht miteinberechnet hat für den Kontrakt, denn der Einschub so weit am Anfang zwingt sie, den ganzen Umbruch neu zu kalkulieren. Aber gut, sie sagt ohne weiteres zu, so erleichtert ist sie, dass es nur darum geht. Der Tschernobyler gibt ihr die fraglichen Blätter, in derselben pedantischen, winzigen Schrift, an die sie sich so gut erinnert, und geht endgültig.
Blume ist zufrieden, es ist ein vorteilhaftes Geschäft, selbst wenn ein neuer Umbruch gemacht werden muss, und eine Ehre, das einzigartige Buch, die Krone der Lehre, zum zweiten Mal verlegen zu dürfen. Sie hat die Rechte auf zehn Jahre und kann so viele drucken, wie sie will, zu den zweihundert, die ihr der Tschernobyler selbst abnimmt und die seine Schüler unter die Leute bringen werden. Von Sarajevo bis Amsterdam wird man es lesen in ihrer Ausgabe, und diesmal wird ihr Name auf dem Titelblatt stehen, sie sieht es schon vor sich: Gedruckt von Frau Blume, Liebes Tochter, Witwe des Abraham Abusch, Kalmans Sohn, das Andenken des Gerechten zum Segen für die kommende Welt.
Es wäre doch gelacht, wenn die Druckerin von Ginat Schoschanim keinen guten Mann fände. Also macht sie sich geradewegs auf zu Süßel Schächter.
3
Es ist der erste Tag der Woche, der heilige Tag der Christen. Der Jahrmarkt ist vorüber. Das bunte, laute Gewimmel hat sich aufgelöst, ist in Scharen davongezogen, bis auf diejenigen Juden, die den Schabbat über geblieben sind. Ruhe ist eingekehrt in der Stadt, die frischen Gerüche von Lebensmitteln, Vieh und Menschen sind dem fauligen Dunst des überall umherliegenden Unrats gewichen. Auf dem Marktplatz sieht man hier und da eine Ratte huschen. Gastwirte und Kaufleute, müde und steif nach einer ruhelosen Woche, sitzen gähnend in Kontor oder Hinterstübchen und zählen ihre Einnahmen, während Blume Liebes mit Feder und Tinte vorm wackligen Tisch am Fenster ihrer kleinen Schlafkammer sitzt, Manuskripte ringsumher, und die Arbeit der nächsten Wochen und Monate plant: Wer wann was setzen und drucken soll und wie lange man dafür zu veranschlagen hat, was Folio werden soll und was Quart oder kleiner und in welchen Lagen, was fest gebunden und was in Fadenheftung, wie viel Bögen Papier es brauchen wird und wie viel Druckerschwärze. Das alles will wohl überlegt und kalkuliert sein.
Als sie einmal beiläufig hinaussieht, erspäht sie Nate, den Strumpfwirker, wie er an der orthodoxen Kirche vorbei die Straße entlangkommt und direkt auf ihr Haus zusteuert, schwarzhäutig, grobschlächtig, schweren, langsamen Schritts, ohne seinen Bauchladen. Blume wird es mulmig. Hastig verständigt sie Rivele, die Magd. Sie soll sie verleugnen, falls der Strumpfwirker sie zu sprechen wünscht, und ihn schnell loswerden.
Gleich darauf hört sie von unten seine Stimme, weich, dunkel, honigsüß, und die der Magd, wie sie miteinander verhandeln. Das Herz klopft ihr bis zum Hals. Was kann er von ihr wollen? Sicher nichts Gutes. Hat er etwa gemerkt, dass er ihr gefällt? Blume schämt sich. Endlich sieht sie ihn gehen, in die gleiche Richtung, aus der er gekommen ist, stracks und zielstrebig, ohne sich umzusehen. Nur den breiten Rücken sieht sie noch von ihm.
Die Magd kommt die Treppe hoch und zu ihr herein. «Ich soll Euch grüßen von dem Strumpfhändler», sagt sie, «und Euch ausrichten, dass er sich jetzt auf den Heimweg macht, nach Raschkov.»
«Na und», fragt Blume fast entrüstet, «was hab ich damit zu schaffen?»
«Das müsst ihr selbst am besten wissen», sagt Rivele und lacht keck, ein knochiges, sommersprossiges Ding von sechzehn, siebzehn Jahren, das Blume gern um sich hat wegen seines unbekümmerten, fröhlichen Gemüts, aber jetzt missfällt ihr das freche Lachen.
«Wozu stehst du noch da», sagt Blume, «scher dich nach unten, es gibt genug zu tun.» Dann klopft sie dem Mädchen freundschaftlich auf die Schulter, zum Zeichen, dass sie’s so böse nicht mit ihr meint.
Am Nachmittag ist Blume im Groben fertig mit den Plänen. Ginat Schoschanim hat sie den Vorrang vor allem anderen gegeben und will am selben Abend noch den Umbruch berechnen, wozu sie die einzuschiebenden Seiten probesetzen wird. Vorläufig aber braucht sie vom Kalkulieren eine Pause. Da sie sonst nichts erledigen muss, was nicht ein Stündchen warten könnte, hält sie die Zeit für gekommen, schon einmal bei Süßel Schächter nachzufragen, ob die inzwischen einen Vorschlag für sie hat. Einen der fremden Kaufleute vielleicht, die letzte Woche in der Stadt waren, denen man Eisik nach und nach beibringen kann und die wahrscheinlich noch froh drum sind, dass sie als Witwe nicht eine ganze Horde Kinder mit in die Ehe bringt.
Knapp eine halbe Meile läuft sie zu Süßel. Diese Gegend der Stadt betritt sie ungern, es gibt ihr immer einen Stich. Drei Häuser neben Süßel hat Mate gewohnt, ihre beste Freundin, seit sie Abusch geheiratet hat und nach Kamenka gezogen ist. Kaum eine Woche hier, hat sie Mate in der Mikwe, dem rituellen Tauchbad, bei der monatlichen Waschung kennen gelernt. Auch Mate war frisch verheiratet, hatte es aber schlechter als Blume getroffen mit ihrem Mann, der ein großer Säufer war und zwei-, dreimal die Woche so voll, dass er nicht allein nach Hause gehen konnte. Das ahnte Mate damals freilich noch nicht. Auf der Stufe am Beckenrand stand sie, wollte gerade eintauchen, klein, rundlich, die Haut rosig geschrubbt, braune Stoppeln auf dem Kopf, und begrüßte die eintretende Fremde mit einem schüchternen Lächeln und einem warmen Leuchten in den Augen. Noch am selben Tag gewannen sich die beiden lieb und waren sich Vertraute und Trösterinnen bis zu Mates frühem Tod. Vor vier Jahren ist sie gestorben, an einer Darmkrankheit. Nie ist Blume Schlimmeres widerfahren. Noch immer hält sie regelmäßig Zwiesprache mit Mate an deren Grab und sagt ihr alles, was sie auf dem Herzen hat.
Heute aber hält sie sich mit trübseligen Gedanken nicht auf, als sie in die Gasse zu Süßels Haus einbiegt, denn der Kopf ist ihr randvoll mit Heiratsphantasien.
Vor Süßels Haus steht ein süßlicher, warmer Dunst. Es riecht nach Fleisch, Blut und Innereien, die in der Hitze liegen. Ein kulleräugiges Mädchen lungert barfuß und im Hemd auf der Schwelle herum. Ja, die Mutter sei im Haus, sie möge nur hereinkommen, antwortet sie brav auf Blumes Frage. Drinnen riecht es noch stärker. Die Kleine führt Blume zu Süßel, die, mit hochgeschobenen Ärmeln vor Wannen und Schüsseln sitzend, damit beschäftigt ist, einen halben Hammel auszunehmen und das Fleisch zum Einweichen in Wasser zu legen. Wie ein Mehlkloß sitzt sie auf ihrem Stuhl, der ganz unter ihr verschwindet, weiß, teigig, wabernd, drei Doppelkinne hängen ihr über den Spitzenkragen, ihre Brüste lagern flaschenkürbisgleich auf dem wie in einer ewigen Zwillingsschwangerschaft geschwollenen Bauch. Blume findet Süßel alles andere als süß, vor allem jetzt, da sie auf dem Stuhl vorrutscht, als wolle sie ihre wabernde Leibesfülle erst richtig zur Geltung bringen, als wolle sie Blume sagen: Guck, so sieht eine Mutter aus, die zehn Kinder geboren hat, davon drei schon jetzt viel versprechende gute Lerner sind, du aber hast mit gut dreißig noch die schmale Taille und hohen, festen Brüste einer Jungfrau, schäm dich.
Aber Blume will sich nicht mehr schämen, die Nase voll hat sie davon, es regt sich der Trotz. In der Haltung einer makellosen Vielbegehrten, der die Anträge gleich dutzendweise hinterhergeworfen werden, will sie Süßels Vorschläge entgegennehmen.
«Eilig scheinst du’s zu haben mit dem Heiraten», begrüßt Süßel sie, «dass du so früh kommst. Viel Zeit hatte ich nicht, mich umzuhören.»
«So weißt du gar niemanden, der in Frage käme? Du musst ihm ja noch nicht von mir gesprochen haben, das kannst du immer noch tun. Irgendeinen Witwer mit Kindern wird es doch geben, reich muss er nicht sein.»
Süßel hebt die Brauen und konzentriert sich auf ihr Fleisch.
«Tatsächlich hat sich so einer gemeldet in den letzten Tagen. Ich hab die Einzelheiten drüben notiert, lass mich nur erst das Fleisch fertig machen.»
«Soll ich dir helfen?», fragt Blume.
«Bitte, wenn du willst», brummt Süßel und weist ihr ein Messer. Blume zieht einen Schemel zur anderen Seite der Bank, setzt sich und macht sich an die Arbeit. Im Gegensatz zu Süßels flinker, präziser Geschicklichkeit stellt sie sich unbeholfen und langsam an mit dem ungewohnten Schneidgerät.
«Was bist du doch für eine tölpische Hauswirtin!», lacht Süßel, als sie ihr zusieht. Na warte, bis ich dich mal beim Drucken anstelle, denkt Blume und arbeitet schweigend weiter.
Süßel bricht das Schweigen und kommt doch schon jetzt, über dem halben Hammel in der Wanne, dessen Knochengerüst immer bloßer und hohler wird, auf Blumes möglichen Freier zu sprechen.
«Du hast großes Glück, Blume. Weißt du, wer wieder heiraten will? Reb Schalom Friedel Ostrer aus Jampol, mit der großen Druckerei. Das heißt, du könntest in deinem angestammten Handwerk weiterarbeiten. Seine zweite Frau, seligen Angedenkens, hat im Frühjahr die Schwindsucht geholt. Ein gebildeter Mann in ordentlichen Verhältnissen, und das Beste ist: Er hat eigens nach dir gefragt, noch bevor mein Mann dich ins Gespräch bringen konnte. Von Eisik weiß er schon und ist bereit, ihn mit aufzunehmen. Es ist ein großer Glücksfall. Ich rate dir, schlag zu, solang er noch zu haben ist, er hat noch andere Frauen im Auge, drüben in Jampol.»
Ein Glücksfall?, wundert sich Blume. Der will doch nur die gefährliche Konkurrentin unschädlich machen, indem er sie unter das eigene Dach holt. Laut sagt sie: «Wie viele Kinder hat er denn? Und was verlangt er von mir als Mitgift, was will er auf mich aussetzen für den Fall von Scheidung oder Tod?»
Das muss Süßel in ihren Notizen nachlesen. Das Fleisch liegt inzwischen fertig im Wasser, die beiden Frauen waschen sich die Hände, und Süßel wabert hinüber zum Kästchen beim Fenster, in dem sie ihre Unterlagen für Heiratssachen sorgfältig bewahrt. Sie schließt es auf und kramt darin herum, dabei sieht Blume von hinten, wie ihr das Fett an den Oberarmen hin- und herschwabbelt. Bald hat sie alles, was sie braucht, gefunden und setzt sich erneut, ein paar Papiere in den Händen.
«Beim Drucker aus Jampol waren wir», konstatiert sie. «Nun, es ist Verhandlungssache wie immer, aber sein Vorschlag wäre: Du gibst ihm die Ausstattung deiner Werkstatt als Mitgift und vielleicht noch etwas Geld dazu. Das Haus hier soll deines bleiben, doch solang er lebt und ihr verheiratet seid, hat er den Nießbrauch, also die Miete, denn du selbst sollst nach Jampol ziehen. Bei Scheidung oder falls er stirbt, bekommst du deine Presse und deine Lettern zurück, und außerdem die Hälfte der Miete, die sich für dein Haus bis dahin angesammelt hat und die er für dich ansparen will.»
«Das soll alles sein, was er mir für Scheidung oder Tod verschreibt? Dann habe ich bestimmt hinterher weniger als vorher, selbst wenn er mein Handwerkszeug nicht schon längst versetzt hat für die Verheiratung seiner Töchter, was zu befürchten steht. Ein wirklich schlechtes Geschäft.»
«Es kann ja noch verhandelt werden. Und lass es dir gesagt sein, Blume, eine Prinzessin bist du nicht, dass man dir Gold und Geschmeide nachtragen möchte. Fast zehn Jahre verheiratet und nichts zustande gebracht als –»
«Ich weiß», unterbricht Blume sie, «und überlegen werd ich’s mir mit dem Friedel Ostrer. Aber falls du noch etwas anderes auf Lager hast, selbst wenn es auf den ersten Blick nicht besser scheint, sag es mir nur.»
Und tatsächlich, Süßel hat noch einen, und nicht den Schlechtesten.
«Jemand aus Schargorod», berichtet sie, «der zur Messe hier war, eine sehr gute Partie. Ein hochgelehrter Jüngling, schön von Angesicht, gut gewachsen, höflich, mit allen Tugenden, die man sich denken kann. Sogar ein Buch hat er schon geschrieben mit gerade siebzehn Jahren. Ich bin sicher, er wird eine große Berühmtheit werden. Und stell dir vor, auch er hat eigens nach dir gefragt!»
Blume schwant etwas. «Wie heißt er denn?»
Süßel kneift die Augen zusammen und liest vor: «Reb David ben Israel Rofe.»
Aha! Jetzt weiß Blume Bescheid. Der Junge mit den Talmudhaarspaltereien und den Korkenzieherlöckchen bis auf die Hüften.
«Geld hat er keines, nehme ich an?»
«Nicht viel jedenfalls, fürchte ich. Der Vater ist schon viele Jahre tot, und er hat noch zwei unverheiratete Schwestern …»
«Denen soll ich wahrscheinlich die Mitgift stellen.»
«Nicht dass ich wüsste, davon war nicht die Rede. So etwas wird er nicht von dir verlangen, den Schwägerinnen die Mitgift zu zahlen, das ist unüblich.»
Verlangen wird er’s nicht, denkt Blume, aber erbetteln und erpressen, falls sie ihn heiratet. Tag und Nacht wird er ihr in den Ohren liegen, und sie wird’s am Ende tun, denn es wäre nicht schön von ihr, es zu verweigern.
«Wahrscheinlich will er fürs Erste noch lernen?», fragt sie weiter.
«Sicher, so ein hochbegabter junger Mann, ein echtes Wunderkind, was soll der anderes tun wollen als Lernen. Es wird sich doch ein Oberstübchen bei dir finden, wo er ungestört sitzen kann.»
Blume hat nicht schlecht Lust, sich den Milchbart ins Haus zu holen. Er, der mittellose Jüngling, abhängig von ihr, wird ihr nicht dreinreden; sie wird ihm nicht dreinreden in seine Lernerei, und so oft es vorgeschrieben ist, wird er mit ihr schlafen. Ein ruhiges, angenehmes Eheleben.
«Auch das ist eine Möglichkeit, ich lass es mir durch den Kopf gehen. Und sonst? Hast du noch einen weiteren Vorschlag?»
«Was, zwei ausgezeichnete Angebote, und du hast den Hals noch nicht voll?»
«Vielleicht ist das dritte Angebot noch besser? – Verzeih mir, Süßel, ich bin sehr zufrieden mit dem, was du mir vorgeschlagen hast, aber übers Knie brechen will ich so eine wichtige Sache nicht und alle, wirklich alle Möglichkeiten abwägen, eh ich mich entscheide. Also, was gibt es noch?»
«Nichts, was für dich passend wäre und sich messen könnte mit dem, was du schon gehört hast. Na ja, vielleicht der alte Kamelhaar, der sucht wieder eine Frau, der könnte an dir interessiert sein, denn Kinder hat er genug. Und alle Töchter verheiratet bis auf eine, ein solider Kaufmann dazu, wirklich eine gute Partie. Du könntest nach seinem Tod noch ein hübsches Sümmchen ergattern.»
«Nicht der Sohn, sondern der alte Kamelhaar? Der ist ja schon so tatterig, dass er kaum noch gerade stehen kann.»
«Nun», sagt Süßel und zwinkert ihr zu, «wenn’s dir auf das Stehen so ankommt, dann ist er allerdings nichts für dich.»
«Nein», bestätigt Blume, «der kommt nicht in Frage. Und sonst? Weißt du sonst keinen mehr? Fragen kostet nichts, er muss ja nicht Ja sagen und ich auch nicht.»
«Herr der Welt, du bist nie zufrieden, Blume. Und glaub mir, fragen kostet doch. Man kann nicht jeden jedem anbieten, die Leute sind sonst beleidigt, und mein Mann und ich, wir haben einen Ruf zu verlieren.
Also bitte, wenn du drauf bestehst, einen hab ich noch. Auch der hat speziell und ausdrücklich nach dir gefragt, der Dritte binnen drei Tagen, ich dachte schon, du habest die halbe Stadt verhext. Aber der ist völlig unmöglich, und ich würde dich nicht mit ihm belästigen, wenn du mich nicht so bedrängtest.»
«Wer also?», fragt Blume.
Süßel fummelt ein kleines Zettelchen hervor, hält es sich vor die zusammengekniffenen Augen und drückt ihr Doppelkinn forschend nach unten. «Reb Natan Nate Aschkenasi», liest sie in gespieltem Pathos vor, als sei es ein Ehrentitel. Blume wird es heiß und kalt, und damit Süßel davon nichts merkt, fragt sie mit betonter Gleichgültigkeit: «Also Nate Deutsch, der Strumpfwirker aus Raschkov?»
«Eben der. Aus Balta kommt er wohl ursprünglich, aber jetzt ist er in Raschkov ansässig. Ich hab’s erst nicht glauben wollen, so eine Anmaßung. Er muss sich bös verguckt haben in dich, dass er zwei und zwei nicht mehr zusammenzählen kann. Und dann soll ich dir noch ausrichten: Als Sicherheit für Scheidung oder Tod will er dir nur eine symbolische Summe in den Vertrag setzen lassen, denn er hat nichts, du aber sollst ihm keine Mitgift geben. Er will es so mit dir halten, dass du dein Eigentum behältst und er das seine, viel wird’s ja nicht sein. So weit, so schlecht. Aber warum er glaubt, dass du, nachdem du gestraft bist mit dem einen Schandfleck, deinem Sohn, dir freiwillig und absichtlich einen zweiten ins Haus holen willst mit ihm, diesem schrecklichen Nate Deutsch, das ist mir ein Rätsel.»
«Kinder hat er keine?», fragt Blume.
«Danach hab ich ihn gar nicht gefragt. Aber was interessiert’s dich, du wirst ihn doch sowieso nicht nehmen.»
«Du hast Recht, wohl kaum. – Und jetzt muss ich los, Süßel. Ich dank dir für alles; in zwei, drei Tagen komm ich wieder vorbei und sag dir, mit wem ich Verhandlungen aufnehmen will.»
Draußen, hinter der nächsten Ecke, wo Süßels spielende Kinder außer Sichtweite sind, fasst sich Blume im Gehen mit beiden Händen ins Gesicht und fühlt ihre Wangen wie Feuer glühen. Mit schnellen Schritten strebt sie nach Hause, den Hals gestreckt, den Blick erhoben und ein feines Lächeln um die Lippen.
4
Blume wird zu Hause ungeduldig erwartet. Rivele, die Magd, sitzt draußen auf der Bank und hat sich Eisik zwischen die Beine geklemmt, dem sie mit quirligen, unruhigen Bewegungen den Kopf laust. Dabei späht sie die Straße entlang, ihrer Herrin entgegen. Eisik, als er seine Mutter bemerkt, befreit sich aus Riveles Armen und trippelt in unsicherem Laufschritt und mit ausgestreckten Ärmchen auf sie zu, wie immer, wenn sie heimkehrt. Auch die Magd erhebt sich. Knochig, zappelig, ungelenk steht sie neben der Bank, bis Blume mit Eisik an der Hand herangekommen ist. Blume ist seltsam berührt, denn sie glaubt, ihren eigenen Ausdruck wieder zu erkennen in dem schmalen Gesicht, dessen schwarze Augen leuchten und auf dessen sonst bleichen Wangen unter zahllosen braunen Sommersprossen ein Hauch Rosa liegt.
«Ich muss Euch was sagen, Frau Wirtin», fängt Rivele an und beißt sich auf die Unterlippe, während ihr Mund auf der linken Seite nach oben zuckt, als wolle er gleich zu strahlen anfangen. Blume spürt genau, dass Rivele am liebsten vor Glück und Erregung auf der Stelle hüpfen würde.
«Was denn, mein Kind», fragt sie, wie man es von ihr erwartet, während sie Eisik und das Mädchen ins Haus führt.
«Ich werd Euch zu Neujahr verlassen müssen. Mein Vater war vorhin kurz hier, es steht jetzt fest, ich soll gleich nach Neujahr heiraten.»
«Du willst heiraten! Und schon so bald! Das kommt mir natürlich ungelegen, aber für dich ist es ein Glück. Deine Eltern müssen sehr zufrieden sein, dir beizeiten einen guten Mann gefunden zu haben. Dabei hatte ich gehofft, dass du noch ein, zwei Jahre bei mir bleibst. Du bist eine gute, brave Magd, Rivele, und ich werd lange warten müssen, bis ich so etwas wie dich wieder ins Haus kriege.»
Blume macht gebührend Aufhebens um die Sache, damit die frisch gebackene Braut nicht enttäuscht ist, setzt sich mit ihr auf die Küchenbank, legt ihr den Arm um die Schultern und lässt sie erzählen.
«Ein Kaufmannssohn aus Sedilkov», sprudelt es aus ihr hervor, «und wird ein eigenes Geschäft bekommen, jetzt, wo er heiratet. Neunzehn Jahre ist er alt, in Lemberg in der Jeschive hat er gelernt bis vor kurzem. Gut soll er aussehen, mit einem ganz fein geschnittenen Gesicht und schönen schwarzen Augen, mittelgroß.»
O weh, denkt sich Blume, wo mag da der Haken sein. Das ist eine zu gute Partie für ein Mädchen aus einfachen Verhältnissen. Laut sagt sie: «Du hast ihn also noch nicht selbst gesehen?»
«Nein, aber morgen schon werden wir uns vorgestellt. Bei meinen Eltern. Da wollt ich Euch gleich noch drum bitten, mir morgen frei zu geben, am Nachmittag.»
«Aber sicher, das versteht sich von selbst. Was wirst du denn anziehen, hast du dir das schon überlegt? Wenn du willst, können wir etwas von mir für dich heraussuchen, Schmuck oder eine andere Kleinigkeit, auch ein schönes Kleid könnte sich finden, das dir passt.»