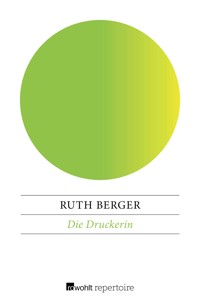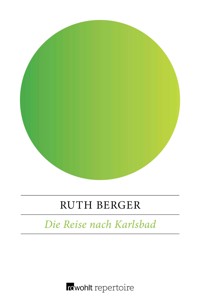
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine junge Frau von Stand auf der Suche nach einer guten Partie Karlsbad 1824: Die junge Bettina von Denkewitz, Majorstochter aus Berlin, lernt während der Sommerfrische zwei wohl situierte Junggesellen kennen. In den einen verliebt sie sich, mit dem anderen verlobt sie sich. Die Eltern sehen Letzteres mit Freude, und auch Bettina ist erleichtert über den Antrag des Baron Baringsdorf. Schließlich will sie nicht als alte Jungfer enden – der heimlich begehrte Lord Clarendon ist schon einer anderen versprochen. Doch dann stürzt auf einer Landpartie die Kutsche des Barons um, und die Kurgesellschaft wird gehörig durcheinander gewirbelt ... Ein Roman wie von Jane Austen: geistreich, spöttisch und voller Vertrauen in die Unfehlbarkeit des Herzens
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 554
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Ruth Berger
Die Reise nach Karlsbad
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Eine junge Frau von Stand auf der Suche nach einer guten Partie
Karlsbad 1824: Die junge Bettina von Denkewitz, Majorstochter aus Berlin, lernt während der Sommerfrische zwei wohl situierte Junggesellen kennen. In den einen verliebt sie sich, mit dem anderen verlobt sie sich. Die Eltern sehen Letzteres mit Freude, und auch Bettina ist erleichtert über den Antrag des Baron Baringsdorf. Schließlich will sie nicht als alte Jungfer enden – der heimlich begehrte Lord Clarendon ist schon einer anderen versprochen. Doch dann stürzt auf einer Landpartie die Kutsche des Barons um, und die Kurgesellschaft wird gehörig durcheinander gewirbelt ...
Ein Roman wie von Jane Austen: geistreich, spöttisch und voller Vertrauen in die Unfehlbarkeit des Herzens
Über Ruth Berger
Ruth Berger, geboren 1967 in Kassel, lebt als freie Autorin und Wissenschaftlerin in Frankfurt am Main.
Inhaltsübersicht
Die Gedichtzeilen auf S. 63 stammen von Friedrich Hölderlin und sind nach folgender Quelle zitiert: Friedrich Hölderlin, Die Wanderung, in: Hölderlins Werke in zwei Bänden, Berlin/Weimar 1989, Bd. 1, S. 224–226. Das Gedicht auf S. 34f. von David Onqinera stammt aus dem 16. Jahrhundert und wurde von der Autorin nach folgender Publikation aus dem Hebräischen gekürzt übersetzt: Schire David Onqinera, hg.v.Josef Patai, in: Qovez ’al jad – Minora Manuscripta Hebraica II (= Meqize nirdamim, Neue Reihe, 2. Folge), Jerusalem 1937, S. 108f.
Teil I
1 Ankunft und erste Bekanntschaften
Am Abend eines Julitags im Jahre 1824 traf in einer hoch bepackten Berline nebst einem kleineren Wagen eine augenscheinlich den besten Kreisen entstammende Familie vor dem Hotel Impérial in Karlsbad ein. Während eine matronenhaft beleibte, aber elegante Frau mittleren Alters, zwei nach der neuesten Mode gekleidete junge Mädchen und zwei weitere junge Frauen, deren einfache Kleidung sie als Zofen auswies, mit einer großen Zahl von Koffern und Truhen auf dem Trottoir vor dem Hotelportal warteten, war ihr einziger männlicher Begleiter, ein älterer Herr, in die Empfangshalle vorgeeilt, um dort die nötigen Regelungen zu treffen. Nur wenige Augenblicke hatten sich die Frauen draußen aufgehalten, die ältere mit gelassener Miene auf einen Gehstock gestützt, die jüngeren in steter leichter Bewegung, um die unangenehme Steifheit der Glieder nach langem, beengtem Sitzen abzuschütteln, da eilte ein livrierter Bediensteter, sie hineinzubitten und den Transport des Gepäcks an seinen Bestimmungsort zu veranlassen.
Trotz der Kürze der Zeit, welche die Frauengesellschaft vor dem Portal zugebracht hatte, erregte sie währenddessen einige Aufmerksamkeit bei drei jüngeren Herren, die in einem Salon seitlich des Eingangs beisammensaßen, von wo man die Allee überblicken konnte – ein Umstand, um dessentwillen sich gerade dieser Sitzplatz bei den fraglichen Herren schon seit mehreren Wochen großer Beliebtheit erfreute.
«Nun, lieber Bruder», kommentierte der Jüngste von ihnen die Szene, «kann unter diesen neu eingetroffenen Schönheiten eine vor deinem wählerischen Auge bestehen?» Der Angesprochene, ein etwa dreißigjähriger strohblonder Mann mit ebenmäßigen, etwas harten Gesichtszügen, entgegnete scherzhaft, dabei aber nur mühsam einen Anflug von Ärger verbergend, die älteste der Damen entspreche, von ihren körperlichen Vorzügen bis zu ihrem ganzen vornehmen Auftreten, am ehesten seinem Bilde von der Frau, die er dereinst auf den Landsitz seiner Väter heimzuführen gedenke; man müsse allerdings befürchten, dass sie nicht mehr ungebunden sei. Darauf ergriff auch der dritte das Wort, ein dunkelhaariger, um ein weniges jüngerer Mann mit fast schwarzen Augen, dessen auffallend blasse Gesichtsfarbe auf wenig Aufenthalt im Freien, vielleicht auch auf Krankheit schließen ließ: Ihm hätten von den fünf Schönheiten gleich zwei gut gefallen – zunächst eine der Zofen, ein Mädchen mit unzähmbaren roten Locken, und dann die ältere der beiden Töchter, ein eher zu mageres, aber doch recht hübsches Ding, das, so habe er es jedenfalls empfunden, von besonderer, charmanter Lebhaftigkeit zu sein schien.
Diese Worte waren in ausgezeichnetem, fehlerfreiem Deutsch gesprochen, wiewohl man merkte, dass dies nicht die Muttersprache des Dunkelhaarigen war.
«Das passt nun wieder ganz zu dir, James», lachte der Jüngste der Runde. «Da gehen wir beiden Brüder schon seit zwei Sommern vergeblich auf Brautschau, haben an jeder was zu mäkeln und können die Rechte nicht finden, während dein Herz allem mit Begeisterung zufliegt, was langes Haar hat. Aber sieh dich vor, dass du deiner ‹Lebhaften› nicht gar zu schöne Augen machst, du bist anderweitig vergeben, und ich habe noch Pläne mit ihr, vielleicht ist sie doch was für unseren Franz» – wobei er dem dritten mit spitzbübischem Lächeln auf die Schulter klopfte.
Die junge Dame, von der hier in so saloppem Ton gesprochen wurde, war Bettina von Denkewitz, die älteste Tochter eines Majors, der seinen Rang in der Berliner Gesellschaft weniger militärischem Ruhm als seinen Ländereien in Schlesien und seinem vertrauten Ein- und Ausgang am Hofe verdankte (war er doch der Jugendfreund eines langjährigen hohen Hofbeamten, des Grafen von Z.).
Seit seinem Rückzug aus dem aktiven Militärdienst einige Jahre zuvor hatte der Major seine ganze Familie nach Berlin umsiedeln lassen. Zum einen sagte ihm das Leben in der Stadt mit seinen beständigen gesellschaftlichen Aktivitäten mehr zu als eine zurückgezogene Existenz in einem der entlegensten Winkel der deutschen Lande. Zum andern war er überzeugt, dass den beiden Töchtern der Schliff eines weiten gesellschaftlichen Umgangs bei der Anbahnung einer Ehe ebenso nützlich sein werde, wie eben dieser Umgang selbst mannigfaltige Kontakte zu den besten Familien eröffnete, sodass sich eine gute Partie früher oder später von allein ergeben müsste.
Leider hatten sich der Major und seine Frau, eine Rheinländerin von einfachem, aber stabilem Gemüt, bisher, was ihre ältere Tochter Bettina betraf, in dieser Hoffnung auf krasseste Weise enttäuscht gesehen. Das Mädchen war zwar von Gesicht und Körper nicht unansehnlich und konnte trotz seiner bedauerlichen Magerkeit als hübsch gelten, wenn es ein wenig Sorgfalt auf seine Toilette verwendete, aber es war dabei auf geradezu krankhafte Weise schüchtern und nervös. So hatte es sich bisher stets geweigert, an größeren Gesellschaften oder gar Bällen teilzunehmen, ja, zog sich sogar anlässlich gewöhnlicher Abendeinladungen im elterlichen Hause oft genug mit Migräne oder einer anderen Unpässlichkeit, von der man nicht wusste, ob sie vorgeschoben war oder sich aus Aufregung tatsächlich eingestellt hatte, leidend in sein Bett zurück. War Bettina doch einmal bei einem gesellschaftlichen Ereignis anwesend, bedeutete dies für ihre Mutter, die jede ihrer Regungen ängstlich beobachtete, mehr eine Qual denn eine Freude: Auf Ansprache, zumal von Männern, reagierte sie oft mit auffälligem, heftigem Erröten, dessen Intensität in keinem Verhältnis zum Anlass stand; wurde sie zu einem Musik- oder Gesangsvortrag aufgefordert, schien der Mutter ihre Darbietung, wenn Bettina denn nach langem, eher linkischem als damenhaftem Zieren sich schließlich dazu entschloss, stets mangelhaft, nie so geschliffen und perfekt wie der Vortrag anderer junger Damen, und jedenfalls wesentlich schlechter als das, was ihr Begabung und Fleiß ermöglichten und was man von ihr hören konnte, wenn die Familie unter sich war.
So verwunderte es kaum, dass Bettina von Denkewitz noch keinen ernsthaften Verehrer vorzuweisen hatte, ein Umstand, der ihrer Mutter umso peinlicher war, als sich im Kreise ihrer Damenbekanntschaften das Gespräch unentwegt um Avancen drehte, die dieser oder jener galante junge Mann aus gutem Hause der einen oder anderen strahlend schönen, sicher auftretenden und beliebten Tochter machte, gemacht hatte oder zweifelsohne zu machen im Begriffe war. Die bedauernswerte Majorin konnte bei solchen Unterhaltungen wenig aus der eigenen Erfahrung beisteuern. Sie profitierte zumindest insofern, als sie hier Material schöpfte, mit dem sie ihrer Tochter am Mittagstisch illustrieren konnte, wie erfolgreich andere junge Damen von ihren Reizen, ihrer Bildung und ihren Begabungen Gebrauch zu machen verstanden und wie sehr Bettinas Unfähigkeit zu sicherem gesellschaftlichem Auftreten ihr selbst und letztlich auch ihrer Familie schade, deren ganze Hoffnung und ganzer Ehrgeiz auf eine glückliche und standesgemäße Verheiratung der beiden Töchter ausgerichtet sei.
In der Tat verhielt es sich so, dass das Ehepaar von Denkewitz mit besonderer, besorgter Aufmerksamkeit das Werden und Gedeihen der beiden Töchter, Bettinas und der erst fünfzehnjährigen Luise, verfolgte, denn andere Kinder waren ihm nicht geschenkt. Ein kleiner Sohn war, einige Jahre nach der Geburt Luises, tot auf die Welt gekommen. Während der Niederkunft hatte auch die Mutter in größter Gefahr geschwebt, sodass der Arzt, ein alter Bekannter der Familie des Majors, diesem, nachdem die Krise überstanden war, im Geheimen eine traurige Mitteilung machen musste: Er befürchte, dass die Majorin eine weitere Schwangerschaft nicht überleben werde. Ein unglücklicher Ausgang sei zwar nicht absolut sicher, aber nach seiner Erfahrung in einem Fall wie dem ihren doch mehr als wahrscheinlich. Als alter Freund fühle er sich verpflichtet, den Major von dieser seiner Befürchtung zu unterrichten, und überlasse ihm nun die Entscheidung, ob er der Hoffnung auf ein weiteres Kind, möglicherweise den ersehnten Stammhalter, gegenüber etwaigen Risiken mehr Gewicht beilegen wolle als umgekehrt. Dem Major, der an seiner Frau hing, war ihre gütige, lebhafte, manchmal etwas bestimmende, aber sehr vertraute Anwesenheit lieber als ein hypothetischer Stammhalter, den er nicht kannte und der sich als ein wenig liebenswerter Mensch erweisen mochte, wenn nicht ohnehin wieder als Totgeburt. So enthielt er sich denn künftig einiger Freuden des Ehelebens, um andere dafür umso länger genießen zu können. Seiner Frau, die er bald nach ihrer völligen Wiederherstellung über die Umstände informierte, war diese Entwicklung zunächst gar nicht unlieb gewesen. Später jedoch schlich sich nach und nach eine schwer zu beschreibende wehmütige Gemütstönung bei ihr ein, etwas wie eine leichte Verbitterung über das Schicksal, über einen Mangel in ihrem Leben, den andere Frauen selbst niederen Standes nicht leiden mussten.
Umso mehr konzentrierte sie sich nun auf ihre beiden Töchter und die vielerlei Aktivitäten, die mit deren Gesunderhaltung, Bildung und Ausstattung zusammenhingen und die am Ende ihrer Unterbringung in einem der Stellung der Familie angemessenen und glücklichen Ehestand dienen sollten.
Dass sie dem Erreichen dieses Ziels bisher nicht näher gekommen war, musste an sich noch nicht als Grund für ernste Sorge genommen werden: Bettina beendete gerade erst ihr zwanzigstes Lebensjahr, ein Alter, in dem der Jungfernstand alles andere als eine Schande bedeutete. Ihre beständigen gesellschaftlichen Misserfolge gaben allerdings einigen Anlass, sich Gedanken zu machen, und während eines Gesprächs mit ihrem Gatten, in dem die Majorin ihren diesbezüglichen sorgenvollen Ahnungen lebhaftesten Ausdruck verliehen hatte, war der Entschluss gefallen, den Sommer über einige Monate in Karlsbad zu verbringen.
Die Hoffnung der Eltern war, Bettina möge hier, durch alltägliche Übung in der ungezwungenen Atmosphäre eines Bades, sich so weit an gesellschaftlichen Umgang mit anderen jungen Leuten gewöhnen, dass sie sich später im heimischen Berlin mit größerer Sicherheit und Eleganz in der Öffentlichkeit werde zeigen können. Insgeheim glaubte der Major zudem, die Vielzahl der Unterhaltungsmöglichkeiten, die Karlsbad bot, zusammen mit der Weitläufigkeit der Räume und Anlagen, in denen jene sich abspielten, würden Bettina zumindest zeitweise von der beständigen mütterlichen Beobachtung befreien und dadurch etwas unbefangener machen.
Als der Major und seine Gemahlin am ersten Karlsbader Morgen nach ziemlich verspätetem Frühstück gemeinsam auf die Terrasse traten, wo sie sich mit ihren in jugendlichem Entdeckerdrang schon eine halbe Stunde zuvor enteilten Töchtern vereinen wollten, trafen sie auf ein Bild, das allerdings zu den schönsten Hoffnungen Anlass gab:
An einem marmornen Tisch saß eine Gruppe von jungen Menschen in eine freudvolle und angeregte, aber dennoch die Gebote des Anstands und der vornehmen Zurückhaltung nicht durch übertriebene Lebhaftigkeit verletzende Unterhaltung vertieft. Schmeichelnd fiel die Morgensonne, gefiltert durch ein schmiedeeisernes Gitter, das die Terrasse begrenzte und zum Teil überschattete, auf die leicht geröteten Wangen der Mädchen, die beide, die Ältere wie die Jüngere, mit gelöst-glücklichem Gesichtsausdruck, öfter durch ein strahlendes Lächeln unterbrochen, an dem Austausch mit ihren männlichen Tischnachbarn teilnahmen. Von den drei gut gekleideten, vornehm wirkenden Herren waren es die beiden sonnengebräunten Blonden, die sich mit großer Aufmerksamkeit den Mädchen zuwandten, bald die eine, bald die andere ansprachen oder selbst für länger das Wort ergriffen. Der Blasse, Dunkelhaarige aber mochte nicht recht in die glückliche Gesellschaft passen, saß etwas abseits, wirkte unbeteiligt und ließ den Blick immer wieder in die Ferne schweifen.
Der Major war, als er dieser Szene gewärtig wurde, so angerührt, dass er seiner Frau vorschlug, sich in den Salon zurückzuziehen und die jungen Menschen noch eine Weile in diesem traulichen und unbeschwerten Zusammensein zu belassen. Die Majorin jedoch wollte davon nichts hören und bestand darauf, zunächst in Erfahrung zu bringen, wer die Herren seien und ob eine Bekanntschaft mit ihnen für ihre Töchter überhaupt als wünschenswert erachtet werden könne. Der Major fügte sich und geleitete seine Frau zu der Gesellschaft am Marmortisch. Freudig erstaunt gewahrte er dort, dass es seine ältere Tochter übernahm, ihre Eltern mit den jungen Männern bekannt zu machen. Den männlich-heldenhaft wirkenden, hoch gewachsenen Blonden stellte sie als Baron Baringsdorf vor, den deutlich jüngeren und mit weicheren Gesichtszügen ausgestatteten zweiten Blondschopf als dessen Bruder Friedrich und wandte sich dann etwas zögernd dem Dunkelhaarigen zu: «Und dieser Herr ist …» – da drehte der Dunkelhaarige, der scheinbar gelangweilt zur Seite gesehen hatte, seinen Kopf, blickte ihr direkt in die Augen und lächelte. Bettina errötete schlagartig, stockte, wirkte verwirrt, und der junge Mann beendete selbst den Satz: «James Lord Clarendon. Frau Majorin, Herr Major, ich freue mich sehr, Ihre Bekanntschaft zu machen.»
Die ganze Gesellschaft hatte sich beim Hinzukommen des Ehepaares erhoben. Jetzt zerstreute sie sich, nach einigen belanglosen Worten, die der Major noch mit den Herren wechselte. Die beiden Mädchen brachen gemeinsam mit ihren Eltern zu einer vormittäglichen Promenade auf, die leicht getrübt wurde durch die schlechte Stimmung der Majorin: Gerade in dem Moment, da sie mit Freude den Rang der neuen Bekanntschaften ihrer Töchter zur Kenntnis nahm, war jede Hoffnung auf eine Fortführung der angeknüpften Beziehungen durch das ungeschickte Verhalten Bettinas bei der Vorstellung des Lords verspielt worden.
2 Verschiedene Meinungen
In diesem, wie sich bald herausstellen sollte, fälschlichen Glauben war die Majorin noch befangen, als sie am übernächsten Abend eine umfangreiche Epistel nach Berlin verfasste.
Im Verlauf des Tages hatte sie Erkundigungen eingezogen, wozu sie speziell einen Aufenthalt in der Wandelhalle des Marienbrunnens vorzüglich verwenden konnte, und sich versichert, dass die Herren von Baringsdorf sowie Clarendon von unzweifelhaftem Ruf und sämtlich unverheiratet waren. So befand sie sich denn in der ungewöhnlichen und glücklichen Lage, fast ganz wahrheitsgemäß ihren Berliner Freundinnen berichten zu können, wie ihre Tochter von drei akzeptablen Freiern auf einmal umworben werde. Diese Genugtuung wollte sie sich nicht entgehen lassen; darum schrieb sie den Brief gleich jetzt, aus Angst, in einigen Tagen könnten die Kandidaten bereits öffentliches Desinteresse gezeigt haben, was ihr die Freude an einem Bericht über die bisherigen Triumphe Bettinas doch merklich geschmälert haben würde.
Während sie in ihrem Salon solcherart beschäftigt war und ihr Mann am Rauchtisch in einer Zeitung blätterte, klopfte ein Page und überbrachte ein Billett an den Major, der seiner Frau den Inhalt sogleich mitteilte: Der Baron Baringsdorf bitte die Familie von Denkewitz für den folgenden Abend zu einer kleinen Soiree auf seine Suite.
Sofort erhob sich die entzückte Majorin, um ihre Töchter unverzüglich von dieser bemerkenswerten Entwicklung zu unterrichten und bereits erste Vorbereitungen, wie die Auswahl der Kleider und der Frisuren, in die Wege zu leiten.
«Ich bitte dich, liebe Dorothea», hielt ihr Mann sie zurück, «bedenke doch, dass du damit Bettina viel zu früh in Aufregung versetzest und nur erreichen wirst, dass sie den Anlass zu wichtig nimmt und deshalb Migräne entwickeln wird.»
«Dass sie ihn zu wichtig nimmt, sagst du? Aber er ist doch sogar von alleräußerster Wichtigkeit! Diese Einladung ist gewiss eine besondere Aufmerksamkeit des Barons gegenüber Bettina, und vielleicht eröffnen sich dadurch Chancen auf eine zukünftige Verbindung!»
«Gerade», entgegnete der Major, «weil es solche Möglichkeiten zu bedenken gilt – wenn ich mir da auch keineswegs so sicher bin, wie du es zu sein scheinst –, gerade darum bitte ich dich, unseren Töchtern erst morgen etwa zwei Stunden vor der Zeit von der Einladung zu berichten. Glaube mir, Dorothea, andernfalls wirst du Bettinas und unseren Interessen mehr schaden denn nützen.»
Ein so bestimmtes Eingreifen des Majors in die Entscheidungen seiner Frau war ungewöhnlich und verfehlte eben deshalb seine Wirkung nicht. Wenn er die Majorin auch nicht ganz von der Richtigkeit seiner Ansichten überzeugen konnte, so fügte sie sich doch zunächst darein und blieb, wo sie war, statt sich auf die Suche nach ihren Töchtern zu begeben.
Die waren mit einer unterdessen aus dem Bergischen eingetroffenen Tante, Amalie von Middeldorf, einer älteren Schwester der Majorin, zu einem Spaziergang in die Promenaden aufgebrochen, um nach einem bedrückend schwülen Tag die milde Abendluft zu genießen. Weit war man jedoch nicht gekommen. Man war auf Bekannte gestoßen, und während der soeben berichtete Austausch zwischen dem Major und seiner Frau stattfand, saßen die Mädchen, von beiden Eltern unvermutet, in derselben Gesellschaft wie am Morgen zuvor, nur ergänzt durch die Tante, an dem marmornen Terrassentisch. Das Gespräch war lebhaft und drehte sich, zum Leidwesen von zweien der Damen, seit einiger Zeit um die Wissenschaft.
«Es will mir nicht in den Sinn», hatte soeben Friedrich von Baringsdorf das Wort ergriffen, «warum man in dieser Frage an der grundsätzlichen Wahrheit des biblischen Schöpfungsberichtes zweifeln sollte. Hat sie sich denn nicht auch in anderer Hinsicht bestätigt? So hat Cuvier nachgewiesen, dass zunächst die niederen Tiere, nämlich Fische, Kriechtiere und Amphibien, und erst in späteren Zeitaltern die höheren Wirbeltiere entstanden sind, der Mensch jedoch als Krönung ganz am Schluss, im letzten, dem unsrigen Zeitalter dazukam und somit fossil nicht existiert. Ist das nicht ganz die Reihenfolge, wie sie uns die Bibel überliefert, wenn auch dort die Zeitdauer des gesamten Schöpfungsvorgangs auf ein fast absurdes Maß verkürzt erscheint? Aber hier ist es unsere Schuld, wenn wir die Bibel zu wörtlich nehmen: Was für Gott ein Tag ist, das kann aus menschlicher Sicht gut und gerne ein ganzes Zeitalter bedeuten. Nein, bis ihr mir nicht überzeugendere Gründe für das Gegenteil vorlegen könnt, glaube ich daran, dass die gesamte Menschheit von nur einem Mann und einer Frau abstammt, deren Nachkommen sich dann in verschiedene Stämme und Nationen aufgespalten haben.»
«Es ist ein lobenswerter Zug von dir, dass du an den Überlieferungen unserer Vorfahren, denen wir Respekt schulden, festhalten möchtest», meldete sich nun der Lord mit seinem charakteristischen leichten Akzent zu Wort. «Es gibt aber doch hinreichend gute Gründe für Zweifel. Im Tierreich hat es ja keine derart einheitliche Entwicklung gegeben, wie du sie jetzt nach Cuvier dargestellt hast. So ist heute wie in antediluvialer Zeit die Fauna auf den verschiedenen Kontinenten höchst unterschiedlich. In Amerika gibt es das Faultier und das Gürteltier, in Afrika die Giraffe und das Nilpferd, und in Australien fehlt die Ordnung der Säugetiere ganz und ist durch die Ordnung der Beuteltiere ersetzt. Es scheint doch, dass der Schöpfer jedem Kontinent seine eigene Tier- und Pflanzenwelt beigesellt hat, die sich, je nach Klima und Landschaft, von denen anderer Kontinente mehr oder minder stark unterscheidet. Genauso verhält es sich mit den Menschen: Es muss mehrere erste Menschenpaare oder Menschengruppen gegeben haben, verschieden gestaltet, damit sie der Umgebung, für die sie geschaffen, in ihren äußeren Eigenschaften entsprachen. Nimm etwa das wollige, feste Haar des Negers, das ihn vor zu starker Hitzeeinwirkung auf den Schädel durch die sengende afrikanische Sonne schützt, während die nördlichen Völker eher feines Haar besitzen.»
«An deinem Beispiel», entgegnete der während dieser Ausführungen ungeduldig gewordene Friedrich, «kann man im Gegenteil ablesen, dass von einer unterschiedlichen ursprünglichen Schöpfung der Menschen nicht die Rede sein kann. Unser feines, langes Haar ist doch für jeden ersichtlich dem Wollhaar des Negers bei weitem vorzuziehen. Das Letztere ist nicht der ursprüngliche Zustand, in welchem der Schöpfer das Menschenhaar geschaffen hat, sondern eine Degeneration im Gefolge des ungünstigen afrikanischen Klimas, wie das Blumenbach und andere auch für die Hautfarbe und Gesichtsform dargelegt haben.»
«Aber Herr von Baringsdorf», ließ sich an dieser Stelle zum großen Erstaunen ihrer Tante Bettina vernehmen, «was macht Sie denn so sicher, dass unser Haar dem des Negers vorzuziehen sei? Schon Voltaire hat eindringlich beschrieben, wie relativ solche Urteile sind und dass jedes Volk eben gerade das für schön und wohlgeformt hält, was es selber auszeichnet. Wenn wir Kaukasier nun unser Urteil für allgemein gültig halten wollen, dann kommen wir allerdings auf Ergebnisse wie die von Blumenbach, der glaubt, die von uns abweichenden Rassen seien degeneriert, weil sie ihre Heimat mit dem ihnen zuträglichen Klima verlassen hätten. Aber hieße das nicht dem Schöpfer schlechte Arbeit unterstellen? Die Besiedelung der ganzen Welt durch den Menschen war doch Teil des Schöpfungsplans, sollte sie nur unter entstellender Degeneration möglich gewesen sein?»
«Du siehst, Friedrich», versetzte nun der Baron, der Bettina während ihrer Rede mit halb erstauntem, halb gönnerhaftem Lächeln angeblickt hatte, «da bist du nun von uns dreien mit so vielen Argumenten eingekesselt worden, dass du dich unmöglich mehr herauswinden kannst. Und damit sollten wir es vorläufig auch bewenden lassen, denn ich fürchte, wir haben Frau von Middeldorf und Fräulein Luise von Denkewitz mit unserem gelehrten Disput nicht unerheblich gelangweilt.»
«Aber ganz und gar nicht, Eure Exzellenz», erklärte daraufhin Frau von Middeldorf. «Es ist immer lehrreich und interessant, einem philosophischen Austausch unter Männern zu lauschen, obzwar wir als Frauen natürlich wenig davon verstehen» – wobei sie ihrer älteren Nichte einen tadelnden Seitenblick zuwarf. «Für uns drei ist jetzt aber dennoch Zeit, uns zurückzuziehen; ich fürchte, meine Schwester und ihr Gatte könnten sich wegen unseres unerwartet langen Ausbleibens sorgen. Seien Sie unseres Danks für das angenehme Beisammensein versichert, ebenso wie unserer Wertschätzung Ihrer Leutseligkeit, und haben Sie eine gute Nacht.»
Bettina, die sich für die abschließenden Worte ihrer Tante nicht weniger schämte, als jene es zuvor bei der Einmischung ihrer Nichte in die gelehrte Debatte getan hatte, erhob sich als Erste und murmelte ein unverständliches Abschiedswort, worauf alle aufstanden und sich gegenseitig eine gute Nacht wünschten.
Als die drei verhinderten Spaziergängerinnen kurz darauf bei der Majorin und dem Major anklopften, um ihre Rückkunft zu melden, und Frau von Middeldorf ihrer Schwester von der Gesellschaft erzählte, in welcher man die letzte Stunde verbracht, da konnte diese nicht länger an sich halten und berichtete entgegen ihren Vorsätzen nun doch von der Einladung des Barons. Die beiden Frauen verfielen sofort in ausführliche Betrachtungen über die außerordentliche Bedeutung, welche der bevorstehenden Abendgeselligkeit für die Zukunft der Fräulein von Denkewitz, und vornehmlich der Bettinas, zukam.
Diese, die sich in der freundlichen und klugen Gesellschaft der drei jungen Herren bislang immer recht wohl, ja fast glücklich gefühlt hatte, war im ersten Moment ebenfalls über die Einladung erfreut. Doch als sie nun hörte, wie Mutter und Tante beschlossen, sie müsse morgen als belle des Abends glänzen und sich damit ein für alle Mal der Gunst zumindest eines der Herren versichern, da breitete sich eine unangenehme Kälte in ihren Händen und Füßen aus, und sie begann, unruhig auf ihrem Stuhl hin und her zu rutschen. Als gar, ohne die Betroffene zu konsultieren, festgelegt wurde, Bettina müsse, komme, was wolle, einen Musikvortrag geben, und man sich über die Frage den Kopf zu zerbrechen begann, welches Stück aus ihrem Repertoire am besten geeignet sei, Baronenherzen zu gewinnen, unterbrach Bettina und teilte unwirsch mit: Sie beabsichtige nicht, sich in der Gesellschaft von Fremden öffentlich zu produzieren, um Aufmerksamkeit zu erregen; insbesondere werde sie dem Publikum nicht ihr mittelmäßiges Klavierspiel zumuten. Sie wolle vielmehr still und zurückhaltend an der Veranstaltung teilhaben und es würdigeren, talentierteren Damen überlassen, im Vordergrund des Interesses zu stehen.
Die Tante, welche Bettina vor dem Zusammentreffen in Karlsbad mehrere Jahre nicht gesehen hatte, war in höchstem Maße erstaunt, ja erschrocken über diesen ihr völlig unbegreiflichen Ausbruch ihrer Nichte, die sie als kluges und fröhliches Kind ohne Launen und Allüren kannte.
«Bettina, meine Liebe, mir scheint, du begreifst die Lage nicht ganz», begann sie nun, ihrer Nichte einen Vortrag zu halten. «Du bist eine junge Dame auf der Suche nach einer Partie, und wie deine gleich situierten Altersgenossinnen bist du gehalten, willst du einen standesgemäßen Ehemann finden, auf schickliche Weise deine Reize zur Schau zu stellen. Dazu sollten dir gesellschaftliche Anlässe wie der morgige dienen – gedenkst du nicht, sie zu nutzen, so tätest du besser daran, ihnen gar nicht erst beizuwohnen. Und was dein Klavierspiel betrifft: Als junges Ding von zwölf, dreizehn Jahren hast du, wie ich mich entsinne, für dein Alter ausgezeichnet gespielt. Sollten deine Fähigkeiten heute wirklich nur als mittelmäßig zu bezeichnen sein, so wäre dies Grund genug, sich zu schämen, anstatt sich trotzig damit zu entschuldigen. Eine junge Dame muss das Klavierspiel mit größtem Fleiß betreiben, zum einen, um unter ihren Konkurrentinnen zu bestehen, solange sie unverheiratet, zum anderen, um ihrem Manne zur Freude und Zerstreuung dienen zu können, wenn sie denn in den Bund der Ehe getreten ist. Auf deine äußeren Reize allein kannst du dich nicht ein Leben lang verlassen. Bei aller Sorgfalt werden diese früh genug verwelken. Du wirst dir innere Reize schaffen müssen, um deinen Mann auf Dauer an dich zu binden.»
Eine tiefe Röte war Bettina während dieser Worte nach und nach ins Gesicht gestiegen, und ihre Stimme klang noch gereizter als zuvor, als sie ihrer Tante antwortete: «Mein Klavierspiel ist für den Hausgebrauch durchaus genügend und jedenfalls nicht schlechter als das deinige. Ich bin lediglich nicht so vermessen zu glauben, dass andere hierin nicht viel besser begabt seien als ich. Was die inneren Reize angeht, so hoffe ich, dass ein kluger Mann bei einer Frau auch weitläufige Bildung zu schätzen weiß, die sie ihm zu einem angenehmen Visavis und Ratgeber machen kann.»
Auch Frau von Middeldorf war nun aufs Äußerste verärgert und entgegnete:
«Ich sehe wohl, dass gut gemeinter Rat bei dir auf taube Ohren stößt, doch möchte ich dich bei dieser Gelegenheit darauf aufmerksam machen, dass du dich vorhin auf der Terrasse tatsächlich unschicklich in den Vordergrund gespielt hast, wie du es nennst. Mit deiner ‹weitläufigen Bildung› wolltest du wohl prahlen, als du dich ausgerechnet mit dem abgeschmackten, welschen Voltaire auf den Lippen in ein Gespräch unter Männern einmischtest, was dir nicht zustand und womit du sicher nicht die Zuneigung der Herren gewonnen hast. Ist doch einem Mann nichts unerträglicher als ein Weib, das die Gelehrte spielen will.»
Hierauf erwiderte Bettina nichts, erhob sich von ihrem Platz, raffte Rock, Ridikül und Schal zusammen, hauchte «Gute Nacht» und verließ den Raum, einen resignierten Vater, eine unglückliche Mutter, eine verärgerte und verwirrte Tante sowie eine grenzenlos gelangweilte Schwester zurücklassend.
3 Rosige Aussichten
Am folgenden Tag um die Mittagszeit machten sich die beiden Fräulein von Denkewitz zu einem in geringer Entfernung vom Hotel gelegenen Kurzwarenhandel auf, um dort, nach dem Beschluss der Majorin, noch einige farbige Bänder zu erstehen, die am Abend ihre Frisuren zieren sollten. Solch kleine gemeinsame Unternehmungen der Schwestern waren sonst von lebhaften Gesprächen und häufigem mädchenhaftem Lachen begleitet. Diesmal aber war, durch Bettinas anhaltende leichte Missstimmung verursacht, der kurze Ausflug nichts mehr als eben eine lästige Besorgung, der es sich zu entledigen galt. Bettina bangte nicht nur vor dem Abend, es bedrückte sie auch der unglücklich verlaufene Wortwechsel mit der Tante, welcher sie, obzwar sie in manchem anders dachte, im Grunde herzlich zugetan war. Am Morgen hatte sie sich entschuldigen wollen, aber der rechte Moment dazu hatte sich nicht ergeben, auch waren ihr passende Worte nicht eingefallen. Vor allem aber hatte das sehr abweisende Verhalten der Tante am Frühstückstisch ihren festen Vorsatz ins Wanken gebracht, im Dienste einer Versöhnung die Schuld für die Verstimmung ganz auf sich zu nehmen.
Als die jungen Damen, von ihrer Besorgung zurückkehrend, die Hotelhalle betraten, wurden sie zu ihrer Überraschung vom Baron Baringsdorf empfangen. Er und Clarendon hätten, so erläuterte er, im benachbarten Salon sitzend, die Damen die Vortreppe hinaufsteigen sehen und sich entschlossen, sie als Schiedsrichter in einem Disput über eine Frage der Malerei anzurufen. Er bitte sie, diesem Zweck einige Minuten ihrer Zeit zu opfern und sich kurz mit ihm und seinem Freund im Salon niederzulassen, wo das Streitobjekt als Wandschmuck ausgestellt sei.
Die Fräulein von Denkewitz erklärten sich zu dazu gerne bereit und folgten dem Baron in den Salon. Das fragliche Kunstwerk, welches seitlich über dem Tisch hing, an dem der Lord saß und an dem jetzt auch die drei anderen Platz nahmen, war die Abbildung einer Jagdszene in Öl: Vor einer dramatischen Bergkulisse trieben bewaffnete und waidmännisch gekleidete Reiter mit Hunden zwei Füchse vor sich her.
Die Frage, die sich an diesem Bild entzündet hatte, berichtete nun der Baron, sei eine grundsätzliche: Habe die Kunst einen Wert an sich, oder sei es das auf einem Bild Dargestellte, das für den Betrachter seinen Wert ausmache?
«Verzeihen Sie, Exzellenz», bemerkte hierzu Bettina, «wenn ich mich unverständig zeige – mir ist nicht ganz klar, worauf Sie hinauswollen. Gibt es denn eine Kunst an sich, die gänzlich unabhängig ist von dem, was sie darstellt?»
«Genau das, Fräulein von Denkewitz, ist die Frage, um die es hier geht», warf da der Lord ein. «Wir sollten vielleicht bei dem Beispiel bleiben, über das wir uns nun seit fast einer Stunde streiten, ohne dass einer den anderen überzeugen könnte. Das Kunstwerk, welches Sie hier vor sich sehen, hat als solches schwere Mängel. Der Maler hat eine breite Palette verschiedener Farbtöne verwendet und dabei fast nicht gemischt, sodass die Farben bunt nebeneinander stehen. Es fehlt also in dem Bild die farbliche Harmonie. Auch hat der Künstler es versäumt, die Formen aufeinander zu beziehen; das Gemälde hat kein Zentrum, keine das Auge leitenden Linien, keine natürliche Umrahmung. Und zuletzt fehlt in diesem Bild das Spiel von Licht und Schatten. Es scheint sich um eine Szene aus einer fremden Welt zu handeln, einer Welt, die nicht von einer Sonne beleuchtet wird, in der das Licht von überall kommt und die Szene gleichmäßig aushellt.
Während ich glaube, dass ein so mangelhaft ausgeführtes Kunstwerk keinen Wert für den Betrachter besitzen, ihn nicht erfreuen kann, hält dagegen unser Freund, der Baron, das Bild für eine Zierde dieses Raums. Auch er sieht zwar die künstlerischen Mängel, glaubt aber, dass diese durch das ansprechende Motiv ausgeglichen würden.»
«Kurz», unterbrach der Baron, «ich bin selbst ein Freund der Jagd und freue mich über ein wirklichkeitsgetreues Jagdmotiv, betrachte es gerne, mag es nun etwas bunt geraten sein oder nicht, weil es in mir Erinnerungen an schöne Stunden und damit verbundene angenehme Gefühle weckt.»
«Ich glaube», ließ sich nun Luise vernehmen, «dass wir in dieser Frage ganz auf Ihrer Seite stehen, Exzellenz. Wenn ein Bild erkennbar etwas Schönes darstellt, dann ist es auch ein schönes Bild, ganz gleich, wie es gemalt ist. Oder bist du etwa anderer Meinung, Bettina?»
Bettina lachte: «Ich schließe mich dir an, liebe Schwester. Wenn ein Bild etwas zeigt, was uns gefällt, was uns vielleicht sogar lieb und teuer ist, werden wir es auch in dem Falle gerne betrachten wollen, dass es nur mittelmäßige künstlerische Qualität hat. Für gewöhnlich wird der Wert eines Bildes für den Betrachter gewiss ganz erheblich vom Motiv bestimmt. Allerdings mag es Menschen geben, die in der Kunst weitaus mehr als die meisten ihrer Zeitgenossen bewandert sind und denen deshalb eine fehlerhafte technische Ausführung mehr als anderen den Genuss verleidet. Wahrscheinlich sind Sie, my lord, so ein Mensch.»
Mit diesen letzten Worten, die ihr, kaum waren sie heraus, plötzlich gewagt vorkamen, ohne dass sie hätte sagen können, warum, wandte sie sich Lord Clarendon zu, errötend in dem Bewusstsein, dass sie ihn zum ersten Male direkt ansprach.
«Tatsächlich», entgegnete dieser daraufhin lächelnd, «mag es wohl ein Grund für unsere unterschiedliche Auffassung sein, dass ich als Einziger an diesem Tisch ein fast professioneller Liebhaber der Malerei bin. Mein Vater hat eine recht umfangreiche Kunstsammlung hinterlassen, die ich mich bemühe zu pflegen und zu mehren, und vor allem habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, einigen jungen Malern, die ihre besondere Begabung und Befähigung erwiesen haben, Unterstützung in jeder Form zukommen zu lassen. Das schließt auch ein, dass ich versuche, Käufer für ihre Werke zu finden, und mich so geradezu als Kunsthändler betätige.»
«Wenn man unsere gegensätzlichen Interessen betrachtet, ist es nun wahrlich kein Wunder, dass wir über dieses Bild nicht einig werden», meldete sich wieder der Baron zu Wort. «Schon als Bub hast du ja mit deinem und meinem Vater in der Bibliothek gesessen und über Bilder geschwatzt, während ich mir mit den anderen Gästen zu Pferd die frische Luft hab um die Nase wehen lassen.»
«So kennen Sie sich wohl schon seit vielen Jahren?», warf Bettina fragend ein.
«In der Tat», versetzte der Baron, «schon unsere Väter waren eng befreundet, und wir beide haben die Freundschaft sozusagen geerbt. Zur Jagdsaison hatten wir, als James’ Vater noch lebte, die Clarendons so gut wie jedes Jahr zu Gast. Gejagt allerdings hat der alte Lord nur selten, wie auch mein Vater dieses Geschäft gern anderen überließ.»
«Das erklärt», bemerkte Bettina, «warum der Lord so gut Deutsch spricht.» Sie hatte sich bei diesen Worten wieder Clarendon zugewandt, der jedoch, die schweren Lider halb geschlossen, nur still versonnen auf seine locker auf dem Tisch übereinander liegenden Hände blickte. Er hat sehr große Hände, fiel Bettina plötzlich auf, groß jedenfalls für einen sonst doch sehr schlank und zart gebauten Mann, und mit recht langen Fingern. Sie hörte nur mit halbem Ohr, wie der Baron nun die beiden Mädchen fragte:
«Wie würden Sie sich denn entscheiden, wenn Sie die Wahl hätten zwischen einer verstaubten Bibliothek und einer stürmischen Herbstlandschaft? Oder anders gefragt: Welch einem Bildmotiv würden Sie schlechte künstlerische Arbeit am ehesten verzeihen?»
«Bei Bettina ist das sonnenklar», sprach nun Luise mit verschmitztem Grinsen. «Die würde sich, wenn sie könnte, Bilder von riesigen Stapeln alter, verstaubter Scharteken aufhängen!»
«Luise, du verleumdest mich», protestierte lachend die Verspottete. «Ganz so weit geht meine Passion für Bücher nun doch nicht. Und wenn ich mir aussuchen könnte, wo ich mein Buch lesen oder mich mit Freunden über das Gelesene unterhalten sollte, so würde ich einer dunklen, staubigen Bibliothek allemal einen lichtdurchfluteten Garten vorziehen oder einen einsamen Platz an einem Wasser, selbst wenn es stürmt.»
«Dann wäre mein Haus ideal für Sie», sagte unvermittelt der Lord. «Aus der Bibliothek blickt man auf einen Rosengarten, und von weitem hört man die Brandung des Meeres.» Bettina wusste darauf nichts zu antworten und wurde wieder rot, aber diesmal färbte sich plötzlich auch das bleiche Gesicht des Lords eine Spur dunkler. Auch der Baron saß starr und sprachlos, bis nach einer kleinen Pause Luise fröhlich weiterplapperte: «Und was mich anbetrifft, ich würde allemal Bücher Bücher und Bilder Bilder sein lassen, mich aufs Pferd schwingen und die Männer bei der Jagd begleiten, wenn mich Papa nur ließe.»
4 Die Verlobung
Nach dem Gespräch im Salon war Bettina in einer helleren, heiteren Stimmung; der dumpfe Druck im Kopf, der sie seit dem Vorabend begleitete, war einem leichten Ziehen in den Schläfen gewichen und quälte sie nicht mehr.
Etwas aufgeregt, aber fröhlich betrat sie gegen acht Uhr mit ihren Eltern und ihrer Schwester die Zimmer des Barons. In einem großen, ebenerdigen Salon versammelten sich stehend die Gäste. Es waren viele, sicher über zwanzig, und Bettina war es lieb, in der Menge unterzugehen. Doch als dann im Nebenraum zu Tisch gebeten wurde, stellte sie fest, dass man sie als Tischdame des Barons vorgesehen hatte – und ihr schauderte, als sie mit halbem Ohr triumphierende Bemerkungen ihrer Mutter wahrzunehmen glaubte, die auch anderen Gästen in der Umgebung nicht unbemerkt bleiben konnten.
Der Baron saß ums Eck von ihr am Kopf der Tafel, während Bettina gegenüber, auf der anderen Seite des Barons, eine ungewöhnlich schöne junge Frau mit klaren, warmen braunen Augen und rabenschwarzer Lockenpracht Platz nahm. Sie wurde als Komtess von Lauenburg vorgestellt. In der Nähe dieser strahlenden Schönheit fühlte sich Bettina nicht recht wohl und malte sich aus, wie die Mutter später wehklagen würde: Sie habe im direkten Vergleich mit dieser ihr zu allem Übel an Rang überlegenen Dame erbärmlich abgeschnitten, und durch den kombinierten Zufall der ungleichen Verteilung der Gnadengaben der Natur und der Sitzordnung seien ihre Heiratschancen ins Bodenlose gesunken.
Der Baron richtete während des ersten Ganges seine Konversation jedoch ausschließlich an Bettina und beachtete ihre schöne Konkurrentin kaum. Auch Bettinas Tischnachbar zur Rechten, Friedrich von Baringsdorf, schenkte ihr viel Aufmerksamkeit, und beide zusammen ließen ihr wenig Zeit, die anderen Gäste zu beobachten oder über unerfreulichen Gedanken zu brüten.
Nach der Vorspeise erhob sich der Baron zu einer kleinen Rede. Bettinas Auge war dabei unwillkürlich auf den neben der schönen Komtess sitzenden Lord gefallen, der, zur Seite gewandt, statt den Redner mit einem leisen Lächeln auf den Lippen die Komtess ansah. Sie nahm die ersten Sätze des Barons kaum wahr. Doch dann horchte sie auf. Noch bevor sie mit dem Verstand aufgefasst, was ihre Ohren gehört hatten, verspürte sie ein Gefühl wie einen Schlag in die Magengrube: Der Baron gab die Verlobung der Komtess von Lauenburg mit seinem Freund Lord Clarendon bekannt. Zu Ehren des glücklichen Paares habe er die heutige Geselligkeit ausgerichtet. Er sprach danach noch einige Sätze mehr, es gab etwas Bewegung am Tisch, andere Gäste meldeten ihre Gratulation an. Bettina hörte nicht mehr zu, weil die Empfindung bitterster Enttäuschung sie einige Minuten ganz überwältigt hielt, eine Empfindung, gegen die sie mit dem Verstand anzukämpfen suchte, schon deshalb, weil sie keinen Sinn zu ergeben schien. Nie hatte Bettina ernsthaft erwogen, der Lord hege Interesse für sie, das schüchterne Mauerblümchen. War er doch von den drei Junggesellen, die neuerdings in freundschaftlichem Austausch mit den Fräulein von Denkewitz standen, immer der zurückhaltendste gewesen.
Sie hatte sich gefasst, als der zweite Gang aufgetragen wurde; doch verspürte sie keinen Appetit und musste sich zum Essen zwingen. Während sie belanglos mit ihren Tischnachbarn plauderte, fiel ihr Blick zwangsläufig hin und wieder auf die Komtess. Erstaunlicherweise schien auch diese keinen Appetit zu haben, wirkte alles andere als strahlend vor Glück, ja stocherte fast angewidert in ihrem Essen. Auf einmal wurde sie leichenblass und verließ hastig den Raum. Da erhob sich Lord Clarendon ebenfalls vom Tisch und folgte seiner Verlobten nach draußen.
Die Gräfin Lauenburg, die auch geladen war, teilte in dem plötzlich herrschenden, peinlichen Schweigen mit, ihre Tochter leide in den letzten Tagen an einer kleinen Unpässlichkeit, man möge darüber nicht in Sorge verfallen, sondern sich weiterhin amüsieren.
Dem zu folgen, bemühten sich die Anwesenden eifrig. Friedrich von Baringsdorf und der Baron spannen den Faden des unterbrochenen Gespräches weiter und setzten Bettina ihre Ansichten über einen romantischen Gedichtband der letzten Saison auseinander. Diese pflichtete unterschiedslos dem einen wie dem anderen bei und hielt mit feuchten Händen ihr Besteck umklammert. Nach einer Weile sah sie in dem schräg gegenüber hängenden Spiegel, wie die Komtess und der Lord den Raum wieder betraten. Das Paar blieb einen Moment in einer schmalen Vorhalle hinter der Tür stehen und fühlte sich gewiss unbeobachtet. Bettina konnte erkennen, wie der Lord der Komtess den Arm um die Schultern legte und ihr mit der Hand sanft über die Wange strich. Da wurde ihr plötzlich schwarz vor Augen. Sie stand ruckartig auf, sagte schroff: «Verzeihung, auch ich bin unpässlich» und eilte nach draußen, wobei sie an der Tür um ein Haar mit den dort noch Stehenden kollidierte.
Die Majorin saß wie vom Donner gerührt an ihrem Platz und starrte mit großen Augen in die Richtung, in welche ihre Tochter entflohen war.
Der Baron sagte besorgt: «Ich beginne zu glauben, dass die Vorspeise verdorben war. Fühlen sich sonst alle gesund? Vielleicht sollten wir einen Arzt holen?»
«Aber ich bitte Sie, Exzellenz», machte sich ein wenig konfus die Majorin bemerkbar, «Sie müssen verzeihen, aber am Essen wird es nicht liegen – es ist nämlich so, dass meine Tochter häufig unter Migräne leidet, und ganz besonders, wenn wir in Gesellschaft sind, mussten wir schon öfter –»
Hier unterbrach sie der Baron mit der eindringlichen Bitte, nach ihrer Tochter zu sehen und ihr, falls nötig, Pflege angedeihen zu lassen.
Der Majorin blieb nichts übrig, als die Gesellschaft zu verlassen und sich zum Schlafzimmer ihrer Töchter zu begeben. Dort fand sie Bettina, nicht anders als befürchtet, mit rasenden Kopfschmerzen und sehr elend vor – ein Zustand, der sich durch die jetzt auf sie einströmenden mütterlichen Klagen nicht besserte.
5 Aurelie
Auch diesmal erwiesen sich die Befürchtungen der Majorin als unbegründet, Bettina habe die Gunst des Barons, inklusive der daraus für die Zukunft ableitbaren Hoffnungen, für immer verspielt.
In den folgenden Tagen ergaben sich immer wieder Gelegenheiten zum Gespräch zwischen den jungen Leuten, oder der Baron schaffte solche, sodass die Familie von Denkewitz, vorzüglich aber deren Töchter, bald zum engsten Zirkel des Barons gerechnet werden musste. Insbesondere wurde es zur festen Einrichtung, dass man die Mittagsmahlzeiten gemeinsam einnahm, wobei neben den Herren von Baringsdorf zumeist auch der Lord, oft seine Verlobte und manchmal deren Eltern teilnahmen. Ständige Mitglieder des Kreises waren außerdem ein Professor Eckenrath, der in Greifswald alte Sprachen lehrte und vor vielen Jahren einmal der Lateinlehrer des Barons gewesen war, sowie ein Herr von Arnsberg mit seiner Tochter, entfernte Verwandte derer von Baringsdorf.
Das Auftauchen der Aurelie von Arnsberg, eines dunkelblonden, puppenhaft hübschen Mädchens Anfang der zwanzig, war für die Majorin ein herber Schlag. Sie hatte die Herren von Baringsdorf im Geiste bereits gerecht auf ihre beiden Töchter aufgeteilt und sich eingeredet, einer derart glücklichen Geschwisterhochzeit stehe kaum noch etwas im Wege. Nun aber hatte, wie sie ihrem Mann auseinander setzte, kurz vor dem Sieg ein neuer Feind in die Schlacht eingegriffen, und es war an ihr, durch listenreiche Beratung ihrer Töchter die Eroberung des Baringsdorf’schen Schlösschens doch noch möglich zu machen. Als eine Verbündete erkannte sie inzwischen die Komtess: Deren häufige Indispositionen ließen Bettina im Vergleich wie die Verkörperung robuster Gesundheit erstrahlen und ihren jüngsten, fast zwei Tage währenden Migräneanfall hoffentlich vergessen machen.
Ein Vorteil für ihre Töchter war in den Augen der Majorin auch, dass das Fräulein von Arnsberg, wenn es schon an Migräne oder Ohnmachten nicht zu leiden schien, von einer äußerst merkwürdigen nervösen Ungeschicklichkeit befallen war. Kaum ein Tag verging, an dem sie nicht ein volles Glas umwarf, die schmackhafte Ladung einer Gabel auf das Tischtuch plumpsen oder ein Messer mit lautem «Pling!» zu Boden sausen ließ.
Eines Abends auf der Terrasse, als die kleine Gesellschaft, wie so oft, fast vollzählig beisammensaß, gab der wohlmeinende Professor Eckenrath eine Theorie zum Besten, worin die Ungeschicklichkeit des Fräuleins von Arnsberg begründet liegen und wie sie demnach behoben werden könne. Der Professor, ein wohlgenährter, rotwangiger Herr, war, wie er bei jeder Gelegenheit verkündete, zeit seines Lebens weder ernstlich krank noch im Geringsten indisponiert gewesen. Er betrachtete es als seine Aufgabe, auch den Rest der Menschheit in diesen beneidenswerten Zustand zu versetzen, und hielt sich deshalb nach eigenem Bekunden, obwohl er das Arztstudium einst nach wenigen Semestern an den Nagel gehängt hatte, in allen Bereichen der Medizin auf dem neuesten Stand der Wissenschaft.
«Gerade die nervösen Leiden», dozierte er jetzt mit seiner hohen, heiseren Stimme, «werden ja, weil zumeist nicht tödlich, von der Medizin sträflich vernachlässigt. Um einmal Sie, verehrtes Fräulein von Arnsberg, zum Beispiel zu nehmen: Sicher ist keinem von uns verborgen geblieben, wie Sie durch ungeschickte Zuckungen Ihrer Gliedmaßen beständig ein kleines Malheur nach dem anderen verursachen.» Die Angesprochene, sonst eine selbstbewusst auftretende junge Frau, wurde bleich wie das Tischtuch und gab keine Antwort, die der Redner ohnehin nicht von ihr erwartete. Dieser schien das Unbehagen seiner unfreiwilligen Patientin nicht zu bemerken und führte weiter aus:
«Nun wird Ihre Familie sicher zu Hause einen guten Arzt haben, doch der, mit Verlaub, sieht dem Pferd zwar in den Mund, kuckt aber nicht zu, wie es frisst.» Mehreren der Anwesenden fiel es an dieser Stelle nicht ganz leicht, Haltung zu bewahren. Der im tiefen Ernst sprechende Professor ließ sich jedoch von der Unruhe unter seinen Zuhörern nicht beirren und setzte zu weiterer Rede an, als ihn der Lord in scherzendem Ton unterbrach:
«Wollte man die Beobachtung der Tischmanieren zur ärztlichen Diagnose verwenden, so käme man bei Ihnen zweifellos zu der Auffassung, Sie müssten die Gicht haben, da Sie von den reichhaltigsten Speisen immer gleich zweimal nehmen.»
«Meine Art zu essen, junger Mann, bekommt mir gottlob ausgezeichnet, und dies nicht ohne Grund. Doch will ich Ihnen jetzt auf dieses Stichwort nichts antworten, denn es würde uns vom Thema ablenken.» Der Lord, dessen Absicht genau das gewesen war, tauschte einen resignierten, gleichzeitig halb belustigten Blick mit der ihm schräg gegenübersitzenden Bettina, während der Professor weitersprach:
«Ihre nervösen Zuckungen, Fräulein von Arnsberg, scheinen dem gewöhnlichen Arzt nicht der Behandlung bedürftig, wenn er sie auch vielleicht einmal beobachtet. Ich aber sage: Es muss nicht sein, dass ein junges Mädchen bei Tisch allenthalben unangenehm auffällt …» (Hier hob er seine Stimme, um das zu vernehmende allgemeine Protestgemurmel zu übertönen) «… kurz, ich will Ihnen eine ausgezeichnete Kur verschreiben, die Ihnen sicher helfen wird.» Zur Erleichterung der Anwesenden folgte an dieser Stelle diesmal keine detaillierte Beschreibung eines neuartigen Abführmittels und seiner vortrefflichen Wirkungen, wie man sie anlässlich der Unpässlichkeiten der Komtess sich öfter hatte anhören müssen. Stattdessen waren wieder einmal die verstaubten Heilkünste des Herrn Mesmer an der Reihe, über welche man aus dem Munde des Professors ebenfalls schon einiges Lob vernommen.
«Die Krankheit, an welcher Sie leiden, beruht, wie mir scheint, auf einer Stauung des tierischen Magnetismus in Ihrem Unterleib. Diese hat einige Teile Ihres Körpers schon jetzt vom harmonischen Fluss dieses Lebensprinzips abgeschnitten und wird, lässt man sie unbehandelt, letztendlich zu einer Zerrüttung aller nervlichen Funktionen führen. Noch ist das Übel nicht allzu weit fortgeschritten, noch macht es sich nur bemerkbar, indem Ihre Glieder, wenn sie die Nähe einer viel Magnetismus enthaltenden Materie spüren, plötzlich ausschlagen, gleichsam als wollten Sie sich des fehlenden Stoffes bemächtigen. Ich hoffe, nicht anmaßend zu klingen, wenn ich gestehe, in solchen und ähnlichen Fällen mit einer Kur nach Mesmer stets gute Erfolge erzielt zu haben. Wenn Sie gestatten, Fräulein von Arnsberg, würde ich mich gerne auch Ihnen in dieser Hinsicht behilflich zeigen.»
Die Angesprochene, die direkt neben Eckenrath saß und während seiner Rede den Blick nicht auf ihren Gesprächspartner, sondern starr vor sich in die Luft gerichtet hielt, versetzte nun mit gepresster Stimme:
«Ich gestatte nicht, denn ich habe keinerlei Interesse an Ihrer Quacksalberei und möchte mir zudem künftige ungebetene Einmischungen in meine privaten Kümmernisse auf das Entschiedenste verbitten.»
Hierauf erhob sie sich ruckartig, ließ in dieser Bewegung ihr fast volles Weinglas über des Professors Beinkleider kippen, sagte: «Oh, verzeihen Sie, eine meiner Zuckungen» und verschwand in Richtung der Terrassentüre.
Die ganze Versammlung saß einen Augenblick in betretener Stille, in der man unterdrücktes Kichern wahrnahm. Jedoch war keiner der Zeugen dieser kleinen Szene gezwungen, sich das Hirn um passende Worte zu zermartern, da Eckenrath selbst sogleich zu einem ausführlichen Kommentar des Geschehenen ansetzte. Während er sich von Bettina das besudelte Beinkleid notdürftig reinigen ließ, rief er mit einem Ausdruck, der zwischen mitleidsvoller Verwunderung über die Ahnungslosigkeit der Menschen auf der einen und lebhafter Begeisterung für sein Steckenpferd auf der anderen Seite schwankte:
«Es ist doch bedauerlich, wie Argwohn, Missgunst und Unwissen die Entdeckungen des großen Mesmer befleckt und sie in den Augen mancher geradezu unter die Betrügereien versetzt haben! Wie sehr könnte die Menschheit durch dieses von der Natur so verschwenderisch dargebotene allgemeine Verwahrungsmittel gegen Krankheiten profitieren, wenn man ihm nicht in vielen Kreisen mit solch unbegründeter Voreingenommenheit begegnete!»
Den weiteren Diskurs des noch immer in bester Stimmung befindlichen Professors hörte Bettina nicht mehr, denn sie war mit ihrer weinbefleckten Serviette in der Hand davongeeilt, allerdings nicht, wie man hätte annehmen können, um diese auszuwaschen. Sie begab sich vielmehr zu den Räumen der Arnsbergs, wo sie Aurelie anzutreffen hoffte.
Sosehr ihre Mutter sich mühte, ihr die andere als Rivalin darzustellen, die es auszuspielen galt, so sehr hatte zugleich Bettina eine Zuneigung zu der etwas Älteren entwickelt. Auf ihre Art nicht weniger selbstbewusst im Auftreten als die Komtess, wirkte Fräulein von Arnsberg doch, anders als diese, unaffektiert und herzlich und schien ihrem Rang, ihren Kleidern oder ihren äußerlichen Vorzügen wenig Wert beizumessen. In ihrer Gesellschaft fühlte sich Bettina um einiges wohler als unter den jungen Damen, die in Berlin im Kreise ihrer Eltern verkehrten.
Sie hatte, wie alle anderen bis auf den Professor, beobachtet, dass sich Aurelie dessen Äußerungen offenbar mehr als geboten zu Herzen nahm. Nun hoffte sie, durch einen Bericht von Leidensgenossin zu Leidensgenossin die Bestürzung ihrer neuen Freundin mildern zu können. Bettina selbst war nämlich einige Tage zuvor, in Abwesenheit Aurelies, das Opfer eines ihr äußerst peinlichen heilkundlichen Vorschlags des Professors geworden: Er hatte auf ihr häufiges und heftiges Erröten aufmerksam gemacht (was natürlich sogleich ein solches hervorrief) und auch ihr den Mesmerismus als geeignetes Heilmittel angepriesen.
6 Die heimliche Kur
Am nächsten Morgen saß Bettina von Denkewitz an ihrem Frisiertisch, als die Zofe Fräulein von Arnsberg ankündigte. Sie richtete weiter aus, Fräulein von Arnsberg wisse, dass sie zu sehr früher Stunde komme, bitte, dies vielmals zu entschuldigen und sich außerdem keine Umstände mit der Toilette zu machen. Sie begehre sehr dringlich, Fräulein von Denkewitz zu sprechen.
Bettina war ebenso verwundert wie geschmeichelt und ließ die Besucherin in das schmale Boudoir bitten, das an das Schlafzimmer der Schwestern grenzte.
«Fräulein von Denkewitz», begann Aurelie, «ich bin gekommen, um Sie um einen Freundschaftsdienst in einer etwas heiklen Sache zu bitten.»
Bettina erklärte sich sofort zu jeder erdenklichen Hilfe bereit und bat Aurelie, ihr Anliegen vorzutragen.
«Ich weiß nicht recht, wie ich anfangen soll, und Sie werden mich in jedem Fall für eine ausgesprochen dumme Gans halten. Auch möchte ich vorausschicken, dass es mir lieb wäre, wenn Sie niemandem von unserer Unterredung berichteten.»
Bettina sagte ohne Zögern ihre Verschwiegenheit zu. Ihre Gesprächspartnerin holte tief Luft und kam zur Sache:
«Gestern Abend, es war schon recht spät, habe ich insgeheim Professor Eckenrath auf seinem Zimmer im Hotel Sobota aufgesucht und ihn gebeten, eine Mesmerisierung bei mir vorzunehmen, wovon allerdings mein Vater und auch sonst niemand etwas wissen dürfe. Der Professor stimmte begeistert zu, wie Sie sich denken können, und wir haben uns für heute früh in meinem Zimmer verabredet. Nun, da der Zeitpunkt gekommen ist, fürchte ich mich ein wenig vor der Behandlung und auch davor, mit dem Professor, der mir doch etwas wunderlich scheint, allein zu sein. Ich möchte Sie bitten, liebes Fräulein von Denkewitz, mit mir auf mein Zimmer zu kommen und der Prozedur beizuwohnen. Ich würde mich in Ihrer Gesellschaft um vieles wohler fühlen.» Bettina war von den ersten Worten Aurelies in Erstaunen versetzt worden, hatte sich aber gegen Ende wieder so weit gefangen, dass sie, ohne diesem Erstaunen Ausdruck zu verleihen, ihre Bereitschaft zu dem von ihr erbetenen Dienst erklären konnte.
Mit wenigen Griffen und fliegenden Händen beendete sie notdürftig ihre Toilette, denn die Zeit drängte: Es blieben nicht zehn Minuten bis zu dem verabredeten Rendezvous mit dem Professor. Kaum waren die beiden Mädchen auf Aurelies Zimmer eingetroffen, ganz ohne Gelegenheit, in Ruhe noch einige Worte zu wechseln, da klopfte es schon anhaltend und bestimmt an der Tür.
Eckenrath erstrahlte in rosig glänzender Lebensfreude, als ihm geöffnet wurde.
«Das nenn ich eine freudige Überraschung: Statt einer Patientin warten gleich deren zwei auf den alten Eckenrath! Ich sehe, Fräulein von Denkewitz, auch Sie haben sich meinen Rat nun doch noch zu Herzen genommen …»
«Aber keineswegs, Herr Professor, Sie missverstehen. Ich bin hier nicht als Patientin, sondern als Freundin und Helferin Fräulein von Arnsbergs, falls diese während oder nach der Behandlung weiblichen Beistands bedürfen sollte.»
«So, so, Sie wollen also dem alten Eckenrath ein wenig auf die Finger sehen! Aber Ihre Vorsorge ist gänzlich unnötig, ich werde Ihrer Freundin gewiss nichts zuleide tun. Der Mesmerismus ist eine sehr ungefährliche Behandlung. Aber denken Sie nicht, dass ich etwas gegen Ihre Anwesenheit einzuwenden hätte … Fräulein von Arnsberg, nehmen Sie doch einmal hier auf diesem Stuhl Platz, er steht für meine Zwecke günstiger … im Gegenteil, Fräulein von Denkewitz, ich hoffe, Sie heute zu bekehren! Wenn Sie erst sehen, wie Ihre Freundin von ihrem Veitstanz kuriert wird … aber Fräulein von Arnsberg, bleiben Sie doch sitzen … ja; was hüpfen Sie denn so ängstlich umher, mein gutes Kind, der alte Onkel Eckenrath wird Ihnen nichts tun!»
Aurelie war plötzlich und ohne erkennbaren Anlass von ihrem Stuhl aufgesprungen und stand leichenblass mitten im Zimmer, aber bevor noch Bettina, die ebenfalls aufsprang, zu ihr eilen konnte, hatte sie sich wieder gesetzt und wehrte Bettinas Hilfe ab: Es sei nichts, sie fühle sich wohl, sei nur etwas nervös (und hier zuckte ihre Hand).
Der Professor, der nun aus einer Tasche zwei eigenartige, konisch geformte Stäbe hervorkramte, in den Händen wog und immer wieder rieb, sprach dabei ungerührt weiter: «Gerade bei Ihnen, Fräulein von Denkewitz, schiene mir eine Behandlung besonders erfolgversprechend. Gleicht Ihr Fall doch fast aufs Haar dem der Jungfer Österlin, bei der Mesmer damals eine so sensationelle Heilung gelang und an der er die Wirksamkeit seiner Methode zum ersten Mal unter Beweis stellen konnte. Die schlimmsten Zufälle bei der Jungfer Österlin waren bekanntlich, dass ihr das Blut ungestüm in den Kopf drang und die fürchterlichsten Zahn- und Kopfschmerzen verursachte, welche mit Wahnwitz, Wut, Erbrechen und Ohnmachten verbunden waren. Doch nach wenigen Sitzungen konnte Mesmer eine fast völlige Rückbildung aller Symptome erreichen, sodass die Österlin schließlich sogar den Ehe- und Mutterstand erleben durfte, was man doch zuvor bei ihrer schweren Indisposition für schier unmöglich gehalten hätte.»
Eckenrath hatte sich unterdessen vor Aurelie auf die Knie niedergelassen wie ein flehender Liebhaber und begann jetzt ernstlich mit seiner Behandlung. Unter dem Erröten und starren Entsetzen der Mädchen hob er Aurelies Rock und schob seine Hände darunter, mit denen er die beiden Stäbe entlang ihrer Unterschenkel platzierte und festhielt. Die Spitzen berührten jeweils die Außenseiten der Knöchel. In dieser erstaunlichen Haltung verweilend, murmelte Eckenrath nun in heiserem, dunklem und beschwörendem Ton:
«Ströme, Kraft des Lebens, ströme, ströme … Sie spüren, wie etwas in Sie fließt, etwas wie eine feine Flüssigkeit, wie es fließt und fließt und alle Glieder Ihres Körpers durchdringt, und es strömt hierhin und es strömt dorthin, bis es Sie ganz und gar erfüllt … ströme, Kraft des Lebens, ströme!»
Schließlich brach er seine Inkantationen abrupt ab, richtete sich rotgesichtig und schwer atmend auf und wiederholte die Prozedur zweimal, indem er die Stäbe zunächst an die Handgelenke und dann beidseitig an den Hals Aurelies hielt. Sodann legte er die seltsamen Gerätschaften beiseite, kniete wiederum vor seiner Patientin und strich ihr mit der flachen Hand von der Mitte des Bauches nacheinander in verschiedene Richtungen nach außen hin auf die Extremitäten zu, dabei fortgesetzt seine heisere Litanei von den strömenden Lebenskräften wiederholend.
Als er schließlich geendet hatte und in die gewohnte joviale Manier zurückfiel, war Aurelie ganz benommen, sprach und rührte sich fast nicht, bis der Professor sich verabschiedete: Er sei in Eile, weil er bei einer Gräfin Galitzina im Grandhotel Pupp in kaum einer Viertelstunde ebenfalls einen Behandlungstermin habe, dort allerdings nicht als Freundschaftsdienst – er hoffe auf ein ausgezeichnetes Honorar. Bettina war zu verwirrt, um zu überlegen, ob die Bemerkung am Schluss nur freudige Teilnahme an seinem Glück hervorrufen oder vielmehr Aurelie in diskreter Weise ihrerseits zu einer Zahlung auffordern sollte.
«Wie fühlst du dich?», fragte sie, als beide allein waren, die Freundin, in ihrer Aufregung das Siezen vergessend. «Hast du tatsächlich etwas gespürt?»
«Ich … ich weiß nicht», entgegnete Aurelie, «am Anfang nicht, aber nach und nach wurde mir immer wunderlicher zumute, und schließlich war mir tatsächlich, als ströme eine feine Materie in mich ein. Alle Glieder wurden mir so schwer und warm.»
«Vielleicht ist doch etwas an der Sache. Vielleicht kam es uns nur so lächerlich und quacksalberhaft vor, weil ausgerechnet Eckenrath uns dazu bekehren wollte, den man so wenig ernst nehmen kann.»
«Vielleicht», stimmte Aurelie zu, «bete für mich, dass es so sein möge.»
Dies sagte sie mit einem solchen Todernst in der Stimme, dass Bettina nachgefragt hätte, wäre nicht im selben Moment ein Klopfen von draußen erklungen: Aurelies Vater war von seinem morgendlichen Bädergang zurückgekehrt und wollte sehen, ob seine chronisch langschläfrige Tochter schon auf sei.
7 Die Burg Elbogen
Einige Tage nach der heimlichen Kur Aurelies (deren nervöses Leiden übrigens wirklich Anzeichen einer Besserung zeigte) brach recht früh am Morgen vor dem Hotel Impérial eine kleine Reisegesellschaft nach der Burg Elbogen auf. Der Baron hatte, ebenso wie der Lord, seine Kutsche vorfahren lassen, und die Ausflügler verteilten sich unter angeregtem Geplapper auf die beiden Wagen. Eine zusätzlich noch bereitgestellte Chaise ließ man stehen, denn für eine bloße Tagesexkursion war mäßiges Gedränge bei angeregter Unterhaltung bequemer Einsamkeit wohl vorzuziehen.
Die Majorin bot ihre ganze Geschicklichkeit auf, um eine strategisch günstige Sitzordnung zu erreichen. Als sich die Pferde endlich in Bewegung setzten, gratulierte sie sich selbst zum erfolgreichen Verlauf der Operation. Am schwierigsten war es gewesen, das inzwischen unzertrennliche Paar Bettina und Aurelie auseinander zu reißen. Die Letztere saß nun mit ihrem Vater, der Majorin und deren jüngerer Tochter im Landauer des Lords, während Bettina in die Berline des Barons geklettert war, gemeinsam mit diesem, seinem Bruder Friedrich, dem Professor und der Komtess als einziger möglicher Rivalin, die aber sozusagen außer Konkurrenz mitfuhr, denn sie war ja vergeben.
Wahrscheinlich wäre die Majorin weniger stolz auf ihre eigene Geschicklichkeit, aber durchaus noch mit der strategischen Lage zufrieden gewesen, hätte sie gewusst, dass sie von ungeahnter Seite unterstützt worden war: Aurelie hatte sich, die Wünsche der Majorin erahnend, ganz bereitwillig in den Wagen mit der weniger attraktiven Gesellschaft leiten lassen. Wusste sie doch von Bettina um die Bemühungen und Sorgen der Majorin hinsichtlich der Heiratschancen ihrer ältesten Tochter ebenso, wie sie selbst Bettina unter vier Augen versichert hatte, sie, Aurelie, hege keinerlei mehr als nur freundschaftliches Interesse am Baringsdorf’schen Schlösschen und seinen Bewohnern.
In der freiherrlichen Berline drehte sich das Gespräch, während man noch die Stadt durchfuhr, um die unerwartete Abwesenheit des Lords. Dieser hatte sich beim Baron und den anderen durch die Komtess entschuldigen lassen: Er habe aus der Frühpost von der direkt bevorstehenden Ankunft eines alten Freundes erfahren und wolle im Hotel bleiben, um diesen zu erwarten.
«Ich nehme an», sprach die Überbringerin der Nachricht gerade mit leicht brüskierter Stimme, «dass es sich um ein sehr wichtiges Geschäft handeln muss, wenn er so plötzlich unabkömmlich ist. Aber es will mir doch seltsam scheinen, dass er es mir verschweigt, dass er stattdessen sein Treffen mit diesem Menschen als ein rein freundschaftliches darstellt. Es geziemt sich nicht, mir in der Position, in der wir uns befinden, wichtige Teile seiner finanziellen Umstände zu verheimlichen. Schließlich sind meine Eltern und ich über seine Verhältnisse nur auf Treu und Glauben informiert.»
Bettina war sehr erstaunt, dass die Komtess solcherlei Befürchtungen und Bedenken Dritten gegenüber offen zum Ausdruck brachte. Sie verstand jedoch gleich darauf, dass diese Offenherzigkeit den Zweck hatte, dem Baron Näheres über mögliche finanzielle Schwierigkeiten des Lords zu entlocken.
«Ihre Befürchtungen, Komtess», sprach der Baron, «sind unbegründet, jedenfalls was die Bonität Ihres Verlobten betrifft. Die ist über jeden Zweifel erhaben. Aber ich muss sagen, auch ich bin verstimmt über sein Daheimbleiben. Seit Jahren ärgert mich seine unwürdige Freundschaft mit diesem Emporkömmling Buenaventura, und es will mir nicht in den Kopf, warum er uns, die er doch auch seine Freunde nennt, enttäuscht und eine längst gemachte Zusage zurückzieht, nur um den alten Mann ein paar Stunden früher zu sehen.»
«So sollte er diesen Menschen wirklich seinen Freund nennen?», fragte die Komtess erstaunt.
«Allerdings, und wenn der Altersunterschied nicht wäre (denn Buenaventura muss wohl siebzig oder mehr Jahre zählen), so müsste man sagen: seinen Busenfreund.»
«Es wird meine Eltern nicht erfreuen, wenn mein künftiger Gatte so unstandesgemäße Freundschaften pflegt. Am Ende wird Clarendon wohl gar erwarten, dass der Alte zur Hochzeit geladen wird und wir ihn später in unserem Haus empfangen!»