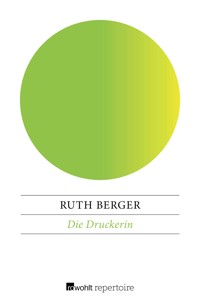6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wenn aus Wünschen Wunder werden … Frankfurt 1844: Der Waisenjunge Josua wird auf die Straße gesetzt. Halberfroren trifft er auf Elise Best, die allerdings eigene Sorgen hat: Ihr Vater hat soeben den Bankrott des Geschäftes verkündet. Elise soll sofort heiraten, um ihre Versorgung zu sichern. Dummerweise hat sie ein lahmes Bein, und der einzige sich anbietende Heiratskandidat ist ein alter Pfarrer. Ein Weihnachtswunder muss her, das sowohl ihr als auch dem kleinen Josua aus der Patsche hilft … doch gibt es solche Wunder überhaupt?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 135
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Ruth Berger
Eisweihnacht
Eine Wundergeschichte
Über dieses Buch
Wenn aus Wünschen Wunder werden …
Frankfurt 1844: Der Waisenjunge Josua wird auf die Straße gesetzt. Halberfroren trifft er auf Elise Best, die allerdings eigene Sorgen hat: Ihr Vater hat soeben den Bankrott des Geschäftes verkündet. Elise soll sofort heiraten, um ihre Versorgung zu sichern. Dummerweise hat sie ein lahmes Bein, und der einzige sich anbietende Heiratskandidat ist ein alter Pfarrer. Ein Weihnachtswunder muss her, das sowohl ihr als auch dem kleinen Josua aus der Patsche hilft … doch gibt es solche Wunder überhaupt?
Impressum
Rowohlt Digitalbuch, veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, November 2012
Copyright © 2012 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Umschlaggestaltung any.way, Barbara Hanke/Cordula Schmidt
(Umschlagillustration: Andrea Offermann)
ISBN Buchausgabe 978-3-463-40606-0 (1. Auflage 2012)
ISBN Digitalbuch 978-3-644-30871-8
www.rowohlt-digitalbuch.de
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Abbildung
Die Kälte war ...
Im Haus des ...
Die Straßen waren ...
Der Pfarrer Wartenstein ...
Nachdem die Gäste ...
Am Christkindchesmarkt brannten ...
Später fragte sich ...
Josua ging es ...
Nachdem der Arzt ...
Josua hatte am ...
Vor einer Generation ...
Es klingelte. Elise ...
Das Esszimmer war ...
Elise war zu ...
Anders als der ...
Zwei Stunden später, ...
Elise konnte nicht ...
Die ganze Nacht ...
Das Treffen zwischen ...
Das folgende Weihnachtsfest ...
Die Illustratorin
Die Kälte war so beißend, dass einem in dem Augenblick, wo man ins Freie trat, die Feuchtigkeit in der Nase gefror. Ließ man sich davon nicht schrecken und ging weiter, bekam man den Eindruck, es müssten bald Zapfen aus den Nasenlöchern wachsen. Den Bettlern und den Marktleuten geschah auch genau das. Der Winter 1844 war der kälteste seit einer Generation. Niemand, der jetzt auf der Welt war, sollte je wieder einen solchen Winter erleben, auch nicht die Kinder und Enkel, und keine so schwere Hungersnot, wie sie am Ende aus der Eiseskälte erwuchs.
In diesem entsetzlichen Winter nun geschah dem kleinen Josua Anspach das Schlimmste, was einem siebenjährigen Kind geschehen kann. Im Sommer schon war der Vater an einem Sumpffieber gestorben, das er sich auf Reisen in Oppenheim geholt hatte. Anfang Dezember dann verblutete die Mutter bei der Geburt eines Geschwisterchens im Kindbett.
Josua hatte einen jüngeren Bruder, den genau wie das Neugeborene Verwandte zu sich nahmen. Josua selbst aber gaben die Verwandten, nach einigen geheimen Debatten und etwa zwei Wochen nach dem Tod der Mutter, mitten in der Nacht einem Postillon in Obhut, mit dem Auftrag, das Kind nach Frankfurt zu bringen. Bei sich trug der Junge nichts außer etwas Proviant in der Westentasche, eine zum Bündel geschnürte Decke für die Reise sowie einen schwarzen Ledergurt mit einem versiegelten Brief darin, den er in Frankfurt, so sagte man ihm, der erstbesten vertrauenswürdig aussehenden Person in die Hand geben sollte.
Josua wehrte sich nicht. Er fühlte sich wie gelähmt. Seit dem Tod der Mutter war das Leben zu einem bösen Traum geworden, aus dem er beständig hoffte aufzuwachen. Die ganze Zeit hatte er kaum geweint und kaum geredet und kaum gegessen. Seine Mutter sollte tot sein? Das musste sich doch als falsche Nachricht erweisen, als Missverständnis! Jede Minute musste Mama aus der Tür des Schlafzimmers treten, in ihrem himmelblauen Nachtrock mit roten Wangen und aufgelösten Haaren, und ihn in den Arm nehmen. So sehr vermisste Josua seine Mutter, dass er fast sicher gewesen war, seine Sehnsucht müsse bewirken, dass sie irgendwann erschien.
Jetzt aber, als die Tante ihn in die Kutsche setzte, bei Frost und Dunkelheit, zu einem fremden Herrn mit hohem Zylinder und buschigen Brauen, da wusste Josua mit einem Mal, dass er wirklich und wahrhaftig seine Mutter verloren hatte und dass er selbst verloren war, ganz und gar verloren. Der fremde Herr hatte eine schmale Oberlippe und einen gelben Stock und eine Daunendecke auf den Knien und sah ihn im Licht der Laterne scharf an. Die Bank war hart und kalt, und Josua kam mit den Füßen nicht auf den Boden. Als der Wagen losfuhr, begann er zu weinen. Sofort gefroren die Tränen auf seinem Gesicht und schmerzten ihn, und da weinte er noch mehr.
Im Haus des Frankfurter Grossisten Best, Kaufmann für Spezereiwaren und Importartikel, erwartete man am folgenden Mittag wichtigen Besuch. Nur die Person, der dieser Besuch galt, ahnte davon nichts. Diese Person war Herrn Bests älteste Tochter Elise, die mit dreißig Jahren (Gehässige munkelten: über dreißig) noch unverheiratet war. Fräulein Elise Best saß allerdings nicht tagein, tagaus untätig im Stübchen, sondern ersetzte als Gehilfin im Geschäft ihres Vaters diesem immerhin einen männlichen Angestellten. Gerade stand sie fröstelnd im Gewölbe, einem riesigen, unterirdischen Verlies, das sich in drei hohe Räume aufteilte, verbunden durch niedrige Gänge. Das Gewölbe war größer als der Grundriss des Hauses, aus hellem Sandstein gemauert, der hier und da weiße Salzkrusten und gelbe Flechten angesetzt hatte, und es bildete gleich nach Erfahrung und Renommee das wichtigste Kapital des Best’schen Geschäfts. Denn ein Frankfurter Kaufmann, der kein Gewölbe besaß, musste eines mieten. Und billig war das nicht.
Elise Best stand, Laterne in der Hand, vor den Weinflaschen. Sie lagerten auf einem Gestell im Gelass ganz hinten, neben dem strengen, steinharten italienischen Käse, der in großen runden Laibern auf einem Holzregal gestapelt war. Elise konnte kaum glauben, was sie entdeckte. Alle Flaschen waren geplatzt. Alle. Niemals war dergleichen vorgekommen. Dazu hatte man eben ein Gewölbe, damit es nicht vorkam. Aber verwunderlich war es nicht. Die Temperatur war nach langen, strengen Frostwochen nun auch hier drinnen unter den Gefrierpunkt gesunken; sogar weit darunter, wenn Elise richtig spürte. Sie sah sich im Rest des Lagers um. Die Zitronen in den Kisten am Boden – hart gefroren und zweifellos verdorben. Wie gut, dass sie vor einer Woche die wertvollsten frostempfindlichen Waren nach oben geholt hatten. Bloß eben den Wein nicht, weil der Vater schimpfte, es wäre nicht nötig, und die viele Bewegung würde den edlen Tropfen schaden.
Der Vater begann jedes Jahr Anfang Dezember unleidlich zu werden. Vielmehr, noch unleidlicher als sonst. Ein Nörgler und Grantler war er ohnehin, außer natürlich mit Kunden und Geschäftsfreunden – zu denen war er ganz liebenswürdig. Ein richtiger Charmeur konnte er da sein. Nur nicht zu Haus.
Der Advent und das Weihnachtsfest waren aber tatsächlich jedes Jahr seine grantigste Zeit. Dabei könnte man es so nett haben zu den Festtagen, dachte Elise. Wie sollte man denn den langen Winter ertragen, ohne es sich wenigstens um die Weihnachtszeit schön zu machen und ein bisschen Licht und Freude in das alte, dunkle Haus zu holen? Das Best’sche Stammhaus lag im Tuchgaden hinterm Roten Haus, hier war alles dicht an dicht gebaut, und die Sonne sah man nie. Elise würde so gerne in die Neustadt ziehen, wo die Gassen nicht so eng waren und die Fenster nicht so klein. Doch das ließ das Geschäft angeblich nicht zu.
Wenn der Vater nur vergessen könnte.
Genau das konnte er nicht. Beide seiner Frauen, die erste, Elises Mutter, und später die zweite, hatte er an Heiligabend verloren. Darüber war ihm noch einiges andere abhandengekommen. Seine Lebenslust und sein Humor zum Beispiel und, wusste Elise, sein Glaube an Gott. Und ganz bestimmt seine Freude am Weihnachtsfest, dessen Bilder, Düfte und Klänge den Kaufmann Best an Ereignisse erinnerten, an die er nicht erinnert werden wollte. Weshalb er leider seinem gesamten Hausstand verbot, in irgendeiner Form das Fest zu begehen. Weihnachten gab es nicht im Hause Best. Und Advent natürlich auch nicht. Draußen aber war die Festzeit nur allzu präsent. Denn wenn man mitten in der Altstadt wohnte, so nahe am Christkindchesmarkt, konnte man ihr kaum entgehen.
«Elise! Elise, Potzteufel noch mal! Wir suchen dich überall!»
Elise schrak zusammen, so in Gedanken war sie gewesen. Schwer atmend kam der Vater, den Kopf gebeugt, durch die niedrige Eingangswölbung mit der schmiedeeisernen Gittertür in den Lagerraum. Ernst Wolfgang Best war ein mittelgroßer Mann mit zur Röte neigendem Gesicht, grauen, lockigen Haaren, der Mode gemäß nach vorn gekämmt, die sich in der Mitte etwas lichteten, und einer Nase und einem Kinn, die beide schon immer Überlänge besessen hatten und mit fortschreitendem Alter die Tendenz zeigten, einander näherzukommen. Streng sah Best erst seine Tochter an, dann seine goldene Taschenuhr, dann wieder Elise. «Was treibst du hier unten? Wie siehst du überhaupt aus? Du wirst oben gebraucht, es kommt Besuch. Marsch ab hoch, dass du dich wenigstens ein bisschen hübsch machst.»
«Papa, der Wein … schau her, die Flaschen hier sind alle hin, der Frost …»
«Merde, verdammte. Aber mach dich jetzt hoch, ab marsch.»
«Wer kommt denn?»
«Wirst du gleich merken. Jetzt verdammt noch mal hoch mit dir. Wie sehen deine Haare aus? Geh zu deiner Tante, die soll schauen, was sie mit dir anfängt.» Der Kaufmann Best selbst allerdings folgte seiner Tochter nicht, sondern ging mit langen Schritten in die hintere Ecke, um mit eigenem Auge zu begutachten, wie der strenge Winter seine Waren verdarb.
Die Treppe vom Keller ins Erdgeschoss war Elise verhasst. Oft schlüpfrig, liefen die Stufen steil die Wand des Gewölbeeingangs hoch. Auf der Seite, wo keine Wand war, da war auch kein Geländer. Elise hatte als Kind die Kinderlähmung gehabt, nur leicht, aber der linke Unterschenkel war nicht sonderlich gut zu gebrauchen. Fürs gewöhnliche Gehen kam sie gut und ohne Krücken zurecht. Sie konnte sogar schwere Kisten schleppen (na ja, nie mehr als eine auf einmal). Steile Treppen aber waren eine Sache für sich. Wenn Elise vor etwas Angst hatte, dann davor, eines Tages von der Gewölbetreppe zu stürzen und sich alle Knochen zu brechen.
Als sie die Treppe glücklich geschafft hatte, wartete oben in der Diele die verwitwete, kinderlose Tante Lotte, eine lustige, verträgliche Person mit derselben langen Nase wie der Vater. Jetzt zitterte ihr Vogelkopf leicht, was bei ihr Aufregung anzeigte. Die Tante scheuchte ihre Nichte hoch in deren Schlafzimmer, wo sie auf dem Bett schon eins der guten Kleider zurechtgelegt hatte. «Kind», sagte Tante Lotte kopfnickend und hektisch, «ich weiß auch nicht, was dein Vater sich denkt, uns so spät zu informieren. Es ist doch auch gar nicht die Zeit für Besuch, direkt nach dem Mittagessen. Komm, beeil dich, damit ich dich noch frisieren kann.»
«Wer kommt denn überhaupt?», fragte Elise, die das immer noch nicht wusste und sich wunderte, dass die Tante so ernst und nervös schien. Eigentlich pflegte Tante Lotte sich eher über ihren Bruder und seine Launen zu mokieren, als dass sie sich von ihnen das Leben schwer machen ließ.
«Irgendein Pfarrer», verkündete die Tante.
«Wie? Irgendein Pfarrer?»
«Der Wartenstein bringt einen Freund mit.»
Elise machte große Augen. «Wie, und da muss ich unbedingt die Aufwartung machen und danebensitzen?»
Der Pfarrer Wartenstein von der Paulskirche war seit dem Debakel mit Papas zweiter Frau dessen Busenfreund. Genau genommen, seit die Herren festgestellt hatten, dass sie erstens beide gerne Schach spielten, zweitens beide gerne Zigarre rauchten und drittens beide einen gewissen Zynismus gegenüber der Welt pflegten und sich in dieser Haltung wechselseitig wunderbar bestärkten.
«Nicht nur du», sagte die Tante. «Wir sollen beide dabei sein. Line macht Kaffee. Elischen, du solltest dich freuen. Sonst beschwerst du dich doch, dass wir so selten Besuch haben und es so trist hier im Haus ist.»
Inzwischen saß Elise an der Frisierkommode, und die Tante ziepte ihr an den Haaren herum, die bekanntermaßen eine Katastrophe waren: karottenrot und kraus dazu. Elises Haare galten in der Familie neben ihrem lahmen Bein als der Grund, warum sie nicht verheiratet war. Insgeheim sagte sich Elise, es spiele dabei womöglich auch eine Rolle, dass der Vater sie gern zu Hause und beschäftigt hielt. Viel in Gesellschaft kam sie gerade nicht. Jedenfalls seit der Kaufmann Best seine zweite Frau verloren hatte und Elise die Aufgabe zufiel, den Vater als liebende, aufmerksame Tochter und Helferin darüber hinwegzutrösten. Andererseits, man konnte auch nicht gerade sagen, dass sie sich gegen diese Rolle je gewehrt hätte. Im Gegenteil.
«Was sollen wir den Herren denn anbieten?», fragte sie. «Dank Papas Spleen haben wir ja kein Stück Weihnachtsgebäck da.»
«O doch, mein Kind. Ich habe nämlich die Line zum Markt geschickt. Und ich hab ihr gesagt, sie soll lieber etwas mehr nehmen.»
Die beiden Frauen kicherten. Über das Gebäck, das so nun doch noch ins Haus kam, freuten sie sich bestimmt mehr, als der Besuch es tun würde.
Die Straßen waren allesamt eisglatt. Mit einem Schlitten wäre man wahrscheinlich ganz gut vorangekommen. Der Postwagen aus Camberg aber rutschte in jeder leichten Kurve, man bewegte sich im Schneckentempo, und als schließlich nahe Liederbach eines der Pferde ausrutschte, stürzte und sich verletzte, da hatte der beinahe zur Eissäule gefrorene Postillon genug. Er sah nach dem Tier, prüfte die Hufe. Keine Stifte im Eisen und keine Vorsorge gegen das Aufstollen von Schnee. Da rutschte ein Pferd natürlich. Wer hatte das denn verbockt? Notdürftig warf er dem verletzten Braunen eine Decke über. Nicht, dass es helfen würde. Dann stolperte und schlitterte er zu Fuß nach Höchst, statt das gesunde Pferd zu reiten, aus Angst, es könnte ebenfalls stürzen und ihm das Bein abdrücken oder Schlimmeres.
In dem nassauischen Städtchen angekommen, besprach er mit dem Posthalter: Man werde zwar die Kutsche mit Ersatzpferden vom Unfallort abholen und nach Höchst bringen, aber heute nicht mehr bis Frankfurt durchfahren. Die Briefe könnten später zu Fuß gebracht werden, die Pakete am nächsten Morgen mit der Taunusbahn.
Als sie endlich mit der Ersatzbespannung am Unfallort eintrafen, da war das gestürzte Pferd tot. Verletzte starben schnell bei diesen sibirischen Temperaturen. Mit Mühen bekamen sie den Kadaver vom Weg. Dann rasch ab zur Höchster Poststation. Dank der grimmigen Kälte hatte die Post von Camberg nur zwei gebuchte Fahrgäste gehabt. Von denen wollte der eine ohnehin nach Wiesbaden weiter und nicht nach Frankfurt. Und der andere, der Junge – nun, sollte er eben laufen.
Josua war steif gefroren, sodass er in Höchst aus der Berline mehr gehoben und gezogen wurde, als dass er sich selbst bewegte. Seine Füße spürte er gar nicht mehr. Die Hände und das Gesicht schmerzten. Ein fremder Mann, es war nicht der Postillon und auch nicht der Herr aus der Kutsche, stellte ihn auf den Boden und hielt ihn an den Schultern, bis er sein Gleichgewicht gefunden hatte. Es war längst Tag geworden. Josua hörte, wie sein Helfer mit einem anderen Fremden sprach, der am Gehsteig neben einem großen, schwarzkrustigen Schneeberg stand: «Wo geht es sich denn besser, auf dem Leinpfad oder auf der Straß’?»
«Ei, am besten auf dem Fluss natürlich!», sagte der andere, und dann lachten beide lauthals, und Josua hatte das Gefühl, dass sie sich über ihn lustig machten, was ja auch kein Wunder war. So eine elende, verlorene kleine Gestalt wie ihn sahen sie sicher nicht oft. Josua wünschte sich manchmal (zum Beispiel, wenn er sich in der Schule sehr blamierte), dass man sich einfach im Kopf wegdenken könnte. So als ob man gar nicht zu dem Körper und dem Kind gehörte, dem da gerade etwas Dummes widerfuhr. Hieß es nicht, die Gedanken wären frei? Wer zwang sie eigentlich, immer in seinem, Josuas, Kopf zu bleiben? Warum steckten seine Gedanken überhaupt in seinem Kopf, statt frei durch die Welt zu sausen? Von ganz weit oben könnten die Gedanken jetzt über die weiße Schneelandschaft fliegen und alles betrachten und müssten auch gar nicht frieren.