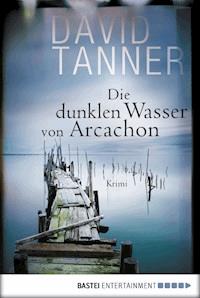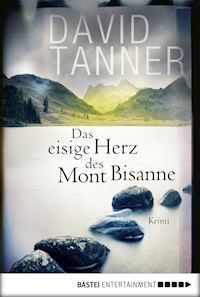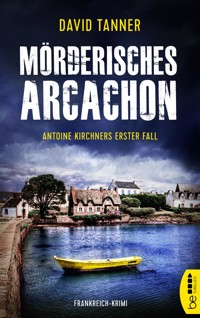9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Zwei Gourmet-Krimis um den französischen Journalisten und Hobbykoch Antoine Kirchner. Die dunklen Wasser von Arcachon. Warum treibt die Leiche des französischen Finanzministers vor dem Cap Ferret im Atlantik? War es ein Unfall oder Mord? Und was haben die Fischer von Arcachon damit zu tun? Der eigenwillige Journalist Antoine Kirchner wird von seinem Chefredakteur beauftragt, der Sache nachzugehen. In Arcachon macht er sich auf die Suche nach den Gründen für den ungewöhnlichen Todesfall und gerät in ein Netz aus Verschwörungen und Intrigen, das die höchsten Politikerkreise umspannt ... Das eisige Herz des Mont Bisanne. In einem bekannten Skiort der Savoyer Alpen wird eine geschändete Frauenleiche an einem Sessellift aufgeknüpft. Dass es der Bericht über diese grausame Tat lediglich in die kleine Lokalzeitung von Chanterelle schafft und der Mord selbst dort nur einmal kurz erwähnt wird, macht den eigenwilligen Journalisten Antoine Kirchner stutzig. Gibt es vielleicht jemanden, der die Tat vertuschen möchte? Kirchner begibt sich auf die Suche nach der Wahrheit und in das eisige Herz des Mont Bisanne ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 462
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über dieses Buch
Über den Autor
Titel
Impressum
Die dunklen Wasser von Arcachon
Arcachon und Umgebung
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
Das eisige Herz des Mont Bisanne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Epilog
Über dieses Buch
Zwei Gourmet-Krimis um den französischen Journalisten und Hobbykoch Antoine Kirchner.
Die dunklen Wasser von ArcachonWarum treibt die Leiche des französischen Finanzministers vor dem Cap Ferret im Atlantik? War es ein Unfall oder Mord? Und was haben die Fischer von Arcachon damit zu tun? Der eigenwillige Journalist Antoine Kirchner wird von seinem Chefredakteur beauftragt, der Sache nachzugehen. In Arcachon macht er sich auf die Suche nach den Gründen für den ungewöhnlichen Todesfall und gerät in ein Netz aus Verschwörungen und Intrigen, das die höchsten Politikerkreise umspannt …
Das eisige Herz des Mont BisanneIn einem bekannten Skiort der Savoyer Alpen wird eine geschändete Frauenleiche an einem Sessellift aufgeknüpft. Dass es der Bericht über diese grausame Tat lediglich in die kleine Lokalzeitung von Chanterelle schafft und der Mord selbst dort nur einmal kurz erwähnt wird, macht den eigenwilligen Journalisten Antoine Kirchner stutzig. Gibt es vielleicht jemanden, der die Tat vertuschen möchte? Kirchner begibt sich auf die Suche nach der Wahrheit und in das eisige Herz des Mont Bisanne …
Über den Autor
David Tanner, geboren 1965, wuchs als Kind deutsch-französischer Eltern in Bayern und Südfrankreich auf. Als Student schloss er sich verschiedenen Hilfsorganisationen an und bereiste mit ihnen die Welt. Tanner lebt als Kinderarzt mit seiner Familie in Paris.
David Tanner
DIEDUNKLENWASSER VONARCACHON
DAS EISIGEHERZ DESMONT BISANNE
BASTEI ENTERTAINMENT
Digitale Originalausgabe
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgaben:
Copyright © 2013 (»Die dunklen Wasser von Arcachon«), 2014 (»Das eisige Herz des Mont Bisanne«) by Bastei Lübbe AG, Köln
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2016 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat/Projektmanagement: Christina Bleser
Umschlaggestaltung: Manuela Städele-Monverde unter Verwendung von Motiven: © shutterstock: Production Perig | PhotonCatcher | ER_09 | bensliman hassan
eBook-Erstellung: Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-3400-5
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
David Tanner
DIEDUNKLENWASSER VONARCACHON
Kriminalroman
I.
Antoine Kirchner schlief und träumte noch unruhig, als das Telefon klingelte, es war erst kurz nach sechs Uhr, auf dem Leuchtfeld des Telefons erschien der Name Pelleton, es musste dringend sein.
Kirchner brauchte einen Moment, die Zumutung der frühen Störung zu überwinden, sein großer, schwerer Körper lag dem Telefon abgewandt zwischen den Zargen seines alten Bettes. Es dauerte, bis ihn die seltsamen Träume, bevölkert von Fischen, endlich losließen. Nach sechsmaligem Läuten wälzte er sich herum und hob fahrig ab.
»Antoine«, hörte er seinen Chef im breiten Singsang seines südfranzösischen Akzents sagen, »ich glaube, es wäre gut, wenn du einen kleinen Ausflug nach Arcachon machst.«
Kirchner setzte sich auf und stellte die nackten Füße auf den Steinboden. Er klemmte sich den Hörer zwischen Kiefer und Schulter wie ein Geiger sein Instrument, mit den freien Händen rieb er sich über Augen und Stirn.
»Weißt du, wie spät es ist, Henri?«, brummte er.
»Es ist schon nach sechs Uhr, mein Guter, also reg dich nicht auf«, sagte Pelleton. »Du verdienst genug, um zu dieser Zeit schon ansprechbar zu sein.«
»Was ist denn so wichtig?«, fragte Kirchner.
Pelletons Antwort klang seltsam triumphierend: »Ein Fischer aus Arcachon hatte heute Nacht die Leiche des Finanzministers im Netz, sie trieb ziemlich weit draußen vor Cap Ferret im Golf. Wir sind die Ersten, die es wissen, und das wird auch noch für eine Weile so bleiben, also frag nicht weiter, und mach dich an die Arbeit.«
Kirchner legte auf und blieb noch eine Weile mit aufgestützten Armen auf dem Bett sitzen, dehnte seinen Hals langsam nach links und nach rechts, hob ein paarmal die Beine an, wie zu einer kleinen Morgengymnastik, dann sprang er dynamisch auf, zog die Vorhänge zur Seite und öffnete die beiden Fenster im Obergeschoss des Gehöfts, das er mit seinem Vater bewohnte.
Sein Schlafzimmer lag im Giebel des vierhundert Jahre alten Steinhauses, das normannische Bauern einst aufgeschichtet hatten: ein schiefergedeckter Eindachhof, auf einer Anhöhe am Meer gelegen, umgeben von Feldern, Apfelhainen und mittelalterlichen Brunnen und Wegen.
Ein neuer Tag zog auf über der Küste des Ärmelkanals. Die Flut war zurück seit dem frühen Morgen und brachte blauen Himmel mit, das Wasser deckte das Watt im engen Delta der Vire schon wieder zu bis auf einen breiten Streifen vorne am Strand. Kirchner sah die Möwen winzig und weit drunten über der Brandung segeln, der Wind kam kühl ins Zimmer, die See draußen funkelte in der aufgehenden Sonne wie Stanniol.
Kirchners Vater arbeitete hinter dem Haus schon seit einer Weile »in den Äpfeln«, wie er das nannte. Der Alte war ein Frühaufsteher, mit jedem Lebensjahr ein wenig mehr, ein kleiner grauer Mann in Gummistiefeln und gewachster Jacke. An seiner Seite sprang stets Filou, ein schneller schwarzer Retriever. Kirchner konnte den Alten hören, wie er nach Filou rief und dem Hund wie einem Kind erklärte, was er in den Äpfeln gerade machte.
Kirchner ging zu einem Waschtisch in einer Ecke seines quadratischen Zimmers, dehnte sich noch einmal, putzte sich fahrig die Zähne, rasierte sich nass und zog einen Kamm durch die vollen, glatten Haare, die er jeden Tag ein wenig grauer werden sah. Er stieg in eine dunkelkarierte Tweedhose, nahm sich ein schwarzes Hemd vom Bügel und begann, barfuß, den Tag.
Auf dem Treppenabsatz unten traf er seinen Vater, die beiden Männer nickten sich wortlos einen Gruß zu. Der Alte hob zum Spaß militärisch die flache Hand an den Schirm seiner Kappe, Kirchner winkte ab. Er hockte sich kurz hin, um Filou unter der Schnauze zu kraulen, dann betrat er eine Küche, die jeden Besucher allein wegen ihrer schieren Größe überrascht hätte. Der Raum maß zehn Mal sechs Meter und war eine alte Stallung. Vater und Sohn hatten, vor vielen Jahren schon, die alte Hängedecke des Dachbodens eingerissen, um die vielhundertjährigen Eichenbalken des Dachstuhls freizulegen. Jetzt wirkte der Raum wie ein bäuerlicher Festsaal oder ein kleines Kirchenschiff. Aus breiten Luken im Dach floss weiches Licht, zu ebener Erde ging der Blick aus den Fenstern hinunter aufs Meer. Nach hinten lagen die normannischen Wiesen, die die schön gestaffelten Hügel bis zum Horizont bedeckten, gegliedert von Hecken, Feldrainen und den Kronen alter Bäume, in denen bald, wenn der Herbst sich alles Laub geholt hätte, die Starennester hängen würden wie dicke dunkle Christbaumkugeln.
An der Stirnseite des Raums stand eine breite Küchenzeile, begrenzt nach rechts von einem Kühlschrankturm, ein paar Meter links daneben schimmerten die Klappen zweier hochgebauter Herde. Mittig dazwischen waren alte Spülbecken aus weißem Porzellan montiert, eingelassen in großzügige Arbeitsflächen aus hartem Holz, die über und über Spuren intensiven Kochens zeigten – kreisrunde Muster eingebrannter Topfböden, Messerschnitte, Schrammen. Gusseiserne Kasserollen in schwarz und orange baumelten die Wand entlang an schweren Fleischerhaken, Pfannen aus Kupfer, Bräter aus Eisen, Stieltöpfe jeder Größe, ellenbreite Fischpfannen, Dämpfgeschirr, Siebe.
Die eigentliche Feuerstelle, fünf gasgetriebene Flammen, deren mittlere selbst wannengroßes Kochgeschirr heizen konnte, war eingebaut in einen tafelgroßen Tisch, der parallel zur Küchenzeile im Raum stand, eine Insel, die sich fast hüfthoch aus dem Boden erhob, unterbaut mit Schubfächern und Schränken, mit langen Regalen voller Kochbücher. Darüber spannte sich eine Abzugshaube aus Inox-Stahl, deren Schlund glatt sechs Meter hoch zur alten Balkendecke reichte, mit Drähten raffiniert in ihrer Position gehalten, an denen wiederum Utensilien griffbereit und in Augenhöhe aufgereiht hingen wie Wäsche zum Trocknen: Schaumsiebe und Schöpflöffel, Fleischgabeln und Wetzstähle, Schneebesen, Reibeisen, Hobel, Pressen, Stopfnadeln, Schälwerkzeug.
Antoine Kirchner, groß und schwer, aber dabei ein eleganter Mann, dem man ansah, dass er einige Energie darauf verwendete, sich durch nichts aus der Ruhe bringen zu lassen, machte sich Kaffee. Bei seiner Rückkehr aus dem Libanon zwei Wochen zuvor hatte er sich aus Paris chinesische Bohnen mitgebracht, gekauft bei einem Röster in der Rue Rambuteau, die einen sehr eigenen Duft verströmten. Nun saß Kirchner mit der Mühle zwischen den Beinen auf einem Holzstuhl und ließ das Mahlwerk mit kreisenden Armbewegungen knirschen.
Morgens setzte er sich nie an den großen Esstisch, der der Küchenzeile gegenüber Richtung Kamin und Geschirrschrank den Raum füllte und von einem guten Dutzend hell gerahmter Thonet-Stühle umringt wurde. Wenn seine Tage begannen, nahm er stets Platz an einem kleinen Tisch, der an der Meerseite des Hauses an einem der Fenster stand. Darauf lag linker Hand ein kleiner silberner Laptop, rechter Hand der Stapel Zeitungen, den sein Vater jeden Morgen zuverlässig dort ablegte.
Libération und Aujourd’hui en France, Le Figaro und Ouest France, L’Equipe und Le Monde vom Vorabend, die Herald Tribune, die Süddeutsche und die Neue Zürcher Zeitung, die Magazine der Woche, Match, Nouvel Observateur, Marianne, Time und Der Spiegel, aber auch die Frauen-Magazine aus Paris stapelten sich, genau wie die Lokalzeitungen aus der Gegend, aus Caen und Cherbourg. Kirchner war ein Suchtleser, er liebte die gedruckte Presse, er war abhängig von ihr. Je nach Stimmung und Tageslage las er in seiner Küche intensiv ganze Vormittage lang, aber es konnte auch vorkommen, dass er nur kurz blätterte, auf der Suche nach dem schnellen, kleinen Reiz.
An diesem Morgen wusste er, dass all die Zeitungen und Zeitschriften keine Nachrichten enthalten würden, die mit Pelletons frühem Anruf zu tun haben konnten, deshalb blätterte er nur achtlos und unkonzentriert in L’ Equipe und amüsierte sich über die Niederlage der französischen Fußballer gegen China.
Er wartete darauf, dass die Kaffeemaschine, ein schweres deutsches Fabrikat, ihr Werk endlich fauchend getan hatte, und schenkte sich das dunkle Gebräu in eine Tasse mit verblichenem Silberrand ein.
Der Finanzminister, tot im Meer vor Cap Ferret. Kirchner überlegte, wie er die Geschichte angehen könnte.
Er nippte am Kaffee. Er ist gut, dieser chinesische Kaffee, sogar sehr gut. Kirchner trank ihn schwarz mit einem Löffel Zucker, spürte dem exotischen Aroma nach, kaute auf dem Kaffee herum. Schokolade, dachte er, der Röster hat recht, schmeckt nach Schokolade.
Sein Vater kam in die Küche, Erde an den Stiefeln, Filou auf seinen Fersen, sie brachten eine schöne Brise des frischen Morgens mit herein. Der alte Kirchner nahm sich einen Henkeltopf bedruckt mit einer Girlande aus Rosen, die den Schriftzug George umrankte, und schenkte sich ein.
»Vorsicht«, sagte Kirchner, »nicht einfach so. Das ist ein sehr vornehmer Kaffee aus China. Schmeckt nach Schokolade.«
Der Vater hob den Topf zur Nase, machte ein neugieriges Gesicht und trank. »Schmeckt gut. Aus China? Gar nicht schlecht.«
»Wen kennst du in Arcachon?«, fragte Kirchner.
Der Vater schwieg und überlegte, nippte am Kaffee, dann sagte er, langsam, nach einer Weile, in der sich die beiden angeschwiegen hatten: »Der Sohn vom alten Bouchot arbeitet doch da unten, weißt du, der Biologe, Pierre. Der ist bei irgendeinem Meeresforschungsinstitut, ja, ja, das ist so, der ist in Arcachon.«
»Großartig, besorg mir bitte die Nummer, George. Das ist genau, was ich brauche.«
»Was ist denn los?«
»Ich hatte einen Anruf von Pelleton. Der Finanzminister ist tot aus dem Meer gefischt worden. Da kommt mir ein Meeresforscher gerade recht.«
II.
Kirchner stieg wieder hinauf in sein Schlafzimmer, um zu packen. Es war immer schwer zu sagen, wie lange er unterwegs sein würde. Diesmal rechnete er fürs Erste mit einer Woche und sammelte routiniert Wäsche und Hemden, Hosen und Jacken zusammen.
Er war ein Reisender, seitdem er denken konnte, unterwegs in allen Ecken der Welt. Seine Reporterkarriere hatte begonnen, als er Ende der 1970er-Jahre den russischen Krieg in Afghanistan für Paris Match beschrieben hatte, in preisgekrönten Reportagen, die vom Leben und Sterben der Mudschaheddin im Pandschir-Tal erzählten und später vom furchtbaren Rückzug der sowjetischen Truppen über den Salang-Pass.
Damals wurde er, ein junger Mann noch und keine zwanzig Jahre alt, schon zum Grand Reporter, er wurde gefeiert und galt eine Zeit lang als der bestbezahlte Schreiber der Branche. Als Chefreporter wechselte er bald von Paris Match zu Le Monde und fand sich in den Jahrzehnten seither regelmäßig an den Schauplätzen der Weltgeschichte wieder, in Berlin und Moskau, in Jerusalem und Bagdad, in Peking und New York. Er war ein journalistischer Sondergesandter, dessen Erfolg darin bestand, den gebrechlichen Zustand der Welt in ruhige Worte zu fassen.
Immer hatte er es als Glück empfunden, so hart am Wind der Zeit zu segeln. Er sagte von sich selbst, er sei letztlich nur ein »bezahlter Zeitzeuge«, und diese Bescheidenheit war nicht gespielt. Er meinte es so, und seine Leser bewunderten ihn für seinen Mut, die Beharrlichkeit und eine Sprachmacht, in der sich seine Bescheidenheit durchaus spiegelte. Kirchner genoss die Anerkennung, zu Kopf gestiegen war sie ihm nicht. Er wusste, wie flüchtig aller Ruhm auf Erden war, und vor allem hatte er in all den Jahren draußen in der Welt nie vergessen, wo er hingehörte. In den Kriegsgebieten, in den Krisenregionen träumte Kirchner manchmal von der Normandie, von seiner Region Calvados, von den Wiesen, vom Meer, und danach erwachte er, wo auch immer er war, mit einem Lächeln auf dem Gesicht.
Sein Leben war reich an Prüfungen. Er hatte den Tod und seine Gesichter auf seinen Fahrten kennengelernt, ihm war der Teufel in Menschengestalt begegnet. Manchmal war er selbst nur um Haaresbreite davongekommen. Aber die Gefahren schreckten ihn nicht, er fühlte sich, konfrontiert mit ihnen, immer nur wie ein Rad im Weltgeschehen und hatte das Talent, kein Ereignis persönlich zu nehmen.
Nie aber würde er den Tag vergessen, als er während des Falklandkrieges der Briten mit den Argentiniern gerade über den Untergang der Belgrano berichtete und ein englischer Funker ihn mit seinem Vater verband, der ihm vom Tod der Mutter daheim erzählte, von dem Milchlaster, der sie und ihren blauen Renault 5 am Kreisel zwischen Osmanville und Isigny zermalmt hatte.
»Jeanne ist tot.« Dieser erste Satz des Vaters hatte sich ins lärmende Chaos des Funkverkehrs gemischt wie ein verirrtes Telegramm, und in den Kriegswirren um die Falkland-Inseln dauerte es vier quälende Tage, ehe Kirchner die Heimreise endlich antreten konnte.
Der entsetzliche Widerspruch zwischen den welthistorisch bedeutsamen Toten auf dem sinkenden Kriegsschiff und dem banalen Verkehrsunfall, der ihm die Mutter genommen hatte, und auch das Gefühl der Schuld, im falschen Augenblick am falschen Ort zu sein, großspurig durch die Welt zu hetzen, statt sich um die kleineren, aber wesentlichen Dinge zuhause zu kümmern, ließen ihn damals an vielem zweifeln. Er hatte alles hinwerfen wollen, der Journalismus kam ihm sinnlos und zynisch vor, seine eigene Rolle darin beliebig und austauschbar.
Fast ein ganzes Jahr hatte er gebraucht, um wieder Tritt zu fassen, und am Ende war es sein Vater, der ihn zum Weitermachen ermunterte. Mit dem größten Kompliment, das ihm je ein Leser gemacht hatte. Der Vater sagte damals, mit seiner schlichten Überzeugungskraft, nach einem Jahr dunkler Trauer in der Normandie, dass das Leben und das Sterben nun einmal so sei, wie es sei, dass aber niemand besser darüber schreiben könne als er. »Dein Talent«, sagte der Vater, »ist dein Auftrag.«
In Kirchners Erinnerung war seine Mutter eine schöne, stattliche Frau, die stets das Beste aus dem Leben zu machen versuchte, die aber auch von inneren Widersprüchen geplagt war.
Sie war das Kind eines deutschen Soldaten, der sich in den Kriegswirren am Beginn der 1940er-Jahre in Caen in eine junge französische Lehrerin verliebt hatte. Und sie hatte seine Gefühle erwidert.
Ohne je genau sagen zu können, warum, hatte die Mutter unter dieser Herkunft gelitten. Sie hatte sich immer gewünscht, einfach ein normales Mädchen zu sein; die unmögliche Liebe aus fernen Kriegszeiten lastete dunkel auf ihr.
Wenn in der Region, den ganzen Ärmelkanal entlang, jedes Jahr die Feierlichkeiten zur Erinnerung an den D-Day stattgefunden hatten, hatte sie sich im Haus verkrochen und war kaum je vor die Tür gegangen.
Kirchner selbst hatte diese Herkunft eher als Bereicherung empfunden. Schon als Kind hatte er sich in seiner Fantasie abenteuerlich den Moment ausgemalt, in dem der Großvater im Kampf mit den über den Atlantik anrückenden alliierten Brigaden gefallen war, getroffen, nach allem, was bekannt war, von der Kugel eines Fallschirmjägers der amerikanischen 101. Airborne Division. Irgendwo hinter der Steilküste landeinwärts an der Pointe du Hoc war das geschehen, und immer, wenn Kirchner dort spazieren ging, war ihm der fremde Großvater präsent.
Die Frau, die der Soldat aus Oberbayern geliebt hatte, die ihn geliebt hatte, Kirchners Großmutter Josephine, hatte bis zu ihrem Tod ein mehr als zwiespältiges Verhältnis zur Befreiung Frankreichs von den Nazis gehabt. Sie erzählte oft Geschichten darüber, wie die Franzosen gemeinsam mit den Deutschen vor den anrückenden Amerikanern, Kanadiern und Briten geflohen waren, und nur, weil ein vernünftiger Bürgermeister eingeschritten war, war sie selbst dem Schicksal entgangen, mit kahl geschorenem Kopf und einem Hurenschild um den Hals durch ihr Dorf getrieben zu werden.
Sie, die Großmutter, hatte jedenfalls dafür gesorgt, dass ihr einziger Enkel Antoine solide Deutsch lernte und dass er die Schwarz-Weiß-Bilder, die sich alle Welt für lange Zeit von Deutschland und den Deutschen gemacht hatte, nicht einfach für bare Münze nahm.
Die besondere Familiengeschichte vertiefte Kirchners Bindung zur Normandie, an das alte Steinhaus an der Küste und das Land drum herum, mit seinem Vater mittendrin. Sie waren seine Heimat, gewoben aus Liebe und Schmerz, und wann immer er aus fernen Ländern nach Frankreich zurückkehrte, wenn er wieder landete in Paris, in Orly oder draußen in Roissy, drängte es ihn so schnell wie möglich auf die Autobahn A 13 Richtung Kanalküste, wo ihm Filou aufgeregt entgegensprang, wo seine Küche auf ihn wartete und wo ihn der Vater mit Tränen in den Augen bei jeder Rückkehr in die Arme schloss.
Kirchner ging jetzt auf die fünfzig zu. Der Zustand der Welt war so gebrechlich wie stets, aber er hatte sich beruflich eine Position erarbeitet, die ihm die Auswahl seiner Stoffe erlaubte. Selten wurde er, wie an diesem Morgen, von Henri Pelleton, dem allmächtigen Le-Monde-Chef, einfach losgeschickt. Sein Alltag sah jetzt in der Regel anders aus, ruhiger als früher, weniger gehetzt. Jüngere Kollegen eilten zu den Schauplätzen, an denen geschossen und gestorben wurde, Kirchner sprang selbst nur noch ein, wenn der Pulverdampf verzogen war und der größere Zusammenhang einer Geschichte sichtbar wurde. Zwischen seinen Einsätzen draußen in der Welt beschränkte er sich auf Europa und arbeitete seit einer Weile wieder häufiger in Frankreich selbst, und diese Entwicklung war ihm nur recht. Seit einiger Zeit verspürte er manchmal Anflüge großer Müdigkeit, nach langen Flügen oder während aufwändiger Recherchen. Das ist das Alter, sagte er sich.
Seit seinem vierzigsten Geburtstag wusste er, dass er nicht mehr fünfundzwanzig war. Aber sooft er sich auch selbst überprüfte, und das war ihm das Wichtigste, kam er doch immer wieder zu dem Schluss, dass er wach geblieben und vor allem neugierig auf die Welt und die Menschen war, was er als den wesentlichen Charakterzug eines guten Reporters ansah.
Darüber und über viele andere Dinge redete er neuerdings mit seinen jungen Kollegen, Pelleton hatte ihn darum gebeten. Deshalb lud er sich jetzt manchmal die Talente, seine Nachfolger, in die Normandie ein, um über die Arbeit zu diskutieren, über das Reporterleben und seine goldenen Regeln, und natürlich auch, um gemeinsam ausgiebig zu essen und zu trinken. Kirchner mochte diese Workshops, er hatte sich, beruflich wenigstens, nichts mehr zu beweisen.
Gummistiefel, dachte Kirchner, ich brauche unbedingt Gummistiefel.
Er musste auf einen Stuhl steigen, um das Paar grüner Aigle-Stiefel aus einem oberen Schrankfach zu holen; er trug sie selten, in der Normandie fast nie. Er ging barfuß ins Watt und auch in die Wiesen. Eigentlich mied er es, Schuhe zu tragen, sooft es ging, und noch heute, da er längst ein erwachsener Mann war, wiederholte sein Vater manchmal die tausendfach ausgesprochene Warnung der Mutter aus den fernen Kindertagen, er werde sich mit seinen nackten Füßen ganz gewiss eine Erkältung holen und sich die Nieren entzünden.
Der Alte hatte drunten inzwischen das Radio aufgedreht, Aznavour sang Emmène-moi au bout de la terre, nimm mich mit bis ans Ende der Welt. Der Vater sang mit, Kirchner summte.
Er trug seine Reisetasche nach unten und schenkte sich eine zweite Tasse des chinesischen Kaffees ein.
»Hast du die Nummer von Bouchot?«, fragte er.
Der Vater hielt sie ihm auf einem abgerissenen Stück Zeitungspapier hin.
»Und? Was sagt der alte Bouchot?«, fragte Kirchner.
»Er sagt, dass es dieses Jahr schlecht aussieht mit den Austern.«
»Na ja, und weiter?«
»Sein Sohn wird sich freuen, dich zu sehen, sagt er.«
»Sehr gut, auf dich ist Verlass, George, wie immer.« Und nach einem weiteren Schluck aus der Tasse schaute er den Vater angewidert an und sagte: »Also dieser Kaffee … wenn er frisch ist, schmeckt er wunderbar, und jetzt, keine zwanzig Minuten später, hat er was von Schweiß, oder?«
Der Vater schüttelte den Kopf. »Weißt du, Antoine«, sagte er bedächtig, »manchmal denke ich, du spinnst.«
Kirchner nickte grinsend und ging mit dem Zettel und dem schnurlosen Telefon vor die Tür, auf die Landseite des Bauernhofs.
Über den Feldern und Hügeln stieg eine blasse Sonne, auf den Wiesen standen nah und fern die Kühe in einem Schleier aus roséfarbenem Dunst. Ein paar Traktoren zogen schon durch die Felder, über den Kaminen der Bauernhöfe standen dünne Rauchsäulen.
Kirchner setzte sich auf eine der Steinbänke, die unter schönen Bögen in die Fassade des Hauses eingelassen waren.
Von dort aus war rechter Hand der Obsthain des Vaters zu sehen, alte, gedrungene Bäume in vier geraden Reihen, die feste, kleine Boskopäpfel trugen, aus denen jedes Jahr Konfitüren, Kuchen, Chutneys, Cidre und Calvados wurden. Zur Linken des Eindachhofes streckte sich der lange Stall hin, in dem schon lange keine Tiere mehr standen, die Mauern und Eisenbeschläge der Stallung waren umrankt von Kletterrosen, davor scharrte das Dutzend Hühner im Boden. Hinten an der großen Kastanie, die den Gemüsegarten beschattete, unter dem die Gewölbe des Weinkellers lagen, rissen die beiden Ziegen, die der Vater nach den militärischen Codenamen der Landungsstrände getauft hatte, Utah und Omaha an ihrer Schnur. Geradeaus ging der Blick weit ins Land hinein, in die Bocage, auf deren Landstraßen noch immer Pferdefuhrwerke unterwegs waren und alte Bauern mit Säcken voller Nüsse auf dem Rücken ihrer Wege gingen.
Kirchner wählte die achtstellige Nummer, sie begann mit 06, ein Mobilanschluss. Nach dreimaligem Läuten war die Stimme von Bouchots Sohn zu hören.
»Hallo, Pierre? Hier ist Antoine Kirchner, dein Vater hat mir deine Nummer gegeben, wie geht’s?«
»Antoine?«, fragte der junge Bouchot. »Na, das ist eine Überraschung! Grade neulich bin ich bei euch vorbeigefahren und wäre fast hereingeschneit, aber ich hatte dann doch keine Zeit. Wie geht’s deinem Vater?«
»Gut, gut, geht alles seinen Gang bei uns, dein Vater ist auch wohlauf, der sorgt sich nur um seine Austern.«
»Es ist jedes Jahr das Gleiche«, sagte Pierre Bouchot amüsiert. »Aber deswegen rufst du doch bestimmt nicht an. Also, womit kann ich dir helfen?«
»Ich habe heute Morgen erfahren, dass man den Finanzminister irgendwo vor Cap Ferret tot aus dem Meer gefischt hat.«
»Ach du lieber Gott! Das ist … also … das ist ja gar nicht gut.«
»Ich mache mich grade auf den Weg, um der Sache nachzugehen. Wir könnten nachher zusammen ein spätes Mittagessen teilen, ich brauche ein paar Kontakte, einen Anfang, du weißt schon.«
»Sicher, aber natürlich, Antoine«, sagte Bouchot, »du könntest mich abholen im Institut, wir sitzen am Hafen, das ist in Arcachon Richtung Gujan-Mestras. Es gibt auch Schilder. Such nach Arcamer, so heißen wir.«
»Gut, Pierre«, sagte Kirchner, »ich werd dich schon finden. Bin nicht das erste Mal in der Gegend. Bis gleich also, na ja, bis in sechs Stunden oder so, so lange werd ich wohl brauchen. Sagen wir dreizehn Uhr, dreizehn Uhr dreißig.«
Zwanzig Minuten später saß Kirchner am Steuer seines weißen Landrover Discovery und fuhr auf der N174 Richtung Süden durchs wellige Land der Normandie. Er ließ den Cotentin rechts liegen, hielt auf den Mont Saint Michel zu und stellte sich auf eine ereignislose Fahrt ein.
III.
Kirchner erreichte Arcachon nach gut sechs Stunden Fahrt ohne Pause, nun durchquerte er La Teste-de-Buch auf der N251, die Fahrt ging Richtung Norden, direkt nach Arcachon hinein, in zehn Minuten würde er am Hafen sein.
Er rief Pierre Bouchot an, um sich anzumelden, und Bouchot wirkte aufgeregt wegen des Treffens.
Das ist gut, dachte Kirchner, aufgeregte Leute reden gern.
Er mochte Arcachon, die kleine Stadt aus bunten, maritimen Herrenhäuschen, mondän geteilt in eine Winter- und eine Sommerstadt, erbaut zu einer Zeit, als das Baden im Meer gerade erfunden wurde. Zur Hauptsaison war es unerträglich voll hier, an den Wochenenden pilgerte halb Bordeaux herüber, und neuerdings hatte die Politikerelite aus Paris die Düne von Pilat und Cap Ferret als sommerliches Urlaubsziel entdeckt. Jetzt im Herbst zeigte Arcachon wieder seinen wahren Charakter: ein behaglicher, gelassener, bürgerlicher Ort.
Umso überraschter war Kirchner, als er auf der zentralen Achse der Stadt, dem Boulevard Deganne, plötzlich im Stau stand und weit vorne ein Lärm zu hören war, den er nur zu gut kannte. Eine Demonstration zog offenkundig um die Häuser, Kirchner hörte die keuchenden Rufe aus Megafonen, er hörte Trillerpfeifen und sah von ferne auch ein paar rote Flaggen von Gewerkschaften und Männer in grellen Westen.
Nach ein paar weiteren Metern in quälendem Schritttempo und direkt hinter einem Bierlaster mit der Aufschrift Stella Artois bog er in die nächstbeste Seitenstraße ab und stellte den Wagen schräg in eine Ausfahrt. Er musste wissen, was sich dort vorne zutrug.
Schnell stieg er aus dem Auto und hastete den Boulevard entlang, je näher er der Demonstration kam, desto deutlicher hörte er die skandierten Rufe: »Ar-ca-mer – ab-ins-Meer!«
Die Demonstranten standen auf der Kreuzung von Boulevard Deganne und Rue Coste, hier ging es zum Hafen, zu Pierre Bouchots Institut Arcamer.
Kirchner hatte keine Ahnung, worum sich die Aufregung drehte. Hundert, vielleicht hundertzwanzig Leute blockierten den Verkehr. Es war eine Versammlung grober Gestalten, viele in Fischermontur, in Gummihosen, die bis zur Brust reichten, in abgewetzten Wollpullovern. Auf Traktoren mit Anhängern hatten einige zentnerweise Austern herangekarrt, die sie jetzt lärmend auf die Straße schütteten und gegen Häuser warfen, unter den johlenden Rufen der anderen Demonstranten.
Kirchner mischte sich unter die Leute und fragte einen Dicken im gelben Ölzeug, was denn los sei.
»Was hier los ist, Monsieur?«, fragte der im verschliffenen Akzent eines Mannes, der das Reden nicht gewohnt war, zurück. »Ich sag Ihnen, was los ist. Die Herren Meeresforscher wollen uns fertigmachen, das ist los.«
Kirchner nickte unbestimmt und fragte noch einmal: »Aber worum geht’s denn?«
Der Demonstrant schaute ihn von der Seite an. »Du bist wohl nicht von hier, wie?«
»Ich komme aus der Normandie«, antwortete Kirchner.
»Ach so, aus der Normandie? Da habt ihr ja auch Austern, wie?«
»Ja, da haben wir auch Austern.«
»Na ja, wir hier werden wahrscheinlich bald keine mehr haben, weil diese Professoren dauernd neues Gift in unseren Muscheln finden, verstehst du? Dabei sind sie astrein, sag ich dir, hier …«, und mit diesen Worten griff er in den großen Austernhaufen und knackte eine Schale mit dem Schraubenzieher eines Taschenmessers auf, »probier selber, und sag mir, was du denkst.«
Er hielt Kirchner die Auster hin, der keine Sekunde zögerte, sie an den Mund setzte und mitsamt ihrem Wasser in einem Zug ausschlürfte.
»Schmeckt gut«, sagte er zur Zufriedenheit des Dicken, »sehr gut sogar. Fehlt vielleicht ein bisschen Zitrone.«
Nachdem er sich ein paar Flugblätter kleingefaltet in eine König & Ebhardt-Kladde, sein bevorzugtes Notizbuch seit vielen Jahren, gepackt hatte, ging er zurück zum Auto und telefonierte wieder mit Bouchot.
»Du bist mir ja einer, Pierre! Sagst kein Wort darüber, dass die Leute hier gegen euch auf die Straße gehen.«
Bouchot lachte und fragte, wo Kirchner gerade sei.
»Am Boulevard Deganne.«
»Boulevard Deganne? Dann versuch erst gar nicht, hierher zu fahren. Hier ist alles dicht, die schmeißen uns mit ihren Austern die Scheiben ein, überall ist Polizei. Lauf vor zur Promenade, und geh nach rechts, wenn du am Strand ankommst. Im letzten Bistro an der Ecke treffen wir uns, es heißt L'Océan. Ich nehm das Fahrrad. Bis gleich.«
Kirchner kam früher im L'Océan an als Bouchot. Er verlangte nach einem Tisch für zwei, setzte sich zufrieden auf die Terrasse mit herrlichem Blick auf die Bucht und bestellte einen Kir.
Am Kir, dachte Kirchner, erkennt man den Anspruch eines Lokals.
Schlecht geführte Häuser brachten das Glas immer schon himbeerfarben gefüllt an den Tisch, sie nahmen zu milden Wein und zu viel Crème de Cassis, sodass der Aperitif wie süße Limonade schmeckte. In guten Häusern stand immer nur ein halber Finger Cassislikör im Glas, und der Kellner füllte es vor den Augen des Gastes aus einer guten, kalten Flasche weißen Burgunders auf.
Der Kir kam. Der Kellner stellte ein kleines, lauwarm gefülltes Glas auf den Tisch, zu viel Cassis, zu milder Wein. Kirchner trank. Er war kulinarische Enttäuschungen gewohnt.
»Antoine?« Ein jugendlicher Mann rief nach ihm, ein Enddreißiger mit grauen Schläfen, der Slalom um die Tische auf der Terrasse lief. »Du bist es«, sagte Pierre Bouchot, als er endlich vor Kirchner stand, lang und dünn wie ein Strich, »gleich wiedererkannt! Bei uns ist heute vielleicht was los, meine Güte.«
Bouchot ließ sich auf einen Stuhl fallen, und sie tauschten auf die gute französische Art Höflichkeiten aus, erkundigten sich gegenseitig nach Familienmitgliedern, versuchten herauszufinden, wie oft und wo in der Normandie sie sich eigentlich schon begegnet waren und wo sie sich womöglich knapp verpasst hatten, warum sie sich die grauen Haare nicht färbten und was sie vom Trainer der Fußballnationalmannschaft hielten. Kirchner war in dieser Hinsicht ein ganz weltläufiger Franzose, kein maulfauler Normanne. Er mochte das zivile Hin und Her der Konversation, sie gehörte dazu, sie machte das Leben besser.
Gemeinsam studierten sie die Karte, und Kirchner entschied sich für zwölf Austern aus der Bucht und eine Portion in Brickteig gebackene Seezungenfilets. Ihn verlangte nach etwas Leichtem, es ging schon auf zwei Uhr. Bouchot aß einen grünen Salat mit Knoblauchcroûtons und ein gegrilltes Entrecote mit streichholzdünnen Fritten. Die Männer teilten sich einen halben Liter weißen Graves aus dem nahen Bordeaux.
»Was ist denn nun bei euch los, Pierre?«, fragte Kirchner nach seiner sechsten Auster, die er mit Schalotten-Vinaigrette beträufelte und genussvoll aussog.
Bouchot hielt ihm einen langen, komplizierten Vortrag, dem er schweigend und essend zuhörte.
Kirchner erfuhr, dass Arcamer ein privates Forschungsinstitut mit vielen Staatsaufträgen sei, das sich um die Qualität von Meeresfrüchten hier unten an der Küste zu kümmern hatte. Bouchot war kein Biologe, wie George vermutet hatte, und wie Bouchots eigener Vater es immer noch glaubte, sondern Chemiker. Er erklärte Kirchner, dass sie im Becken hier mit dem Klimawandel zu kämpfen hätten. Die Wassertemperatur in der Bucht steige seit Jahren schon um ein, zwei Zehntel Grad jedes Jahr, was zur Folge hätte, dass sich Mikroorganismen schneller vermehrten.
»In den Austern aus dem Becken werden ständig mehr Bakterien gefunden«, sagte Bouchot, »und immer öfter in Konzentrationen, die über den Grenzwerten liegen.«
Es sei die Aufgabe von Arcamer, solche Vorgänge zu melden und öffentlich zu machen. Leider sei das immer häufiger der Fall.
»Verstehe«, sagte Kirchner, während er auf einem Stück dunklen Brots mit Fassbutter herumkaute, »da draußen in der Natur passiert was, ihr gebt es bekannt und seid die Buhmänner.«
»So ist es«, bestätigte Bouchot.
Der Chemiker schien erschöpft vom Reden und den Aufregungen des Vormittags. Er trank den Wein in großen Schlucken, sodass Kirchner dem Kellner bald einen Wink gab, er möge noch eine weitere Karaffe bringen.
»Aber hat es denn Fälle gegeben, in denen jemand wegen der Austern krank geworden ist?«
Bouchot schüttelte den Kopf. »Das ist ja unser Problem, es gibt keine Fälle, ich meine, Gott sei Dank, niemand ist krank geworden. Deshalb sagen die Austernzüchter ja, dass nicht ihre Ware, sondern die Grenzwerte falsch sind. Ich kann das als Chemiker gar nicht beurteilen, da müsste man einen Mediziner fragen, aber, ganz ehrlich, manchmal denke ich, dass die Züchter vielleicht richtigliegen.«
Die beiden wechselten dann zu anderen Themen.
Bouchot erzählte vom vergangenen Sommer in Arcachon und machte sich lustig über den Auftrieb der Pariser Spitzenpolitiker. »Hier waren im August jeden zweiten Tag die Hauptstraßen gesperrt, weil gerade irgendein Minister oder der Präsident der Republik persönlich und samt Gattin durch die Stadt gerollt ist.« Arcachon sei das neue Saint-Tropez, sagte Bouchot, und in der Zeitung habe neulich gestanden, dass sich Catherine Deneuve nach einem Haus in der Gegend umsehe. »Catherine Deneuve, hier bei uns, stell dir vor!«
»Und was ist nun mit dem Finanzminister?«, fragte Kirchner.
»Tja, du bist irgendwie der Einzige, der etwas darüber weiß, scheint es«, sagte er. »Ich habe heute Morgen jedenfalls nichts davon gehört. Und glaub mir, normalerweise macht hier alles sofort die Runde, ist ja doch nur ein großes Dorf. Vielleicht war dein Fischer gar nicht aus Arcachon? Ich meine, da draußen sind viele Boote unterwegs.«
Kirchner zuckte mit den Schultern und bestellte die Rechnung. Bouchot machte Anstalten, sie zu teilen, aber Kirchner wies ihn ab.
»Auf keinen Fall, Pierre! Das hier bezahlt Le Monde, so weit kommt’s noch.«
Nachdem sich die beiden verabschiedet hatten, ging Kirchner zu Fuß durch den Ort und suchte sich ein Hotel für die Nacht am weißen Strand von Arcachon.
Die Stadt war gezeichnet vom Massentourismus. Es gab mehr Pizzerien als Bistros, Kebab-Läden hatten sich in den Kulissen alter Bäckereien eingerichtet, Asia-Imbisse belegten die Räume alter Werkstätten, in denen einst Bootsbeschläge gefertigt worden waren. Hinter der Jugendstil-Fassade des alten Casinos rotierten nicht mehr die Roulettes auf grünen Tischen, sondern nur noch die schnellen Plastikscheiben der Geldspielautomaten.
An der Promenade dem Pier gegenüber fand Kirchner Le Splendid, ein Hotel mit zuckrigem Stuck um die Fenster, das schon bessere Tage gesehen hatte. Der morbide Charme des Hauses gefiel ihm gleich.
Er ging zurück zu seinem Landrover, zerknüllte den Strafzettel, der unter dem Scheibenwischer steckte, und fuhr am Splendid vor. Mit seiner Reisetasche über der Schulter überquerte er den kleinen Parkplatz, auf dem gedrängt ein paar Autos mit Nummernschildern aus den Niederlanden, Deutschland und Paris standen, und ging an die Rezeption. Über dem Tresen hingen Uhren, die die Zeit in New York, Paris, Moskau und Tokio anzeigten.
Der Rezeptionist, ein junger, verhuschter Mann mit unreiner Haut, wies ihm ein schönes Zimmer mit grandiosem Meerblick zu, der für ein knarrendes Bett, vergilbte Tapeten und unmöglich gemusterte Vorhänge entschädigte.
Zurück in der Lobby verlängerte Kirchner gleich um vier Tage und verneinte, als der Mann am Empfang fragte, ob er im Haus auch frühstücken wolle. Kirchner trank am Morgen Kaffee und sonst nichts. Hotel-Frühstück war ihm ein Gräuel.
Er wollte seine Herberge gerade wieder verlassen, als ihm in der Drehtür eine Gruppe Männer begegnete, die gleich sein Interesse weckte. Die vier waren in dunkelgraue Anzüge gekleidet, unter denen sie helle Hemden ohne Schlips trugen. Sie hatten sehr ähnliche Haarschnitte, sehr ähnliche Attitüden, sie waren alle vier auf sehr ähnliche Weise durchtrainiert, sodass Kirchner sofort den Staatsdienst witterte, Polizei, vielleicht sogar Geheimpolizei. Er verließ das Hotel deshalb nicht, sondern drehte sich sofort wieder in die Lobby hinein, wo die Männer gerade im Aufzug verschwanden.
Er ging zur Rezeption, legte den Ellbogen auf die Theke und fragte den Concierge in verschwörerischem Ton: »Wer sind denn diese Herren?«
Der Rezeptionist wurde fahrig, er tat, als müsse er Papiere sortieren. Dann sagte er, wie er es gelernt hatte: »Darüber kann ich Ihnen leider keine Auskunft geben, Monsieur.«
»Verstehe, verstehe, aber ich kann Ihnen Auskunft darüber geben, wann die Herren hier angekommen sind, wollen wir wetten?« Mit diesen Worten legte er einen Zwanzig-Euro-Schein auf die Marmorplatte des Empfangs.
Der Rezeptionist vermied seinen Blick, aber Kirchner spürte seinen Widerstand schon schwinden.
»Die Herren sind mitten in der Nacht hier angekommen, und zwar heute ganz früh am Morgen, und statt Pässen haben sie beim Check-in Dienstausweise vorgelegt. Na, stimmt’s?«
Der Mann in Livree gab schnell auf, er nickte schon, während Kirchner noch redete.
»Die sind vom DCRI«, flüsterte er und beugte sich weit nach vorne, als fühlte er sich belauscht. »Meine Schicht hat zwar erst um sechs Uhr begonnen, aber der Kollege vom Nachtdienst hat’s mir erzählt. Um fünf Uhr haben sie ihn rausgeklingelt, und sie wollten auch gleich Frühstück.«
Kirchners Schuss ins Blaue war ein Treffer. Die vier Männer kamen von der Direction centrale du renseignement intérieur, dem Inlandsgeheimdienst DCRI. Ohne Zweifel hatten sie den Auftrag, den Tod des Finanzministers so lange zu vertuschen, bis die Regierung in Paris mehr Klarheit über die Vorgänge gewonnen und, vor allem, eine »Sprachregelung« gefunden hatte, wie dergleichen in den Zirkeln der Macht hieß.
Kirchner kannte die Sorte Mensch gut, die gerade an ihm vorbeigeschlichen war. Sie würden nicht reden, es sei denn aus Dummheit oder wenn sie heillos betrunken wären. Gewiss würde er ihnen bei dieser Recherche wiederbegegnen, dann würde man sehen.
Kirchner dankte dem Empfangsportier, ließ den Zwanzig-Euro-Schein auf dem Tisch liegen, ging hinaus zu seinem Auto und machte sich zum Hafen auf.
Die kurze Fahrt führte aus herausgeputzten Straßen und Gassen in die räudige Welt der Gewerbegebiete, gewaltige Hypermarchés von Carrefour und Casino, Bau- und Getränkemärkte siedelten am Stadtrand, unweit davon erreichte Kirchner bald die Hafenanlagen. Um diese Stunde, am späten Nachmittag, war die Arbeit hier getan, die Fischerboote lagen vertäut in langer Reihe an specksteinernen Molen. In den Hallen der Fischverarbeiter räumten dunkelhäutige Hilfsarbeiter auf und spritzten die gekachelte Welt mit scharfem Strahl aus dicken Schläuchen sauber.
Kirchner parkte vor den Büros von Arcamer, die in einem gesichtslosen Würfel aus Waschbetonplatten direkt im Hafen lagen. Er sah kleine Spuren der Verwüstung vom Mittag, zerbrochenes Glas, Austernschalen. Verrostetes Material lag in großen Stapeln herum, abgeschabte Styroporbojen, Netze in mannshohen Haufen, heillos verworren mit Tauen, Kordeln und grellroten Schwimmern.
Die Welt der Häfen hatte Kirchner schon als Kind fasziniert. Irgendwie wartete er immer darauf, eines Tages einem echten Kapitän Ahab zu begegnen, mit einem Bein aus Walfischknochen und einer tiefen Narbe im »scharf tigergelben« Gesicht, genau wie es in Moby Dick stand, einem der wichtigen Bücher seines Lebens.
Während er an der Mole entlangspazierte, die Hände in den Hosentaschen, sog er genießerisch die mineralischen Brisen vom Meer, vom Fisch ein, und von ferne hätte man ihn für einen Urlauber halten können.
Die Ebbe war da, die Bucht draußen lag glatt wie ein Teich unter dem Saum der Landbrücke, die am Cap Ferret vorne abbrach. Im Hafen dümpelten die Boote jetzt drei Meter tief unter dem Rand der Kaimauern. Auf den Decks der Kutter lag aufgeräumt das tonnenschwere Fanggeschirr, zu beiden Seiten je eine Baumkurre, zehn, zwölf Meter lange Stahlröhren, an denen die aufgespannten Netze während der Fischzüge über Grund geschleppt wurden.
Dem Normannen Kirchner waren die Namen und Gerätschaften geläufig, er hatte als Kind viele Stunden im Hafen von Grandcamp verbracht. Er wusste, dass die Fischer schwere Ketten an ihr Schleppgeschirr montierten, die den Meerboden regelrecht durchpflügten und die Schollen und Seezungen »aufweckten«, wie das in der Sprache der Küstenfischer hieß.
An Bord der Elise, einem alten, rostigen Kutter, werkelten noch ein alter und ein junger Mann an ihren Netzen, dem Augenschein nach Großvater und Enkel.
Kirchner rief ihnen ein »Bonjour« hinunter.
Die Männer blickten argwöhnisch auf.
»Wie läuft’s?«, fragte Kirchner und kam sich im selben Moment plump und ein wenig lächerlich vor.
»Wer will das wissen?«, brummte der alte Mann und widmete sich wieder seinem Netz, ohne ihn weiter anzuschauen.
»Ich arbeite für Le Monde«, sagte Kirchner. »Ich habe die Demonstration der Austernzüchter heute gesehen und wollte mich umhören, wie in Arcachon die Stimmung ist.«
»Die Stimmung ist hervorragend«, sagte der alte Mann bitter, »die Quoten sind abgefischt, wir verdienen bis zum Frühjahr keinen Centime mehr, die Dieselpreise steigen, und die Austern sind giftig. Und jetzt fahr wieder nach Hause nach Paris, Monsieur Le Monde.«
Kirchner kannte diese Reaktion, sie begegnete ihm, wann immer er in der französischen Provinz arbeitete. Er hatte Glück, wenn die Landsleute, die er traf, mit dem Namen Le Monde nicht viel anfangen konnten – und das geschah viel häufiger, als es die Kollegen in der Pariser Zentrale ahnten. Er hatte noch mehr Glück, wenn er auf einen Leser traf, der sich fern von Paris durch Lektüre der besten Zeitung des Landes auf dem Laufenden hielt und nun eine Chance witterte, selbst in die Zeitung zu kommen, am besten mit Bild. Er hatte Pech, wenn ein Fischer, wie dieser hier, den Namen Le Monde sehr wohl kannte, ihn aber feindselig mit dem fernen Pariser Politikbetrieb in einen Topf warf.
»Ich komme aus der Normandie«, sagte Kirchner. Das war seine Standardantwort auf Anfeindungen, die nicht ihn, sondern Paris meinten.
»Na und?«, fragte der Fischer. »Ich komme eigentlich aus der Picardie.«
»Können wir nicht vernünftig und in Ruhe reden?«
»Ich wüsste nicht, worüber«, entgegnete der Alte.
»Na ja, darüber zum Beispiel, wie schlecht es der Fischerei hier geht, so wie du es gerade gesagt hast.« Er wechselte wie der Fischer zum Du, um ihn nicht durch weiteres Siezen auf Abstand zu halten. »Es täte meiner Pariser Zeitung und erst recht ihren Pariser Lesern sicher gut, ein wenig mehr darüber zu erfahren.«
Der Alte ließ diese Worte ein wenig nachwirken, dann schaute er zu Kirchner auf, diesmal mit einem offeneren Gesicht. »Du bist wohl ein ganz schlauer Normanne, wie?« Dann lud er Kirchner mit einer Handbewegung ein, aufs Boot herunterzusteigen, drückte ihm zur Begrüßung an Deck ein Schnapsglas in die Hand, goss es mit gelblichem Chartreuselikör voll und sagte: »Santé.«
In der folgenden Stunde, mit dem alten und dem jungen Fischer über feine Netze gebeugt, erfuhr Kirchner mehr über das alltägliche Leben am Becken von Arcachon.
Die beiden Männer – tatsächlich Großvater und Enkel – fingen nach zwei Gläsern Chartreuse zu reden an. Sie erzählten davon, dass »die Politik«, wie sie es nannten, die Fischerei und die Austernzucht im Becken am liebsten »plattmachen« würde, um freie Hand zu haben für den Tourismus.
»Der Hafen stört, verstehst du?«, sagte der junge Mann. »Häfen sind laut und dreckig, sie passen nicht zu den weißen Jachten da draußen. Und ein schickes Hotel bringt viel mehr Steuern.«
Kirchner hörte, dass die Nachfrage nach Liegeplätzen für Jachten in der Bucht das Angebot weit überstieg, sodass die Wartezeit auf einen Ankerplatz in und um Arcachon bei acht Jahren lag.
Die Fischer erzählten, dass die Austernzüchter große Teile des Küstensaums um das Becken belegten – alles potenzielle Strände – und dass die Kommunen damit begonnen hatten, Lizenzen für die Austernzucht zu entziehen oder nicht mehr zu erneuern. Im ganzen Rund des Beckens stiegen die Immobilienpreise in schwindelerregende Höhen.
»In Le Canon drüben ist neulich eine von den alten Fischerhütten direkt am Wasser verkauft worden«, sagte der Alte. »Ein Rechtsanwalt aus Bordeaux hat sie seiner Frau zur Silberhochzeit geschenkt. Und jetzt rate mal, Monsieur Le Monde, was ihm das wert war. Na? Eins Komma drei Millionen Euro hat der Mann bezahlt! Eins Komma drei Millionen! Für eine Fischerhütte! Das muss Liebe sein!«
Kirchner lachte, genau wie die beiden Fischer. Der gelbliche Likör war ihnen zu Kopf gestiegen, für einen Moment verflog die Schwere des Lebens und entlud sich in diesem Lachen über eigentlich triste Geschichten.
Als es Zeit war, Abschied zu nehmen, verabredete Kirchner sich mit dem Alten und seinem Enkel für den nächsten Morgen.
Obwohl die Quoten abgefischt waren und die Fischer von Arcachon eigentlich nichts mehr fangen durften, fuhren sie weiter zu Beutezügen aus, europäische Regeln hin oder her. An Land fanden sich stets Händler und Fischverarbeiter, die die illegale Ware abnahmen. Im Grunde war ein großer Schwarzmarkt in Gang, den die Behörden, bestochen oder nicht, einfach ignorierten, dem sozialen Frieden zuliebe.
Die Elise würde jedenfalls am nächsten Morgen um vier Uhr ablegen, mit der Flut, um im nächtlichen Meer die Netze auszuwerfen, nach Makrelen, Sardinen, den billigen kleinen Fischen.
»Wird nicht viel werden«, sagte der Alte, »aber du hast schon verstanden, dass du nur an Bord darfst, wenn du keine Zeile über unseren Fischzug schreibst?«
»Hab ich verstanden«, antwortete Kirchner. »Wir sehen uns morgen um vier.«
Er ging zum Landrover zurück und rief die Fotoredaktion an.
»Ich wollte nur mal durchgeben, dass ich hier in Arcachon unterwegs bin«, sagte er zu Didier Chapon, dem Chef der Abteilung, »ich weiß nicht, ob ihr im Bilde seid.«
»Was denkst du?«, antwortete Chapon, ein dicker Zigarrenraucher, der sich mit allen Pariser Spitzenköchen duzte. »Henri redet auf den Konferenzen von nichts anderem mehr.«
»Umso besser. Ich rufe auch nur an, um dich zu bitten, jetzt noch niemanden loszuschicken. Das ist eine heikle Kiste hier, und wenn jetzt noch einer von uns nach Ministerleichen im Meer fragt, dann kommen wir zu nichts.«
»Ist schon klar«, sagte Chapon schmatzend. »Aber sag mal, Antoine, jetzt mal zu den wesentlichen Fragen: Hast du die Menüfolge für dein Herbstfest schon im Kopf? Ich träume noch immer von den gebackenen Muscheln, die du letztes Mal aufgetischt hast.«
Kirchner lachte geschmeichelt. »Das wird natürlich eine Überraschung, Didier. Sind ja auch nur noch drei Wochen hin.«
»Ich kann’s kaum erwarten. Also, du meldest dich, wenn ich hier einen Kollegen aufs Pferd setzen soll. Bis dann.«
Kirchner legte auf und fuhr an der Küste östlich des Hafens entlang, durch Gujan-Mestras.
Das Dorf hatte keine erkennbare Form, es war ein großer Haufen Hütten und Schuppen, die sich auf endloser Fläche vorne am Wasser ballten. Abseits der Hauptstraße, wo ein paar hübschere, neuere Gebäude und das alte Rathaus standen, löste sich die Landschaft in Kanäle und Teiche auf. Das Gelände franste sumpfig ins Becken aus, die Wege waren gesäumt von verwitterten Bauten, von denen kaum zu sagen war, ob sie noch genutzt wurden oder schon seit Langem verrotteten. Wilde, dornige Büsche wucherten überall. Spezialgerät der Austernzüchter stand in offenen Verschlägen oder war als Schrott in die Fläche gestreut. In ihrer langen Geschichte hier hatten die Austernzucht und die Fischerei das Land offenkundig in eine Art maritimes Gewerbegebiet verwandelt, mit räudigen Brachen dazwischen, und die ganze Fahrt über war kein Mensch zu sehen.
Kirchner schaltete das Autoradio ein, France Inter. Es lief eine Talkshow, in der sich Experten über die Rentenreform stritten. Einer zitierte ein Interview des Finanzministers, als wäre nichts geschehen. Auch in den Nachrichten zur vollen Stunde, ein paar Minuten später, fiel kein Wort über ihn und sein Schicksal. Das war gut. Paris schlief noch. Paris hatte noch keine Ahnung von den sensationellen Neuigkeiten, denen Kirchner hier unten auf der Spur war, und er hoffte, dass das noch möglichst lange so bleiben möge.
***
Für den Abend hatte er sich schon während der Fahrt aus der Normandie einen Tisch im Chez Janine reserviert, dem einzigen Restaurant Arcachons mit einem Michelin-Stern. Das Lokal lag direkt am Wasser, kurz vor der Düne von Pilat. Es befand sich in einem stattlichen weißen Holzhaus, dessen einziges Zimmer auf der Beletage ein heller, gediegener Speisesaal war, der sich auf eine Veranda mit blutroten Markisen öffnete.
Die Reservierung erwies sich als überflüssig, denn als Kirchner gegen acht Uhr ankam, waren nur wenige Tische besetzt. Auf der Veranda draußen saß eine Gruppe lokaler Honoratioren, und Kirchner ließ sich einen Tisch unweit des ihren geben. Er belauschte gern fröhliche Männerrunden.
Er ließ den Aperitif aus, bestellte eine Flasche Wasser und studierte die Karte. Schon an der Beschreibung des Menüs konnte Kirchner erkennen, ob der Koch es ernst meinte mit seinem Beruf oder nur ein Blender war. Dieser hier schien sein Handwerk zu verstehen. Er verlor nicht viele, aber die richtigen Worte, arbeitete streng saisonal, hatte dabei einen Schlag ins Südliche, kochte viel mit Tomaten, mit Thymian und Zitronen. Kirchner lief das Wasser im Mund zusammen.
Unter den Entrees reizten ihn sowohl ein Rebhuhn mit Datteln als auch ein Samtsüppchen gemacht aus Topinambur. Als Hauptgang würde er die Lotte en cocotte nehmen, ein herbstliches Fischragout mit Steinpilzen, dazu eine halbe Flasche Chateau Léoville, Saint-Julien, Rotwein, der Pilze wegen, und weil er Lust auf einen guten Roten hatte.
Kirchner bestellte. Suppe und Fisch.
Er schaute aufs Meer hinaus, tat wie ein zufälliger Gast auf Durchreise und horchte den Gesprächen ringsum zu, so gut es ging.
»Decayeux, du musst das jetzt regeln«, hörte Kirchner einen Mann mit öliger Stimme vom Tisch der Lokalgrößen sagen.
»So kann es jedenfalls nicht weitergehen«, sagte eine andere, hellere Stimme.
»Der Radau muss aufhören«, sagte eine dritte. »Am Ende haben wir die Pariser Journaille hier am Hals.«
»Das mit Le Canon hätte nicht passieren dürfen, das war zu viel.«
Die Männer schienen über dieselben Dinge zu reden wie die Fischer von der Elise, nur aus anderer Perspektive. Mit »dem Radau« konnte eigentlich nur die Demonstration vom Mittag gemeint sein, mit »Le Canon« vielleicht der überteuerte Hauskauf, von dem die Fischer erzählt hatten. Kirchner würde herausfinden, wer Decayeux war.
»Wenn Lacombe eingelenkt hätte, wäre er noch am Leben und könnte sich weiter mit seiner kleinen Friseurin vergnügen. Was hat ihn denn eigentlich geritten? Er hat doch sonst auch immer nur mit seinem Schwanz gedacht …«
Lacombe. Klar und deutlich war der Name des Finanzministers gefallen. Kirchner zwang sich, den Kopf nicht zu wenden und seine innere Aufregung zu verbergen. Er riss sich ein Stück Baguette ab, als wäre nichts, kaute und spülte mit einem großen Schluck Wein nach.
Decayeux, Lacombe, Friseurin, wiederholte er in Gedanken.
Diese Männer waren im Bilde, der Tod des Ministers war ihnen geläufig, ein innerer Zirkel hier wusste über alles Bescheid. Er warf unauffällige Blicke zu ihrem Tisch hin, um sich das halbe Dutzend Gesichter nach und nach einzuprägen. Es war die übliche Versammlung hellhäutiger, teigiger Männer, wie sie Frankreichs Beamtenstand zuverlässig seit ewigen Zeiten hervorbringt, gut genährte Typen, gut gekleidet, gut frisiert noch im hintersten Dorf des Landes.
Die Herrenrunde wandte sich jetzt anderen Themen zu, sodass sich Kirchner seinem Menü widmen konnte. Es gelang ihm aber nicht recht, sich auf das schöne Essen zu konzentrieren, das Gehörte ging ihm nach, sein Hirn arbeitete auf Hochtouren. Er musste sich, weil er die Zusammenhänge noch nicht kannte, im Grunde jeden gesagten Halbsatz möglichst wörtlich einprägen. Ein Detail, das jetzt noch keinen Sinn hatte, konnte später zum entscheidenden Puzzlestück werden, eine Information, die jetzt völlig nebensächlich erschien, konnte später wesentlich für das Verständnis werden.
Und vielleicht kämen die Herren ja noch einmal auf das Thema zurück?
Kirchner aß, er trank den Bordeaux, der ihn ein wenig enttäuschte. Er schaute aufs Meer, dessen Grenzen jetzt, schwarz in schwarz, nicht mehr anzugeben waren. Nur ab und an war die Gischt der kleinen Brandung als kleiner heller Streifen in der Dunkelheit zu sehen und markierte den Rand des Strandes.
Vom Nebentisch fing Kirchner noch einzelne Sätze auf, die ihn hoffen ließen, es würde nun gleich wieder um seinen Fall, um den Finanzminister, gehen, aber dem war nicht so. Die Männerrunde löste sich bald auf, man bezahlte, es wurden Stühle gerückt, die Herren zogen sich nach dem Aufstehen die Hosen wieder zurecht. Nachdem sie das Lokal verlassen hatten, war ringsum bald das Geräusch anspringender Automotoren zu hören. Auch Kirchner bestellte die Rechnung.
Viel Arbeit wartete auf ihn, er musste ins Bett, um vier Uhr früh schon würde die Elise auslaufen. An einem kleinen Stehpult am Ausgang des Restaurants stieß er auf den Koch, einen kurzen, stämmigen Mann, dem die Brustbehaarung aus dem Kragen einer schwarzen Kochjacke quoll. Er stand über das Reservierungsbuch gebeugt und summte vor sich hin.
Kirchner schüttelte ihm die Hand, bedankte sich für das Essen und sagte: »Das Fischragout, sagen Sie, täusche ich mich, oder habe ich da eine Spur Koriander geschmeckt?«
IV.
Um Punkt vier Uhr früh stand Kirchner geduscht, rasiert und in seinen grünen Gummistiefeln am nächtlichen Kai von Arcachon. Er sah ein wenig aus wie verkleidet. Die Elise war klar zum Ablegen.
Fünf Minuten nach vier Uhr wusste Kirchner bereits, dass Decayeux der Vorsitzende des Austernzüchter-Verbands war, zuständig für alle Züchter im Becken und selbst Inhaber eines der größten Betriebe. Der alte Fischer und sein Enkel hatten die Augenbrauen hochgezogen, als sein Name fiel.
Jetzt hatten sie mit dem Manövrieren und ihren Arbeitsvorbereitungen zu tun.
Kirchner stand auf der kleinen Brücke des Kutters und schaute hinaus auf das schwarze Wasser, in dem sich erst flirrend die spärlichen Lichter der Küste spiegelten, dann das graue, flächige Licht eines fast vollen Mondes in sternklarer Nacht. Die Elise nahm Kurs auf Cap Ferret, um dahinter bald das offene Meer zu erreichen.
Das kleine Boot schaukelte durchs ruhige Wasser, die Dieselmaschinen lärmten. Möwen flogen kreischend um die Takelage, sie würden dem Boot in der Hoffnung auf Beifang folgen wie eine aufgeregt flatternde Fahne. Im trüben Mondlicht sah das Becken aus wie eine unwirkliche Kunstinstallation. Lange Stangen, die die Lage der Austerntische unter Wasser markierten, ragten überall aus der See, die Fahrt ging vorbei an den hundertjährigen Cabanes tchanquées, hölzernen Pfahlbauten, die in Frankreich jedes Kind als Wahrzeichen des Beckens von Arcachon kannte.
Kirchner hätte Lust gehabt, eine Zigarette zu rauchen. Seit einem halben Jahr hatte er wieder aufgehört, eigentlich in der Gewissheit, auch wieder damit anzufangen, aber jetzt war doch nicht der Moment dazu.
Der Alte stand links neben ihm und navigierte, der Junge saß draußen und rauchte. Nach kurzer Fahrt war der Kahn aus dem Beckenmund ausgefahren und hatte seinen Bug ins offene Meer hineingedreht, das kleine Schiff wurde von unruhigem Seegang erfasst, über die Reling spritzte jetzt manchmal Wasser an Deck.
Kirchner pendelte seinen schweren Körper gegen die wellenförmigen Bewegungen des Kutters aus, er stemmte die linke Schulter gegen eine Seitenscheibe des Führerhauses. Er war kein geübter Seemann, aber er wusste, wie man sich als Passagier auf kleinen Booten zu verhalten hatte.
Schon als Kind war er mit seinem Vater zum Fischen in den Ärmelkanal gefahren, er hatte mit Freunden oft Makrelen und Stinte geangelt im Meer vor Grandcamp. Es waren Erfahrungen, die ihm auch später halfen, große Seekrankheiten auszuhalten, die sich im Grunde immer anfühlten wie ein kleiner Kreislaufkollaps.
Er hatte derer schon viele überstanden, auf stürmischen Fahrten vor der spanischen Atlantikküste, als er über die große Ölpest von 1987 berichtet hatte. Er hatte mit Muscheltauchern den Indischen Ozean vor Aceh befahren, nach dem Tsunami. Mit deutschen Krabbenfischern war er auf der Nordsee unterwegs gewesen, und mit norwegischen Dorschjägern hatte er einmal zwei volle Wochen im nordischen Eismeer verbracht, an Bord eines Fabrikschiffes, das seine Beute noch auf hoher See in fertig verpackte Fischstäbchen verwandelte. Kirchner hatte großen Respekt vor der See und vor den Männern, die es täglich mit ihr aufnahmen.
Rechts von ihm brüllten in Kopfhöhe alte Chansons aus einem Radio, die die Schönheit der Pariser Mädchen besangen, von irgendwoher kamen die krächzenden Geräusche des nächtlichen Funkverkehrs der Fischer, die sich und ihre Boote selbst in der Nacht und auf kilometerweite Entfernungen allein an der Stellung ihrer Bordlichter sicher erkannten. Sie nahmen Kontakt zueinander auf, wann immer sie sich begegneten, riefen sich über Funk anzügliche Witze zu oder tauschten Neuigkeiten aus über Fußball und Fanggründe, über Wetterwechsel und Blondinen.
Dass diese Männer von einer Leiche da draußen im Meer nichts gehört haben, ist ausgeschlossen, dachte Kirchner.
Nach einer guten Dreiviertelstunde Fahrt holte er deshalb knapp Luft und fragte den Alten neben sich: »Und was ist nun mit der Leiche, die ihr vorgestern aus dem Meer gefischt habt?«
Der Alte sah ihn kurz an, schaute dann lange geradeaus und fing an, schwerfällig zu nicken, wie es Leute tun, die ihre eigenen Gedanken kommentieren. »Hab ich mir schon gedacht, Monsieur Le Monde, dass dich das interessiert.«
»Und? Wie geht die Geschichte?«
Der Alte schien mit sich selbst im Streit zu liegen.