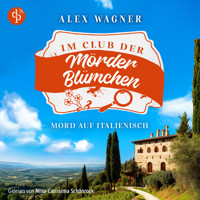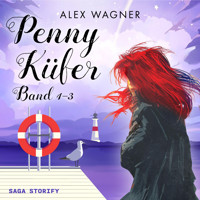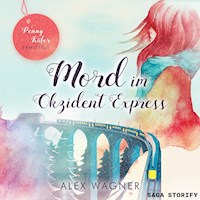9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Wie begeht man den perfekten Mord? Clara Annerson braucht dringend Inspiration für ihren neuen Roman. Deswegen greift sie sofort zu, als sie die Einladung bekommt, ein paar Tage auf einem Landschloss in der Nähe von Wien zu verbringen - schließlich lässt es sich wohl kaum stimmungsvoller morden als inmitten von Kunstschätzen. Dumm nur, dass einer der anwesenden Gäste das offenbar genauso sieht wie Clara: Kaum angekommen, stolpert die Autorin über eine Leiche in der Bibliothek ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 397
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressum123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445PersonenverzeichnisÜber dieses Buch
Wie begeht man den perfekten Mord? Clara Annerson braucht dringend Inspiration für ihren neuen Roman. Deswegen greift sie sofort zu, als sie die Einladung bekommt, ein paar Tage auf einem Landschloss in der Nähe von Wien zu verbringen - schließlich lässt es sich wohl kaum stimmungsvoller morden als inmitten von Kunstschätzen. Dumm nur, dass einer der anwesenden Gäste das offenbar genauso sieht wie Clara: Kaum angekommen, stolpert die Autorin über eine Leiche in der Bibliothek ...
Über die Autorin
Alex Wagner, geb. 1972, lebt in Wien. Ursprünglich Betriebswirtin, experimentierte sie sich durch die Jobwelt – von Private Banking und Versicherungsvertrieb über Coaching und Hypnose bis zu Weltretten bei Greenpeace. Derzeit schreibt sie an der Fortsetzung von »Die edle Kunst des Mordens«.
ALEX WAGNER
Die edle Kunst des Mordens
CLARA ANDRSONERMITTELT
Kriminalroman
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Dieser Titel wurde vermittelt durch die Berliner Literaturagentur Wortunion
Copyright © 2018 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Stefanie Kruschandl, Hamburg
Umschlaggestaltung: U1berlin/Patrizia Di Stefano
Titelillustration: © Luciano Lozano/getty-images; © Beastfromeast/getty-images
eBook-Erstellung: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7325-5577-2
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
1
An jenem Abend, an dem alles – wie ich damals dachte – seinen Anfang nahm, war ich nur aus einem einzigen Grund ins Museum gekommen: Ich musste ihn endlich finden, den perfekten Schauplatz für meinen Mord.
Die Sache duldete keinen weiteren Aufschub.
Wie ahnungslos ich damals doch war, was Anfänge und Morde anbelangte.
Stundenlang war ich bereits durch die Gemäldegalerien geirrt. Jetzt ließ ich mich treiben, war schon kurz davor aufzugeben. Ich wanderte von der Ägyptisch-Orientalischen Sammlung in die Antikensammlung, den Mumiengeruch noch in der Nase … und kam abrupt zum Stehen.
Vor mir erstreckte sich ein Wald aus Marmorsäulen, düster, bedrohlich, geheimnisvoll. Dazwischen Götterstatuen, die im Licht der Deckenstrahler beinahe lebendig wirkten. Und im Zentrum des Ganzen ein jahrtausendealtes Bodenmosaik, auf dem Theseus gerade den Minotaurus erschlug, die schauderhafte Bestie, halb Stier, halb Mensch.
Das war es endlich. Genau das, wonach ich gesucht hat-te.
Hier musste die Leiche gefunden werden, ihr lebloser Körper inmitten der Windungen des Labyrinths, das dem Untier als Heimstatt diente. Am besten nackt, passend zur Antike, ihr Blut ein helles Leuchten auf den dunklen Steinen.
Vorsichtig blickte ich mich um, spähte über meine Schulter hinauf zur Kuppeldecke des Saals. Und da waren sie.
Natürlich.
Diese grässlichen Überwachungskameras, die immer alles verdarben.
Wo man auch hinging, starrten sie auf einen herunter, an jeden halbwegs stimmungsvollen Ort verfolgten sie einen, mit ihren stumm glotzenden Fischaugen. In der Neuzeit konnte man wirklich nur noch an belanglosen Orten morden.
Ich aber hatte mir in den Kopf gesetzt, es genau hier geschehen zu lassen, in Wien, wo viel zu wenig klassische Krimis angesiedelt waren, mitten in der Antikensammlung des Kunsthistorischen Museums, wo meines Wissens nach überhaupt noch nie gemordet worden war.
Und so schnell gab ich mich nicht geschlagen. Ich würde einen Weg finden, Überwachungskameras hin oder her. Die Dinger hatten ihre toten Winkel, und man konnte sie bestimmt irgendwie überlisten. Mir würde schon etwas einfallen. Es gibt keine Probleme, nur Herausforderungen.
Mein Herz schlug schneller, und ein angenehmes Kribbeln wanderte meinen Nacken hinauf. Oh süße Euphorie! Es fühlte sich gut an, wieder bei der Arbeit zu sein.
Aber ein Mord im Museum? Eine echte Herausforderung. Gut, es war machbar, der Da-Vinci-Killer im Louvre hatte das vor einigen Jahren eindrucksvoll bewiesen. Und das Kunsthistorische Museum war nicht der Louvre. Zumindest, was die Sicherheit betraf. In Wien lief immer noch alles … ein wenig gemütlicher ab als im Rest der westlichen Welt. Nur Überwachungskameras gab es hier natürlich auch.
In diesem Augenblick bog eine ältere Dame um die Ecke, in der braunen Uniform der Saalaufsicht. Ihre Aufgabe bestand nur darin, lästige Kinder vom Begrapschen der Ausstellungsstücke abzuhalten. Mit einem Killer konnte sie es vermutlich nicht aufnehmen. Aber mit einkalkulieren musste ich sie trotzdem bei meinen Mordplänen. Der Mord musste hier im Museum geschehen, und weder Kameras noch Saalaufsichten würden mich davon abhalten! Mein erster Mord sollte perfekt werden.
Ich ließ mich auf einer der samtbezogenen Bänke nieder, die die Museumsverwaltung für erschöpfte Besucher aufgestellt hatte, und kramte mein Notizbuch hervor. Theseus-Mosaik notierte ich. Viel Blut. Farbkontrast zum Boden. Dolch? Eine antike Waffe aus einer der Vitrinen ein paar Säle weiter wäre wunderbar. Aber die Vitrinen waren bestimmt alarmgesichert. Auch das noch.
Eindringliche Worte vom hinteren Ende des Saals rissen mich aus meinen Gedanken. »Man muss doch die Münze sehen können, meine Liebe, vergessen Sie das bitte nicht!«
Es war eine Männerstimme. Eine von jener Sorte, der man andächtig lauschen würde, selbst wenn sie einem das Telefonbuch vorlas. Eine Stimme, bei der man unmöglich an Mord denken konnte.
Ich sah mich um. Ein Mann im dunklen Abendanzug war es, der gesprochen hatte, groß und sehr schlank, mit einem Gesicht, das der Stimme in nichts nachstand. Langes dunkelbraunes Haar fiel ihm in die Stirn, und er lächelte der Frau, die er angesprochen hatte, aufmunternd zu.
Sie lehnte an einem Schaukasten und wirkte angespannt, nervös. Sie war noch sehr jung, vielleicht Anfang zwanzig. Der Mann war alt genug, um ihr Vater zu sein, obwohl es mir schwerfiel, sein Alter genau zu schätzen. Vermutlich etwas älter als ich, so Mitte vierzig.
Das Mädchen hielt jetzt die Münze hoch, die der Mann angesprochen hatte, ein auf Hochglanz poliertes Goldstück, drehte es rastlos zwischen den Fingern und blickte sich dabei nach allen Seiten um. Es wirkte fast, als würde sie sich verfolgt fühlen. Mit der anderen Hand strich sie ihr Kleid zurecht. Ein eher spärliches Teil, eine Art Tunika mit einer dunkelroten Kordel als Gürtel. Ziemlich durchsichtig. Es war zwar Anfang Juli, aber dieser Aufzug hätte dann doch eher an den Strand gepasst als in ein Museum.
Der Mann nickte anerkennend, auch er sah sich um, dann sagte er zu dem Mädchen: »Sie schaffen das schon, keine Angst!« Seine Stimme war warm und eindringlich. Selbst mir, die ich am anderen Ende des Saals stand, ging sie bis ins Mark. Diesem Mann würde man nicht so einfach widersprechen. Man wollte es gar nicht. Viel eher wollte man ihm stundenlang lauschen, ihn einfach nur ansehen, ihn … verdammt, was fantasierte ich da!
Und was ging hier vor? Was führte dieses ungleiche Duo im Schilde? Sie würden doch nicht … waren sie Konkurrenz? Nein, unmöglich. Meine Idee mit dem Museumsmord war einzigartig! Na gut, zumindest was Österreich anbelangte. Sicherlich heckten diese beiden etwas anderes aus. So, wie sie sich ständig umblickten, aber bestimmt nichts Koscheres.
Der Mann setzte sich in Bewegung, ging auf den Saalausgang zu. Seine Schritte waren die eines Menschen, der in vertrautem Territorium unterwegs war. Bevor er in den nächsten Saal verschwand, hielt er im Durchgang kurz an und lugte um die Ecke. Als suche er jemanden? Oder, ganz im Gegenteil, als wolle er nicht gesehen werden? Dann hörte ich nur noch seine Schritte über den Steinboden hallen.
Ich blickte zu der jungen Frau zurück, die noch immer am Schaukasten lehnte und nervös mit der Münze spielte. Dabei betrachtete sie den Inhalt der Vitrine, als stünde sie vor der Auslage eines Juweliers. Und mit einem Mal war mir völlig klar, worum es hier ging. Gehen musste. Nicht um einen Mord, sondern um etwas viel Naheliegenderes: Das Kunsthistorische Museum war eine Schatzkammer! Es beherbergte Kleinode aus vier Jahrtausenden, die am internationalen Schwarzmarkt ein Vermögen wert waren. Der Mann mit der Samtstimme und seine leicht bekleidete Partnerin planten einen Kunstraub! Auch wenn ich nicht ganz verstand, welche Rolle die Münze in ihrer Hand dabei spielte. Bestimmt irgendein perfides Ablenkungsmanöver.
Mein Mord auf dem Mosaik konnte warten. Ich musste der Sache nachgehen! Kriminelle Machenschaften waren schließlich mein neues Spezialgebiet.
Hätte ich zu diesem Zeitpunkt auch nur die geringste Ahnung gehabt, welche Kette von Ereignissen ich in Gang setzte, als ich mich entschloss, dem Mann zu folgen … welche Auswirkungen es haben würde … nun, vermutlich wäre ich ihm trotzdem gefolgt. Neugier war schon immer mein größtes Laster gewesen.
Ich durchquerte den Saal, wie es der Mann getan hatte. Im nächsten Raum traf ich auf Vitrinen voller Vasen, alle in der gleichen Farbkombination aus Schwarz und Terracotta, verziert mit Helden, Ungeheuern und geraubten Frauen. Aber keine Spur von dem Fremden.
Zwei Türen führten aus diesem Saal. Welche hatte er genommen? Ich entschied mich für die linke, lief weiter, in die ägyptische Sammlung zurück – wo ich mit der Saalaufsicht zusammenstieß. Wieder eine ältere Dame, nicht die gleiche wie vorhin, schlanker, mit blond gefärbten Haaren. »Der Mann«, stammelte ich, »wo ist er hin?«
Sie muss dich für eine Verrückte halten, schoss es mir durch den Kopf, aber die Frau grinste nur. »Das müssen Sie schon selber rausfinden, meine Liebe. Es ist gegen die Regeln, dass ich Ihnen helfe.« Sie lächelte kryptisch. Dann wandte sie sich ab und nahm ihre Patrouille wieder auf.
Gegen die Regeln? Was sollte das bedeuten? Die wichtigste Regel in einem Museum musste es doch wohl sein, die Kunstschätze zu beschützen?! Konnte es sein … Steckte diese Frau womöglich in der Sache mit drin? War sie eine Komplizin? Saalaufsichten verdienten bestimmt nicht viel … sie zu kaufen würde nicht allzu teuer sein.
Ich lief los. Vorbei an Sarkophagen, Sphinxen, Göttern mit Löwen- und Vogelköpfen, einem mumifizierten Krokodil … durch Hauptsäle, durch Kabinette … Und dann, neben dem Grabmal eines Hohepriesters, fand ich ihn. Den Mann mit dem langen Haar. Egal wie viele Leute in den geplanten Raubzug verwickelt waren, so, wie er auftrat, war er bestimmt der Anführer.
Er beugte sich gerade über einen jungen Mann, der leger auf einer der Besucherbänke ruhte. Der Junge war bestenfalls fünfundzwanzig. Blondes, kurzes Haar, ein T-Shirt in grellbunten Farben, dazu das Gesicht eines griechischen Gelehrten, klug und klar geschnitten. Er nickte sehr ernsthaft zu den Worten des anderen, die ich zu meinem Ärger nicht verstehen konnte.
Der Anführer legte ihm jetzt die Hand auf die Schulter und flüsterte ihm etwas ins Ohr – auf eine fast zärtlich anmutende Art. Der Junge lächelte und nickte wieder.
Und dann sah ich die Adlerfeder. Der Junge hielt sie genauso in der Hand, wie das Mädchen die Münze gehalten hatte. Als wäre es eine kostbare Trophäe. Er allerdings wirkte kein bisschen nervös. Vermutlich war er schon länger dabei. Ein Profi.
Erst eine Münze, jetzt eine Adlerfeder. Was zum Teufel ging hier vor?
Plötzlich waren Schritte zu hören, aus dem Kabinett zu meiner Rechten. Schwere Schritte, von mehr als einer Person.
Der Junge mit der Adlerfeder blickte hoch, jetzt scheinbar doch ein wenig angespannt, und der Anführer verschwand mit der Eleganz einer Wildkatze hinter einer hundeköpfigen Götterstatue.
Zwei Männer waren es, die aus dem Kabinett in den Saal einbogen. Ein stämmiger, athletischer Typ, der an einen Gladiator erinnerte – nur dass an seinen Handgelenken Manschettenknöpfe aus Perlmutt schimmerten, anstelle von Lederbändern. Er hatte grobknochige Hände, muskulöse Arme und die Schultern eines Ringers.
Der andere Mann bestand vor allem aus Bauch, er war glatzköpfig und trug einen Smoking. Ziemlich overdressed für einen Museumsbesuch. Er redete auf den Gladiator-Typ ein. Was er sagte, konnte ich nicht verstehen, aber seine Stimme klang wie das Quieken eines Ferkels. Die schrillen Töne schmerzten in meinen Ohren, in denen noch die Samtstimme des Langhaarigen nachklang.
»Ha«, rief der Bauch, als er den Jungen mit der Adlerfeder erblickte. »Wir haben ihn, Lohenstein! Sehen Sie nur! Arcimboldos geliebter Assistent – das muss der Letzte sein!«
Lohenstein, der Gladiator-Typ, grinste breit. »Exzellente Arbeit, Bischoff. Sie alter Fuchs!«
Die beiden steuerten schnurstracks auf den Jungen mit der Adlerfeder zu. Mein Magen zog sich zusammen. Wer waren diese Männer? Weitere Bandenmitglieder? Wir haben ihn klang eher, als wollten sie dem Jungen Übles. Allerdings würden Profis doch wohl kaum mit einer derartigen Lautstärke und so offensichtlich auf den Jungen zupoltern. Oder war das gerade die Masche? Nicht heimlich und auf leisen Sohlen, sondern unter aller Augen, wie eine Elefantenherde?
Mich hatten sie zum Glück noch nicht bemerkt. Weder Lohenstein, der Gladiator-Typ, noch der Mann mit dem enormen Bauch, der augenscheinlich Bischoff hieß. Zumindest würdigten sie mich keines Blickes. Rasch sah ich mich um. Von der Saalaufsicht keine Spur. Wobei, wenn sie tatsächlich gekauft war, würde sie mir ohnedies nicht helfen.
Ich konnte mich nicht als Kunstkennerin bezeichnen, aber das brauchte ich auch nicht zu sein, um das Offensichtliche zu erkennen: Allein in diesem einen Raum lagerten Abermillionen Euro, in Form von einzigartigen Kultfiguren, Schmuckstücken und Ritualgegenständen. Alles mindestens dreitausend Jahre alt. Und in handlicher Größe, quasi zum Mitnehmen. Noch dazu lag der Raum unmittelbar neben der Freitreppe, die auf direktem Weg aus dem Museum führte. Ich musste diese Männer aufhalten!
Alarm auslösen! Das war es. Den Sicherheitsdienst des Museums auf den Plan rufen, der hoffentlich rechtzeitig hier sein würde. Ich zögerte nur den Bruchteil einer Sekunde, dann warf ich mich mit meinen stolzen zweiundsechzig Kilo gegen die Vitrine, der ich am nächsten stand, und … schrie laut auf vor Schmerz.
Die Vitrine gab ein sanftes Ächzen von sich, als ließe man sich in einen alten Schaukelstuhl fallen. Lohenstein, Bischoff und der Junge mit der Adlerfeder wandten abrupt die Köpfe. Das war alles. Keine Alarmsirene, die losheulte, keine Stahlgitter, die aus der Decke sausten und die Eingänge blockierten, kein mehrköpfiges Team schwer bewaffneter Sicherheitsleute, das mir – und den Schätzen des Museums – im Laufschritt zu Hilfe eilte.
Der Gladiator-Typ – der Mann namens Lohenstein – kam mit hochgezogenen Augenbrauen auf mich zu. Das Hemd spannte über seinen breiten Schultern. Jetzt blieb mir nur noch, Verwirrung zu stiften und auf ein Wunder zu hoffen. Vielleicht war ja wenigstens irgendwo ein stiller Alarm losgegangen, und ich musste nur etwas Zeit gewinnen. Ich sprintete auf den Jungen zu, der noch immer auf der Besucherbank saß, und riss ihm mit einer Handbewegung, die mich in ihrer Gewandtheit selbst überraschte, die Adlerfeder aus der Hand. Im nächsten Moment prallte ich gegen etwas Großes, Hartes. Es war der langhaarige Mann, der offenbar blitzschnell hinter seiner Götterstatue hervorgetreten war. Jetzt stand er zwischen mir und dem Ausgang. Den Laut, der mir entfuhr, will ich lieber nicht beschreiben.
Seine Arme schlossen sich um mich, er trat einen Schritt zurück, was uns davor bewahrte, übereinandergestapelt auf dem Marmorboden zu landen. Und was tat ich? Ich sog seinen Duft ein, der mich unwillkürlich an einen Sommerabend im Wald denken ließ.
Er trat einen weiteren Schritt zurück und blickte aus weit geöffneten Augen auf mich herab. Sie waren blassblau, diese Augen, kaum dunkler als ein Sommerhimmel, und saßen tief in den Augenhöhlen. Der Mann war nicht auf vordergründige Art schön, doch sein Gesicht … es hatte etwas an sich. Etwas Zeitloses, das die Jahre nicht zerstören konnten, da war ich mir sicher.
Sommerwald, Sommerhimmel, zeitlose Schönheit? Was war nur mit mir los? Nach allem, was ich wusste, war dieser Mann der Anführer einer Verbrecherbande, der ich nun auf Gedeih und Verderb ausgeliefert war.
»Frau Annerson?«, riss er mich aus meiner Verwirrung. »Clara Annerson?«
Er kannte meinen Namen!? Aber das war doch unmöglich?
Lohenstein, der Gladiator-Typ, eilte herbei.
»Eine Freundin von Ihnen, Arcimboldo?«, fragte er. »Gehört sie auch zum Spiel? Ich muss schon sagen, diesmal haben Sie sich selbst übertroffen! Einen Moment lang dachte ich … nun, ich dachte … na, ist ja egal, nichts für ungut. Jedenfalls eine spektakuläre Einlage.«
Ein Spiel? Hatte er das wirklich gerade gesagt? Hatte ich mich soeben komplett zum Narren gemacht? War ich so in die Suche nach meinem Mordschauplatz vertieft gewesen, dass ich Verbrechen sah, wo gar keine waren? Oder versuchte dieser Lohenstein bloß, seine kriminellen Machenschaften zu verschleiern?
Alles nur ein Spiel? Immerhin bedrohten diese Männer mich nicht, was aber auch daran liegen mochte, dass sie keine ernstzunehmende Gefahr in mir sahen. Ich schaffte es ja noch nicht einmal, eine Vitrine zu einem Alarmsignal zu bewegen.
Mir drehte sich der Kopf. Meine Schulter schmerzte von ihrer Bekanntschaft mit dem Panzerglas.
Der Mann mit den Sommerhimmel-Augen, der mich in seinen Armen aufgefangen hatte, musterte mich jetzt mit einem unverhohlenen Grinsen. Wie hatte Lohenstein ihn genannt? Arcimboldo? Was sollte das denn für ein Name sein? Wer war er? Und vor allem: Wie zum Teufel konnte er wissen, wer ich war?
Um das herauszufinden, musste ich wohl oder übel mitspielen. Man hielt mich für eine Freundin dieses Arcimboldo? Nun gut. Bevor er wusste, wie ihm geschah, hakte ich mich bei ihm unter. Rasch sagte ich: »Ja, wir sind alte Freunde … ähm, Arcimboldo und ich. Und wirklich ein tolles Spiel, nicht wahr? Überhaupt, diese Adlerfeder …« Ich hatte nicht die leiseste Ahnung, was ich da vor mich hin fabulierte, aber Lohenstein schien es zufriedenzustellen.
»Schön, schön«, sagte er. »Ist ja aufregend, unseren Arcimboldo mal in Damenbegleitung zu sehen. Sonst hängt ja immer nur sein geliebter Assistent an seinem Rockzipfel.« Bei diesen Worten grinste er anzüglich zu dem jungen Mann hinüber, der die Adlerfeder gehalten hatte. Der saß noch immer auf seiner Bank, als hätte sich gar nichts ereignet, und nahm die Bemerkung mit einem Schulterzucken hin.
Bischoff, der Kugelbauch im Smoking, der mittlerweile neben Lohenstein getreten war, quiekte amüsiert auf. Auf seiner Glatze glänzten Schweißperlen.
Arcimboldo selbst – wenn er denn tatsächlich so hieß – studierte mich aus dem Augenwinkel, aber er streifte meinen Arm nicht ab.
»Sie sehen aus wie Tizians Lukrezia«, sagte Lohenstein zu mir, »wirklich verblüffend, die Ähnlichkeit. Aber das hören Sie bestimmt oft.«
»Wie wer?«, fragte ich.
Er gab sich erstaunt. »Sagen Sie bloß! Lukrezia … eine berühmte Schönheit der Antike! Und ein Vorbild an weiblicher Tugend.« Er lachte, wobei sein ganzer muskulöser Körper in Bewegung kam. »Hängt drüben in der Gemäldegalerie. Sie haben genau ihre unschuldigen braunen Augen, denselben Spitzmund … Sogar ihr Haar! Exakt der gleiche Blondton. Bemerkenswert!« Er studierte mich eingehend. Allerdings schien er nicht an mir als Frau interessiert zu sein. Er wirkte eher wie ein Kunstkenner, der eine seltene Vase taxierte.
Dann erinnerte er sich offensichtlich an seine Manieren, streckte mir seine Hand entgegen und stellte sich vor: »Ich bin Christian Lohenstein. Und dies hier ist Emil Bischoff, das Oberhaupt unserer kleinen Vereinigung.« Er deutete auf den fettleibigen Mann neben sich.
»Welcher Vereinigung?«, fragte ich, bevor ich darüber nachgedacht hatte, ob das eine gute Idee war.
»Haben Sie ihr das nicht erzählt, Lamarck?«, wandte sich Lohenstein an den Mann, den er eben noch Arcimboldo genannt hatte. War das nun dessen richtiger Name?
Lohenstein wartete keine Antwort ab, sondern klärte mich selbst auf: »Der Rudolfsbund. Ein eher loser Zusammenschluss kunstfreudiger Menschen und leidenschaftlicher Sammler, gegründet von Emil Bischoff.« Er blickte den bauchigen Glatzkopf an, der sich gerade mit einem Taschentuch die Stirn trocknete. »Leidenschaftlicher bis fanatischer Sammler, sollte ich besser sagen.«
Bevor ich fragen konnte, wer dieser Rudolf war, der dem Bund seinen Namen gab, kam mir Arcimboldo oder Lamarck, wie immer er nun hieß, zuvor. Fast als könne er meine Gedanken lesen.
»Rudolfsbund wegen Rudolf II.«, sagte er. »Der legendäre Sammler, Kunstmäzen und Okkultist. Diesem Habsburg-Kaiser verdankt auch das Museum hier erhebliche Teile der Sammlung.«
Erst vor wenigen Stunden war mir eine Bronzebüste des besagten Kaisers in der Kunstkammer aufgefallen. Die schwülstige Unterlippe und das hängende Kinn, das viele der Habsburger entstellte. Eine Folge der Inzucht, munkelte man. Als Herrscher hatte sich Rudolf II., soweit ich wusste, auch nicht mit Ruhm bekleckert, sein Hof jedoch war legendär. Ein Schmelztiegel der Nationen, tolerant in Religionsfragen und im sechzehnten Jahrhundert das Zentrum von Kunst und Wissenschaft in Europa. Von esoterischeren Disziplinen gar nicht zu reden.
Ich nickte langsam. Also keine Kunstdiebe, sondern Kunstsammler? Auf einmal sahen diese Männer überhaupt nicht mehr gefährlich aus, der gut gelaunte Lohenstein mit seinen Gladiatorschultern, der schwitzende Bischoff mit seiner Quiekstimme. Nur dieser Arcimboldo oder Lamarck, für dessen Freundin man mich hielt, war mir noch immer ein wenig unheimlich. Dennoch ließ ich seinen Arm nicht los.
»Also, ich weiß ja nicht, wie’s Ihnen geht«, ließ sich Bischoff vernehmen, »aber ich könnte eine Stärkung vertragen. Ihre Künste als Zeremonienmeister in allen Ehren, Arcimboldo … ein wirklich gelungenes Spiel heute … aber auch der reinste Marathon! Treppauf, treppab, von der Gemäldegalerie in die Kunstkammer, von der Kunstkammer zu den Römern, wieder hinauf zu Rembrandt, hier zu den Ägyptern – no sports, sag ich da nur!«
»Schon gut«, sagte Lohenstein, »dann auf zum Dinner!«
Meine letzten Zweifel verflüchtigten sich. Eine Diebesbande würde wohl kaum am Schauplatz ihres Verbrechens dinieren!
Das Dinner, das jeden Donnerstagabend im Kunsthistorischen Museum stattfand, war legendär: Im prachtvollen Kuppelsaal ließ es sich tafeln wie an einem Fürstenhof längst vergangener Tage.
Natürlich war ich nicht eingeladen, aber als die Männer sich in Bewegung setzten, blieb ich an Arcimboldos Seite, als würde ich dazugehören. Für eine »Freundin« würde doch noch ein Platz frei sein an der Dinnertafel? Ich würde jedenfalls nicht den Heimweg antreten, bevor ich nicht herausgefunden hatte, woher dieser mir völlig Fremde meinen Namen kannte.
Arcimboldo protestierte nicht, sondern öffnete mir galant die Tür, die ins marmorverkleidete Treppenhaus führte.
2
Er ging langsam, ließ Lohenstein und Bischoff auf der Treppe den Vortritt. Ich blickte mich um, erwartete den Jungen mit der Adlerfeder hinter uns, der offensichtlich Arcimboldos Assistent war, doch er war uns nicht gefolgt.
Als Lohenstein und Bischoff bereits einen deutlichen Vorsprung gewonnen hatten, lächelte mein Begleiter mich an und blieb stehen. »Sie können meinen Arm jetzt loslassen, Frau Annerson«, sagte er mit seiner Samtstimme.
»Woher kennen Sie meinen Namen? Was für ein Spiel spielen Sie hier, zum Teufel? Und wieso nennt man Sie Arcimboldo?«, sprudelte es aus mir heraus.
Er lächelte nur. Und sprach – im deutlichen Gegensatz zu mir – langsam und völlig unaufgeregt. »Ich hätte mich Ihnen ja vorhin schon vorgestellt«, sagte er. »Das hätte allerdings ein wenig eigenartig anmuten können, wo Sie doch meine Freundin sind, nicht wahr?« Sein Lächeln wurde breiter, und seine blauen Augen funkelten.
»Aber jetzt, wo wir unter uns sind: Mein Name ist Raffael Lamarck. Nennen Sie mich Raffael. Ich freue mich sehr, dass wir uns persönlich kennenlernen. Ich bin ein Fan, kann man sagen.«
»Ein Fan?«
»Ihrer Bücher.«
Verdutzt starrte ich ihn an. »Meiner … Bücher? Sie lesen Liebesromane?«
»Gelegentlich«, sagte er, und seine Stimme war jetzt süß wie Honig. Noch immer hielten mich seine Augen fixiert, und noch immer funkelte darin etwas Schalkhaftes.
»Ich war bei einer Lesung von Ihnen«, sagte er. »Erst kürzlich.«
Ich glaube, daraufhin wurde meine Kinnlade ein Opfer der Schwerkraft.
»Ich fand den Titel Ihres letzten Buches ungewöhnlich«, fuhr er fort und war mit einem Mal wieder ernst. »Merlins Rabe. Wie sind Sie darauf gekommen? Eigentlich wollte ich Sie das schon bei der Lesung fragen.« Seine Augen bohrten sich jetzt fast in meine. In meinem Nacken kribbelte es.
»Das ist eine lange Geschichte«, sagte ich ausweichend. Ich hatte jetzt wirklich keine Lust, meine Bücher zu diskutieren. Die Art Bücher, die ich nicht mehr schrieb. Zu viele eigene Fragen brannten mir auf der Zunge.
»Diese Männer … aus dem Rudolfsbund, wieso nennen die Sie Arcimboldo? Und was für ein Spiel haben Sie inszeniert?«
Raffaels Lippen kräuselten sich zu einem Lächeln, bevor er antwortete. Der Themenwechsel schien ihn nicht zu überraschen. »Kaiser Rudolf II. hatte einen Hofkünstler namens Arcimboldo. Sein bevorzugter Zeremonienmeister. Eventmanager, würde man heute sagen. Aber Sie kennen wahrscheinlich am ehesten seine Naturalienporträts? Einige hängen hier im Kunsthistorischen Museum.« Er sah mich mit hochgezogenen Augenbrauen an.
Naturalienporträts? Ja … die hatte ich gesehen. Erst heute Nachmittag. In der italienischen Gemäldegalerie des Museums. Groteske Köpfe, die ganz aus Obst, Gemüse, Fischen oder allem möglichen Gerät bestanden, von Zündhölzern bis Kanonen – je nach der Thematik des Gemäldes. Groteske Bilder, aber dennoch faszinierend. Genau wie dieser Mann.
»Und was das Spiel des heutigen Abends anbelangt«, fuhr Raffael fort, »das war eine von mir inszenierte Schnitzeljagd rund um die Liebschaften des Göttervaters Zeus. Die Rudolfsbündler lieben derartige Zerstreuungen.« Er strich sich eine dunkle Haarsträhne hinters Ohr.
»Mein Assistent Andreas, dem Sie auf so bühnenreife Art die Adlerfeder entrissen haben, spielte Ganymed, jenen Hirtenknaben, den Zeus in Gestalt eines Adlers auf den Olymp entführte. Und die junge Frau mit der Goldmünze im Mosaiksaal war Danaë, die Königstochter, der sich Zeus als Goldregen näherte.«
Ich nickte stumm. Raffael hatte mich also bereits im Mosaiksaal entdeckt, während ich geglaubt hatte, ihn unbemerkt zu beobachten.
»Und das Museum hat nichts gegen diese Nutzung der Sammlungen als Spielwiese für Ihren Bund?«, fragte ich. Raffael hatte sich wieder in Bewegung gesetzt, und ich schritt an seiner Seite die Marmortreppe hoch.
»Christian Lohenstein ist einer der großzügigsten Gönner dieses Hauses«, sagte er, über seine Schulter gewandt. »Das heißt, eigentlich seine Frau, Lavinia. Es ist ihr Geld. Und was die Spielwiese anbelangt: Wir verhalten uns ja leise und gesittet und kommen den Kunstschätzen auch nicht zu nahe. Noch kein Mitglied des Rudolfsbunds hat sich je gegen eine Vitrine geworfen.« Er lächelte, und in seinen Augen lag wieder dieses Funkeln.
Ich starrte auf meine Schuhspitzen, als müsse ich mich aufs Treppensteigen konzentrieren. Er aber hakte nach. »Wollen Sie mir nicht verraten, was genau Sie da getan haben? Im Gegensatz zu Lohenstein weiß ich, dass Sie heute Abend ganz sicher kein Bestandteil meiner Inszenierung waren. Was hatten Sie denn mit dieser Vitrine vor? Und mit der Adlerfeder?«
»Ich … ich war so in meinen Mord vertieft, dass ich die … dass ich die Situation wohl ein wenig fehlinterpretiert habe.«
»Ihren Mord?« Seine Augen weiteten sich.
»Meinen Krimi, meine ich«, sagte ich rasch. »Ich arbeite an einem neuen Buch.«
»Oh. Aber Sie schreiben doch Liebesromane, oder?«
»Ich … nein … also früher natürlich schon. Das wissen Sie ja. Aber jetzt nicht mehr. Ich bin mit der Liebe fertig!« Den letzten Satz bereute ich, noch während er über meine Lippen glitt. Das ging diesen Fremden doch wirklich nichts an.
»Sie haben sich also gegen diese Vitrine geworfen, weil Sie dachten …?«
»Ich wollte den Alarm auslösen«, nuschelte ich in Richtung meiner Schuhspitzen. »Ich dachte, dass Sie einen Kunstraub planen.«
Ich rechnete es ihm hoch an, dass er nicht in schallendes Gelächter ausbrach.
»Verstehe«, sagte er nur, und ich spürte seine Augen auf mir, obwohl ich noch immer zu Boden starrte.
Rasch wechselte ich das Thema. »Christian Lohensteins Frau, die das Museum so großzügig unterstützt, ist heute Abend auch hier?« Kunstsponsoring interessierte mich in etwa so sehr wie Fußball, aber alles war besser, als meinen peinlichen Auftritt weiter zu diskutieren.
Raffael hielt abrupt an. »Lavinia? Nein. Sie kommt nie hierher. Sie verlässt das Haus generell nicht. Und empfängt auch keine Gäste. Sie hat gesundheitliche Probleme und hasst jede Art von Publicity. Ich selbst habe sie in den zwei Jahren, die ich Christian Lohenstein kenne, noch nie zu Gesicht bekommen. Nur einmal durfte ich ein antikes Perlenhaarnetz für sie besorgen.«
»Ein was?«
Er sah mich an und lächelte wieder. »Wenn ich nicht gerade Partys für exzentrische Sammler organisiere, bin ich Kunsthändler, wissen Sie. Und Lavinia Lohenstein liebt Schmuck. Perlen im Besonderen.«
»Oh«, sagte ich nur. Für Perlen hatte ich mich noch nie besonders erwärmen können.
Als wir den Kuppelsaal erreichten, war das Dinner bereits in vollem Gange. Der Tisch des Rudolfsbunds war eine lange, festlich geschmückte Tafel in der Mitte des Raums. Lohenstein und Bischoff diskutierten mit einigen anderen Gästen lautstark und wortreich die Höhepunkte, Schwierigkeiten und Fallen der heutigen Schnitzeljagd.
Als ich mich neben Raffael niederließ, nickten mir einige der Rudolfsbündler einen kurzen Gruß zu. Meine Anwesenheit bei Tisch wurde von niemandem hinterfragt. Ich atmete erleichtert aus.
Eigentlich hätte ich an dieser Stelle gehen können, die Rätsel und Missverständnisse des Abends waren gelöst. Doch ich blieb. Was – abgesehen von dem exquisiten Essen – vor allem an Raffael Lamarck lag. Ich genoss es, an seiner Seite zu sitzen und seiner wundervollen Stimme zu lauschen. Er erzählte mir alles über die schier unendlichen Liebschaften des Zeus, und mir kam der Gedanke, dass die antiken Götter wesentlich lebensfreudiger waren als jene, die wir heute so verehrten.
Es dauerte fast eine halbe Stunde, bis der Gewinner des Abends eintraf. Ein Mann Mitte vierzig, mit der Art von Gesicht, das zwar angenehm anzusehen war, aber keinerlei bleibenden Eindruck hinterließ. Er trug einen sehr korrekten Scheitel, auf der schmalen Nase eine Brille mit dünnem Goldrand. Und er war ziemlich außer Atem.
Höflich begrüßte er mich, sogar mit einer kleinen Verbeugung. »Frank Hofstädter, es freut mich sehr, Sie kennenzulernen.«
Seine Stimme klang schwermütig, und er zögerte, wo er sich niederlassen sollte. Raffael deutete auf den Stuhl neben mir und lächelte ihm aufmunternd zu. Kurz darauf wurde der Neuankömmling von allen beklatscht, weil er heute Abend die meisten Rätsel von Raffaels Schnitzeljagd gelöst hatte. Die Aufmerksamkeit und das Lob waren Frank Hofstädter sichtlich unangenehm.
»Christian Lohenstein und ich haben zusammen studiert«, sagte er nach einer Weile, als müsse er mir seine Anwesenheit an diesem Tisch erklären. »Alte Freunde. Ich sammle zwar auch, bin aber bei weitem nicht in Christians Liga. Römische Münzen und Gemmen, wissen Sie. Ein überaus faszinierendes Gebiet. Ich …«
Weiter kam Hofstädter nicht, denn an dieser Stelle erhob sich Christian Lohenstein und schlug zweimal mit dem Kaffeelöffel gegen sein Champagnerglas.
»Meine lieben Freunde«, begann er und blickte in die Runde wie ein wohlwollender Fürst, der zu seinen Untertanen sprach. »Sie alle wissen, welcher besondere Tag sich am kommenden Samstag zum 460. Male jährt. Es ist mir eine große Freude, dass wir den Geburtstag unseres Schirmherrn dieses Jahr endlich im passenden Rahmen feiern können. Sie werden es nicht glauben, aber nach fast drei Jahren Bauzeit – gefühlt eher dreißig – ist mein bescheidenes kleines Landschloss endlich fertiggestellt. Damit findet meine Sammlung nun auch einen neuen Platz. Ich möchte Sie, meine lieben Rudolfianer, hiermit ganz herzlich zur Eröffnungsfeier am kommenden Wochenende einladen!« Eine weite Geste seiner muskulösen Arme, gefolgt von einer kurzen Pause, wohl um seinen Worten das nötige Gewicht zu verleihen.
»Am Freitagabend findet ein kleines Dinner statt und dann die Enthüllung meiner Kunst- und Wunderkammer. Ich darf ohne Eitelkeit sagen, dass Europa seit den Tagen unseres Kaisers nichts Vergleichbares mehr gesehen hat. Und am Samstag – da ich ja weiß, wie sehr Sie alle die Veranstaltungen unseres Zeremonienmeisters schätzen – wird Arcimboldo ein ganz besonderes … Amüsement organisieren. Ich bin sicher, er wird sich zu diesem Anlass selbst übertreffen und Ihnen ebenfalls ein Jahrhundertspektakel bieten.«
Frank Hofstädter klatschte aufgeregt. Emil Bischoff stimmte lautstark in den Beifall ein, seiner sauertöpfischen Miene nach zu urteilen allerdings eher aus Pflichtgefühl denn aus wahrer Begeisterung.
»Aber Lohenstein«, rief ein junger Mann vom unteren Ende der Tafel. »An dem Wochenende ist doch die Studienreise nach Florenz! Da sind doch die meisten von uns …«
»Ich weiß, mein Lieber«, unterbrach ihn Lohenstein, »aber der Geburtstag des Kaisers ist der Geburtstag des Kaisers, was kann man da machen!« Er zuckte seine Gladiatorenschultern, und sein Gesicht spiegelte völlige Machtlosigkeit wider.
Ich wurde den Verdacht nicht los, dass es ihn gar nicht besonders störte, wenn nicht alle Mitglieder des Rudolfsbunds seiner Einladung Folge leisten konnten. Anscheinend genossen nicht alle Untertanen gleichermaßen seine Gunst.
Während ich ihn ansah, schoss mir ein anderer Gedanke durch den Kopf: Die Eröffnung eines Landschlosses samt Kunst- und Wunderkammer? Das war es! Der Schauplatz für einen Mord schlechthin! Eine geschlossene Gesellschaft exzentrischer Kunstsammler, Menschen mit zu viel Geld, ganz unter sich. Dagegen verblasste selbst das Theseus-Mosaik, das mir noch vor wenigen Stunden als der ideale Ort für meine Leiche erschienen war. In Christian Lohensteins Schloss würde ich einen besseren finden, dessen war ich mir sicher. Außerdem … ein kleiner Teil von mir wollte auch ihn wiedersehen. Raffael Lamarck. Arcimboldo. Ein winziger Teil von mir. Kaum der Rede wert!
Es gab nur ein Problem: Ich war nicht eingeladen.
Sich an eine Dinnertafel zu schummeln war eine Sache – zu einem Wochenende exklusiv für Mitglieder des Rudolfsbunds konnte ich allerdings nicht einfach untergehakt an Raffaels Arm erscheinen.
Ich wandte mich an Emil Bischoff, der mir schräg gegenübersaß. »Ich würde gerne Mitglied bei Ihnen im Rudolfsbund werden«, sagte ich, so viel Selbstbewusstsein versprühend, wie ich aufbringen konnte. »Mein Freund Raffael hat mir schon so viel von Ihnen erzählt, und heute Abend konnte ich mich persönlich davon überzeugen, was für eine illustre Gesellschaft Sie sind! So viele nette Leute!«
Gott, klang das hölzern. Clara Annerson, Schriftstellerin. Es war ein weit verbreiteter Irrtum, dass jemand, der halbwegs lesbare Sätze zu Papier bringen konnte, sich auch mündlich auszudrücken verstand. Ich bewies regelmäßig – und bei den unpassendsten Anlässen – das Gegenteil.
Emil Bischoff riss mich aus meinen selbstkritischen Gedanken. »Sammeln Sie denn auch, Frau Annerson?«, fragte er.
»Ich … ja, ich sammle Bücher! Ich besitze einige durchaus wertvolle Erstausgaben, teilweise sogar signiert. Ich …«
»Ich meinte, ob Sie Kunst sammeln«, fiel mir Bischoff ins Wort.
Unter anderen Umständen hätte ich diesen glatzköpfigen Bauchträger jetzt mit Nachdruck darüber aufgeklärt, dass Bücher Kunst schlechthin waren, aber so stammelte ich nur etwas Unzusammenhängendes vor mich hin.
Dann bemerkte ich, dass Christian Lohenstein, der zwei Plätze weiter saß, meinen kläglichen Versuch, in den Rudolfsbund und damit in sein Schloss zu kommen, verfolgt hatte. Er sah mich an, dann Emil Bischoff, sagte aber nichts. Und da hatte ich die rettende Idee!
»Sagen Sie, Herr Lohenstein«, begann ich, »brauchen Sie nicht für die Eröffnung Ihres Schlosses einen Hofdichter, nach dem Vorbild Rudolfs II.? Damit geben Sie dem Anlass doch erst den würdigen Rahmen, wenn Sie jemanden haben, der Glanz und Gloria Ihres Festes für die Nachwelt in unsterbliche Verse gießt. Nicht wahr?« Ich mochte mich manchmal hölzern ausdrücken, aber schwülstig beherrschte ich auch. Und das war ausnahmsweise genau das Richtige. Auch wenn es mir in tiefster Seele widerstrebte, mich so anzubiedern, noch dazu so unverhohlen – das Schloss war es bestimmt wert!
»Und natürlich werde ich auch eine Ode auf Sie als Schlossherrn schreiben!«, setzte ich noch hinzu. Schwulst, Schmeichelei und zur Krönung noch ein fetter Köder. Genau das Richtige für diesen Möchtegernfürsten! Dass er mich eher an einen Gladiator als an einen Schlossherrn erinnerte, sollte in der in Aussicht gestellten Ode wohl besser nicht vorkommen.
Hatte ich zu dick aufgetragen? Ein hysterisches Lachen kitzelte meine Kehle, das ich als Hüsteln kaschierte, um dann betont ernst auf meinen Teller zu starren.
Aus dem Augenwinkel sah ich, wie sich Raffaels Lippen kräuselten. Wie erbärmlich musste ich mich angehört haben. Aber dann kam er mir unerwartet zu Hilfe. »Eine hervorragende Idee, finde ich«, sagte er mit seiner verführerischen Stimme. »Außerdem würde Frau Annerson eine echte Bereicherung meiner Inszenierungen zu Ehren des Kaisergeburtstags sein – ihr diesbezügliches Talent hat sie ja heute eindrucksvoll unter Beweis gestellt.«
Ich biss mir auf die Zunge und spürte, wie mir das Blut in die Wangen schoss. Doch dann lachte Lohenstein – sichtlich erfreut über meine Schmeichelei – auf, sagte »Einverstanden!« und die Anwesenden brachen in Beifall aus.
Nun war ich also Hofdichterin – ein ganzes Wochenende lang. Ich wollte gar nicht darüber nachdenken, was für krudes Zeug ich dafür zusammenschreiben musste. Als Schriftstellerin hatte ich ja schließlich auch einen Ruf zu verlieren.
3
Christian Lohenstein ging sogar so weit, mir einen persönlichen Chauffeur zur Verfügung zu stellen – seine Sekretärin Annabel Kadinsky. Da ich kein Auto besaß und seine Villa gut sechzig Kilometer westlich von Wien lag, hatte er arrangiert, dass mich Annabel in ihrem Wagen mitnahm.
»Habe ich Ihnen zu viel versprochen?«, sagte sie, während ich wie gebannt aus dem Wagenfenster starrte. Keine hundert Meter von mir stolzierte ein weißer Hirsch unter den ausladenden Bäumen des Schlossparks umher, auf seinem Kopf ein Geweih, das ihn in freier Wildbahn unweigerlich das Leben gekostet hätte. Sein Fell leuchtete wie Schnee in der Julisonne.
Bevor ich Annabel etwas antworten konnte, wandte der Hirsch seinen Kopf, sah mich aus seinen schwarzen Augen unvermittelt an und stieß ein kehliges Röhren aus. Es klang wie ein Schmerzensschrei. Gleich darauf war er mit wenigen Sprüngen hinter einem kleinen Tempel verschwunden, der rechts der Auffahrt lag.
Heute sehe ich diesen Schrei als Omen, als Warnung davor, was mich in diesem Schloss erwartete. Aber damals glaubte ich noch nicht an Omen. Mein Weltbild war … nun ja, ziemlich begrenzt zu jener Zeit.
»Wir haben eine kleine Herde im Park«, sagte Annabel, die den Schrei wohl als natürliches Verhalten abtat. »Herrn Lohenstein war es ein Anliegen, das Anwesen so authentisch wie möglich zu gestalten. Private Menagerien waren in der Monarchie sehr beliebt, wissen Sie? Und Herr Lohenstein legt viel Wert auf … Aber was erzähle ich Ihnen, Sie haben ihn ja bereits kennengelernt.« Sie lächelte mir vielsagend zu und fuhr dann fort: »Nur Herrn Lamarck haben wir es zu verdanken, dass der Chef auf Raubtiere verzichtet hat. Dafür haben wir neben den Hirschen noch ein wunderschönes Pfauenpärchen. Bestimmt werden Sie sie später noch sehen.«
Annabel war eine kleine, schlanke Frau mit südländischem Teint. Sie kleidete sich zwanzig Jahre älter, als sie ansonsten aussah, und trug ihr schweres dunkles Haar im Nacken zu einem Zopf geflochten. Die unerschütterliche Ruhe eines Zen-Mönchs ging von ihr aus, kein noch so rücksichtsloser Fahrer auf der Autobahn hatte ihr auch nur die kleinste Regung entlockt. Bewundernswert und vermutlich genau das, was ihr flamboyanter Arbeitgeber brauchte.
Die Fahrt hatte uns eine Weile entlang der Donau geführt, dann über eine Nebenstraße durch postkartentaugliche Dörfer und schließlich über eine Privatstraße, die sich durch einen dichten Nadelwald schlängelte. Bis an das wuchtige schmiedeeiserne Tor, das wir gerade passiert hatten.
Die Villa lag vor uns auf einer kleinen Anhöhe, umgeben von moosbewachsenen Baumriesen, die wohl die ursprünglichen Schlossherren gepflanzt hatten. Ein herrliches Gebäude, mit Säulen, Türmchen und Erkern. Die grün gestrichenen Fensterläden hoben sich effektvoll von den Mauern ab, die in einem Farbton verputzt waren, den wir in Wien Schönbrunner-Gelb nennen. Vermutlich ein altes Jagdschloss, wie man sie über ganz Österreich verstreut findet. Die Renovierung musste ein Vermögen gekostet haben.
Was wollte man mehr. Und bestimmt waren auch die Kunstschätze, die Lohenstein uns angekündigt hatte, die Reise wert.
Annabel geleitete mich auf mein Zimmer. »Wir haben Sie im ersten Stock einquartiert«, sagte sie, während wir eine mit rotem Teppich ausgelegte Marmortreppe hinaufschritten. »Ein sehr schönes Eckzimmer mit Blick auf den Teich.«
Im ersten Stock angelangt, machte die Frau, die ich eben noch mit einem Zen-Mönch verglichen hatte, eine plötzliche und umfassende Verwandlung durch. Mit einem Mal war es vorbei mit der unerschütterlichen Ruhe, die ich ihr vorhin unterstellt hatte. Sie blieb wie angewurzelt stehen, tapste einen Schritt zurück. Kurz befürchtete ich, sie würde stolpern. Meine Reisetasche glitt aus ihrer Hand, ein lautes »Oh!« entfuhr ihr, und sie schlug die Hände vor dem Mund zusammen.
Auslöser dafür war offensichtlich die Wandmalerei, die sich zu unserer Rechten über gute zehn Meter des Gangs erstreckte, vom Boden bis zur Decke. Annabel lief die Länge des Gemäldes mehrmals ab, ging in die Knie, streckte sich, um die höher gelegenen Details zu erkennen, trat mit zugekniffenen Augen ganz nahe an eine Szene heran, und dann wieder zurück, als wäre sie geblendet. Sie verschlang ihre Hände ineinander. Ihr Mund stand leicht offen, aber die Sprache hatte es ihr anscheinend verschlagen. Mich hatte sie offenbar vollkommen vergessen.
Das Gemälde war durchaus beeindruckend, voller mythischer Gestalten: Götter, Helden, Amazonen, Faune und Nymphen, beim Jagen, Trinken, Lieben und Sterben, in leuchtenden Farben und so meisterhaft auf die Wand gebannt, dass es fast schien, als lebten und atmeten sie.
»Ein wundervolles Werk«, sagte ich, um mich wieder in Erinnerung zu rufen. »Und sehr gekonnt restauriert.« Ich redete schon, als gehörte ich dazu, zum Rudolfsbund und seinen Kunstfanatikern. Offensichtlich konnte der Anblick eines Gemäldes selbst die Sekretärin des Hauseigentümers in Entzücken versetzen.
Mit leicht geröteten Wangen drehte sie sich zu mir um. »Entschuldigen Sie, aber das ist gerade erst fertig geworden. Als ich das letzte Mal hier war, war es noch eingerüstet. Ist es nicht unglaublich?«
»Ganz hervorragend.«
»Eine originale Arbeit übrigens«, sagte sie, »nicht restauriert. Von Nicolas Frey.« Stolz schwang in ihrer Stimme mit. »Unser Hofmaler. Sie werden ihn heute Abend kennenlernen. Er ist …«
Weiter kam sie nicht. Schritte waren auf der Treppe zu hören, jemand rief: »Annabel?«, und dann bog ein Mann im Tweed-Anzug um die Ecke und kam mit zum Gruß erhobener Hand auf uns zu.
»Paul Leon«, stellte er sich vor, »für die Sicherheit im Haus verantwortlich.«
Sein Händedruck war warm und fest, und wie er dabei lächelte, erinnerte eher an einen Krankenpfleger als an einen Personen- oder Objektschützer. Dem gängigen Klischee dieser Berufsgruppe entsprach Paul Leon überhaupt nicht. Er war zwar kräftig, aber eher feingliedrig gebaut, und nur eine gewisse Härte in seinem Blick verriet, dass man ihn nicht unterschätzen sollte.
»Frau Annerson, richtig? Herzlich willkommen. Wenn es Ihnen recht ist, gebe ich Ihnen eine kurze Einführung, was die Sicherheitsvorkehrungen im Haus anbelangt. Nur das Wichtigste – oder möchten Sie lieber erst in Ruhe auspacken?« Auch seine Stimme klang angenehm warm. Ein sympathischer Mann.
Ich machte eine geistige Notiz. Sicherheitsleute konnte man immer mal wieder brauchen, in der Art Bücher, die ich von nun an schreiben wollte. Eigentlich auch in der Art Bücher, die ich nicht mehr schrieb, wenn man es recht bedachte. Nun, Liebesromane mit sexy Bodyguards, die aufgrund ihrer düsteren Vergangenheit glaubten, nie wieder lieben zu können … diese Stories würde ich in Zukunft anderen überlassen, so viel stand fest.
Wie dem auch sei: Gast zu sein in einem Haus mit eigenem Wachpersonal und Sicherheitsvorkehrungen war neu für mich. Das Auspacken konnte warten.
»Ihre persönliche Schlüsselkarte haben Sie ja schon erhalten, nicht wahr?«, sagte Paul Leon und sah dabei zu Annabel hinüber.
Diese nickte steif. Täuschte ich mich, oder herrschte da eine gewisse Spannung zwischen den beiden?
Ich hielt die Plastikkarte hoch, die ich in der Hand trug. Er folgte meinem Blick. »Sehr gut. Das ist sie. Diese Karte öffnet ihre Zimmertüre und das Eingangstor unten im Erdgeschoss. Die Pforte, also das schmiedeeiserne Tor in der Einfahrt, lässt sich nur über die Portiersloge steuern. Also von mir.« Er lächelte wieder. »Sollten Sie das Anwesen verlassen wollen, geben Sie mir einfach Bescheid.«
»Die reinste Festung hier«, scherzte ich.
Er nickte. »Und das ist gut so. Wir haben einige sehr wertvolle Kunstobjekte im Haus.« Seine Stimme klang jetzt sachlich und professionell. Dieser Mann konnte einen kühlen Kopf bewahren, wenn es darauf ankam, da war ich mir sicher. Und ja, Klischee hin oder her, man fühlte sich in seiner Gegenwart irgendwie … beschützt.
Er begleitete mich das letzte Stück zu meinem Zimmer und zeigte mir, wie man die Schlüsselkarte benutzte. Mit einer galanten Handbewegung ließ er mich eintreten. Annabel war am Treppenabsatz zurückgeblieben und hatte sich wieder in das Wandgemälde vertieft.
Das Zimmer maß gute dreißig Quadratmeter, hatte vier große Flügelfenster und war ausschließlich mit Antiquitäten eingerichtet.
Paul Leon fuhr fort: »Für die Kunstkammer hat ausschließlich Herr Lohenstein einen Schlüssel, alle anderen Räume im Haupthaus sind jederzeit frei zugänglich. Die Kunstkammer und die große Galerie werden außerdem videoüberwacht, überall sonst besteht der Chef auf Privatsphäre. Brandmeldeanlage im ganzen Haus, die ist allerdings nicht sehr empfindlich eingestellt – wäre sinnlos mit all den offenen Flammen hier.« Ihm war anzusehen, dass er damit nicht glücklich war.
»Feuerlöscher finden Sie in allen Räumen, Ihrer ist gleich hier links neben dem Kleiderschrank, und falls Sie die Kerzenleuchter benutzen möchten …« Er zögerte kurz. »Seien Sie bitte vorsichtig. Die Ausstattung hier stammt aus der Zeit vor der Erfindung feuerhemmender Materialien.«
Auf dem Nachttisch und auf einer der Kommoden an der Wand standen vergoldete fünfarmige Kerzenleuchter, jeweils mit einer Schachtel Streichhölzer daneben.
»Eine Festung voller Antiquitäten«, korrigierte ich meine frühere Bemerkung. »Das macht Ihren Job bestimmt nicht leichter, Paul.«
Ein Haus voller Holz, Stoffe und alter Bücher. Bestes Brennmaterial. Und dazu Kerzen, wohin das Auge blickte. Und offene Kamine, die jetzt im Sommer immerhin nicht brannten. Lohenstein legte Wert auf Authentizität, kein Zweifel – und bereitete seinem Sicherheitsmann damit vermutlich schlaflose Nächte.
Paul verdrehte gequält die Augen. »Wem sagen Sie das.«
»Gut, das war’s schon«, beendete er seinen Vortrag. Seine Stimme nahm wieder ihren offiziellen Tonfall an. »Falls Sie etwas brauchen, erreichen Sie mich jederzeit telefonisch. Meine Nummer ist in Ihrem Gerät eingespeichert. Drücken Sie bei Bedarf einfach Security. Jederzeit.« Er deutete auf das Schnurlostelefon, das auf dem verschnörkelten Schminktisch wie ein außerirdisches Artefakt anmutete.
»Ich lasse Sie jetzt alleine. Ein unvergessliches Wochenende wünsche ich Ihnen. Oder haben Sie noch Fragen?«
Ich schüttelte den Kopf. »Keine Fragen.«
»Sehr schön. Um achtzehn Uhr starten wir mit einem Aperitif im Roten Salon. Wenn Sie die Treppe hinuntergehen, gleich die zweite Türe rechts. Rote Tapeten.« Er lächelte und verabschiedete sich mit einem Nicken.
Ein unvergessliches Wochenende. Das sollte es werden.
4
Als frischgebackene Hofdichterin war es wohl angemessen, zuallererst die Bibliothek zu besichtigen. Was ich allerdings auch getan hätte, wenn ich mich nicht in diese lächerliche Rolle hineingedrängt hätte. Bücher kamen im Ranking meiner Leidenschaften noch vor Schokolade. Und Lohensteins Bibliothek war bestimmt groß und voller Schätze. Ein Fürst, der auf sich hielt, zeigte der Welt seine Gelehrsamkeit in Form einer wohlbestückten Büchersammlung.
Jetzt musste ich sie nur noch finden.
Ich lief ins Erdgeschoss hinunter. Hier waren alle Türen verschlossen und keine Menschenseele zu sehen. Die schweren Eichentüren hatten etwas so Strenges an sich, dass ich zögerte, jede einzelne davon aufzureißen, bis ich die Bibliothek fand. Aber es ging ja auch anders! Ich lief durch die Eingangstüre, die von zwei Steinlöwen flankiert wurde, hinaus in den Schlosspark.
Die Fenster im Erdgeschoss waren allesamt Terrassentüren, von außen gut einsehbar. Ich würde nur einmal ums Haus laufen müssen, um zu wissen, wo die Bibliothek lag. Und sie lag bestimmt im Erdgeschoss. Bibliotheken lagen immer im Erdgeschoss.